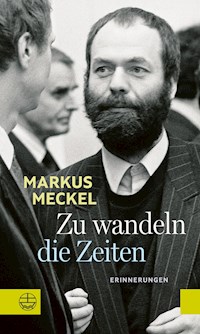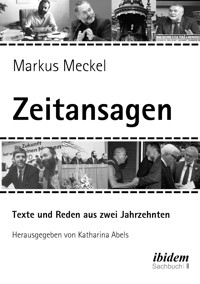
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„Zeitansagen“ hat Markus Meckel im Laufe seines Wirkens unzählige gemacht. Er war Pfarrerssohn, unbequemer Schüler und Wehrdienstverweigerer in der DDR, Pfarrer, Gründer der oppositionellen sozialdemokratischen Partei in der DDR, Außenminister der ersten frei gewählten DDR-Regierung, langjähriger Bundestagsabgeordneter und Außenpolitiker im vereinten Deutschland sowie schließlich Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Sehr offen spricht Markus Meckel in seinen Texten und Reden aus zwei Jahrzehnten über seinen ungewöhnlichen Lebensweg in der DDR und über die Zeit von Friedlicher Revolution und Deutscher Einheit. Er stellt unbequeme Fragen an unseren Umgang mit der wechselvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts und plädiert mit Leidenschaft für eine durch und durch europäische Sichtweise auf Geschichte und Außenpolitik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Geleitwort
30 Jahre Rückblick und Zukunftsperspektiven zur Opposition und Friedlichen Revolution in der DDR, Reflexionen über die Aufarbeitung der Geschichte und die Beschreibung außenpolitischer Herausforderungen – ein beachtenswerter Sammelband mit dem schlichten Titel „ZEITANSAGEN“.
Es geht um Lebenserfahrungen von Markus Meckel, einer Persönlichkeit, deren politisches Engagement sich wie ein roter Faden durch die Biografie zieht. Schon während seines Theologiestudiums und im späteren Pfarramt trat er in der DDR als Bürgerrechtler für Demokratie und Menschenrechte ein. Gemeinsam mit seinem Freund Martin Gutzeit initiierte Markus Meckel 1989 die Gründung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR, die zu einer wichtigen Kraft der Friedlichen Revolution wurde. Als Außenminister in der frei gewählten Regierung der DDR verhandelte er die deutsche Einheit mit. In seinem sich anschließenden Bundestagsmandat engagierte er sich über zwei Jahrzehnte hinweg als Außenpolitiker für die Neugestaltung Europas.
Wir als Lesende und Adressaten der „ZEITANSAGEN“ nehmen erneut Teil an der Wirksamkeit überzeugter Nonkonformisten, Widerstands- und Freiheitskämpfer in der vorrevolutionären Phase in der DDR, besonders eng verbunden mit Polen, die aus christlicher Überzeugung daran festhalten, dass wir Menschen zur Freiheit berufen und verpflichtet sind. Markus Meckel formuliert: „Gott ist ein Gott der Freiheit, er hat uns als mündige Menschen zur Freiheit berufen“ (S. 17). Sein Blick auf die Freiheit öffnet, befreit, lädt ein zum Mitmachen, zur Solidarisierung, nicht punktuell, sondern dauerhaft.
In diesem Textband mit lebensphilosophischen und politischen Kernaussagen meldet sich ein aktiv suchender und kritisch fragender Christ und zugleich politisch denkender und handelnder Mensch zu Wort, ein Außenseiter, Außenminister in der ersten frei gewählten DDR-Regierung, Abgeordneter zunächst der ersten demokratischen Volkskammer, dann des Bundestages. Schließlich Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und bis heute vielfältig in verschiedensten nationalen und internationalen Gremien und Organisationen aktiv. Darüber hinaus ist er im In- und Ausland als gefragter Vortragsredner tätig.
Er hat bis heute nicht aufgehört, sich für Menschen in Europa und weltweit zu engagieren. Seine Hauptthemen waren und sind: Freiheit und Frieden, die Bewahrung der Schöpfung, die Gestaltung Europas und insbesondere die seiner östlichen Nachbarschaft sowie das Gedenken an unsere belastete Geschichte und unsere daraus erwachsende Verantwortung.
Der leidenschaftlich engagierte Europäer macht uns immer wieder bewusst, welch entscheidende Bedeutung auch heute dem zivilgesellschaftlichen Handeln zukommt. Außenpolitik ist für ihn nie nur Handeln von Diplomaten und Staaten. Der aktiven Gesellschaft kommt in seinen Augen eine besondere Bedeutung zu. Diese zu fördern hält er für eine wesentliche Aufgabe, sowohl für Deutschland wie für die Europäische Union.
Wir sind nicht der Ohnmacht preisgegeben, sondern Menschen haben nicht zuletzt in der Friedlichen Revolution bewiesen, wie wirksam engagierte Bürger sein können.
Der „Zeitansager“ weicht nicht in die Vergangenheit aus, er nutzt sie zur ständigen Erneuerung und Verstärkung seiner Aktivitäten. Viele haben daran mitgewirkt, in Deutschland, Europa und weltweit. Aber die entscheidende „Zeitansage“ lautet: Die Friedliche Revolution, die Überwindung des kommunistischen Systems haben wir in der DDR mit größter Widerstandskraft gewaltlos (friedlich) herbeigeführt, die Freiheit durchgesetzt. Immer wieder kämpft er für ein waches Geschichtsbewusstsein. Er klagt ein, dass die deutsche Einheit Ergebnis eines Verhandlungsprozesses der beiden demokratischen deutschen Staaten war. Es war der aufrechte Gang der Ostdeutschen in die Einheit – und nicht allein das Werk westlicher Politiker. Das ist zentral für die anstehenden Aufgaben heute.
Die Erinnerung an den Einigungsprozess vor 30 Jahren wird hier engagiert eingefordert. Markus Meckel tritt dafür ein, die verschiedenen Perspektiven stärker ins öffentliche Gespräch zu bringen und sich gegenseitig zuzuhören. Er fordert eine verstärkte Forschung zu 1989/90 und der folgenden Transformation Ostdeutschlands. Kritische Fragen stellt er sowohl Richtung Westen wie auch an seine Mitbürger im Osten Deutschlands. Bei aller notwendigen kritischen Durchleuchtung der damaligen Entscheidungen dürfe aber nicht vergessen werden, dass dieses Jahr zur Glücksstunde der Deutschen im 20. Jahrhundert wurde. Deutschland frei und geeint, umgeben von Partnern im sich einigenden Europa – und das nach den Schrecken, die Nazideutschland über ganz Europa gebracht hatte. Das, so bekennt er, hatte er vorher so nicht zu träumen gewagt.
Das Jahr 1989/90 hat nicht nur Deutschland verändert, sondern in der Folge ganz Europa. Markus Meckel sah es als ein Vermächtnis dieses Sieges von Freiheit und Demokratie an, dass die neuen Demokratien ein Recht haben, sowohl der EU wie der NATO anzugehören. Dafür hat er sich als Außenpolitiker unermüdlich eingesetzt.
Markus Meckel ist eine Persönlichkeit, die mit ihren „Zeitansagen“ nahezu in jedem Text ihre Prägung als Christ und engagierter Europäer zu erkennen gibt. Das schließt herausfordernden Streit nicht aus, manchmal sucht er ihn geradezu und verbindet ihn mit politischer Tatkraft. Seine Texte rütteln wach, geben Orientierung, laden ein mitzudenken und zu handeln. Sein Ziel ist Versöhnung.
Rita Süssmuth
im August 2019
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort der Herausgeberin
Teil I Freiheit – Opposition – Einheit
1. Freiheit
Predigt zu Kirche und Politik: Zur Freiheit hat uns Christus befreit (2014)
Freiheit – ein Grundbegriff der Reformation (2017)
Predigt zum Jahrestag der Friedlichen Revolution (2018)
2. Kirche als Raum der Freiheit
Das evangelische Pfarrhaus in der DDR zwischen Bildungsbürgertum und Politik (2013)
Eine Hoffnung lernt gehen – die Bedeutung der evangelischen Kirchen in der DDR (2017)
Predigt zum Jahrestag der Deutschen Einheit (2015)
3. Opposition und Revolution
Nichts muss bleiben, wie es ist: Erinnerungen zur Gründung der Ost-SPD (2010)
Solidarność und ihre Bedeutung für die DDR-Opposition (2005)
4. Einheit und Zusammenwachsen
Rede an die Deutsche Nation: Einigkeit und Recht und Freiheit – QUO VADIS? (2018)
Der Weg in die deutsche Einheit und was daraus wurde (2013)
Aufruf: In welcher Verfassung wollen wir leben? Das Grundgesetz zur deutschen Verfassung machen. Ein Aufruf zur Selbstverständigung der Deutschen (2019)
Rede im Deutschen Bundestag: Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals (2000)
Predigt zum 9. November: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke (2014)
Teil II Die Zukunft der Vergangenheit – Erinnerung und Aufarbeitung
1. Das Zeitalter der Extreme
1914, 1989 und das Zeitalter der Extreme. Ein Manifest (2014)
1918–2018: Ein Manifest
1918 – 2018. Nation und Demokratie – Herausforderung auch für die Kirchen (2018)
Rede im Deutschen Bundestag: 90. Jahrestag des Völkermords an den Armeniern im Osmanischen Reich (2005)
Rede zum Gedenktag der armenischen Gemeinde an den Völkermord an den Armeniern (2009)
Zum 10. Jahrestag der Einrichtung der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte (2002)
Rede im Deutschen Bundestag: Errichtung der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (1998)
Rede im Deutschen Bundestag: Würdigung der Opfer des Kommunismus: Für eine SED-Opferrente (2007)
Zwanzig Jahre Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau (2018)
2. Europäisch Erinnern
Europa gemeinsam erinnern (2013)
Der vergessene Krieg. 100 Jahre Beginn des Ersten Weltkrieges (2014)
Die Zukunft der Vergangenheit (2019)
Gedenkrede für die Opfer der Bombardierung von Swinemünde 1945 (2014)
Aufruf: Gemeinsame Erinnerung als Schritt in die Zukunft. Für ein Europäisches Zentrum gegen Vertreibungen, Zwangsaussiedlungen und Deportationen – Geschichte in Europa gemeinsam aufarbeiten (2003)
Flucht und Vertreibung – Symbole und Netzwerke (2007)
Die Teilung Europas und ihre Überwindung. Aufruf zur Gründung eines „Museums des Kalten Krieges “ (2008)
3. Kriegsgräber als Erinnerungsorte
Der Volksbund im Aufbruch (2016)
Ein Vermächtnis Friedrich Eberts: Arbeit für den Frieden – Versöhnung über den Gräbern (2015)
Die „Trauernden Eltern“ von Käthe Kollwitz in Belgien und Russland (2015)
Zur Erinnerung an die Kriegsgefangenen in Zeithain/Sachsen (2018)
Teil III Nachbarschaft und Welt
1. Polen
Mein Polen, meine Polen (2016)
100 Jahre Unabhängigkeit Polens – eine gedenkpolitische Herausforderung (2017)
Der Brief der polnischen Bischöfe und der deutsch-polnische Versöhnungsprozess (2015)
Rede im Deutschen Bundestag: 10 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag (2001)
Aufruf zur Umgestaltung des polnischen Denkmals in Berlin-Friedrichshain (2009)
Zum Überfall auf Polen am 1. September 1939 (2018)
2. Europa- und Außenpolitik
Vom totalen Wehrdienstverweigerer zum Befürworter von Auslandseinsätzen der Bundeswehr (2014)
Die deutsche Einigung und der europäische Einigungsprozess (1991)
Rede im Deutschen Bundestag: Für eine europäische Verfassung (2004)
Rede im Deutschen Bundestag: EU-Erweiterung und Nachbarschaft (2003)
Rede im Deutschen Bundestag: 50 Jahre deutsche NATO-Mitgliedschaft (2005)
Aufruf zur Bildung einer Enquete-Kommission zur Reform der Sicherheitspolitik (2005)
Aufruf zur Schaffung einer Europäischen Stiftung für Demokratie (2006)
Rede im Deutschen Bundestag: Europäische Verantwortung für Belarus (2006)
Kuba-Strategie: Entwurf für eine sozialdemokratische Positionsbestimmung (2008)
Epilog: „Hier stehe ich …“
Vorwort der Herausgeberin
Markus Meckel ist seit Jahrzehnten politisch aktiv. Er war Pfarrerssohn, unbequemer Schüler und Wehrdienstverweigerer in der DDR, Pfarrer, Gründer der oppositionellen sozialdemokratischen Partei in der DDR, Außenminister der ersten frei gewählten DDR-Regierung, langjähriger Bundestagsabgeordneter im vereinten Deutschland und Präsident des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V.
„Zeitansagen“ hat Markus Meckel im Laufe seines Wirkens unzählige gemacht. Das vorliegende Buch versammelt ausgewählte Texte und Reden von Markus Meckel aus den Jahren 2000 bis 2019. Somit schließt „Zeitansagen“ praktisch nahtlos an den 2001 erschienenen Band „Selbstbewußt in die Deutsche Einheit. Rückblicke und Reflexionen“ an, der Texte aus den 1990er Jahren bis 2000 beinhaltet.
Eine wichtige Rolle spielt für Markus Meckel die Befassung mit den Wurzeln des eigenen Handelns und die Auseinandersetzung mit der eigenen Verantwortung in Gesellschaft und Welt. Als freier Mensch, als Christ, als (Ost-)Deutscher, als Sozialdemokrat, Politiker und bisweilen auch als Querdenker reflektiert er in ungewöhnlicher, ehrlicher, manchmal unbequemer Weise. Von historischen Erfahrungen und unserem Umgang damit schlägt er stets den Bogen in die Gegenwart und Zukunft. Er streitet mit Leidenschaft für eine ehrliche Betrachtung der Jahre 1989/90 und für ein über den nationalen Tellerrand hinausblickendes Geschichtsbild.
Drei zentrale Themen ziehen sich wie rote Fäden durch seine Arbeit: Freiheit und Opposition, Erinnerung und Aufarbeitung von Geschichte sowie die Außen- und Europapolitik mit besonders geschärftem Blick nach Osten. Entsprechend der zentralen Themen ist „Zeitansagen“ in drei Teile mit jeweils mehreren Kapiteln gegliedert. Die Texte folgen innerhalb der Kapitel nicht der Reihenfolge ihres Entstehungszeitpunktes, sondern vielmehr der Chronologieihrer Inhalte. Teilweise wurden Texte gekürzt und leicht überarbeitet; sich wiederholende Aussagen wurden gestrichen, sofern es den Gedankengang nicht beeinträchtigte.
Auf Markus Meckels eigener Internetseite www.markusmeckel.eu sind darüber hinaus umfangreiche Bibliographien seiner Texte und Reden zu finden.
Berlin im Juli 2019
Katharina Abels
Teil IFreiheit – Opposition – Einheit
1. Freiheit
Predigt zu Kirche und Politik: Zur Freiheit hat uns Christus befreit (2014)1
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen.“(Gal. 5,1)
Liebe Gemeinde!
Vor mehr als dreißig Jahren habe ich schon einmal über diesen Text gepredigt. Ich war damals ein junger, theologisch und politisch engagierter Vikar in einem kleinen mecklenburgischen Dorf an der Müritz. Ich las diese Worte des Apostels Paulus ganz klar auch als politischen Text, als Ruf zur Freiheit. In der DDR-Schule lernte man ja, dass die Kirchen normalerweise an der Seite der Unterdrücker stünden, was ja historisch leider auch nicht immer falsch war. Ich aber wollte die biblische Botschaft dagegen setzen: Gott ist ein Gott der Freiheit. Er hat uns als mündige Menschen zur Freiheit berufen!
Als Zeugen Christi gilt es für uns als Christen und als Kirche, klar auf der Seite der Freiheit zu stehen und für diejenigen einzutreten, die ihrer Freiheit beraubt sind oder deren Freiheit bedroht ist. Wer solche Zeiten miterlebt hat, der weiß, wie wichtig es ist, wenn Kirche zum Raum der Freiheit wird, der die Möglichkeit zu freier Rede und gelebter Solidarität gibt, der ein Ort des füreinander Einstehens und der Orientierung und nicht zuletzt eine Schule der Zivilcourage ist. Glücklicherweise durften wir solche Erfahrungen machen.
Deshalb bin ich auch froh und dankbar, dass im Herbst 1989 wirklich viele Christen aktiv dabei waren, die Tür zur Freiheit aufzustoßen. Die Ökumenische Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, die 1988/89 zusammentrat, hat viel dazu beigetragen und zu klaren Aussagen gefunden. 1989 öffneten sich vielerorts die Tore der Kirchen zu Friedensgebeten, zu Versammlungen, zu Informations- und Diskussionsveranstaltungen. Oft ging man aus der Kirche auf die Straße. Die Kirchen wurden so für die ganze Öffentlichkeit zu einem Ort der Hoffnung und der Freiheit.
Das ist nun lange her. Wir leben heute in einem politischen System, das alle politischen Freiheiten gewährt und Teilhabe ermöglicht. Der Alltag ist wieder eingekehrt. Doch wie steht es um unsere Freiheit?
Zur Freiheit hat uns Christus befreit! Dieses Wort des Apostels gilt auch heute. Es spricht von einer Tatsache: Der Befreiungsakt liegt hinter uns. Er ist eine Realität, auf die wir bauen können, eine Wirklichkeit, die gelebt werden will. Es ist wie die Gnade, die uns vor Gott gerecht macht – die Freiheit, die uns geschenkt ist, will mit Leben erfüllt sein. Mit der Freiheit ist es wie mit der Liebe: Beide können nicht befohlen werden! Liebe kann nur erfahren, erlebt und gelebt werden. Und ebenso muss die Freiheit erfahren und wahrgenommen werden. Sonst ist sie nicht. Schon deshalb hat Freiheit so viel mit uns selbst zu tun und nicht nur mit den äußeren Verhältnissen und Umständen. Wir müssen uns also immer auch fragen, was uns wann unfrei macht. Was nimmt uns gefangen?
Vielleicht ist es für viele Menschen die Sorge um die äußere Existenz, die schlichte Sorge, über die Runden zu kommen. Da wird dann die Frage nach der Freiheit leicht zu einem Luxus, den man sich gar nicht leisten kann. Für andere wiederum ist es die Routine des Alltags. Viel zu viel Arbeit, dazu die Aufgaben zu Hause, die Erwartungen der Menschen, mit denen man lebt und leben möchte und die Erfahrung, dass irgendetwas, irgendeiner immer zu kurz kommt. Wer kümmert sich da schon um die Freiheit. Leicht wird aus dieser Perspektive Freiheit zum Traum. „Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein…“ Das eigene Leben aber ist eingeengt in Arbeit und Pflichten.
Sehen wir unsere Welt heute an: da ist die ständige Verführung und Suggestion durch Werbung, die den Verstand ausschalten soll; da ist die kaum kontrollierte Macht der Medien und in der Politik immer wieder auch ein Hang zum Populismus, der die Welt in Gut und Böse einteilt, obwohl wir gelernt haben, dass die Welt in verschiedenen Grautönen realistischer gemalt wird. Viele resignieren auch vor der Kompliziertheit der heutigen Welt, die immer schwerer zu durchschauen ist.
Die Gefahren für die Freiheit sind auch heute nicht gering. Ja, vielleicht sind sie sogar in gewissem Sinne gefährlicher, weil versteckter. Bei einer Diktatur weiß der Mensch, woran er ist. Er stellt sich ihr vielleicht nicht entgegen, um sich das Leben nicht schwer zu machen. Auch wir wussten vor 1989 sehr wohl, woran wir waren. Die Frage war nur, wie viel uns die Freiheit wert ist. Heute droht die Freiheit eher erstickt als erschlagen zu werden. Aber am Ende steht eben auch Unfreiheit!
Deshalb braucht es heute wie früher den Auszug aus der Unfreiheit und den Willen zur Freiheit, ja, es braucht die immer neue Erfahrung, um zur Freiheit, zum Selbst-Sein zu ermutigen. Denn Freiheit hat etwas mit unserer Würde als Menschen zu tun!
Paulus spricht von uns als Kindern Gottes. Freiheit gehört für Paulus zum Menschsein dazu. Als Menschen haben wir das Recht – und man muss an dieser Stelle fast sagen auch die Pflicht – zur Freiheit. Die Freiheit, die Paulus im Blick hat, ist nun aber nicht bloße Willkür, sie bedeutet nicht, tun und lassen zu können, was man will. Gott macht uns als Kinder Gottes zu seinen Partnern, die frei und keine Marionetten sind. Gott hat uns geschaffen zur Gestaltung seiner Erde. Er will seine Welt nicht nur als Natur, sondern als das, was wir heute Kultur und Zivilisation nennen. Gestaltung ist gefordert, Ideen und Kreativität sind gefragt. Zur Lösung von Problemen ebenso wie zur Weiterentwicklung von Kultur und Wissenschaft zum Wohle des Menschen. All dies gehört zum Schöpfungsauftrag des Menschen und zur Berufung zur Freiheit, die uns zu Menschen macht. Gott will, dass wir als Partner Gottes Verantwortung übernehmen – für uns selbst, für andere und für diese Erde.
Unsere Gesellschaft braucht freie Menschen, die bereit sind, sich wirklich einzubringen und zu engagieren. Es ist nicht nur in einer Diktatur, sondern wohl in jeder Gesellschaft so, dass Anpassungsbereitschaft und Stromlinienförmigkeit oft mehr geschätzt werden als Selbstständigkeit oder Ecken und Kanten. Es braucht ein starkes Selbst, Selbstgewissheit, um Freiheit und Verantwortung wahrzunehmen. Es braucht die Freiheit des Geistes, um kreativ zu sein, um selbstverantwortet zu handeln.
Diese Freiheit, diese Verantwortung ist manchmal schwer. Jeder weiß das, der einmal schwerwiegende Entscheidungen für sich selbst oder auch für andere zu treffen hatte. Verantwortung heißt dann eben auch, für die Folgen einzustehen. Und es schließt die Möglichkeit des Fehlens ein und auch die der Schuld. Freiheit heißt auch Schuldfähigkeit. Deshalb sind in der Bibel auch nur Menschen zur Schuld oder Sünde – wie es dort heißt – fähig. Und so gehören Mündigkeit, Freiheit und Schuldfähigkeit zusammen.
Freiheit ist also immer die je eigene und ganz persönliche – aber nie die allein auf mich bezogene!
Wer große Verantwortung trägt weiß, wie groß die Einsamkeit sein kann, wenn man sich selbst bewusst ist, dass die eigene Entscheidung selbst getroffen werden muss und es einem von niemandem abgenommen werden kann. Und dass die Folgen verantwortet werden müssen! Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Versuchung immer wieder groß ist, Verantwortung von sich zu weisen.
Freiheit kann schließlich auch eine Last sein und als Überforderung empfunden werden! Große Denker der Moderne wie Friedrich Nietzsche, die die Freiheit des Menschen gefeiert haben und meinten, sie wäre nur mit dem Tode Gottes denkbar, waren sich dann doch gleichzeitig der Herausforderung bewusst, die Freiheit mit sich bringt.
Aber an dieser Stelle muss auch daran erinnert werden, dass Gott den Menschen nicht überfordert. Ist es doch gerade die große evangelische Botschaft, dass uns nicht durch unser Tun, sondern durch die Gnade Gottes Heil zugesprochen wird. Nicht weil wir so toll Verantwortung übernehmen, spricht Gott uns als seine Kinder an. Sondern weil er uns seine Kinder ruft, können wir frei handeln und Verantwortung übernehmen, ohne uns zu übernehmen.
So lasst uns einstimmen in das wunderbare Gebet Oetingers:
Gott,
Gib mir Kraft und Mut aktiv zu werden, wo ich etwas ändern kann,
Gib mir die Gelassenheit zu ertragen, was ich nicht ändern kann,
Gib mir die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden!
Amen.
Freiheit – ein Grundbegriff der Reformation (2017)2
„Hier stehe ich, ich kann nicht anders!“ So sind die Worte Martin Luthers vor dem Reichstag im Worms überliefert – ein großer Akt von Mut und Freiheit. Luther stand zu seinen Thesen und Erklärungen und zu dem, was er für wahr und als Gottes Wort erkannt hatte.
Sie beginnen hier in Regensburg Ihre Reihe zu den Grundbegriffen der Reformation mit dem der „Freiheit“. Das hat mich gefreut. Mut zur Wahrheit den Mächtigen gegenüber beeindruckt uns und erwärmt das Herz. Auf der Wartburg übersetzt Martin Luther dann das Neue Testament und später die ganze Bibel. Es wird mit zu dem Wichtigsten zählen, was unsere Sprache und Kultur bis heute prägt. Das Wort Gottes – so wollte es Luther – sollte für jeden in seiner Muttersprache zugänglich sein, die christliche Botschaft für jeden existentiell hörbar werden und so das Leben ausrichten. Dem Glaubenden wurde zugetraut, auch ohne die auslegende Autorität der Kirche als Zwischeninstanz selbst zu verstehen und auf Gott zu hören! Dies war, wenn man so will, ein wirklicher Trompetenstoß der Emanzipation.
Und doch müssen wir zugleich vorsichtig mit vorschneller Proklamation bleiben. In Martin Luthers bekannter Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ heißt es:
„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. […] Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“3
Es wäre also zu einfach, Martin Luther lediglich als modernen Prediger von Freiheit und Demokratie auszurufen. In der weiteren Entwicklung dürfen wir dann auch nicht die historische Erfahrung mit den Kirchen beiseiteschieben, nicht allein mit der katholischen, sondern auch mit den reformatorischen. Diese Geschichte war in den letzten Jahrhunderten über weite Strecken alles andere als nur eine Freiheitserfahrung. Da wurden, nicht zuletzt in Deutschland, die Kirchen und die Religion insgesamt eher als Mächte der Unfreiheit angesehen. Die Aufklärung hatte sich mit den Kirchen schwer auseinanderzusetzen. Man denke an Ephraim Lessing, dessen Ringparabel zum Verhältnis der Religionen noch heute Lehrstoff in den Schulen ist, und seinen erbitterten Streit mit dem Hamburger Pastor Johann Melchior Goeze, der ihm Zensur und Schreibverbot einbrachte. Interessanterweise war es gerade die proklamierte Religionsfreiheit, die Anstoß erregte, denn sie umfasste auch das Recht, sich zu einer anderen Religion zu bekennen. Das wollte man dann doch nicht einfach zugestehen. Dieses Problem begegnet uns auch heute noch in islamischen Ländern, wenn es um das Recht zur Konversion geht. Manche Schwierigkeiten, über die wir heute den Kopf schütteln, sind uns also, wenn auch zeitversetzt, gar nicht so fern.
Die besonders im deutschen Protestantismus entstandene Verbindung von Thron und Altar und die damit einhergehende Zwei-Reiche-Lehre führten dazu, dass der christliche Glaube im 19. Jahrhundert für freie Geister zunehmend als Religion zur Erziehung gehorsamer Untertanen angesehen wurde. So war es kein Zufall, dass Karl Marx und die entstehende Sozialdemokratie stark mit einem religionskritischen, ja atheistischen Impetus verbunden wurden. Das änderte sich im Westen Deutschlands erst mit dem Godesberger Programm der SPD in den 1950er Jahren; für die vor hundert Jahren entstandenen Kommunistischen Parteien hingegen nie wirklich. Mit der Oktoberrevolution im zaristischen Russland, dem Entstehen der Sowjetunion und der Ausbreitung dieser totalitären Diktatur nach dem Zweiten Weltkrieg im östlichen Europa verbanden die Menschen zunehmend die Erfahrung von Terror und Schrecken, von Repression und Unfreiheit. So auch in der DDR, wo ich aufgewachsen bin.
Jetzt war, was einmal emanzipatorisch begonnen hatte, untrennbar mit der Erfahrung von Unfreiheit verbunden. Dem gegenüber entdeckten wir im christlichen Glauben eine freiheitliche Perspektive. Die evangelischen Kirchen in der DDR, in denen ich geprägt wurde, hatten ihre geistigen Wurzeln in der Bekennenden Kirche aus der Zeit des Nationalsozialismus. Wichtig war hier die Barmer Theologische Erklärung aus dem Jahr 1934. Dort heißt es in der zweiten These:
„Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben; durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürften.“4
Dieser kurze, mehr assoziative Ausflug in die Geschichte macht deutlich, was für die Freiheit wesentlich ist: Sie kann nie Besitz sein, weder durch Einzelne noch durch gesellschaftliche Gruppen oder eine geistige Tradition. Der ganz Europa erfassende geistige Aufbruch der Reformation wurde doch in den folgenden Jahrhunderten eben auch zu einer Art Orthodoxie, welche – ebenso wie die katholische Kirche – von vielen Menschen als geistiges Gefängnis angesehen wurde. Und aus der im 19. Jahrhundert entstehenden Sozialdemokratie, in welcher Untertanen zu politischen Subjekten wurden, die für ihre Freiheit kämpften, entstand der Kommunismus. In dessen Heilslehre für eine glückliche Menschheit der Zukunft spielte die Opferung von Millionen Menschenleben in der Gegenwart überhaupt keine Rolle.
Wissend, dass Andere es anders erlebten, war für mich die Erfahrung von christlichem Glauben und Kirche in der DDR eine Freiheitserfahrung. In meiner Jugend fühlten wir uns mit den Christen in Lateinamerika, denen die Befreiungstheologie Hoffnung gab und mit den Schwarzen in Südafrika, wo die christliche Botschaft im Kampf gegen die Apartheid eine wichtige Rolle spielte, verbunden. Auch wir verstanden den christlichen Glauben als eine lebendige Botschaft der Befreiung.
Meine erste Predigt in einem mecklenburgischen Dorf habe ich über das Pauluswort im Galaterbrief gehalten: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So stehet nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“(5,1). Als ich diese Predigt jetzt noch einmal nachgelesen habe, wurde mir bewusst, wie sehr ich damals wahrscheinlich meine Bauern mit dieser emphatischen Botschaft überfordert habe. Mit Inbrunst sangen wir etwa das Lied „Sonne der Gerechtigkeit“, in dem es heißt: „…weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit […] gib den Boten Kraft und Mut, Glaubenshoffnung, Liebesglut, lass viel Früchte deiner Gnad folgen ihrer Tränensaat […] Lass uns deine Herrlichkeit ferner sehn in dieser Zeit und mit unserer kleinen Kraft üben gute Ritterschaft.“ Gleiches galt für Luthers „Ein feste Burg ist unser Gott“: „Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen.“ Das alles gab Mut, gab Kraft und Zuversicht.
In den Kirchen und ihren Ausbildungsstätten gab es Freiheit des Denkens und der Rede. Hier wurde – immer bedroht und gefährdet – die Freiheit gelebt, sich unter der Perspektive des Glaubens mit den verschiedenen Optionen des Denkens über unsere Wirklichkeit auszutauschen und zu streiten. Eben frei zu denken. Anders als sonst an staatlichen Schulen und in der Gesellschaft üblich war ein freier Diskurs möglich. Das unterschied sich doch sehr von der verbreiteten „Trichterpädagogik“ (wie ich es nannte), bei der fertige, angebliche Wahrheiten vermittelt und von den Schülern dann eins zu eins reproduziert werden sollten.
Diese Freiheit, von der ich spreche, war und ist ja nicht einfach ein „Machen-Können-was-ich-gerade-will“, sondern vielmehr ein kommunikatives Geschehen und Sich-Entdecken auf der Suche nach Gültigem, nach Wahrheiten.
In der Schule lernten wir, dass Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit sei und mussten zugleich erfahren, dass ein offenes Wort leicht zu Problemen führen konnte. Recht früh erkannte jeder die für dieses System so typische Gespaltenheit, die darin bestand, in der Öffentlichkeit, in Schule und Beruf den Erwartungen zu entsprechen und die eigene Haltung und Meinung auf den privaten Raum zu begrenzen. So war es in der DDR für viele ein befreiendes Erlebnis, im Raum der Kirche oder in den verschiedenen oppositionellen Gruppen, die dann in der 1980er Jahren entstanden, diese Gespaltenheit und Lüge überwinden zu können oder sie zumindest zeitweise hinter sich zu lassen. Die gemeinschaftliche Suche nach Erkenntnis, ja, nach Wahrheit, wurde zu einer oft das Leben bestimmenden Freiheitserfahrung.
Wir können nicht allein frei sein. Freiheit ist auf der einen Seite immer konkret die jeweils eigene und nicht nur abstrakte Möglichkeit selbstbestimmter Lebensgestaltung. Gleichzeitig aber gehört eben die Freiheit des Anderen jeweils konstitutiv dazu. Es geht bei der subjektiven Freiheit immer mit um die der Anderen. Meine Freiheit erfährt in der des Anderen nicht nur ihre Grenze, sondern eben auch ihre Erfüllung. Deshalb ist Freiheit nicht nur auf das Selbst, sondern immer auch auf die Anderen bezogen. Der Einzelne braucht die gemeinschaftliche Erfahrung, sich ausprobieren und artikulieren zu können und sich dabei angenommen zu wissen. Dazu gehört das unumstrittene Recht des Widerspruchs, denn nur in freier Kommunikation wächst die Fähigkeit zu Selbstständigkeit und zur Eigenverantwortung. Verantwortung ist die soziale Dimension der Freiheit, ohne die sie nicht sein kann beziehungsweise ohne die sie sich selbst zerstört.
In einer Diktatur ist echte Verantwortung im Sinne der Selbstermächtigung schlichtweg nicht vorgesehen. Sie ist nämlich gefährlich. Denn wo Menschen selbst denken, wo sie im Gespräch und Disput mit anderen nach dem rechten Verhalten suchen, da fruchten vorgegebene Wahrheiten und verordnete Verhaltensweisen nicht mehr. Der Mensch – so gehört es zu seinem Wesen – ist zuständig für seine Wirklichkeit und kann sich im Grunde nicht freisprechen lassen von der Verantwortung für sie, denn das wäre Einwilligung in die Entmündigung.
Als Jugendlicher habe ich in der Kirche viel Streit miterlebt, etwa zu ethischen Fragen, die den Einzelnen betreffen, zu Fragen des miteinander Lebens als auch zu denen der Gesellschaft. Es ging zum Beispiel um Sexualität vor der Ehe oder um die Frage der Wahlbeteiligung, denn wir wussten ja doch, dass es in der DDR Wahlen im eigentlichen Sinne nicht gab. Ich erinnere mich auch an die kontroversen Diskussionen um Engagement und Teilnahme an staatlichen Organisationen und Institutionen wie den sogenannten „Jungen Pionieren“, der FDJ, an der Jugendweihe, an Diskussionen über die neue Verfassung in der DDR 1968 und an die Auseinandersetzung mit der Frage, ob Kirchen auch Befreiungsbewegungen unterstützen dürfen, die mit der Waffe kämpfen. Wichtig war ebenso die Frage, ob die Wehrpflicht zu akzeptieren sei. Ich selbst habe schließlich den Wehrdienst total verweigert, auch den als Bausoldat, da er innerhalb der militärischen Strukturen abzuleisten war. Die Debatten um diese und andere Themen waren eine große Freiheitserfahrung. Anders als im DDR-staatlichen Kontext, wo es um das „Wir oder die Anderen“ ging (um Schwarz oder Weiß, wobei dann Recht und Unrecht immer klar verteilt waren), wurde in den kirchlichen Debatten, die wir auch in der Jugendarbeit einübten, um Entscheidungen und das rechte Urteil gerungen.
Freiheit – das wurde in solchem Ringen um ethisch verantwortbare Entscheidungen zu einem verantwortlichen Handeln deutlich – ist nicht allein die Freiheit von etwas, das Fehlen von Druck, von Repression und Zwang. Vielmehr handelt es sich vor allem um eine Freiheit zu etwas, zur Hingabe an einen Menschen, an eine gesellschaftliche Aufgabe, um Gestaltung unserer Wirklichkeit. In revolutionären Situationen, das war auch unsere Erfahrung von 1989/90, ist es allemal leichter, sich mit anderen darin einig zu sein, was man ablehnt (das herrschende System, die Diktatur), als sich auf Vorstellungen darüber zu einigen, was man will, wie gesellschaftliche und staatliche Strukturen und Ziele konkret aussehen sollen.
Zur Freiheit und zur Wahrnehmung von Verantwortung gehört notwendigerweise das klare Bewusstsein der eigenen Grenzen. Als mein Freund Martin Gutzeit und ich Anfang 1989 den Plan fassten, in der DDR eine Sozialdemokratische Partei zu gründen, hatten wir die eigene Begrenzung sehr bewusst im Blick. Wir waren uns bewusst, nicht für alle sprechen zu können. Eine Partei ist eben nur pars (Teil), sie muss um Zustimmung und Anerkennung werben und sich zur Durchsetzung von Zielen um Verbündete bemühen. So verbanden wir mit der Gründung der SDP (so lautete damals das Kürzel für die Sozialdemokratische Partei in der DDR) auch den Aufruf an diejenigen, die sich uns inhaltlich nicht anschließen konnten, dann selbst andere demokratische Parteien zu gründen, um auf der Grundlage von Gemeinsamkeiten mit ihnen kooperieren zu können.
Auch wenn Freiheit oft zuallererst als eine Möglichkeit individuellen Denkens und Verhaltens angesehen wird ist es wichtig sich deutlich zu machen, dass Freiheit ganz wesentlich auch mit gesellschaftlichen, ja mit staatlichen Strukturen und Institutionen zu tun hat. So ging es uns damals nicht nur darum, Freiheit und Einhaltung der Menschenrechte von den Herrschenden zu fordern. Vielmehr war es unser Anliegen, Freiheit ermöglichende und sichernde Institutionen des Rechts, der Partizipation und der Gewaltenteilung zu konstituieren. Wir wollten den in der DDR vorhandenen Strukturen der Entmündigung und Verantwortungslosigkeit solche entgegensetzen, in denen der Einzelne wirkliche Verantwortung zu übernehmen in der Lage ist. Dazu aber mussten sich Menschen finden, die sich für solche Verantwortung in den Institutionen der Demokratie auch selbst zur Verfügung stellten. In vielen Gesprächen war meine Botschaft: Worauf willst Du beziehungsweise sollen wir warten? Wer soll es denn für uns übernehmen? Du bist gefordert! Mach mit!
Eine Begebenheit ist mir in besonderer Erinnerung: Es war im Herbst 1989, wir hatten die Partei gerade gegründet und ich veranstaltete in meiner Ökumenischen Bildungs- und Begegnungsstätte bei Magdeburg ein Seminar zur Gewaltlosigkeit. Dazu hatte ich Freunde aus Budapest eingeladen, Vertreter der sogenannten Bulanyi-Gruppen, einer sehr beeindruckenden katholischen Basisbewegung in Ungarn, die seit vielen Jahren den Wehrdienst verweigerten und dafür ins Gefängnis kamen. Am Abend erzählte einer der ungarischen Freunde, dass er im neu gegründeten „Ungarischen Demokratischen Forum“ engagiert sei. Falls dieses bei der künftigen Wahl aber gewinnen sollte, werde er wieder austreten, denn er wolle an keiner Macht teilhaben. Ich stritt mit ihm und meinte, er sollte in meinen Augen sogar bereit sein, Innenminister zu werden und eine bewaffnete Polizei in seine Verantwortung übernehmen, um das Gewaltmonopol des Staates zum Schutz der Menschen durchzusetzen. Es sei natürlich deeskalierend zu gebrauchen. Ich konnte mit ihm nicht einig werden. Ich ahnte zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht, dass ich nur ein halbes Jahr später selbst Minister sein würde.
Ich kannte dieses sehr ambivalente Verhältnis zur Macht auch in den kirchlichen Kreisen, aus denen ich stamme. So erinnere ich mich an die Reaktionen so mancher Weggefährten, als ich im Januar 1990 bei der ersten großen Konferenz der Sozialdemokratie am Alexanderplatz sagte, dass wir die Macht erstreben, denn bei uns sei sie in guten Händen, kontrolliert und begrenzt und auf der Grundlage eines klaren Mandates. Macht anzustreben, was ja die Voraussetzung für politische Gestaltungsfähigkeit in einem demokratischen System ist, das galt in unseren kirchlichen Kreisen damals noch als sehr anrüchig. Dabei gilt ja auch heute und in der Zukunft, dass es Menschen geben muss, die dazu bereit sind, nicht nur als politisch wache Bürger kritisch aktiv zu sein, sondern eben auch Politik – und sei es auf Zeit – als Beruf auszuführen. Wir brauchen Menschen, die sich mit ihrer ganzen Existenz politisch einbringen und handeln, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Es braucht immer wieder neu wache und kritische Bürger, die überzeugend und zur Differenzierung fähig sind, die sich für derlei Aufgaben zur Verfügung stellen.
Wenn Freiheit und Demokratie von selbstbestimmten Gestaltungsentscheidungen leben, dann geht es gleichzeitig immer darum, wie miteinander bei unterschiedlichen Erkenntnissen und Haltungen umgegangen wird. Freiheit ist notwendigerweise stets mit Toleranz verbunden, wobei selbige nicht gleichgültig gegenüber der jeweiligen Verschiedenheit ist, sondern dieser mit Respekt und Achtung gegenübersteht.
Zur Freiheit gehört die Achtung der Unterschiedlichkeit, die Achtung dessen, der in seiner Freiheit, seiner Herkunft und Tradition nicht nur von uns verschieden ist, sondern in seinem Denken und Handeln auch zu ganz anderen Ergebnissen kommt. Diese Achtung hat ihren tieferen Grund in der Würde, die dem Menschsein entspricht. Für einen Christen wurzelt diese Würde in der Gottesebenbildlichkeit und in der Liebe Jesu Christi. Es ist übrigens gerade unser trinitarisches Gottesverständnis, das Gott als Beziehung denkt, in welchem sowohl die Freiheit als auch die Bezogenheit des Menschen, seine Fähigkeit zu Hingabe, Liebe und Verantwortung ihren Grund hat. Deshalb spricht Martin Luther, wie oben ausgeführt, davon, dass der Christ eben nicht nur frei, sondern auch „Knecht“ sei, also in verbindlichen Bindungen lebt. Hier liegt letztlich auch die tiefere Begründung dafür, dass wir jedem Menschen – und zwar weltweit – Freiheit zusprechen müssen oder anders ausgedrückt, weshalb die Menschenrechte universal sind, auch wenn sie in der westlichen, von der Aufklärung geprägten Welt formuliert worden sind.
In der jüdisch-christlichen Tradition, die für unser Freiheitsverständnis so wichtig ist, spielt Erinnerung eine wesentliche Rolle. Die Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten ist für das jüdische Volk konstitutiv für das religiöse Leben. Vor diesem Hintergrund kann ich nicht wirklich verstehen, warum wir Deutschen uns so schwer tun, auch an positive Erfahrung öffentlich zu erinnern. Mehr als zehn Jahre wird nun schon darüber diskutiert, in Berlin zum Gedenken an die Friedliche Revolution und die Deutsche Einheit 1989/90 ein Freiheits- und Einheitsdenkmal zu errichten. Ich hoffe sehr, dass es gegen alle immer wieder aufkommenden Widerstände nun endlich gebaut wird. Es geht doch um die für unser Volk glücklichste Stunde im 20. Jahrhundert und noch dazu um eine, bei der die Völker Europas und der ganzen Welt in dieser Freude an unserer Seite standen!
Zur konkreten Theorie der Freiheit gehören seit der Aufklärung die Idee der Menschenrechte und ihre Kodifizierung in gültiges Recht. Vor dem Hintergrund vielfältiger Erfahrungen von Unfreiheit, Sklaverei und Knechtung waren die Menschenrechte in ihrer klassischen Form Abwehrrechte gegen den Staat und gegen die Bevormundung der Kirche. So haben sich die Kirchen lange gegen die Religionsfreiheit gewehrt. Mit den Menschenrechten soll der einzelne Bürger Rechtssicherheit erhalten und geschützt werden, sowohl als Besitzender als auch als politisches Subjekt. Denken wir an das Recht auf Glaubensfreiheit, auf Meinungs-, Rede- und Versammlungsfreiheit etc. Diese sogenannten „negativen Freiheitsrechte“ für das politische Subjekt sind die Grundlage, für die der Liberalismus stand. Nicht zuletzt in der Geschichte der Sozialdemokratie wurde darüber hinaus Wert darauf gelegt, dass es zur Wahrnehmung der politischen Rechte gehört, entsprechend sozial abgesichert zu sein, um überhaupt zu politischem Handeln befähigt zu sein.
Diese Spannung hat die Diskussion um die Menschenrechte und damit um die Freiheit bis heute stark bestimmt. Einerseits ging es darum, die politischen Rechte des Individuums zu stärken und sie gegenüber dem übergriffigen Staat zu schützen, andererseits aber auch darum, den Staat in die Verantwortung zu nehmen. Er hat gerade für die Schwächeren in der Gesellschaft zu sorgen und durch Verteilung des Wohlstands die sozialen Grundlagen für freies Handeln zu gewährleisten.
Uns wurde in der DDR der Vorrang der sozialen Rechte gelehrt und auch die Kirchen setzten sich in ihren ökumenischen Aktivitäten oft für diese Prioritätensetzung ein. Gleichzeitig mussten wir jedoch erleben, wie die politische Realität in den kommunistischen Ländern von der faktischen Abschaffung der politischen Rechte geprägt war. Auch heute gibt es immer wieder die Argumentation, dass für bestimmte Staaten wohl doch eine autoritäre Herrschaftsform zu akzeptieren sei, um die Entwicklung voranzutreiben. Politologen sprechen hier von Entwicklungsdiktaturen. Manche sind der Meinung, das könne auch für Russland gelten. Ich bin diesbezüglich zutiefst skeptisch und glaube, dass die politischen Rechte immer Priorität haben, denn wer sollte das Subjekt von Veränderung sein, wenn nicht die Bürgerinnen und Bürger, die Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen? Wir haben demgegenüber doch erlebt was geschah, wenn einige (oder eben eine Partei) glaubten, zum Besten aller handeln zu können, weil schon von der Ideologie her die Gewissheit bestand, die Wahrheit zu kennen.
Über die politischen Abwehrrechte hinaus wird in der Rechtsphilosophie im Gefolge der englischen und amerikanischen – republikanischen – Tradition ebenfalls von den demokratischen Partizipationsrechten gesprochen. Hier geht es um das Recht auf Mitgestaltung des Gemeinwesens.
Mir gefällt an dieser Stelle der Begriff der „Bürgerrechte“ besonders gut, weil er die verschiedenen Dimensionen der Freiheit so klar zum Ausdruck bringt. Jeder Mensch hat im Gemeinwesen diese Rechte der freien Rede und der Versammlung, aber eben auch staatsbürgerliche Pflichten für das Gemeinwohl. Deshalb bin ich auch so skeptisch gegenüber der heute häufigen Praxis, von „Bürgerrechtlern“ zu sprechen, so, als sei das ein Titel. Zumal wir ja feststellen müssen, dass bürgerschaftliche Verantwortung heute in einer Demokratie nicht weniger wichtig ist als in Diktaturen!
Ursprünglich bezog sich das Bürgerrecht vor allem auf freie Wahlen, ist aber natürlich viel weiter zu fassen. Wir sind heute in einem breiten Prozess des Nachdenkens darüber, welche demokratischen Mitwirkungsrechte darüber hinaus auch zwischen Wahlen noch sinnvoll und hilfreich sind. Wie sich am Beispiel von „Stuttgart 21“ erkennen lässt, sind die Bürgerinnen und Bürger heute immer weniger bereit zu akzeptieren, dass zwischen den Wahlen von den gewählten Repräsentanten „einfach alles“ beschlossen werden könne. Wie diese „Stärkung der Bürgergesellschaft“ jedoch demokratisch gestaltet werden kann, ohne dass sich nur jene durchsetzen, die sich am lautesten Gehör verschaffen, bleibt noch eine spannende Frage.
Wir haben uns nun mit der Freiheit beschäftigt. Wenn wir uns jedoch die gegenwärtige Situation und die öffentlichen Debatten anschauen, dreht sich das öffentliche Interesse gegenwärtig eher um die Frage der Sicherheit. Das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit ist seit eh und je ein heftig diskutiertes. Einerseits hängt beides eminent zusammen. Freiheit wie Sicherheit sind grundlegende Werte, sowohl für den Einzelnen als auch für das öffentliche Leben. Nur dort, wo das alltägliche Leben gesichert ist, wo niemand Angst haben muss um Leib und Leben, nur dort kann Freiheit gedeihen. Wo Recht und Ordnung herrschen und die Herrschaft des Rechts anerkannt ist, kann Freiheit gedeihen und die freie Gestaltung des Lebens erfolgen. Auf der anderen Seite aber gibt es auch eine Spannung, die in den aktuellen Problemlagen eine wichtige Rolle spielt. Hierzu gehört die Bekämpfung des Terrorismus als eine zunehmende Herausforderung für die öffentliche Sicherheit.
Die Frage ist heute zunehmend, welche Einschränkungen der Freiheit akzeptabel sind, um den Schutz vor Terrorismus wirksam gewährleisten zu können. Gerade nach dem 11. September 2001 und immer wieder neu nach jedem Anschlag (wie kurz vor dem Weihnachtsfest auf dem Berliner Breitscheidplatz) gibt es die Diskussion darüber, was zusätzlich für mehr Sicherheit getan werden kann oder muss. Je nach Akzentsetzung bleibt strittig, ob Freiheit die unabdingbare Voraussetzung für Sicherheit ist oder bis zu welchem Grad die Einschränkung der Freiheit um der Sicherheit willen akzeptiert werden muss. Oder ist doch die Sicherheit die grundlegendere Bedingung für alle Lebensvollzüge, Freiheit inbegriffen? Beide, Freiheit wie Sicherheit, sind gleichwertige öffentliche Güter, sie stehen in keinem hierarchischen Verhältnis zueinander. Aber gerade das macht es im konkreten Handeln auch so schwierig, da jeweils neu austariert und öffentlich ausgehandelt werden muss, worauf es im konkreten Falle ankommt.
Mein Eindruck ist, dass wir angesichts massiver Verunsicherung in unserer Gesellschaft und angesichts gegenwärtiger Herausforderungen – ich nenne nur die Flüchtlingsfrage, den Terrorismus, die Kriege in unserer Nachbarschaft wie in Syrien und in der Ostukraine – einen Trend erleben, in welchem mehrheitlich der Sicherheit Vorrang gegeben wird. Ich halte das für verständlich, glaube jedoch, dass wir sehr darauf zu achten haben, unsere liberale Ordnung, unsere auf Freiheit basierende Lebensweise, nicht aus dem Blick zu verlieren. Absolute Sicherheit gibt es nicht, beziehungsweise nur um den Preis der Freiheit! Wie heute konkret eine Balance zwischen diesen Werten gefunden werden kann, wird gesellschaftlich auszuhandeln sein. Ob Wahlkampfzeiten dafür besonders geeignet sind, kann man hinterfragen, doch wir können es uns nicht aussuchen.
Wenn wir uns heute in der Welt umsehen, müssen wir feststellen, dass die Freiheit – anders, als es vor fünfundzwanzig Jahren aussah – wieder stärker unter Druck geraten ist. Schauen wir nur nach Russland oder in die Türkei oder nun erschreckenderweise auch hinüber in die USA. Gleiches gilt auch in unserer Nachbarschaft, in Polen und in Ungarn. Mit Spannung warten wir ab, wer in Frankreich die nächste Präsidentschaftswahl gewinnt. Europa braucht gerade in diesen Zeiten engagierte Demokraten und Europäer!
Wir erleben heute angesichts der aktuellen Krisen eine große Verunsicherung. Die Folge ist nicht selten die Erwartung eines starken Mannes, die Hoffnung auf einen starken Staat, der dort und immer dann kurzen Prozess macht, wo die Sicherheit infrage gestellt ist. Den komplizierten und langwierigen Prozessen des Rechtstaates und des Interessenausgleichs wird oft die Lösung der Probleme nicht mehr zugetraut. Der Angst der Bürger, ihrer Apathie und dem fehlenden Vertrauen in die Lösungskompetenz der demokratischen Strukturen entspricht sehr schnell das Versprechen von Politikern, die angesichts einer komplexen Wirklichkeit einfache Lösungen zusagen. In einem erschreckenden Maße sehe ich heute beides sich bedingen – Angst und Verunsicherung und die leichte Verführbarkeit durch Populisten. Ich habe dafür keine Lösungen, bin aber überzeugt, dass wir mit den Menschen heute trotz aller neuen Medien und Kommunikationsmittel wieder viel stärker direkt und unmittelbar ins Gespräch kommen müssen.
Hannah Arendt, die bekannte deutsch-jüdische Philosophin, die angesichts der eigenen Erfahrungen viel über die Bedrohung der Freiheit nachdachte, setzte unter Rückgriff auf den alten Kirchenvater Augustinus Freiheit in einen engen Bezug zum Anfangen. Freisein und Beginnen, das gehöre wesentlich zusammen. Sie sprach sogar vom Wunder, von der Macht des unerwarteten und nicht errechenbaren Anfangens und bezog sich hier auf die Predigt Jesu, der uns zusagt, dass der Glaube Berge versetzen kann. Hannah Arendt schrieb: „Der Mensch scheint auf eine höchst geheimnisvolle Weise dafür begabt, Wunder zu tun.“ Und so gehört es für sie zum Geschichtsprozess, der aus menschlichen Initiativen entsteht, dass es „nur realistisch ist, in der Politik mit dem Unvorhersehbaren zu rechnen“.5
Für mich ist dies gerade in der heutigen Zeit eine frohe Botschaft. Wir alle haben Grund zur Sorge, wenn wir uns in der Welt und zuweilen auch im eigenen Land umschauen. Und doch gibt es Hoffnung! Stets kann Unvorhersehbares geschehen. Nur gilt es, nicht einfach darauf zu warten, sondern mit den eigenen Möglichkeiten „anzufangen“, oder, wie wir heute eher sagen würden, die Initiative zu ergreifen. Nur im Handeln ist Freiheit auch lebendige Realität.
Ich danke Ihnen.
Predigt zum Jahrestag der Friedlichen Revolution (2018)6
Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass Du Dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast Du ihn gekrönt. (Ps. 8,5f)
Liebe Gemeinde,
fast dreißig Jahre sind die Ereignisse her, die diesen Tag für Leipzig und die ganze DDR zum Tag der Freiheit gemacht haben. Eine ganze Generation ist inzwischen nachgewachsen. Es gerät in Vergessenheit, was damals geschah, wenn es nicht erinnert, erzählt und weitergesagt wird. Deshalb ist es gut, dass die Stadt und die Kirche und viele Bürgerinnen und Bürger diese Oktobertage jährlich nutzen, um an 1989 zu erinnern und Herausforderungen zu benennen, die im Geist von 1989 heute aktuell sind.
An alte Zeiten zu erinnern, ist von großer Wichtigkeit und steckt gleichzeitig voller Gefahren. Erinnerungen, Geschichten, Mythen – das geht leicht ineinander über. Können Sie sich an Geschichten und Erzählungen Ihrer Großeltern erinnern? Da ging es Ihnen vielleicht auch so: Einerseits waren die Geschichten hochinteressant. Andererseits fragte man sich, wenn man älter wurde, ob man alles glauben könne und ob es noch eine Bedeutung habe. Und doch bleiben die Großeltern in unserer Erinnerung mit ihren Geschichten verbunden.
So ist es auch mit dem Volk Israel. Wenn man einen Juden fragt, was er glaubt, so hält er keinen theoretischen Vortrag, sondern erzählt eine Geschichte, die Geschichte von der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Da steht am Anfang des Glaubens die Erfahrung von Befreiung, eine Erfahrung, die von Generation zu Generation weitererzählt wird.
Der 9. Oktober 1989 steckt hier in Leipzig und in der ganzen DDR voller Erinnerungen und Geschichten. Gleichzeitig aber gilt sogar hier: Da gibt es ganz verschiedene Erzählungen derer, die es erlebt haben. Das gilt für den 9. Oktober wie für das ganze Jahr zwischen dem Sommer 1989 und dem 3. Oktober 1990. Manches droht zum Mythos zu werden. Deshalb es wichtig ist, dass viele erzählen, damit Mythen sich wieder verflüssigen und das Bild bunter wird. Und viele ihre eigenen Erfahrungen wiedererkennen.
Am 9. Oktober waren hier in Leipzig so viele Menschen auf dem Ring, dass – trotz der entsprechenden Vorbereitung – nicht geschossen wurde. Ich selbst habe es in Magdeburg erlebt, wir waren im Dom. Ein junger Mann stellte eine Kerze auf. Er betete dafür, an diesem Abend seinen Vater nicht zu treffen, der zu den bewaffneten Betriebskampfgruppen gehörte, die sich am Ufer der Elbe konzentriert hatten. Als wir den Dom verließen, wussten wir nicht, was geschehen würde. Von diesem Tag an – nachdem nicht geschossen wurde – war ich gewiss, dass wir den Weg der Freiheit erfolgreich weitergehen würden können. Er würde nicht im Blut ersticken. Die sich verlierende Angst, die Zuversicht der Freiheit mündete dann sehr schnell in den nicht mehr zu verdrängenden Wunsch der großen Mehrheit, die Einheit Deutschlands zu erlangen. So hängen der 9. Oktober 1989 und der 3. Oktober 1990 eng miteinander zusammen. „Dass wir das erleben durften!“, so wird auch heute noch von vielen voller Dankbarkeit gesagt, „Welch ein Geschenk!“
„Geschenk?“ – das haben wir doch selbst gemacht, werden einige sagen, die hier unter uns sind. Das haben doch Helmut Kohl und die Großen der Weltpolitik gemacht, sagen andere. Nun, darüber lässt sich trefflich streiten – und das sollte auch geschehen. Noch haben wir Deutschen hier keine gemeinsame Erzählung. Umso wichtiger ist es, dass die verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven zu Gehör gebracht werden und ins Gespräch miteinander kommen.
Diesen Sieg von Freiheit und Demokratie und die darauf folgende Einheit verdanken wir dem Handeln vieler, die durchaus nicht alle das Gleiche wollten. Ich kann hier nur von einem Geschenk reden, denn Gott handelt zumeist durch Menschen. Er traut dem Menschen etwas zu. In dem Psalm 8, den wir vorhin schon gehört haben, heißt es:
„Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass Du Dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast Du ihn gekrönt.“ (Ps. 8,5f)
Gott hat uns Menschen nicht als Marionetten geschaffen, sondern als freie Wesen, die Verantwortung tragen. In dem Wort „Verantwortung“ steckt das Wort Antwort, es meint, dass Verantwortung die Antwort ist auf den Zuspruch der Freiheit und den Anspruch Gottes auf unser Handeln.
Die Theologie spricht beim Verhältnis Gottes zum Menschen unter anderem von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Die Bibel aber erzählt eine Geschichte, in der es heißt: „Er erschuf den Menschen nach seinem Bilde.“ Das klingt wie ein Mythos. Wie bei allen Mythen ist es auch mit einer Botschaft verbunden: Das heißt nämlich, dass der Mensch nicht einfach nur ein Ding ist. Er ist Person, ein Wesen, das ein Verhältnis zu sich selbst hat. Als Geschöpf ist der Mensch durch sein Verhältnis zu Gott definiert. Er hat einen Auftrag, er ist verantwortlich für das, was ihn umgibt. Anders als die Tiere, kann, ja soll er gestalten. Und er ist nicht allein, jeder Mensch ist als Mensch Mit-Mensch, er lebt nicht nur im Gegenüber zu Gott, sondern auch zu seinen Mitmenschen.
Schon die ersten Geschichten der Bibel beschreiben diese Verhältnisse, zum Teil in drastischer Weise. Da bringt etwa Kain seinen Bruder Abel um. Und muss sich vor Gott verantworten! Diese Geschichten machen deutlich: Gott schuf den Menschen als Gestaltenden, als Partner, der Verantwortung trägt. „Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott“, so heißt es in unserem Psalm.
Doch warum rede ich in der dritten Person? Es geht hier nicht um irgendwen, sondern um uns. Von uns ist die Rede, von unserem Verhältnis zu Gott, zu unseren Mitmenschen und zu dieser Welt! Es gehört zu uns, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen und es gestalten, dass wir uns gestaltend ins Verhältnis setzen zu dem, was uns umgibt.
Dies genau war es doch auch, was die Ereignisse damals zum Tanzen brachte. Diese Selbstermächtigung, in der viele die vorgegebenen Bahnen verließen und den Weg der Freiheit beschritten. Es war das Wahrnehmen dessen, was Gott uns als Auftrag in die Wiege gelegt hat: die Zuständigkeit für die eigenen Verhältnisse! Wir können zwar durchaus auch die Augen schließen und scheinbar Gott einen alten Mann sein lassen. Doch holt uns das dann irgendwann ein, denn diese Zuständigkeit und Verantwortung für die eigenen Verhältnisse bleibt.
Ich habe es nie verstanden, wenn man mir etwa in außenpolitischen Diskussionen weismachen wollte, die Menschen in anderen Ländern wollten vielleicht gar nicht frei sein und sich selbst bestimmen. Sie wollten eigentlich gar keine Verantwortung tragen, das sei nicht ihre Tradition. Das kann zwar für den einen oder die andere im Konkreten stimmen. Faulheit, Ignoranz und Eigennutz sind natürlich auch weit verbreitete Eigenschaften. Doch zu unterstellen, dass ein Volk, etwa das russische, weil es kaum Erfahrungen mit Freiheit gemacht hat, diese auch nicht wolle, erscheint mir dann doch ziemlich zynisch. Die Bibel und dieser Psalm sagen uns jedenfalls etwas anderes! Die Freiheit, die eigene Wirklichkeit zu gestalten, das Leben in seinen vielfältigen Bezügen selbst in die Hand zu nehmen, ist Teil unserer von Gott gegebenen Gottesebenbildlichkeit. Paulus sagt im Brief an die Galater, einer Gegend in der heutigen Türkei: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen! (Gal.5,1)“
Mit solcher Botschaft der Freiheit im Herzen und im Rücken haben vor fast drei Jahrzehnten viele, die aus den Kirchen auf die Straßen gingen, plötzlich die Erfahrung gemacht, dass diese Freiheit trägt und Kraft gibt. Dass diese Revolution friedlich blieb, ist ein Geschenk. Vonseiten der Sicherheitskräfte hätte es auch anders kommen können. Am Wochenende vor dem 9. Oktober war es in vielen Städten auch nicht so friedlich. Vonseiten der Demonstrierenden aber war die Friedlichkeit Wunsch und Wille zugleich. In der Ukraine hat man auf dem Maidan vor drei Jahren von einem Aufstand der Würde gesprochen. Ähnliches fand in diesem Jahr in Armenien statt. Das macht Hoffnung! Ich finde diese Rede von einem „Aufstand der Würde“ sehr schön und treffend. Denn das Wort der Würde, die jedem Menschen eigen ist, nimmt in einem säkularen Sinne den Inhalt dessen auf, was in der Bibel Gottesebenbildlichkeit genannt wird. Jedem Menschen kommt eine Würde zu, die nicht verletzt werden darf. Mit dieser Würde kommen jedem Menschen Rechte zu, die einzuhalten wir verpflichtet sind. Mit der Erklärung der Menschenrechte vor siebzig Jahren hat die Staatengemeinschaft sich zu ihrem Schutz verpflichtet. Es ist ein hoher Wert, dass dies in unserem Grundgesetz, unserer Verfassung, gleich zu Beginn festgehalten wird.
Johannes Rau hat in einer kurzen Rede unmittelbar nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten darauf hingewiesen, dass im Grundgesetz nichts von der Würde des Deutschen steht, sondern von der Würde des Menschen. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, heißt es dort und es wird als staatliche Aufgabe benannt, sie „zu achten und zu schützen“.
ICH – DIE – WIR. So lautet das Motto für das Freiheitsfest in Leipzig in diesem Jahr. Für ALLE, für mich – für die – und uns alle gilt, dass uns eine unantastbare Würde zugesprochen ist. Sie kann zwar verletzt, aber nicht vernichtet werden. Sie zu achten und zu schützen sind wir gerufen.
Ich gestehe, dass ich vor drei Jahren, als so viele Flüchtlinge zu uns kamen, erstaunt über die große Bereitschaft der Menschen war, ganz unmittelbar zu helfen. Den Flüchtling als Menschen zu sehen, der Hilfe braucht und sich selbst in der Verantwortung zu wissen, selbst mit anzupacken – diese Grundhaltung ergriff damals Abertausende. Hier war ich wirklich stolz auf unser Land. Leider ist das Gefühl des Stolzes dann ganz schnell verflogen, als die Gegenreaktionen kamen. Heute müssen wir uns oft schämen, wenn wir sehen, wie Menschen wieder gejagt werden, weil sie Fremde und Andersartige sind, wenn wir in Deutschland und ganz Europa darüber diskutieren, ob man die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer retten soll und wer das darf.
Nachdem Abertausende Deutsche in der Zeit des Nationalsozialismus die Erfahrung gemacht hatten, wie schwer es für sie war, in einem anderen Land Asyl zu finden, haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes das Asylrecht sehr hochgehalten. Seitdem haben wir es mehr und mehr ausgehöhlt, was uns nicht zur Ehre gereicht.
Der 9. Oktober steht in unserer Erinnerung als Symbol für die Friedliche Revolution, die Freiheit und Demokratie brachte und das Tor zur Einheit aufstieß. Ich glaube, zu Recht. Und doch muss ich aus dieser Zeit selbst einen Wermutstropfen hinzufügen. Im Herbst 1989 habe ich bei Magdeburg ein Seminar über die Integration von Ausländern in der DDR gehalten. Das war ja durchaus auch damals schon ein Thema. Dorthin hatte ich einige Mosambikaner eingeladen, die in der DDR lebten, arbeiteten oder studierten. Sie berichteten zu unserem Erschrecken, dass sie an verschiedenen Demonstrationen teilgenommen hätten und bei diesen Freiheitsdemonstrationen die Erfahrung massiver rassistischer Pöbeleien erlebt hatten. Das hat mich damals tief betroffen gemacht und macht es noch immer.
Heute hört man immer wieder, die meisten Flüchtlinge kämen gar nicht aus Kriegsgebieten, sondern seien nur Wirtschaftsflüchtlinge. Ich frage mich dann manchmal, wie mit den gleichen Kriterien die Flüchtlinge zu bezeichnen wären, die damals aus der DDR über Ungarn oder die Botschaften in den Westen flohen oder die Absicht dazu hatten. Viele von ihnen, die einen Antrag zum Weggehen gestellt hatten, nahmen damals an den Demonstrationen hier in Leipzig teil. Wir sehen Filme über manche gewagten Fluchtunternehmungen, die Beteiligten werden vielfach bewundert. Sie haben vielleicht den neuen Film „Ballon“ gesehen, in dem solch eine Geschichte erzählt wird. Doch bleibt festzuhalten: Vor Krieg oder einer Gefahr an Leib und Leben flohen DDR-Flüchtlinge oder Ausreiser wohl nicht. Die einen aber abweisend als Wirtschaftsflüchtlinge zu bezeichnen, die anderen für ihre Flucht zu bewundern – da frage ich mich dann doch, ob da bei uns nicht einiges durcheinandergerät.
Natürlich kann nicht einfach jeder zu uns kommen und bleiben. Das hielte kein Land aus, auch unseres nicht. Aber im Flüchtling den Menschen zu sehen, der eine Würde hat, das bleibt eine Grundlage für jedes menschliche und staatliche Verhalten, die wir nicht aufgeben dürfen! Da darf dann mit Dankbarkeit an die vielen erinnert werden, die – ob Christen oder Nichtchristen, auch hier in Leipzig – dem Wort Jesu folgen, der sagte: „Was ihr getan habt einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan!“
ICH – DIE – WIR! Die große Mehrheit der Ostdeutschen wollte vor knapp drei Jahrzehnten, gewissermaßen als ersten Ausdruck ihrer neu gewonnenen Freiheit, die deutsche Einheit, den Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes mit seinem 1. Artikel von der unantastbaren Würde des Menschen. Gewiss haben sich damals viele ganz anderes davon versprochen als das, was sie dann erlebt haben. Es gab neben vielem Guten auch viele Enttäuschungen und heute gibt es mancherlei Unsicherheit und Ängste, wie es weitergeht. Diese Ängste jedoch an den noch Schwächeren auszulassen und sie zum Sündenbock zu machen für die Unzulänglichkeiten im eigenen Land, ist nicht nur unfair, es widerspricht auch der Verantwortung, die wir alle tragen. Es widerspricht dem Willen Gottes.
So bleibt in ganz neuer Weise als Aufgabe, was uns schon damals vor Augen stand: Ein Leben in Freiheit und Würde zu ermöglichen, für uns selbst, aber eben auch für alle, die mit uns leben.
Amen.
1 Predigt in der Bethlehemskirche Berlin - Neukölln, 27. April 2014, Gottesdienst zur Reformationsreihe Kirche und Politik
2 Vortrag beim evangelischen Bildungswerk Regensburg im Rahmen einer Vortragsreihe zu den Grundbegriffen der Reformation, 8. März 2017
3 https://www.luther2017.de/de/martin-luther/texte-quellen/lutherschrift-von-der-freiheit-eines-christenmenschen/ (abgerufen am 1.7.2019)
4https://www.ekd.de/Barmer-Theologische-Erklarung-Thesen-11296.htm (aufgerufen am 27.5.2018)
5 Hannah Arendt, Freiheit und Politik. Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Denken I, Zürich 2012, S. 222f
6 Predigt zum Friedensgebet in der Nikolaikirche Leipzig, 9. Oktober 2018
2. Kirche als Raum der Freiheit
Das evangelische Pfarrhaus in der DDR zwischen Bildungsbürgertum und Politik (2013)1
Als Sohn eines Pastors – und später bis zum Mauerfall selbst praktizierender Pfarrer – schaue ich aus zwei ähnlichen und doch verschiedenen Erlebnisräumen heraus auf das Thema dieses Beitrages.
Wer, wie ich, in einem DDR-Pfarrhaus aufwuchs, lebte in einer durchaus eigenen, sich von der Normalität des sozialistischen Alltags unterscheidenden Welt. Wir Pastorenkinder ertrugen einerseits hautnah verschiedenste Formen der Ausgrenzung und Isolierung, andererseits befanden wir uns auch ein Stück weit in einem schützenden Raum, entlastet von dem üblichen Druck, der auf den meisten Menschen in ihrem Alltag lastete. Das Pfarrhaus war schließlich das Zentrum der Gemeinde, hier traf sich, wer durch seinen christlichen Glauben andere Schwerpunkte im Leben setzte, als jene, welche die durch Partei und Staat bestimmte Gesellschaft „verordnete“.
Unsere familiäre Erziehung war geprägt von gepflegter Bürgerlichkeit und Sittlichkeit. Der Beruf des Vaters prägte den Alltag, die Mutter stand ihm in allen Gemeindefragen ganz zur Seite und organisierte den reibungslosen Ablauf der (Groß-)Familie. Die hauseigene Bibliothek war ebenso selbstverständlich wie das gemeinsame Musizieren und der regelmäßige Austausch mit vielen Gleichgesinnten in praktizierter geistiger Freiheit. Dass ich ab dem Beginn meiner Schulzeit mit den Eltern und vier Geschwistern im Berliner Missionshaus lebte, eröffnete eine zusätzliche Dimension: Gegenüber den im Land verteilten Pfarrhäusern hatten wir den Vorteil eines größeren sozialen Raumes. Hier wohnten nicht nur mehrere Pfarrfamilien einander stärkend unter einem Dach, auch internationale Gäste aller Kontinente gehörten zum Alltag, was unseren Horizont noch auf eine ganz andere Weise erweiterte.
Unter DDR-Pfarrerskindern war es nicht üblich, sich an den staatlichen, kommunistisch geprägten Kinder- und Jugendorganisationen wie den Jungen Pionieren und der FDJ zu beteiligen oder neben der Konfirmation die Jugendweihe mitzumachen. Wer sich dem verweigerte, hatte zwar geringere Ausbildungs- und Aufstiegschancen, stand aber als quasi unverbesserlicher Außenseiter auch nicht ständig unter Rechtsfertigungsdruck. Bis zu einem gewissen Grade wurde das „Ghetto Kirche“ in seinem Anderssein duldend toleriert. Allerdings waren selbst beste schulische Ergebnisse keineswegs ein Garant für den Zugang zu höherer Bildung. Das staatliche Abitur und ein sich anschließendes Studium blieben Pastorenkindern oft verwehrt. Viele suchten deshalb ihren Ausweg in sozialen Berufen oder im Ausreiseantrag nach Westdeutschland. Ein Teil der DDR-Pastorenkinder profitierte von der begrenzten Möglichkeit, über kirchliche Ausbildungsstätten einen anspruchsvolleren Beruf anzustreben. Diese Ausbildungsstätten waren zumeist unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in der Besatzungszeit gegründete und von den Sowjets genehmigte Oberseminare, Konvikte und ähnliches. An derartigen Einrichtungen konnte beispielsweise ein vom Staat unabhängiges, wenn auch nicht anerkanntes Abitur erworben, soziale Berufe erlernt und sogar ein vollständiges Theologiestudium absolviert werden. Naturgemäß war an diesen Bildungsstätten der Anteil von Pfarrerskindern hoch. Auch mein Ausbildungsweg fand innerhalb der Kirche statt, nachdem ich zum Ende der 10. Klasse trotz bester Noten aus politischen Gründen von der Erweiterten Oberschule in Berlin-Mitte (dem einstigen Grauen Kloster) verwiesen wurde. Das Abitur erwarb ich dann im kirchlichen Oberseminar Potsdam-Hermannswerder und schloss später, nach einer Zeit in Naumburg, mein Theologiestudium am Sprachenkonvikt Berlin ab. Wie die Kirchen insgesamt, so waren gerade ihre Ausbildungsstätten Orte geistiger Freiheit. In einer totalitären Gesellschaft wie der DDR waren sie damit zugleich per se ein Politikum.