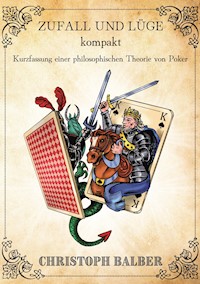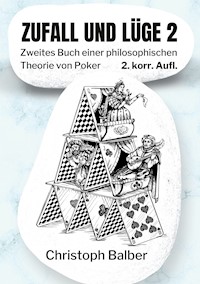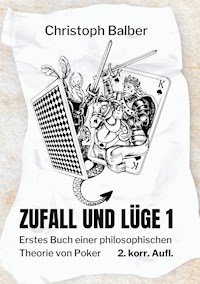
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Das Pokerspiel kann man mit oder ohne Herzeigen der eigenen Karten gewinnen. Auf diesem Gegensatz beruht die Spaltung des Spiels in zwei Bereiche, die beide miteinander im Widerspruch stehen. So sind die Karten etwa theoretisch, objektiv und zufällig. Sie stehen für die Wahrheit, das Wissen und die Vernunft. Der Bluff hingegen ist pragmatisch, subjektiv und manipulativ. Er steht für die Lüge, die Intuition und das Unterbewusste. Zufall und Lüge 1 ist der erste Band einer philosophischen Theorie von Poker, der diesen Gegensätzen auf den Grund gehen will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Dr. med. univ. Christoph Balber BA, geb. 1989, ist Arzt und Philosoph aus Österreich. Er hat Humanmedizin und Philosophie in Wien studiert und befindet sich zum Zeitpunkt der 2. Auflage in Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1.
Eine Einführung
1.1 Die grundlegenden Spielregeln
1.2 Poker aus philosophischer Sicht
2.
Die Poker-Antinomie
2.1 Vorstellung der Poker-Antinomie
2.2 Die Antinomie in ihrer Auflösung
2.3 Intellekt und Courage
2.4 Erste Definition des Spiels
2.5 Bewusste und unterbewusste Motivationen
3.
Der Zufall
3.1 Problem der Freiheit
3.2 Ein Sündenbock
3.3 Die Entmenschlichung des Gegenspielers
3.4 Ich und Du im Fokus
3.5 Menschliche Unlogik
3.6 Individualität im Kollektiv
4.
Der Poker-Mythos
4.1 Einleitung zum Poker-Mythos
4.2 Der Ursprung des Mythos
4.3 Virtuelles Pokerspiel
4.4 Wahrheit und Unwahrheit
4.5 Die Moderator-Funktion der Karten
4.6 Poker-Paradigmen
5.
Poker-Turniere
5.1 Poker ist nicht gleich Poker
5.2 Über Poker-Turniere
5.3 Das Turnier als sportliche Disziplin
5.4 Sich gehen lassen
5.5 Verhinderung von Poker-Tells
5.6 Überlebens-Strategien
5.7 Jagd-Strategien
5.8 Auf lange Sicht
5.9 Nicht auf lange Sicht
5.10 Die Achillesferse des analytischen Pokerspiels
5.11 Der Spielzwang
5.12 Die Bedeutung des Chip Stacks
5.13 Die Fata Morgana des Theoretikers
5.14 Pragmatisch sein
6.
Spieler-Welten
6.1 Die Entstehung der Welt
6.2 Wahrnehmung und Informationsverarbeitung
6.3 Irrationale Spielentscheidungen
6.4 Tight und loose
6.5 Aggressive und passive
6.6 Eine ambivalente Faktenlage
6.7 Analyse und Synthese
7.
Die Unschuldsvermutung
7.1 Einleitung zur Unschuldsvermutung
7.2 Ein unlösbarer Konflikt
7.3 Zurück zum Ursprung
7.4 Ungerechtigkeit und Betrug
7.5 Sehnsucht nach Gewissheit
8.
Die Bluff-Inkompetenz
8.1 Einleitung zur Bluff-Inkompetenz
8.2 Bluff-Abwehr und Gegenbluff
8.3 Vermaledeite Ungewissheit
8.4 Der Fluch des Fanatikers
8.5 Die Vermeidung der Angst
8.6 Persönliche Eignung
8.7 Bluff in Action
8.8 Die Entfremdung des Bluffs
8.9 Es war einmal ein Bluff
9.
Gefahren erkennen und abwenden
9.1 Verhängnisvolle Perfektion
9.2 Die Elimination des Poker-Tells
9.3 Die Bestimmung von Poker-Tells
9.4 Zum Begriff des Risikos
9.5 Ein erfundenes Risiko
9.6 Risiko-Bereitschaft und statistische Risiken
9.7 Schreckhafte Verluste
9.8 Selbstbestimmte Risiken
9.9 Die Unterdeterminiertheit des Risikos
10.
Das analytische Hamsterrad
10.1 Der Auto-Fold-Default
10.2 Vom Zwang zur Reue
10.3 Das analytische Dilemma
10.4 Auflösung des analytischen Dilemmas
10.5 Ein Pokerface mit bunter Schminke
10.6 Die Ziellosigkeit des Semi-Bluffs
11.
Aggressives Pokerspiel
11.1 Einleitung zum aggressiven Pokerspiel
11.2 GTO und exploitative play
11.3 Aura der Authentizität
11.4 Plausibilität und Stimmigkeit
11.5 Imitation und Selbstsabotage
11.6 Der gezielte Bluff
11.7 Die Intensität des Bluffs
11.8 Das Poker-Theorem von David Sklansky
11.9 Problematik des Poker-Theorems
11.10 Dekonstruktion des Poker-Theorems
11.11 Konsequenzen der Dekonstruktion
12.
Die Lüge und ihre Saboteure
12.1 Das Wesen der Lüge
12.2 Ambiguität der Wirklichkeit
12.3 Ursprung der Täuschung
12.4 Die Täuschungskette
12.5 Aus Opfersicht
12.6 Eine offensichtliche Verheimlichung
12.7 Die Rolle des Egos
12.8 Skepsis und Gutgläubigkeit
12.9 Direkte und indirekte Täuschung
12.10 Ein naives Verständnis der Lüge
12.11 Die reflektierte Lüge
12.12 Reflexionsstufen
12.13 Künstliche und natürliche Poker-Tells
12.14 Intention und Motivation
12.15 Hinterfragen des Offensichtlichen
12.16 Außer Kontrolle
12.17 Die Fremdbestimmtheit des Erlebens
13.
Falsche Ehrlichkeit
13.1 Die ungewollte Täuschung
13.2 Das Hintergrundrauschen
13.3 Ungelogen
13.4 In der Falle
13.5 Demonstration von Stärke und Schwäche
13.6 Varianten des Bluffs
13.7 Bluff aus Tilt
13.8 Ein halber Bluff
13.9 Fehlender Ernst
13.10 Freundschaftsspiele
13.11 Die Erlaubnis zum Scheitern
13.12 Unverdiente Gewinne
14.
Phänomenologie der Zeit
14.1 Veränderliche Wirklichkeit
14.2 Das Wissen vom Wissen
14.3 Zeitlos und antiquiert
14.4 Eine bröckelnde Fassade
14.5 Der verbotene Irrtum
14.6 Nebeneinander und nacheinander
14.7 Vorwärts in die Vergangenheit
14.8 Grundlegung der Kausalität
14.9 Warum der Himmel blau ist
14.10 Einen Moment, bitte
14.11 Blick nach vorne
A.
Übersicht der Poker-Antinomien
Vorwort
Es ist nicht leicht, sich dem Pokerspiel auf einer intellektuellen Ebene zu nähern. Denn es ist hoch-komplex, mit einer Vielzahl unterschiedlicher Blickwinkel und Dimensionen, die allesamt miteinander vernetzt sind. Gerade aufgrund dieser Komplexität bin ich nicht überrascht, dass es die „große universale Theorie“ von Poker noch nicht gibt.
Aus mathematischer Perspektive wirkt das Spiel vorhersehbar. Poker wird aber nicht von Maschinen, sondern von Menschen gespielt. Diese Theorie hat damit auch den Menschen selbst zum Thema, und Poker verstehen heißt den Menschen verstehen. Ein Spieler wird von unterbewussten Prozessen und Emotionen gelenkt, weshalb es gerade der „Faktor Mensch“ ist, der es so kompliziert macht.
Meine Stärke und Ambition lagen in der philosophischen Analyse des Spiels, und so habe ich mir die Frage gestellt: „Wie funktioniert Poker eigentlich?“ Dabei führten mich meine Antwortversuche immer wieder auf die fundamentalen Begriffe von Wahrheit und Wirklichkeit zurück, die in ihrer Bedeutung keinesfalls selbstverständlich sind.
Im Zuge meiner Arbeit in der Psychiatrie fand ich es darüber hinaus reizvoll, das Spiel von seiner „menschlichen“ Seite zu erkunden, und so stellte sich die emotionale wie leibliche Dimension des Pokerspielers als besonders bedeutsam heraus. Meine akademische Ausbildung kam mir insgesamt sehr zugute: Das philosophische Studium schulte mein analytisches Denken, und die Arbeit in der Psychiatrie sensibilisierte mich für die verborgenen Regungen des Menschen.
Der Text enthält zahlreiche Querverweise, die für ein Lesen von vorne nach hinten nicht berücksichtigt werden müssen. Von den Querverweisen weitestgehend ausgenommen ist mein Konzept der Poker-Antinomie aus Kapitel 2, weil es das Fundament meiner Theorie bildet.
Falls sich Experten verschiedener Disziplinen (zum Beispiel im Fach Psychologie, Philosophie oder Mathematik) mit meiner Theorie beschäftigen, und sich dadurch Anregungen ergeben, so stehe ich für einen Dialog gerne zur Verfügung. Besonders freue ich mich über Feedback von professionellen Poker-Spielern. Mögliche Ungereimtheiten können schließlich für eine Neu-Auflage des Buches mitberücksichtigt werden.
Mir ist es wichtig anzumerken, dass ich bin kein professioneller Poker-Spieler bin. Das Buch wird deshalb auch nur wenige Empfehlungen enthalten, wie man erfolgreich spielt. Für diesen Zweck gibt es kompetentere Autoren. Ich will stattdessen den Mechanismen nachspüren, nach denen Poker funktioniert. Mir ging es weniger darum zu sagen: „So bluffst du erfolgreich!“ Sondern ich habe mich vielmehr gefragt: Wann spreche ich eigentlich von einem Bluff? Wodurch erlange ich Macht über meine Gegenspieler? Was sind die Elemente einer Täuschung? Ist es überhaupt möglich, in Poker ehrlich zu sein?
Ich möchte hervorheben, dass die Ausgangslage des Buchs das Turnierspiel in der Pokervariante No-Limit Texas Hold-Em ist. Darüber hinaus habe ich meine Spielerfahrung nicht online, sondern im Casino gesammelt. Aus diesem Grund beschäftigt sich das Buch auch explizit mit „realem“ Pokerspiel, wo einem die Gegenspieler leibhaftig gegenübersitzen.
Aufgrund des Umfangs liegt meine Theorie in zwei Bänden vor. Der erste Band liefert gewissermaßen die Grundlagen, während ich mich im zweiten Teil der Aussagenlogik bediene, um die Spiel-Mechanik logisch zu rekonstruieren.
Die vorliegende Theorie ist das Resultat langen Nachdenkens und endlos scheinender Überarbeitungen. Es war für mich eine unvergleichliche Mammut-Aufgabe, sie zu einem würdigen Abschluss zu bringen. Ich habe mich durchweg bemüht, lesbar zu schreiben und gleichzeitig sprachlich präzise zu formulieren, denn es war mir ein großes Anliegen, verstanden zu werden. In diesem Sinne enthält die Neuauflage auch eine Vielzahl kleinerer sprachlicher Korrekturen, die zu einem noch besseren Verständnis beitragen sollen.
Aus ästhetischen Gründen und zur besseren Lesbarkeit wurde auf eine geschlechtergerechte Sprache verzichtet. Ich wünsche mir aber, dass sich alle Menschen gleichermaßen angesprochen fühlen, unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität.
Abschließend möchte ich festhalten, dass ich die Bürgerinitiative „Freies Pokerspiel in Österreich“ mit meiner Unterschrift unterstützt habe.
Wien, im November 2020
aktualisiert im August 2021
1 Eine Einführung
1.1 Die grundlegenden Spielregeln
Zum Verständnis meiner Theorie ist es notwendig, dass man weiß, wie Poker gespielt wird. Da ich mich im Buch auf die Spiel-Variante NO-LIMIT TEXAS HOLD’EM (NLTH) beziehe, sollen hier ihre Grundlagen vorgestellt werden. Wegen einer ausgeprägten Anglisierung des Pokerspiels entstammen viele Begriffe der englischen Sprache. Wer bereits mit dem Pokerspiel und seinen Begriffen vertraut ist, möge diesen Abschnitt ruhig überspringen bzw. überfliegen.
Grundsätzliches
Poker wird in der Regel mit bis zu 9 oder 10 Spielern an einem Tisch gespielt. Es gilt als Spiel „unvollständiger Information“, was daran liegt, dass man mit teilweise oder vollständig verdeckten Karten spielt.K12.3 In NLTH bekommt jeder Pokerspieler zu Beginn des Spiels zwei verdeckte Karten ausgeteilt, die sogenannten HOLE CARDS. Dabei wird mit einem französischen Deck aus 52 Karten gespielt, von denen die Spielfarben gleichwertig sind. Diese sind (in deutscher und englischer Sprache):
Pik /
s
pades
Herz /
h
earts
Karo /
d
iamonds
Kreuz /
c
lubs
Innerhalb einer Farbe sind die Karten nach Wertigkeit geordnet. Zuerst kommt 2 bis 9. Darauf folgen die sogenannten Broadway-Karten, also:
10 /
T
en
Bube /
J
ack
Dame /
Q
ueen
König /
K
ing
Ass /
A
ce (das Ass zählt auch als „1“ im Rahmen einer Straße)
Die fett gedruckten Buchstaben dienen zur verkürzten Schreibweise und bilden damit die Grundlage der POKER-NOMENKLATUR. Hierbei gibt man zuerst die Wertigkeit einer Karte und danach ihre Farbe an. Einen Pik-König schreibt man demnach etwa „Ks“. Der Buchstabe „s“ nimmt jedoch eine Sonderrolle ein, da er eine zusätzliche Bedeutung hat: Wird er nämlich zwei Karten nachgestellt, dann steht er auch für suited bzw. gleichfarbig. Die Alternative hierzu wäre „o“ für off-suit bzw. unterschiedlich farbig. Die Angabe einer Gleich- oder Unterschiedlichfarbigkeit ist bei Starthänden üblich, wie etwa bei „AKs“.
Texas Hold’em ist eine Spielvariante, bei der es neben den beiden Hole Cards, die am Anfang ausgeteilt werden, noch 5 Gemeinschaftskarten gibt, die offen in der Mitte des Tisches über mehrere Spielrunden aufgedeckt werden und die für alle Spieler gelten. Diese Karten nennt man auch das BOARD. Nicht alle Poker-Varianten haben zwangsläufig ein solches Board.
Darüber hinaus kann man Poker grundsätzlich auf 2 Arten spielen, nämlich entweder als Cash Game oder als Turnier. Bei einem TURNIER muss man sich zu Beginn „einkaufen“ (Buy-In), wofür man eine bestimmte Menge an „Spielgeld“ bekommt.K5.2 Seine Funktionsweise basiert auf dem „Freezeout“-System: Dabei gibt es Runden mit steigenden Einsätzen, im Zuge dessen der Reihe nach Spieler eliminiert werden, bis nur mehr ein Einzelner übrig ist.K5.7 Dadurch entsteht eine Rangliste, wobei der Preispool gestaffelt an die besten Spieler ausgezahlt wird. Beim CASH GAME hingegen entsprechen die Spiel-Jetons einem realen Geldwert, die Einsätze bleiben auf gleichem Niveau, und man kann kommen und gehen, wann man will.
Ein Spiel wird entweder gewonnen, indem alle Gegenspieler ihre Karten wegwerfen, oder wenn die eigenen Karten am Ende überlegen sind.K2.1 Treten 2 Spieler gegeneinander an oder sind überhaupt nur mehr 2 Spieler in einem Turnier, so findet ein HEADS-UP statt. Wenn nur mehr 10 Spieler in einem Turnier übrig sind, nehmen diese meist an einem Finaltisch, dem FINAL TABLE, Platz.
Die Poker-Hand
Eine POKER-HAND besteht immer aus genau fünf Karten, nicht mehr und nicht weniger. Ist sie mit weniger als fünf bereits „fertig“, etwa bei einem Paar, dann wird mit den nächstbesten Karten auf fünf aufgefüllt. Haben zwei oder mehr Spieler die gleiche Hand, entscheiden ebenfalls diese „zusätzlichen“ Karten über den Sieger. In einem solchen Fall bezeichnet man die nächstbeste Karte auch als KICKER. In aufsteigender Reihenfolge lauten die Hände wie folgt:
Höchste Karte
engl. High Card
Ein Paar
engl. One Pair
Zwei Paar
engl. Two Pair
Drilling
engl. Three Of A Kind bzw. Trips
Straße
engl. Straight
Flush
(ausgesprochen //, ähnlich wie „Flasche“, bitte
nicht
„Flesch“ sagen)
Full House
engl. auch Boat
Vierling/Poker
engl. Four Of A Kind bzw. Quads
Straight Flush
Gehen wir diese Hände der Reihe nach durch und beginnen wir mit dem Paar: Hier hat man zwei Karten derselben Wertigkeit – wobei man auch von einem Pocket Pair spricht, wenn man zwei gleiche Hole Cards hat. Analog dazu liegen bei einem Drilling drei Karten vor, die gleich viel wert sind. Besitzt man ein Pocket Pair, und macht damit einen Drilling, dann hat man ein Set.
Bei einer Straße handelt es sich um fünf Karten, die nach Wertigkeit geordnet sind (wobei das Ass auch als „1“ gilt), bei einem Flush hingegen um fünf Karten in einer Spielfarbe. Ab der Straße gibt es jetzt auch keine Kicker mehr, weil eine Hand nicht aus mehr als fünf Karten bestehen kann.
Bei einem Full House haben wir einen Drilling mit einem Paar, wobei der Drilling zuerst gerechnet wird. Nehmen wir als Beispiel drei Könige mit zwei Buben her, so würde man auf Englisch „Kings Full“ als Kurzform von „Kings Full of Jacks“ sagen.
Ein Vierling sollte recht selbsterklärend sein: Dabei handelt es sich um vier Karten derselben Wertigkeit. Geschlagen wird diese Hand nur mehr von einem Straight Flush, d.h. einer Straße in einer bestimmten Farbe. Das Royal Flush ist eine Sonderform hiervon, weil es ein Ass an der Spitze hat, und es ist die beste wie auch seltenste Hand im Pokerspiel. Will man hingegen über die beste Hand sprechen, die mit einem bestimmten Board möglich ist, so sagt man auch NUTS dazu.
Man spricht jetzt von einem DRAW, wenn eine oder zwei Karten auf eine Hand fehlen, wie etwa mit vier Karten einer Farbe bei einem Flush Draw. Bei einem Inside Straight Draw fehlt eine Karte in der Mitte der Straße, im Englischen spricht man hier auch von einem Gutshot Draw (engl. für „Bauchschuss“). Hat man stattdessen vier Karten hintereinander und es fehlt nur mehr eine Karte am Rand, dann liegt ein Open-Ended Straight Draw vor. Schließlich sagt man auch, jemand ist Drawing Dead, wenn die Hand trotz Vervollständigung nicht mehr gewinnen würde.
Der Tischaufbau
Der Ausgangspunkt jedes Pokerspiels ist der sogenannte „Dealer Button“ bzw. kurz BUTTON (B), der ganz zu Beginn einem zufälligen Spieler zugewiesen wird. Es handelt sich dabei um einen weißen Knopf, der jede Hand im Uhrzeigersinn weitergereicht wird. Seine Aufgabe ist es, den letzten Spieler festzulegen, der in einer Setzrunde an der Reihe ist. Sollte es keinen unabhängigen Dealer geben, dann legt der Button den Spieler fest, der die Karten auszuteilen hat.
Das Spiel nimmt seinen Anfang, indem der Dealer jedem Spieler zwei Karten austeilt und dadurch die erste Setzrunde eröffnet. In NLTH geht ein Spiel immer über VIER SETZRUNDEN, wobei grundsätzlich der Spieler links vom Button als Erster an der Reihe ist. Genauso wie der Button im Uhrzeigersinn weitergereicht wird, kommen sämtliche Spieler gleichfalls im Uhrzeigersinn an die Reihe. Die Grafik (Abb. 1.1) beschreibt die erste Setzrunde, wobei wir beispielhaft auf Position „1“ sitzen und der Button auf „4“ liegt.
Zu Beginn des Spiels gibt es nun die Besonderheit, dass die ersten beiden Spieler einen Fixeinsatz leisten müssen. Der Fixeinsatz des ersten Spielers auf Position „5“ gilt dabei nur zur Hälfte und heißt dementsprechend SMALL BLIND (SB). Den ganzen Fixeinsatz bzw. BIG BLIND (BB) leistet stattdessen der zweite Spieler auf Position „6“. Im Cash Game können der SB und BB überdies gleich groß sein – wie etwa an einem 1€/1€ Tisch im Gegensatz zu einem 1€/2€ Tisch.
Im Cash Game sind die Blinds konstant. In einem Turnier hingegen werden sie kontinuierlich angehoben, um Druck auf die Spieler zu erzeugen. Dementsprechend gibt es im zeitlichen Verlauf eines Turniers auch unterschiedlich hohe Blind-Levels, die in gleichmäßigen Intervallen angehoben werden. Beim Start eines Turniers liegen diese beispielsweise bei 50/100, ein paar Stunden später bei 3000/6000.
Auf diese Weise werden die ersten beiden Spieler einer Hand zunächst übergangen; und so geht die allererste Spielentscheidung in Wirklichkeit vom Spieler links des BBs aus, dessen Position man under the gun (UTG) nennt. Der vorletzte Spieler rechts neben dem Button wird schließlich als Cutoff (CO) bezeichnet.
Ab einem gewissen Zeitpunkt kommt im Turnier ein zusätzlicher Einsatz hinzu, das sogenannte ANTE: Dabei handelt es sich um ein Zehntel des BBs, das von jedem Spieler vor dem Austeilen der Karten eingesammelt wird. Ein neuer Trend besteht darin, anstatt dieser einzelnen Antes einen zusätzlichen BUTTON ANTE oder BIG BLIND ANTE einzuführen. In diesem Fall wird es nur von einem einzigen Spieler pro Spiel geleistet – quasi „alles auf einmal“. Hierdurch soll es zu einer Zeitersparnis des Dealers kommen.
Abb. 1.1 Aufbau eines Pokertisches
Die Spielrunde
Sehen wir uns jetzt an, welche Handlungen in einem Spiel möglich sind. Wie bereits erwähnt, müssen die ersten beiden Spieler einen Einsatz leisten – ob sie wollen oder nicht. Ein Wetteinsatz bzw. ein Setzen von Chips heißt im englischen Sprachgebrauch BET. Auf einen Einsatz kann man nun auf drei verschiedene Arten reagieren: nämlich mit einem FOLD, einem CALL oder einem RAISE.
Die erste Möglichkeit des Folds besteht darin, die eigenen Karten wegzuwerfen und in diesem Sinne zu folden. Will man sich stattdessen am Spiel beteiligen, dann muss man mindestens die Höhe des letzten Einsatzes leisten. Geht man lediglich mit dem letzten Spieler „mit“, indem man seinen Einsatz bezahlt, dann callt man. Alternativ dazu hat man aber die Möglichkeit, zu erhöhen bzw. zu raisen – wobei ein Raise mindestens die Höhe des doppelten BBs betragen muss.
Am Ende der ersten Runde kommen noch einmal die Spieler in den Blinds an die Reihe, wobei der Spieler im Big Blind jetzt auch checken kann. Bei einem CHECK entscheidet man sich dafür, die Aktion an den nächsten Spieler weiterzugeben, wenn die Spielteilnahme keinen Wetteinsatz erforderlich macht.
Eine Runde muss aber nicht zwangsläufig mit den Blinds ein Ende finden. Sobald nämlich irgendjemand raist, wird jedem bereits involvierten Spieler nochmals die Möglichkeit geboten, eine Aktion auszuführen. Jede Bet und jedes Raise verlangen immer nach einer Antwort. Eine Runde ist erst dann beendet, wenn alle Spieler die Möglichkeit hatten, auf ihre Gegenspieler zu antworten.
Reagiert man auf ein fremdes Raise mit einem eigenen, so spricht man für gewöhnlich von einem RE-RAISE. In einem no-limit Spiel kann der eigene Einsatz grundsätzlich von unbegrenzter Höhe sein, mit dem ALL-IN als das Maximum. Demgegenüber gäbe es auch fixed-limit Spiele, bei denen man nur in begrenzter Höhe setzen oder erhöhen darf. Heute haben sich no-limit Varianten jedoch weitestgehend durchgesetzt.
Eine Spielentscheidung kann entweder verbal angekündigt werden, oder man stellt stattdessen die entsprechenden Chips nach vorne. In den meisten Spielstätten darf man seine Entscheidung jedoch nicht korrigieren oder ergänzen. In Filmen hört man etwa häufig die Floskel: „I’ll see you and raise you.“ Ins Deutsche übersetzt: „Ich gehe mit und erhöhe.“ Ein solches als String-Bet bezeichnetes Spiel-Manöver ist so gut wie überall untersagt.
Die Gemeinschaftskarten
Wie vorhin angemerkt, geht ein NLTH Spiel über vier Setzrunden. Diese heißen wie folgt:
PRE
-
FLOP
F
LOP
T
URN
R
IVER
Die erste Setzrunde verdankt ihren Namen dem Umstand, dass sie „vor dem Flop“ stattfindet. Dieser kommt in der zweiten Runde zu liegen und bezeichnet drei Gemeinschaftskarten, die offen in der Mitte des Tisches aufgedeckt werden. Da eine Poker-Hand aus genau fünf Karten besteht, hat hier jeder Spieler erstmals eine vollständige Hand.
Die zweite Setzrunde beginnt mit dem vormaligen SB (Small Blind), der jetzt die Möglichkeit hat zu checken oder zu setzen. Darauf folgen zwei weitere Setzrunden durch das Aufdecken von jeweils einer weiteren Gemeinschaftskarte, dem Turn (engl. „4th street“) und River (engl. „5th street“).
Das Spiel wird nun auf eine von zwei Arten beendet: Im ersten Fall folden alle Spieler bis auf einen einzigen, sodass der letzte im Spiel befindliche Spieler gewinnt. Alternativ dazu kann aber auch die vierte Setzrunde beendet werden, woraufhin der Dealer zum Aufdecken der Karten auffordert. Es handelt sich dabei um den SHOWDOWN, bei dem der Spieler mit der besten Hand gewinnt. Das bedeutet allerdings nicht, dass man seine Karten auch tatsächlich herzeigen muss. Hier hängt es ganz vom Regelwerk der Spielstätte ab, wann man dazu verpflichtet ist und wann nicht.
Abb. 1.2 Beispiel für einen Showdown
Die Grafik (Abb.1.2) stellt einen Showdown dar, bei dem die letzten drei Spieler ihre Karten aufgedeckt haben. Der Preis für den Sieger ist schließlich der POT, d.h. der gesammelte „Topf“ aller bisher gewetteten Chips. Ein solcher Pot kommt dadurch zustande, dass alle am Ende einer Runde gewetteten Chips zusammengetragen werden. Er ist die Belohnung für den Spieler mit der besten Hand – oder eben für den letzten Teilnehmer im Spiel, wenn alle anderen ihre Karten ablegen. Haben mehrere Spieler eine gleich gute Hand, dann wird der Pot geteilt und es kommt zu einem SPLIT-POT.
Legt man es darauf an, dass alle anderen Spieler ihre Karten wegwerfen, so will man im Grunde von einem BLUFF profitieren: Darunter versteht man grob eine Lüge, im Rahmen derer man Stärke vortäuscht, wenn man in Wirklichkeit eine unterlegene Hand hat.K13.6 Ein SEMI-BLUFF hingegen bezeichnet meist eine Bet auf einen Draw – das heißt auf eine „unfertige“ Hand, die durch eine statistische Gewinnwahrscheinlichkeit abgesichert ist.K8.8
Abschließend soll hier der Begriff des POKER-TELLS erwähnt werden. Darunter versteht man für gewöhnlich die körperlichen Regungen eines Pokerspielers, die seine Täuschungsabsicht sabotieren. Poker-Tells haben jedoch verschiedene Dimensionen,K9.3 und ihre Funktion ist keinesfalls selbstverständlich, weshalb ich noch viele Male auf sie zu sprechen kommen werde.
Spielen nach Statistik
Sobald man durch die Karten gewinnen will, muss man sich mit Zahlen und Statistik beschäftigen. Heutzutage versteht man darunter eine nach Spieltheorie optimierte Spielweise. Das dafür gebräuchliche Akronym GTO leitet sich von der englischen Formulierung „game theory optimal“ ab.K11.2
Zwei der wichtigsten Begriffe im statistischen Verständnis von Poker sind Outs und Pot Odds. Unter OUTS versteht man die Anzahl verdeckter Karten im gesamten Deck, die in der Lage sind, die eigene Hand zu verbessern. Nehmen wir etwa an, wir haben vier Karten mit der Spielfarbe Herz und es fehlt nur mehr eine einzige Herz-Karte auf ein Flush. In diesem Fall haben wir 9 Outs auf ein Flush – denn es gibt genau 13 Herz-Karten im gesamten Deck, von denen wir 4 bereits kennen, weil wir sie besitzen.
Die POT ODDS sind ein Verhältnis, das zum Ausdruck bringt, wie viele Chips beim Call einer Bet für eine bestimmte Potgröße riskiert werden müssen. Setzt der Gegenspieler etwa 500 und ist der zu gewinnende Pot 3000 Chips groß, dann betragen meine Pot Odds 1:6. Sie gelten dann als günstig, wenn ihr prozentmäßiges Verhältnis kleiner als die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns ist. Gehe ich beispielsweise von einer 20%igen Gewinnwahrscheinlichkeit aus, und meine Pot Odds sind 1:6, dann ist ein Call aus statistischer Sicht gerechtfertigt. Wir müssen ja bloß 1:6 des Pots riskieren, während wir ihn in 1:5 der Fälle gewinnen. Wir verlassen uns hier auf ein Pokerspiel, das „auf lange Sicht“ einen Gewinn verspricht,K5.8 und betrachten die vereinzelte Hand in einem größeren Kontext.K5.10
Davon lässt sich jetzt die POT EQUITY eines Spielers ableiten: Hierbei steht die Gewinnwahrscheinlichkeit einer Hand für den prozentmäßigen Anteil am Pot, der einem aus statistischer Sicht zustehen würde.K8.8 Sie beschreibt also den errechneten „Wert“ einer Hand in Abhängigkeit von der Potgröße und der Stärke der eigenen Hand. Habe ich etwa eine 20%ige Chance, einen Pot mit 3000 Chips zu gewinnen, dann beträgt meine Pot Equity 600 Chips.
Die FOLD EQUITY wertet die Pot Equity auf, indem sie eine Wahrscheinlichkeit für den Fold des Gegenspielers annimmt.K8.8 Sie trägt damit dem Umstand Rechnung, dass man eine Hand auch kampflos gewinnen kann. Von der (Pot) Equity muss man den ERWARTUNGSWERT bzw. Expected Value (EV) unterscheiden, der das Ergebnis einer konkreten Spielentscheidung angibt und auch negativ sein kann.K9.4 Calle ich demnach mit ungünstigen Pot Odds, dann ist mir auf lange Sicht ein Verlust garantiert.
Will ich über den Chipstapel eines Spielers sprechen, dann beziehe ich mich auf seinen CHIP STACK. Je nachdem, ob dieser groß oder klein ist, handelt es sich um einen BIG bzw. SMALL STACK. Den Spieler mit den meisten Chips nennt man CHIPLEADER.
1.2 Poker aus philosophischer Sicht
Poker ist für mich vieles, unter anderem jedoch:
ein Spiel der Täuschung und der Lüge,
des Intellekts und der Courage,
von Unwissen und Unwahrheit,
ein Kartenspiel wie auch ein Wettkampf-Spiel,
ein Spiel von Macht und Unterwerfung,
von Zwang und Bedrängnis,
des Bewussten und des Unterbewussten,
sowie der Kränkung und der Selbstsabotage.
Im Aufzeigen dieser Vielgestaltigkeit möglicher Perspektiven möchte ich die Schwierigkeit andeuten, die damit verbunden ist, wenn man der Funktionsweise von Poker nachspüren will. Doch nicht nur das: Das Spiel scheint überhaupt von Widersprüchen durchwachsen zu sein, die eine eindeutige Antwort zusätzlich erschweren.
Die traditionelle Betrachtung des Spiels ist an eindeutigen und objektiven Fakten interessiert, die sie auf rational-logische Weise analysiert.K5.13 Hierfür legt man eine Gewinnwahrscheinlichkeit fest, wiegt die Ausgänge verschiedener Spielentscheidungen anhand ihres „Erwartungswerts“ ab,K8.8 und fällt am Ende eine Entscheidung, die unabhängig von ihren Konsequenzen „richtig“ ist.K3.5 Solange man den Karten vertraut, ist es immer möglich, für die eindeutige Richtigkeit einer Spielentscheidung zu argumentieren.
Was ist aber, wenn man die Spielsituation nicht bloß als Informationsquelle für statistische Analysen heranzieht, sondern sie stattdessen als Begegnung begreift? Treten wir durch unser Handeln denn nicht in einen persönlichen Kontakt mit unserem Gegenspieler?K22.6 Und treffen wir nicht auch gefühlsmäßige Entscheidungen, die einer herkömmlichen Objektivität entbehren?K11.1
Wie kann man überhaupt objektive Entscheidungen treffen, wenn es jederzeit möglich ist, belogen zu werden?K12.11 In der Möglichkeit der Täuschung verliert die Wirklichkeit an Eindeutigkeit.K12.2 Auf einmal steht die Bet eines Spielers nicht mehr für die Karten, die er hat, sondern stattdessen für das Ausmaß seines Begehrens.K11.7 Wie soll man einer solchen Wirklichkeit jetzt aber noch Glauben schenken können?
Die Gegenstände der Wirklichkeit müssen nicht einmal eine gesicherte Existenz haben:K6.6 So kann man etwa argumentieren, dass Poker-Tells erst dann existieren, wenn man sie bewusst wahrnimmt.K9.3 Oder nehmen wir die Annahme der eigenen Karten-Überlegenheit her: Kann man eine solche Überlegenheit denn behaupten, solange es gar nicht zum Showdown kommt?K21.2 Müssten die Karten dann nicht überhaupt bedeutungslos sein?K21.10 Die Karten lassen eine unhintergehbare Objektivität im Pokerspiel vermuten – doch ist eine solche Annahme höchst problematisch.K26.1
Die Emotion muss natürlich „irrational“ sein, solange man sie von einem rational-logischen Standpunkt aus betrachtet;K6.3 und so ist es auch nicht unbedingt falsch, sich vor derart unlogischen Einflüssen von außen in Acht zu nehmen. Die Karten verlangen in ihrer rationalen Natur danach, sich gegenüber den eigenen emotionalen Regungen taub zu stellen.K12.7 Doch läuft man damit Gefahr, die gefühlsmäßige Dimension gänzlich aus dem Spiel zu verbannen.
Braucht es denn nicht das Gefühl, um erfolgreich Poker spielen zu können? Ist es denn nicht notwendig, sich in den Anderen hineinzufühlen, um eine richtige Entscheidung treffen zu können? Ist es nicht die urmenschliche Angst, die uns am Bluff hindert?K24.3 Und braucht es nicht Selbstbewusstsein, um sich dem Gegenspieler in den Weg zu stellen?K12.7 Scheint es nicht Mechanismen im Spiel zu geben, die nicht notwendigerweise in den Karten begründet sind?
Angelehnt an den französischen Philosophen Merleau-Ponty werde ich beschreiben, wie man als Pokerspieler immer schon eine „leibliche Existenz“ hat.K4.3 Wie bedeutsam die Leibhaftigkeit eines Spielers letzten Endes ist, wird im Online Poker besonders auffällig, wo jeder Gegenspieler genauso gut ein Bot sein könnte.1 Auf diese Weise ist nicht nur der Verstand, sondern auch das Gefühl eines Spielers für den Ausgang eines Spiels entscheidend – und das Wissen muss sich bisweilen der Intuition unterordnen.K11.1
Eine große Leistung meiner Theorie liegt darin, genau diesen Gegensatz zwischen einem Spiel nach Karten und einem solchen nach Bluff herauszuarbeiten. In den meisten Büchern wird nur unscharf zwischen diesen beiden Seiten getrennt, und beinahe überall werden sie auf die eine oder andere Weise miteinander vermischt. In der Gegenüberstellung der beiden Hälften ist aber ein bedeutsamer Widerspruch angelegt, den man nicht einfach so übergehen kann.
Wir haben es hier mit einem fundamentalen Zwiespalt zu tun, den ich auch als POKER-ANTINOMIE bezeichne. Unter einer Antinomie versteht man einen Widerspruch zwischen zwei Aussagen, die sich beide gleich gut begründen lassen. Irgendwie scheinen beide Seiten Recht zu haben, doch kann die eine Seite nur dann Recht haben, wenn die andere Unrecht hat.
Den beiden Seiten der Poker-Antinomie entsprechen schließlich zwei Spieler-Mentalitäten: die ANALYTISCHE und die AGGRESSIVE. Die analytische Mentalität steht für die rational-logische „Analyse“ des Spiels und will mit den besseren Karten gewinnenK6.7 – wohingegen eine „aggressive“ Spielweise den Bluff als spielentscheidend betrachtet und mit den schlechteren Karten gewinnen will.K8.9 Insgesamt ist die erste Hälfte stellvertretend für ein Spiel nach Karten, das sich den Zufall zum Verbündeten nimmt; während die zweite Hälfte die Schwächen seiner Gegenspieler ausnutzen und von der Anwendung der Lüge profitieren will.
Ein jeder Versuch, die Antinomie auf eine der zwei Seiten aufzulösen, muss unweigerlich zu einem Konflikt in der eigenen Spielstrategie führen, da die Funktionsweise von Poker auf beide Hälften angewiesen ist. Später werde ich etwa aufzeigen, wie der Bluff aufhört, überhaupt Bluff zu sein, wenn man versucht, ihn zu mathematisieren: Der ursprüngliche Widerspruch wird bloß weitergetragen, und der Bluff wird von seinem eigentlichen Wesen „entfremdet“.K8.8 Die große Herausforderung eines Pokerspielers besteht deshalb darin, die beiden Seiten der Poker-Antinomie miteinander zu versöhnen, ohne der Gegenseite ihre Geltung abzusprechen.
Die beiden Hälften der Poker-Antinomie sind jetzt Prototypen für zwei Spieler-Typen: den ANALYTISCHEN und den AGGRESSIVEN SPIELER. Diese resultieren aus dem Versuch, die Antinomie auf eine der beiden Seiten aufzulösen, indem man die Gegenseite leugnet. So will ein analytischer Spieler etwa die Profitabilität des Bluffs nicht wahrhaben, weshalb er dazu tendiert, seine bluffenden Gegenspieler für „unschuldig“ zu halten.K7.1 Darüber hinaus machen ihn die Verlockungen der Karten überhaupt des Bluffs unfähig.K8.1
Pokerspieler, die es gewohnt sind, nach Karten zu spielen, haben für mich zwei große Sehnsüchte – und zwar nach der RATIONALITÄT DER LOGIK auf der einen Seite und der EINDEUTIGKEIT DES OBJEKTIVEN auf der anderen. Wie eben illustriert folgt der Bluff aber keiner verstandesmäßigen Logik, und seine Entscheidungsgrundlage muss auch nicht objektiv sein. Damit steht das traditionelle Theorie-Gebäude von Poker immer schon auf einem sehr wackligen Fundament.
Das erste Buch bildet den Zwiespalt zwischen einer theoretischen und einer pragmatischen Spielweise ab,K5.14 wonach man entweder mathematischen oder psychologischen Gesetzen gehorchen kann.K4.6 Ich werde mich mit der Wahrheit und Wirklichkeit eines Pokerspielers auseinandersetzen, sodass die LÜGE eine prominente Rolle einnehmen wird.K12.1 Die Poker-Antinomie wird uns durch die ganze Theorie hinweg begleiten, und so werde ich sie immer wieder in einer neuen Formulierung vorstellen. Im Anhang findet sich eine Übersicht über sämtliche Formeln der Poker-Antinomie, die im ersten Buch enthalten sind.ApA
Das zweite Buch wird sich schließlich eine gewaltige Aufgabe vornehmen: nämlich eine logische Rekonstruktion des Spiels. Neben der Poker-Antinomie liegt darin die zweite große Leistung meiner Theorie. Hierfür werde ich zunächst die Zeit in die räumliche Wirklichkeit integrieren und ein eigenes Logik-Kalkül entwickeln, das nach den Regeln der Aussagenlogik funktioniert.K15
Daran anschließend werde ich die Funktionsweise des analytischen und aggressiven Pokerspiels logisch nachzeichnen. Zwei zentrale Begriffe werden die OHNMACHT und die MACHT sein: Eine grobe Definition der Ohnmacht lautet dahingehend, die besseren Karten zu brauchen, um zu gewinnen; während die Macht die Befähigung zum Ausdruck bringt, den Gegenspieler zum Fold bewegen zu können.K19.1
1 Bot: ein Gegenspieler, der durch ein Computer-Programm simuliert wird
2 Die Poker-Antinomie
2.1 Vorstellung der Poker-Antinomie
In Poker hat man Chips und Karten, sowie die Wahl, auf die eigene Hand zu setzen. Eine Spielentscheidung hat dabei die Form einer WETTE– und wie bei jeder anderen Wette auch, überlegt man als Spieler, ob sie sich denn lohnt.K18.3 Aus diesem Grund ist der erste Zugang zum Spiel für gewöhnlich ein zahlenmäßiger: In ihrer vermeintlichen Objektivität geben die Karten Sicherheit, indem sie jeden Zweifel abschmettern,K26.1 und in der Annahme einer eindeutigen Gewinnwahrscheinlichkeit wird das statistische Risiko zum wichtigsten Kriterium.K9.4
In einem solchen Verständnis von Poker nimmt die Lüge ihren Ausgangspunkt von der objektiven Realität der Karten. Indem die Karten im Showdown über Sieg und Niederlage urteilen sollen, wird ihnen ein Vorrang vor der Täuschung eingeräumt. Sie scheinen die stärkste Kraft zu haben, weil sie das letzte Wort haben. So könne zwar jeder Spieler durchaus behaupten, was er will – spätestens im Showdown müsse sich jedoch immer die Wahrheit offenbaren.
So sehr Letzteres auch stimmen mag, bleibt doch das Problem bestehen, dass die Hole Cards aller Spieler bis zuletzt verdeckt sind. Sie können sogar bedeutungslos werden, wenn sie gar nicht aufgedeckt werden.K21.10 Anstatt darin aber eine Quelle der Unwahrheit zu sehen, gilt die Verdecktheit der Karten bloß als Ausdruck eines Unwissens; und so wird Poker als ein Spiel „unvollständiger Information“ aufgefasst.K12.3
Im Festhalten an der unhintergehbaren Wahrheit einer objektiven Wirklichkeit liegt durchaus eine gewisse „Naivität“:K12.10 Stimmt es denn, dass man entweder lügt oder die Wahrheit sagt? Kann denn nicht jede Spielentscheidung immer schon gelogen sein? Ist es überhaupt möglich, im Pokerspiel wirklich „ehrlich“ zu sein?K13.3 Kann man sich womöglich sogar selbst belügen?K26.9
Das große Problem eines Pokerspiels nach Karten besteht darin, dass man eine Hand auch ohne Herzeigen der eigenen Karten gewinnen kann, wenn sämtliche Gegenspieler vorher die ihren wegwerfen. Dieser Satz mag auf den ersten Blick recht trivial klingen – dabei hat er ungeheuer weitreichende Implikationen, die weniger trivial nicht sein könnten.
Sobald man auch mit verdeckten Karten gewinnen kann, ist es nicht mehr offensichtlich, was wirklich und was wahr ist.K12.6 Wie kann man denn noch auf ein statistisches Risiko vertrauen, wenn man den eigenen Karten gar nicht mehr glauben darf? Hier haben wir es mit der Anwendung des Bluffs zu tun, wo wir auf eine unterlegene Hand setzen, damit der Gegenspieler foldet.
Letztlich gibt es zwei Möglichkeiten, den Ausgang eines Pokerspiels für sich zu entscheiden: und zwar entweder mithilfe der besseren Karten, oder im Zuge eines erfolgreichen Bluffs.
Gleichzeitig scheinen sich diese beiden Alternativen aber gegenseitig zu behindern. Wo man nämlich mit den besseren Karten gewinnen will, darf der Gegenspieler seine Karten nicht wegwerfen. Und wo man seinen Gegenspieler bluffen möchte, darf man nicht auf die Karten hören.
Die Funktionsweise von Poker beruht auf einem Zwiespalt, wonach die Karten und der Bluff zwar gleichermaßen spielentscheidend sind, die beiden Möglichkeiten sich aber gegenseitig behindern. Entweder man glaubt, mit den Karten den Bluff schlagen zu können – oder umgekehrt. Wer für die eine Seite argumentieren will, scheint die andere verneinen zu müssen.
Hier haben wir es mit einer ANTINOMIE zu tun. Darunter versteht man einen Widerspruch zwischen zwei Aussagen, die sich beide gleich gut begründen lassen. Man kann demnach sowohl für die Karten, als auch für den Bluff stichhaltige Argumente vorbringen – der Bluff gewinnt aber gerade dadurch, dass die besseren Karten verlieren; genauso wie die Karten sich nur dann durchsetzen können, wenn der fremde Bluff scheitert. Beide Seiten haben durchaus ihre Richtigkeit, doch sind sie schlichtweg nicht miteinander verträglich.
Der Zwiespalt zwischen den Karten und dem Bluff ist das Fundament meiner Theorie, und ich bezeichne ihn auch als POKER-ANTINOMIE. In ihrer ursprünglichen Formulierung stellt sich diese wie folgt dar:
Die ursprüngliche Formulierung der Poker-Antinomie
STANDARD-FORMEL
analytisch: Die besseren Karten entscheiden das Spiel.
aggressiv: Der Bluff entscheidet das Spiel.
Hierbei handelt es sich um die „Standard-Formel“, weil sie den Konflikt eines Pokerspielers in seiner natürlichsten Form aufzeigt. Je nach Perspektive begegnet uns dieser Gegensatz aber in diversen Teil-Aspekten des Spiels wieder, sodass ich die Antinomie öfter neu formulieren werde. Zur Übersicht und zum besseren Vergleich habe ich sämtliche im ersten Buch von mir vorgeschlagenen Antinomien im Anhang zusammengetragen.ApA
Die beiden Seiten der Antinomie haben bei mir eine Entsprechung in zwei unterschiedlichen Spieler-Mentalitäten, die ich als ANALYTISCH oder AGGRESSIV bezeichne. Die analytische Spielweise erhält ihren Namen von der rational-logischen „Analyse“ des Spiels.K6.7
Muss man denn jetzt mit diesem Widerspruch leben? Hier sind wir zunächst Opfer unserer eigenen menschlichen Natur, weil wir uns grundsätzlich schwer damit tun, widersprüchliche Gedanken auszuhalten. Überall dort, wo wir es mit Widersprüchen in unserem Denken zu tun haben, wollen wir sie möglichst rasch und unkompliziert wieder loswerden.
Dies gelingt uns am einfachsten über die Elimination der Gegenseite. Wo zwei Annahmen miteinander im Konflikt stehen, müsse eine davon ganz einfach falsch sein. Auf den ersten Blick hört sich das gar nicht so schlecht an, und die Elimination mag oftmals eine zielführende Denkstrategie sein – für ein Verständnis des Pokerspiels ist sie jedoch verheerend.
2.2 Die Antinomie in ihrer Auflösung
Wir sind von Natur aus dazu veranlagt, die Poker-Antinomie auf eine ihrer beiden Seiten aufzulösen.K2.1 Eine folgenreiche Konsequenz davon ist die folgende: Wenn ausschließlich die Karten das Spiel gewinnen sollen, dann darf der Bluff nicht profitabel sein; und wenn der Gewinn ausschließlich vom Erfolg des Bluffs abhängen soll, dann dürfen die Karten keine Rolle spielen. Die Auflösung der Antinomie auf eine der beiden Seiten scheint zunächst in der Lage zu sein, ihren Widerspruch zu beseitigen – doch führt die Elimination der Gegenseite stattdessen zu unlösbaren Konflikten.
Unser Problem liegt ja darin, dass beide Hälften der Antinomie Recht haben. Anstatt deshalb die vermeintlich „falsche“ Seite loszuwerden, kommt es bloß zu einer LEUGNUNG. Im Versuch, den Widerspruch der Poker-Antinomie aufzulösen, blenden wir aus, was wir nicht sehen wollen.
Die Funktionsweise des Pokerspiels ist aber auf beide Hälften der Antinomie angewiesen; und eine Sache verschwindet nicht automatisch, nur weil wir sie nicht wahrhaben wollen. Die Widersprüchlichkeit der Poker-Antinomie wird stattdessen weitergetragen, indem sie zu Konflikten in der eigenen Spielstrategie führt.
Je nachdem, ob man die Antinomie auf die Seite der Karten oder des Bluffs auflösen will, kommt es jetzt zu einem von zwei Spieler-Typen. Es handelt sich dabei um den ANALYTISCHEN und den AGGRESSIVEN SPIELER. Diese beiden Typen sind das Ergebnis einer einseitigen Auflösung der Poker-Antinomie, sodass ihre Spielweise von unlösbaren Konflikten geprägt ist. Die Grafik (Abb. 2.1) stellt die beiden Typen gegenüber.
Abb. 2.1 Die Poker-Antinomie in ihrer einseitigen Auflösung
Der analytische Spieler
Sehen wir uns zunächst den analytischen Spieler genauer an. Hier finden wir DAVID SKLANSKYs Position wieder, der in seinem berühmten Buch The Theory of Poker schreibt: „Es ist wahr, dass das Bluffen einen wichtigen Aspekt des Pokerspiels darstellt. Es handelt sich aber nur um einen Teil des Spiels, der gewiss nicht wichtiger ist, als seine zulässigen Hände auf richtige Weise zu spielen.“2 Der Bluff wird hier den Karten untergeordnet, und die Antinomie wird zur ersten Seite hin aufgelöst.
Hat ein analytischer Spieler jetzt aber keinen Erfolg, so bringt ihn das in einen Erklärungsnotstand. Er denkt sich: „Hier sitze ich nun und spiele nur meine zulässigen Hände – doch scheinen meine Gegenspieler ständig die besseren Karten zu haben. Mache ich denn irgendetwas falsch?“ Um den eigenen Verzicht auf den Bluff rechtfertigen zu können, und um gleichzeitig nicht zugeben zu müssen, gegen fremde Bluffs zu verlieren, wird die LEUGNUNG DER PROFITABILITÄT DES BLUFFS zur obersten Priorität.
Wie ich später noch zeigen werde, dient diese hartnäckige Leugnung zu einem großen Teil zum Schutz des eigenen Egos; und so wird das gegnerische „Glück“ herangezogen, um sich nicht die eigene Unfähigkeit eingestehen zu müssen.K7.2
Der aggressive Spieler
Ich räume der aggressiven Spielweise grundsätzlich einen Vorrang gegenüber der analytischen ein. Das liegt zuallererst daran, dass die Täuschung im Pokerspiel für mich unhintergehbar ist. Man kann schlicht und einfach nicht Poker spielen, ohne zu täuschenK13.1 Oder anders ausgedrückt: Man kann sich dem Einfluss der Täuschung nicht entziehen. Darüber hinaus ist der Bluff aber auch in der Lage, den Karten als urteilende Instanz zuvorzukommen: Solange es nicht zum Showdown kommt, spielen die Karten keine Rolle.K21.10 Sie mögen zwar das letzte Wort haben – das gilt aber nur, wenn sie vorher nicht mundtot gemacht werden.
Der Versuch des analytischen Spielers, Poker als ein Spiel „unvollständiger Information“ zu begreifen,K12.3 gerät schließlich mit meiner These in Konflikt, dass es überhaupt unmöglich sein müsste, im Pokerspiel „ehrlich“ zu sein.K13.3 Demnach kann man auch ein Lügner sein, ohne eine Täuschungsabsicht zu haben.
Der analytische Spieler hat unterschiedliche Strategien, die Lüge im Pokerspiel zu erklären und anzuwenden. Meist läuft es dabei auf eine gewisse „Mathematisierung“ hinaus, wonach man etwa in einer bestimmten Frequenz bluffen sollte. Hier vertrete ich die These, dass eine solchermaßen theoretische Vereinnahmung des Bluffs ihn von seinem eigentlichen Wesen entfremdet: Der Bluff hört quasi auf, überhaupt Bluff zu sein.K8.8 Man möchte ihn zwar „Bluff“ nennen, doch ist er im Grunde gar keiner mehr.
Der aggressive Spieler hat das Problem, dass er nicht weiß, wie er den Verzicht auf einen Bluff begründen soll: Zum einen kann man nie mit Sicherheit sagen, ob ein Bluff nicht doch funktioniert hätte, solange man ihn nicht versucht.K20.1 Darüber hinaus gibt es aber auch Situationen, in denen ein Bluff chancenlos ist, sodass man sich bisweilen von den Karten begrenzen lassen muss.K27.5 Was wiederum nur dadurch möglich ist, dass man sich auf die erste Hälfte der Poker-Antinomie einlässt.
2.3 Intellekt und Courage
Die erste Seite der Poker-Antinomie beinhaltet die traditionelle Einstellung zum Pokerspiel. Eine solche Spielweise folgt einer vernunftmäßigen Analyse des Spiels, deren Rationalität auf der Annahme eines abgeschlossenen logischen Systems beruht,K5.13 in dem mathematische Gesetze gelten.K4.6 Die Welt eines analytischen Spielers besteht demnach aus objektiven Gegenständen mit einer eindeutig bestimmbaren Existenz.K6.6 Zum Beispiel gibt es immer ein Risiko, Outs und Pot Odds. Das analytische Pokerspiel funktioniert nach Statistik und Zahlen, und der Verstand ist wichtiger als die Emotion.
Weiter oben habe ich vom großen Konfliktpotential gesprochen, das darin besteht, die Antinomie auf eine ihrer beiden Seiten auflösen zu wollen.K2.2 Ich möchte hier ein Beispiel bringen, um diese These zu verdeutlichen.
Der analytische Spieler verfolgt für gewöhnlich eine Spielstrategie, die in der Literatur auch unter dem Namen TIGHT-AGGRESSIVE bekannt ist. In vielen renommierten Poker-Büchern wird zu genau dieser Spielweise geraten; und sie gilt vielfach als die profitabelste Art, Poker zu spielen. Dabei handelt es sich um eine Zusammensetzung aus zwei Attributen: tight bedeutet, dass man nur die besten Hände spielen soll; und aggressive, dass man möglichst hoch setzen soll, wenn die eigene Hand besonders stark ist.
Das eigentliche Problem einer derartigen Spielweise liegt jetzt darin, dass sie unmittelbar den Widerspruch der Poker-Antinomie abbildet:K6.5 Je aggressiver man nämlich setzt, umso mehr fühlt sich der Gegenspieler auch veranlasst zu folden. Die Aggression beinhaltet ein Moment der Täuschung und ist damit ein Werkzeug des Bluffs.K24.2 Wo man jetzt aber die beste Hand hat, kann man gar nicht wollen, dass der Gegenspieler seine Karten wegwirft.K19.15 Die Aggression mag zwar zum Ziel haben, den eigenen Profit zu maximieren – doch ist sie immer schon hinderlich, indem sie den Fold des Gegenspielers vorausahnt.
In einer tight-aggressive Spielweise kann man durchaus eine Versöhnung der Poker-Antinomie sehen; sie wird aber automatisch zum Selbstwiderspruch, wenn man sie unter rein analytischen Vorzeichen betrachtet. Auf den ersten Blick scheint es durchaus so, als würde man dem Bluff-Aspekt des Pokerspiels auf adäquate Weise Rechnung tragen. Wie ist das aber möglich, solange der Fold des Gegenspielers gar nicht gewollt ist? Wer tight-aggressive spielt, will im Grunde nichts mit dem Bluff zu tun haben.
Wir brauchen uns nichts vormachen: Ein rein auf Statistik basiertes Pokerspiel ist sehr verlockend. Es würde einem ermöglichen, den Faktor Mensch mitsamt all seinen irrationalen Emotionen aus dem Spiel zu eliminieren und Poker nach rein rationalen Kriterien zu spielen.K6.3 Genau das ist aber eine große Falle des Spiels, nämlich dass es so tut, als könne man sich den Sieg errechnen. Sobald man einmal anfängt, die menschliche Komponente des Spiels zu ignorieren, vernachlässigt man den Täuschungsaspekt über Gebühr und sieht in allen Lügen nur mehr unhinterfragte Wahrheiten.K12.8
Es ist fatal, den Bluff als weniger wichtig zu sehen und ihn den Karten unterordnen zu wollen. Es verhält sich vielmehr umgekehrt, und der Täuschungsaspekt ist überhaupt von immenser Bedeutung. Er ist sogar so entscheidend, dass man Poker genauso gut „blind“ spielen könnte, indem man die eigenen Hole Cards gar nicht ansieht – und trotzdem Profit macht. Natürlich gehören hierfür viel Geschick und die richtigen Umstände dazu, gleichzeitig betont das aber den Stellenwert der Lüge im Pokerspiel.
ARNOLD SNYDER, der Autor des Buches The Poker Tournament Formula, spricht genau diese Empfehlung aus, um ein Gefühl für den Bluff zu bekommen. Er rät dazu, ein Turnier zu Übungszwecken „in the dark“ bzw. im Dunkeln zu spielen, also nur so zu tun, als würde man sich die eigenen Karten ansehen.3 Es mag mitunter schwer zu glauben sein, aber in Poker kann man auch gewinnen, ohne zu wissen, welche Karten man überhaupt hat.
Für einen analytischen Spieler ist die Richtigkeit seiner Spielentscheidung von ihren Konsequenzen unabhängig.K3.5 In der Spieltheorie würde man diesbezüglich auch von einer „dominanten Strategie“ sprechen. Auf diese Weise gibt die analytische Spielweise ein hohes Gefühl von Sicherheit. Der Showdown wird dabei als ein Schicksal empfunden, das unvermeidbar und unkorrigierbar ist: Wer die besseren Karten hat, der müsse gewinnen, und wer die schlechteren hat, verlieren.K19.6
Worauf soll der Gewinn jetzt aber basieren, wenn es keine Zahlen mehr gibt, um die eigene Entscheidung zu rechtfertigen? Der bluffende Spieler glaubt nicht an ein Schicksal, sondern will stattdessen Prophet einer ungeschriebenen Zukunft sein.K15.6 Er will nicht bloß passiv auf objektive Informationen reagieren, sondern seine Zukunft selbst gestalten.K6.7 Das heißt aber auch, dass er nicht von den Konsequenzen seines Handelns unabhängig ist – sondern ganz im Gegenteil: Der Erfolg eines Bluffs erweist sich überhaupt erst im Handeln des Gegenspielers.
Im Wegfallen der verstandesmäßigen Begründung wird das Spiel plötzlich zu einer Gefühlssache; und indem die Entscheidung zum Handeln nicht mehr auf einer rational-logischen Vernunft beruht, verliert sie auch an Sicherheit. Der aggressive Spieler muss deshalb nach einem bloßen Glauben handeln, ohne sich seines Erfolgs im Vorhinein sicher sein zu können, wofür es letztlich Mut braucht.K21.4
Wir können diesen Gegensatz als Poker-Antinomie formulieren:
Die II. Formulierung der Poker-Antinomie
KOMPETENZ-FORMEL
Intellekt: Der Klügere gewinnt.
Courage: Der Mutigere gewinnt.
Dieser Formulierung der Poker-Antinomie zufolge gewinnt man in Poker, indem man entweder klüger oder mutiger ist. Der Widerspruch besteht darin, dass beide Aussagen nicht zur gleichen Zeit wahr sein können: Für eine Analyse der Spielsituation muss man nämlich nicht mutig sein; genauso wie auch die Karten bedeutungslos werden, wenn ein Bluff gelingt.K21.10
Im Gegensatz zum Spiel nach Karten setzt der Bluff voraus, dass man sich einer Angst stellen muss, die der analytische Spieler von vornherein bereits vermeidet.K8.5 Wofür muss man denn Mut beweisen, wenn die Richtigkeit der eigenen Spielentscheidung allein in den Karten liegt, und es noch dazu egal ist, wie der Gegenspieler darauf antwortet?
So sehr hier beide Seiten miteinander im Konflikt stehen, so haben sie dennoch beide ihre Richtigkeit: Wer nämlich einen statistischen Vorteil ausnutzen will, der muss die Karten analysieren können; und wer bluffen will, der muss mutig sein.
Insgesamt gilt Poker als Spiel des INTELLEKTS, wie auch der COURAGE, womit das Spiel zwei Sphären berührt, in denen der Mensch sehr sensibel auf Kritik reagiert. Niemand gilt gerne als wenig intelligent oder gar feige. Aus diesem Grund bemühen sich analytische wie auch aggressive Spieler darum, ihr Ego vor Kränkung zu schützen. Die Poker-Antinomie bietet dabei ein hervorragendes Werkzeug, um sich die eigene Feigheit nicht eingestehen zu müssen: Solange der Bluff nämlich nicht profitabel sein dürfe, gibt es auch keinen Grund, den eigenen Mut unter Beweis zu stellen.K7.2
2.4 Erste Definition des Spiels
Die analytische Hälfte der Poker-Antinomie wird einer bekannten und durchaus richtigen Definition des Pokerspiels gerecht, und zwar derjenigen als KARTENSPIEL. Wenngleich man Poker auch spielen kann, ohne die eigenen Karten anzusehen, so sind sie doch ein wesentliches strukturelles Element des Spiels. Sie scheinen eine objektive Grundlage zu liefern, und die Rahmenbedingungen für ein tiefer gehendes Verständnis des Spiels zu schaffen. Überall dort, wo wir von Poker sprechen, müsse es auch Karten geben.
Wie sollen wir jetzt aber damit umgehen, dass die Karten bedeutungslos werden, wenn unser Bluff erfolgreich ist?K21.10 Spielen wir überhaupt noch nach den Karten, wenn wir das statistische Risiko zugunsten des Bluffs ignorieren, und bewusst auf eine unterlegene Hand setzen? Wie viel „Kartenspiel“ ist Poker denn, wenn es egal ist, welche Karten man tatsächlich hat?
In der TV-Serie Suits gibt es einen gewieften New Yorker Anwalt unter dem Namen Harvey Specter, der in arrogant anmutender Manier zu seinem Gehilfen sagt: „I told you this before and I’m gonna tell you again: I don’t play the odds, I play the man.“4 Zu Deutsch in etwa: „Ich hab’s dir schon einmal gesagt und sag’s dir nochmal: Ich spiele nicht nach Wahrscheinlichkeiten, sondern gegen den Menschen.“ Diese Übersetzung klingt nicht besonders schick, doch gibt sie am besten die inhaltliche Bedeutung wieder.
Das Zitat passt hervorragend zu meiner Theorie, da Mr. Specter in treffender Weise die Poker-Antinomie auf den Punkt bringt. Poker mag zwar ein Kartenspiel sein, doch braucht es nicht unbedingt die besseren Karten, um zu gewinnen. Wir haben es auf recht ironische Weise mit einem Kartenspiel zu tun, bei dem man sich gar nicht für die Karten interessieren muss.
In dieser Hinsicht kann man in Poker auch ein WETTKAMPF-SPIEL sehen, in dem es darum geht, sich gegen andere Spieler durchzusetzen, und wo die Karten ohne Belang sind. Anstatt mit den eigenen Karten gegen die Karten des Gegenspielers anzutreten, spielt man auf einmal als Mensch gegen andere Menschen. Poker ist damit kein reines Kartenspiel, sondern im Wettkampf offenbart sich auch die menschliche Dimension des Spiels.
Es gibt eine berühmte Sentenz, die lautet: „Poker is a game of people, not cards.“ Zu Deutsch: „In Poker spielt man keine Karten, sondern gegen Menschen.“ Zwei Poker-Legenden, nämlich Doyle Brunson und Thomas “Amarillo Slim” Preston, sollen sich auf diese Weise geäußert haben.
Die alleinige Beschreibung von Poker als Kartenspiel ist deshalb problematisch, weil sie die Karten überbetont: Sie tut so, als ginge es nur darum, die besseren Karten zu haben. Auf diese Weise unterdrückt sie schließlich den menschlichen Aspekt, der für die Anwendung des Bluffs von entscheidender Bedeutung ist. Die Poker-Antinomie gestaltet sich hierbei wie folgt:
Die III. Formulierung der Poker-Antinomie
ERSTE DEFINITIONS-FORMEL
Kartenspiel: In Poker spielt man mit Karten gegen Karten.
Wettkampf-Spiel: In Poker spielt man als Mensch gegen Menschen.
Der Wettkampf-Aspekt des Spiels ist ein entscheidendes Argument, warum Poker kein reines Glücksspiel ist. Um nämlich von einem Glücksspiel sprechen zu können, müssten die Ergebnisse durch statistische Berechnungen vorhersehbar sein. Das ist jedoch nicht möglich, solange die Karten nicht aufgedeckt werden, und der Bluff sie obsolet macht.
2.5 Bewusste und unterbewusste Motivationen
Poker ist zwar ein „Spiel“, doch hat es gleichzeitig einen „ernst“ anmutenden Charakter. Dies hat allem voran damit zu tun, dass man meist um echtes Geld spielt, sodass das Pokerspiel seinen bloßen Spielcharakter übersteigt. Es hat reale Konsequenzen und ist im Grunde ein „Spiel des Lebens“. Wer ein Pokerspiel verliert, der nimmt auch einen finanziellen Schaden, und so verleiht gerade das Geld dem Spiel seine Ernsthaftigkeit.K25.3
In diesem Sinne wehrt sich das Spiel immer schon dagegen, bloß zum Spaß gespielt zu werden – wodurch auch eine bedeutsame Möglichkeit wegfällt, die eigenen Schwächen bzw. Niederlagen zu rechtfertigen. Wäre Poker nur ein „Spiel“, dann könnte man jederzeit sagen: „Mir war es nicht so wichtig, zu gewinnen.“ Stattdessen besitzt es jedoch eine maßgebliche Ernsthaftigkeit, die nicht ohne weiteres durch Spaß ersetzt werden kann. Wer deshalb den Spaß in den Vordergrund stellt, der überdeckt womöglich bloß den Ernst des Spiels, um sich nicht für die eigenen Verluste verantworten zu müssen.
In der Reflexion über den Spielcharakter von Poker ist eine bedeutsame Selbst-Reflexion enthalten – und zwar die Antwort auf die Frage, wie sehr man in Wirklichkeit gewinnen will. Versucht man, in Poker bloß ein Spiel zu sehen, dann offenbart sich darin die Unehrlichkeit sich selbst gegenüber. Man redet sich ein, nicht gewinnen zu wollen, weil man sich nicht eingestehen kann, nicht gewinnen zu können, falls man verlieren sollte.
Wo man gewinnen will, muss man auch ehrlich zu sich selbst sein können. Der eigene Erfolg hängt nämlich entscheidend davon ab, wie sehr man der Überzeugung ist, ihn auch zu „verdienen“. In diesem Sinne muss man in der Lage sein, zu den eigenen Stärken und Schwächen stehen zu können. Wer sich den Erfolg nicht zutraut, der wird ihn nicht erreichen; und wo man die eigenen Schwächen nicht akzeptiert, werden sie auch niemals überwunden.
Zusätzlich dazu bekommt das Pokerspiel hier das Gesicht einer sportlichen Disziplin, denn jeder Athlet muss sich fragen: Was will ich erreichen, und was bin ich bereit, dafür zu tun? Es geht also nicht nur darum, ehrlich sich selbst gegenüber zu sein; sondern man muss auch ANSPRÜCHE stellen können, und sie aktiv einfordern. Oder kurz: Man muss den Sieg auch wollen.
Hier stoßen wir erneut auf den Wettkampf-Aspekt des Pokerspiels,K2.4 indem es die WILLENSSTÄRKE seiner Spieler auf die Probe stellt.K11.7 Der Erfolg hängt demnach davon ab, wie sehr man bestrebt und in der Lage ist, sich gegen andere Spieler durchzusetzen. Im Bluff repräsentiert das Setzen von Chips nicht die Stärke der eigenen Karten, sondern des eigenen Begehrens,K11.7 und das Zurückschrecken vor dem Bluff ist der Ausdruck einer freiwilligen Unterwerfung.K24.4
Aus diesem Grund bin ich der Ansicht, dass erfolgreiche Pokerspieler unbedingt einen „Wettkampfgeist“ brauchen; und deshalb macht es auch Sinn, sich mit der Mentalität von Wettkämpfern zu beschäftigen. Ich kann DOYLE BRUNSON hier nicht unerwähnt lassen, der als Pokerlegende gilt und in seinem Bestseller Super System schreibt: „Mein Wettbewerbsgeist ist einer der Gründe, warum ich glaube, so erfolgreich im Pokerspielen gewesen zu sein.“5
Analytische Pokerspieler tendieren dazu, auf gute Karten zu warten, die nie gut genug sind. Ihr Pokerspiel ist konfrontationsscheu und entspricht nicht der Mentalität eines Wettkämpfers. Und obwohl sie einen Pot nach dem anderen verlieren, fühlen sie sich gleichzeitig tugendhaft. Sie sehen die Ausblendung der Emotion als eine ihre größten Stärken,K12.7 während die vermeintliche Selbstbeherrschung zum Vorreiter einer im Grunde selbstverschuldeten Niederlage wird.
Das Pokerspiel ist sehr trügerisch, weil es sich als harmloses Kartenspiel tarnt und damit seinen Wettkampf-Charakter geschickt verbirgt.K2.4 So würden die Karten etwa eine „Begrenzung“ schaffen, die man nicht übersteigen könne. Es könne sich ja niemand aussuchen, welche Karten er bekommt, während ihr Urteil unbeeinflussbar und endgültig sein müsse.K18.2 Wie soll man denn einen Sieg herbeiführen können, wenn die Karten bereits eine Niederlage in Aussicht stellen? Für einen analytischen Spieler hieße das, sich gegen ein unvermeidbares und unkorrigierbares Schicksal aufzulehnen.K18.6 Die übermäßige Betonung der Karten verhindert den Blick auf den Menschen und die zwischenmenschliche Dimension.
Zusätzlich dazu sind wir es immer schon gewohnt, in Kartenspielen ein Freizeitvergnügen bzw. „nur ein Spiel“ zu sehen. Hebt man den Spiel-Aspekt von Poker hervor, so rückt man damit sein Versprechen von Spaß und Unterhaltung in den Vordergrund. Und so scheint es plötzlich nichts mehr auszumachen, wenn man eine Runde lang unkonzentriert ist und nicht aufpasst.
Vernunft und Trieb
Versuchen wir hier ein kurzes Resümee: Am Anfang habe ich davon gesprochen, dass das Pokerspiel eine unhintergehbare Ernsthaftigkeit besitzt, die uns zur Selbst-Reflexion auffordert. In der Frage nach dem Spiel-Charakter von Poker müssen wir uns fragen, wie wichtig uns der Sieg ist. Behaupten wir jetzt, dass Poker bloß ein „Spiel“ ist, dann sind wir eigentlich unehrlich uns selbst gegenüber: Wir können nämlich nicht Poker spielen, ohne gleichzeitig gewinnen zu wollen. Das Spiel würde schlichtweg keinen „Spaß“ mehr machen.
Diese Unehrlichkeit beruht darauf, dass wir nicht zu unseren eigenen Stärken oder Schwächen stehen wollen. Dabei wäre genau das notwendig: Wer gewinnen will, der muss der Überzeugung sein, den Sieg zu verdienen; und er muss in der Lage sein, sich für seine Niederlagen selbst zu verantworten.K20.2 Zusätzlich dazu muss man aber auch Ansprüche stellen und für diese eintreten können, sodass es ebenso Willensstärke braucht, um zu gewinnen.
Für einen analytischen Spieler scheint das alles nicht notwendig zu sein. Sein Blick auf die Karten macht ihn blind für den Menschen, der sie besitzt. Er sieht den Wettkampf nicht, weil er der Ansicht ist, dass man die Karten nicht „austricksen“ könne. Dementsprechend wähnt er sich überhaupt von jeglichen unterbewussten Prozessen unabhängig: Das eigene Begehren könne sich nicht über die Karten stellen, und so würde es auch keine Rolle spielen.
Die Vernunft funktioniert nicht nach unterbewussten Regeln. Für die Berechnung eines statistischen Risikos muss man nicht ehrlich zu sich selbst sein oder irgendwelche Ansprüche stellen – sondern man gewinnt dann, wenn die Zahlen sagen, dass man gewinnt.
Die Karten sind dabei der Inbegriff des Objektiven. Sie entsprechen einer Wirklichkeit, deren Wahrheit von subjektiven Einflüssen unabhängig sein müsse. Legen wir dem Pokerspiel eine rational-logische Vernunft zugrunde, dann gibt es keine verborgenen Mechanismen. Leiten wir hiervon doch eine Poker-Antinomie ab:
Die IV. Formulierung der Poker-Antinomie
MOTIVATIONS-FORMEL
Vernunft: Pokerspieler treffen nur kontrollierte Entscheidungen auf Basis bewusster Überlegungen.
Trieb: Pokerspieler treffen unterbewusst motivierte und somit unvernünftige Entscheidungen.
Auf der ersten Seite der Poker-Antinomie gehorcht der Verstand vollständig seinen eigenen rationalen Vernunft-Kriterien. Wenn ein Spieler eine Entscheidung trifft, dann wird darunter das Resultat BEWUSSTER Überlegungen verstanden. Eins plus eins ist immer zwei, unabhängig davon, was ich mir als Ergebnis wünsche. Wo es jetzt aber keine „unterbewusste Vernunft“ gibt, kann auch das eigene Handeln nicht unterbewusst motiviert sein. Aus diesem Grund erlebt der analytische Spieler sein Handeln immer als KONTROLLIERT.
Die analytische Spielweise gehorcht einer rational-logischen Vernunft und hält die Gefühle für irrational, wenn nicht sogar für störend. Sie würden richtigen Spielentscheidungen bloß im Weg stehen,K6.3 sodass man die Emotion überhaupt aus dem Spiel eliminieren müsse.K12.7 Doch habe ich bereits auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die mit einer einseitigen Auflösung der Poker-Antinomie verbunden sind.K2.2 Wo man die Gefühle nämlich leugnet, ist man ihrem Einfluss hilflos ausgesetzt: Man wird blind gegenüber der eigenen Unvernunft.
Unvernünftige Selbstsabotage
In der Überzeugung, das Spiel auf rational-logische KriterienK5.13 und mathematische GesetzeK4.6 reduzieren zu können, wird der Einfluss „unvernünftiger“ Entscheidungen geleugnet. Die Funktionsweise von Poker kann aber nicht zur Gänze mit Begriffen einer rationalen Vernunft erklärt werden, sondern das Pokerspiel gehorcht immer auch biologischen und psychologischen Gesetzen.K4.6 So verspüren wir etwa eine Angst, wenn viel auf dem Spiel steht,K8.5 oder wir zeigen unwillkürliche Poker-Tells, die uns nicht bewusst sind.K12.16
Unterbewusst motivierte Entscheidungen haben häufig die Gestalt einer SELBSTSABOTAGE: Ihr Prinzip liegt darin, ein kleines Übel in Kauf zu nehmen, um dadurch ein größeres zu verhindern. So entscheiden wir uns sogar freiwillig für eine Niederlage, sofern sie einen übergeordneten Zweck für uns erfüllt.
Stellen wir uns etwa vor, wir tragen ein großes Gefühl der Schuld mit uns, unter dem wir sehr leiden. Hier kann es dazu kommen, dass wir einer Strafe entgegensehnen, um unsere Schuld zu begleichen, und damit unsere quälenden Schuldgefühle zu besänftigen. Die Niederlage im Pokerspiel kann jetzt zur rituell vollzogenen Selbstbestrafung dienen. Dabei konstruieren wir unangenehme Niederlagen, weil wir sie brauchen, um uns besser über uns selbst fühlen zu können.
Alternativ dazu können wir auch wenig selbstbewusst sein und Gefühle der Minderwertigkeit besitzen. Hier vereiteln wir Momente des Sieges, weil wir glauben, dass er uns nicht zustehen würde. Möglicherweise sind wir es im Alltag schon gewohnt, uns unterzuordnen oder können schwer Nein sagen. Dieselben Mechanismen begegnen uns auch im Pokerspiel;K24.4 und so wird die im Alltag erlernte Unterordnung zur Vorlage genommen, um die eigene Vergangenheit aneinander geketteter Misserfolge unermüdlich zu reproduzieren.
Ein entscheidender unterbewusster Prozess liegt für mich im SCHUTZBEDÜRFNIS DES EIGENEN EGOS. So leugnen analytische Spieler etwa die Profitabilität des Bluffs, um sich nicht für feige halten zu müssen, wenn sie folden.K7.2 Solange ihr Ego verletzbar ist, müssen die Karten gleichfalls vor Kritik geschützt werden. Dadurch erweist sich die Auflösung der Poker-Antinomie auf die Seite der Karten aber auch als ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Und so sind sogar die Überzeugungen eines vernunftgelenkten Spiels (auf recht ironische Weise) von unterbewussten Mechanismen abhängig.
2