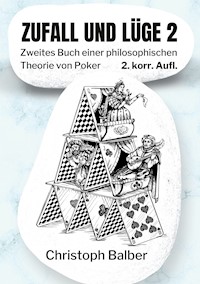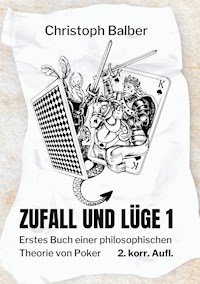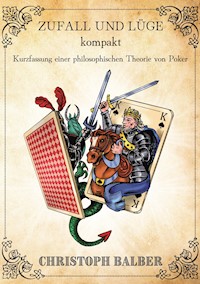
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der Kurzfassung der bislang umfangreichsten philosophischen Analyse des Pokerspiels werden die wichtigsten Konzepte kompakt dargestellt. Im Zentrum steht dabei der Gegensatz zwischen Verstand und Bauchgefühl, wie wir als Pokerspieler damit umgehen, und welchen Einfluss er auf die Spieldynamik selbst hat. Darüber hinaus soll aber auch die Frage geklärt werden, wie die Täuschung in Poker funktioniert und wie sie sich zu anderen Formen der Manipulation verhält. "Zufall und Lüge" stellt unser Erfahrungswissen auf den Prüfstand und bricht mit der Tradition herkömmlicher Pokerbücher. Stattdessen wollen wir einen Blick hinter die Fassade der Wirklichkeit werfen - denn nicht alles, was uns als objektiv gegeben erscheint, muss auch wahr sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Dr. med. univ. Christoph Balber BA, geb. 1989, ist Arzt und Philosoph aus Österreich. Er hat Humanmedizin und Philosophie in Wien studiert und befindet sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Eine Einführung
Die Poker-Antinomie
Der Zufall
Der Poker-Mythos
Poker-Turniere
Spieler-Welten
Die Unschuldsvermutung
Die Bluff-Inkompetenz
Gefahren erkennen und abwenden
Das analytische Hamsterrad
Aggressives Pokerspiel
Die Lüge und ihre Saboteure
Falsche Ehrlichkeit
Phänomenologie der Zeit
Logik der Wirklichkeit in Raum und Zeit
Haus aus Karten
Göttliche Gewalt
Das analytische Urteil
Ohnmächtiges Handeln
Welt und Urteil ohne Karten
Logik der Mächtigkeit
Das Wesen der Macht
Die Unfairness von Poker
Die Macht-Dynamik des Bluffs
Poker-Ethik
Realität ohne Substanz
Eigene und fremde Kräfte
Vorwort
Über Poker ist schon viel nachgedacht worden. Die letzten Jahrzehnte haben einen reichhaltigen Fundus an Theorien hervorgebracht, die sich grob in eine mathematische und psychologische Denkrichtung ausdifferenzieren lassen.
Im Rahmen der Jahrtausendwende ist es jedoch zu einer zunehmenden Verbreitung von Online Poker und einer damit einhergehenden „Virtualisierung“ des Spielgeschehens gekommen. Dadurch hat sich die Mathematik als theoretische Basis durchsetzen können und die Spieltheorie ist zur Königsdisziplin des Pokerspielers hochstilisiert worden.
Die Arbeit an meiner philosophischen Theorie von Poker, die den Titel „Zufall und Lüge“ trägt, soll den starren paradigmatischen Rahmen des Poker-spiels aufsprengen, den es der Vorherrschaft mathematisch orientierter Denker verdankt. Die Mathematik ist nicht so wichtig, wie sie immer tut. Und erklären kann sie das Spiel sowieso nicht alleine.
Das Pokerspiel ist ohne eine psychologische Perspektive nicht erklärbar. Man kann den Bluff eben nicht mathematisieren, so sehr man auch darum bemüht sein mag. Der Widerspruch zwischen den Karten und dem Bluff wird von mir als „Poker-Antinomie“ bezeichnet. Sie bildet das Fundament meiner Theorie und wird in Kapitel 2 näher erläutert.
Unter einer Antinomie versteht man den Widerspruch zweier Aussagen, die beide recht haben. So sind die Karten und der Bluff eben gleichermaßen spiel-entscheidend. Wo der Bluff aber Erfolg haben soll, müssen die Karten bedeutungslos sein – und umgekehrt. Davon können wir vielerlei Gegensätze ableiten: theoretisch – pragmatisch, objektiv – subjektiv, passiv-reaktiv – aktiv-manipulativ, Geist – Leib, Unwissen – Unwahrheit und viele weitere mehr.
„Zufall und Lüge“ ist eine umfangreiche Theorie des Pokerspiels aus der Sicht eines Philosophen. Dabei streift sie diverse philosophische Disziplinen, wie etwa Erkenntnistheorie, Ontologie, Handlungstheorie, Logik, Philosophie der Zeit und Ethik.
Es überrascht nicht, dass damit hohe intellektuelle Anforderungen an meine Leserschaft einhergehen. Gleichzeitig präsentiert sich meine Theorie in einem erheblichen Umfang von 240.000 Wörtern, aufgeteilt auf zwei Bände, für die man erst einmal die notwendige Geduld aufbringen muss. Aus diesem Grund habe ich mich ans Werk gemacht, meine Theorie zu verknappen und zu vereinfachen. Das Ergebnis halten Sie gegenwärtig in den Händen.
Die vorliegende Kompakt-Version meiner Theorie hat den Anspruch, die wesentlichen Ideen zusammenzufassen und quasi einen Überblick zu geben. Dabei habe ich auf komplizierte Begründungen verzichtet und verweise gelegentlich auf die Originaltexte, für die ich als Platzhalter auch die Akronyme ZuL1 für das erste Buch (Kapitel 1 bis 14) sowie ZuL2 für das zweite (Kapitel 15 bis 27) verwende. Die Kapitelbezeichnungen in dieser Kurzfassung stimmen mit den Originalen überein, um ein rasches Nachschlagen zu erleichtern und Verwirrungen zu vermeiden.
Im zweiten Buch (ab Kapitel 15) nehme ich mir eine logische Rekonstruktion der Spielmechanik von Poker vor. In diesem wohl ambitioniertesten Teil meiner Theorie geht es darum, wie die Gegenstände der Wirklichkeit, die Handlungen der Spieler, und die Urteile über Sieg und Niederlage im zeitlichen Verlauf miteinander verknüpft sind. Die Kapitel 15 bis 21 werden von mir auch als „Logik-Kapitel“ bezeichnet, weil sie einen aufwendigen mathematisch-logischen Überbau besitzen.
Das zweite Buch besitzt eine hohe Komplexität und sperrt sich aufgrund der strengen logischen Denkweise häufig gegen eine intuitive Einsicht. Es ist mit einem einfachen „Hausverstand“ schlichtweg nicht bewältigbar und eignet sich deshalb auch nicht für eine schnelle Lektüre. Um dennoch den Zugang zu meinem Werk zu erleichtern, kommt die vorliegende Kurzfassung ohne logische Formeln und mathematische Beschreibungen aus.
Aus ästhetischen Gründen und zur besseren Lesbarkeit habe ich (wie auch bereits im Original) auf eine geschlechtergerechte Sprache verzichtet. Ich wünsche mir aber, dass sich alle Menschen gleichermaßen angesprochen fühlen, unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität.
Wien, im Mai 2022
1 Eine Einführung
Spielregeln. Am Anfang meiner ursprünglichen Theorie steht eine Vorstellung der Grundregeln von Poker anhand der Spielvariante „No-limit Texas Hold’em“. Ich bitte um Verzeihung, dass ich diese hier nicht wiedergebe. Wer sich dafür interessiert, wie man Poker spielt, möge in Google bzw. Youtube danach suchen oder alternativ ZuL1 aufschlagen. Ich setze voraus, dass jede/r weiß, was die Begriffe Flop, Flush, Raise, Button, Draw, Blind, Showdown, Hole Cards, Cash Game und dergleichen bedeuten.
Philosophie. Warum überhaupt eine philosophische Theorie? Wozu braucht man in Poker einen Philosophen? Dies wird deutlich, wenn man sich die Vielgestal-tigkeit möglicher Perspektiven ansieht, die mit dem Pokerspiel verbunden sind. Folgende Dinge kann man darin sehen:
ein Spiel der Täuschung und der Lüge,
des Intellekts und der Courage,
von Unwissen und Unwahrheit,
ein Kartenspiel wie auch ein Wettkampf-Spiel,
ein Spiel von Macht und Unterwerfung,
von Zwang und Bedrängnis,
des Bewussten und des Unterbewussten,
sowie der Kränkung und der Selbstsabotage.
Die traditionelle Betrachtung des Spiels blendet vieles davon zunächst aus und ist vordergründig an eindeutigen und objektiven Fakten interessiert, die sie auf rational-logische Weise analysiert. Hierfür legt man zuallererst eine Gewinnwahrscheinlichkeit fest und fällt am Ende eine Entscheidung, die unabhängig von ihren Konsequenzen „richtig“ ist.
Was ist aber, wenn man die Spielsituation stattdessen als Begegnung begreift? Treten wir durch unser Handeln denn nicht in einen persönlichen Kontakt mit unserem Gegenspieler? Und treffen wir nicht auch gefühlsmäßige Entscheidungen?
Kann man eine überhaupt eine Überlegenheit der Karten behaupten, solange es gar nicht zum Showdown kommt? Müssten die Karten dann nicht bedeutungslos sein? Die Karten lassen eine unhintergehbare Objektivität im Pokerspiel vermuten – doch ist eine solche Annahme höchst problematisch.
Die Karten verlangen in ihrer rationalen Natur danach, sich gegenüber den eigenen emotionalen Regungen taub zu stellen. Doch läuft man damit Gefahr, die gefühlsmäßige Dimension gänzlich aus dem Spiel zu verbannen.
Braucht es denn nicht das Gefühl, um erfolgreich Poker spielen zu können? Ist es nicht notwendig, sich in den Anderen hineinzufühlen, um eine richtige Entscheidung treffen zu können? Scheint es nicht Mechanismen im Spiel zu geben, die nicht notwendigerweise in den Karten begründet sind?
Zwiespalt. Eine große Leistung meiner Theorie liegt darin, genau diesen Gegensatz zwischen einem Spiel nach Karten und einem solchen nach Bluff herauszuarbeiten. In den meisten Büchern wird nur unscharf zwischen diesen beiden Seiten getrennt, und beinahe überall werden sie auf die eine oder andere Weise miteinander vermischt. In der Gegenüberstellung der beiden Hälften ist aber ein bedeutsamer Widerspruch angelegt, den man nicht einfach so übergehen kann.
Wir haben es hier mit einem fundamentalen Zwiespalt zu tun, den ich auch als POKER-ANTINOMIE bezeichne. Unter einer Antinomie versteht man einen Widerspruch zwischen zwei Aussagen, die sich beide gleich gut begründen lassen. Irgendwie scheinen beide Seiten Recht zu haben, doch kann die eine Seite nur dann Recht haben, wenn die andere Unrecht hat.
Den beiden Seiten der Poker-Antinomie entsprechen schließlich zwei Spieler-Mentalitäten: die ANALYTISCHE und die AGGRESSIVE. Die analytische Mentalität steht für die rational-logische „Analyse“ des Spiels und will mit den besseren Karten gewinnen – wohingegen eine „aggressive“ Spielweise den Bluff als spielentscheidend betrachtet und mit den schlechteren Karten gewinnen will. Insgesamt ist die erste Hälfte stellvertretend für ein Spiel nach Karten, das sich den Zufall zum Verbündeten nimmt; während die zweite Hälfte die Schwächen seiner Gegenspieler ausnutzen und von der Anwendung der Lüge profitieren will.
Ein jeder Versuch, die Antinomie auf eine der zwei Seiten aufzulösen, muss unweigerlich zu einem Konflikt in der eigenen Spielstrategie führen, da die Funktionsweise von Poker auf beide Hälften angewiesen ist. Die große Herausforderung eines Pokerspielers besteht darin, die beiden Seiten der Poker-Antinomie miteinander zu versöhnen, ohne der Gegenseite ihre Geltung abzusprechen.
Die beiden Hälften der Poker-Antinomie sind jetzt Prototypen für zwei Spieler-Typen: den ANALYTISCHEN und den AGGRESSIVEN SPIELER. Diese resultieren aus dem Versuch, die Antinomie auf eine der beiden Seiten aufzulösen, indem man die Gegenseite leugnet. So will ein analytischer Spieler etwa die Profitabilität des Bluffs nicht wahrhaben, weshalb er dazu tendiert, seine bluffenden Gegenspieler für „unschuldig“ zu halten.
Pokerspieler, die es gewohnt sind, nach Karten zu spielen, haben für mich zwei große Sehnsüchte – und zwar nach der RATIONALITÄT DER LOGIK auf der einen Seite und der EINDEUTIGKEIT DES OBJEKTIVEN auf der anderen. Wie eben illustriert folgt der Bluff aber keiner verstandesmäßigen Logik, und seine Entscheidungsgrundlage muss auch nicht objektiv sein. Damit steht das traditionelle Theorie-Gebäude von Poker immer schon auf einem sehr wackligen Fundament.
Ausblick. Das erste Buch (Kapitel 1 bis 14) bildet den Zwiespalt zwischen einer theoretischen und einer pragmatischen Spielweise ab, wonach man entweder mathematischen oder psychologischen Gesetzen gehorchen kann. Ich werde mich mit der Wahrheit und Wirklichkeit eines Pokerspielers auseinandersetzen, sodass die LÜGE eine prominente Rolle einnehmen wird. Die Poker-Antinomie wird uns durch die ganze Theorie hinweg begleiten, und so werde ich sie immer wieder in einer neuen Formulierung vorstellen.
Das zweite Buch (Kapitel 15 bis 27) wird sich schließlich eine gewaltige Aufgabe vornehmen: nämlich eine logische Rekonstruktion des Spiels. Neben der Poker-Antinomie liegt darin die zweite große Leistung meiner Theorie. In meiner Kurzfassung muss ich die logische Darstellung des Begründungszusammenhangs mehr oder weniger ausblenden und ich werde stattdessen bloß auf die Kernaussagen eingehen.
Zwei zentrale Begriffe werden in weiterer Folge die OHNMACHT und die MACHT sein: Eine grobe Definition der Ohnmacht lautet dahingehend, die besseren Karten zu brauchen, um zu gewinnen; während die Macht die Befähigung zum Ausdruck bringt, den Gegenspieler zum Fold bewegen zu können.
2 Die Poker-Antinomie
Einleitung. Es gibt genau zwei Möglichkeiten, den Ausgang eines Pokerspiels für sich zu entscheiden: und zwar entweder mithilfe der besseren Karten, oder im Zuge eines erfolgreichen Bluffs.
Gleichzeitig scheinen sich diese beiden Alternativen aber gegenseitig zu behindern. Wo man nämlich mit den besseren Karten gewinnen will, darf der Gegenspieler seine Karten nicht wegwerfen. Und wo man seinen Gegenspieler bluffen möchte, darf man nicht auf die Karten hören.
Demgemäß basiert die Funktionsweise von Poker auf einem Zwiespalt, wonach die Karten und der Bluff zwar gleichermaßen spielentscheidend sind, die beiden Möglichkeiten sich aber gegenseitig behindern. Entweder man glaubt, mit den Karten den Bluff schlagen zu können – oder umgekehrt. Wer für die eine Seite argumentieren will, scheint die andere verneinen zu müssen.
Hier haben wir es mit einer ANTINOMIE zu tun. Darunter versteht man einen Widerspruch zwischen zwei Aussagen, die sich beide gleich gut begründen lassen. Man kann demnach sowohl für die Karten, als auch für den Bluff stichhaltige Argumente vorbringen – es kann jedoch nur eines von beiden zum gleichen Zeitpunkt spielentscheidend sein.
Der Zwiespalt zwischen den Karten und dem Bluff ist das Fundament meiner Theorie, und ich bezeichne ihn auch als POKER-ANTINOMIE. In ihrer ursprünglichen Formulierung stellt sich diese wie folgt dar:
STANDARD-FORMEL der Poker-Antinomie
1. analytisch: Die besseren Karten entscheiden das Spiel.
2. aggressiv: Der Bluff entscheidet das Spiel.
Hierbei handelt es sich um die „Standard-Formel“, weil sie den Konflikt eines Pokerspielers in seiner natürlichsten Form aufzeigt. Je nach Perspektive begegnet uns dieser Gegensatz aber in diversen Teil-Aspekten des Spiels wieder, sodass ich die Antinomie öfter neu formulieren werde. In der vorliegenden Kurzfassung meiner Theorie sind alle Varianten zu finden. Eine Übersicht findet sich im Anhang des Originaltextes.
Auflösung. Überall dort jetzt, wo wir es mit Widersprüchen in unserem Denken zu tun haben, wollen wir sie möglichst rasch und unkompliziert wieder loswerden. Dies gelingt uns am einfachsten über die Elimination der Gegenseite.
Unser Problem liegt jedoch darin, dass beide Hälften der Antinomie Recht haben. Anstatt deshalb die vermeintlich „falsche“ Seite loszuwerden, kommt es bloß zu einer LEUGNUNG. Im Versuch, den Widerspruch der Poker-Antinomie aufzulösen, blenden wir aus, was wir nicht sehen wollen.
Die Funktionsweise des Pokerspiels ist letztlich auf beide Hälften der Antinomie angewiesen; und eine Sache verschwindet nicht automatisch, nur weil wir sie nicht wahrhaben wollen. Die Widersprüchlichkeit der Poker-Antinomie wird stattdessen weitergetragen, indem sie zu Konflikten in der eigenen Spielstrategie führt.
Typen. Je nachdem, ob man die Antinomie auf die Seite der Karten oder des Bluffs auflösen will, kommt es jetzt zu einem von zwei Spieler-Typen. Es handelt sich dabei um den ANALYTISCHEN und den AGGRESSIVEN SPIELER. Die Grafik (Abb. 2.1) stellt die beiden Typen gegenüber.
Abb. 2.1 Die Poker-Antinomie in ihrer einseitigen Auflösung
Analytischer Spieler. Sehen wir uns zunächst den analytischen Spieler genauer an. Dieser löst die Antinomie zur ersten Seite hin auf und ordnet den Bluff den Karten unter. Seine Einstellung wird problematisch, sobald er keinen Erfolg hat. Dann gelangt er nämlich in einen Erklärungsnotstand.
Er denkt sich: „Hier sitze ich nun und spiele nur meine zulässigen Hände – doch scheinen meine Gegenspieler ständig die besseren Karten zu haben. Mache ich denn irgendetwas falsch?“ Um den eigenen Verzicht auf den Bluff rechtfertigen zu können, und um gleichzeitig nicht zugeben zu müssen, gegen fremde Bluffs zu verlieren, wird die LEUGNUNG DER PROFITABILITÄT DES BLUFFS zur obersten Priorität.
Am Ende dient diese Leugnung vor allem zum Schutz des eigenen Egos; und so wird das gegnerische „Glück“ herangezogen, um sich nicht die eigene Unfähigkeit eingestehen zu müssen.
Aggressiver Spieler. Ich räume der aggressiven Spielweise grundsätzlich einen Vorrang gegenüber der analytischen ein. Das liegt zuallererst daran, dass die Täuschung im Pokerspiel für mich unhintergehbar ist. Man kann sich ihrem Einfluss nicht entziehen. Darüber hinaus ist der Bluff aber auch in der Lage, den Karten als urteilende Instanz zuvorzukommen: Solange es nicht zum Showdown kommt, spielen die Karten keine Rolle.
Der analytische Spieler hat unterschiedliche Strategien, die Lüge im Pokerspiel zu erklären und anzuwenden. Meist läuft es dabei auf eine gewisse „Mathematisierung“ hinaus, wonach man etwa in einer bestimmten Frequenz bluffen sollte.
Der aggressive Spieler hat stattdessen das Problem, dass er nicht weiß, wie er den Verzicht auf einen Bluff begründen soll: Zum einen kann man nie mit Sicherheit sagen, ob ein Bluff nicht doch funktioniert hätte, solange man ihn nicht versucht. Darüber hinaus gibt es aber auch Situationen, in denen ein Bluff chancenlos ist, sodass man sich bisweilen von den Karten begrenzen lassen muss.
Kompetenz. Wir brauchen uns nichts vormachen: Ein rein auf Statistik basiertes Pokerspiel ist sehr verlockend. Es würde einem ermöglichen, den Faktor Mensch mitsamt all seinen irrationalen Emotionen aus dem Spiel zu eliminieren und Poker nach rein rationalen Kriterien zu spielen. Genau das ist aber eine große Falle des Spiels, nämlich dass es so tut, als könne man sich den Sieg errechnen.
Es ist fatal, den Bluff als weniger wichtig zu sehen und ihn den Karten unterordnen zu wollen. Es verhält sich vielmehr umgekehrt, und der Täuschungsaspekt ist überhaupt von immenser Bedeutung. Er ist sogar so entscheidend, dass man Poker genauso gut „blind“ spielen könnte, indem man die eigenen Hole Cards gar nicht ansieht – und trotzdem Profit macht. Natürlich gehören hierfür viel Geschick und die richtigen Umstände dazu, gleichzeitig betont das aber den Stellenwert der Lüge im Pokerspiel.
Im Wegfallen der verstandesmäßigen Begründung wird das Spiel plötzlich zu einer Gefühlssache; und indem die Entscheidung zum Handeln nicht mehr auf einer rational-logischen Vernunft beruht, verliert sie auch an Sicherheit. Der aggressive Spieler muss deshalb nach einem bloßen Glauben handeln, ohne sich seines Erfolgs im Vorhinein sicher sein zu können, wofür es letztlich Mut braucht. Wir können diesen Gegensatz als Poker-Antinomie formulieren:
KOMPETENZ-FORMEL der Poker-Antinomie
1. Intellekt: Der Klügere gewinnt.
2. Courage: Der Mutigere gewinnt.
Im Gegensatz zum Spiel nach Karten setzt der Bluff voraus, dass man sich einer Angst stellen muss, die der analytische Spieler von vornherein bereits vermeidet. Wofür muss man denn Mut beweisen, wenn die Richtigkeit der eigenen Spielentscheidung allein in den Karten liegt, und es noch dazu egal ist, wie der Gegenspieler darauf antwortet?
Insgesamt gilt Poker als Spiel des INTELLEKTS, wie auch der COURAGE, womit das Spiel zwei Sphären berührt, in denen der Mensch sehr sensibel auf Kritik reagiert. Niemand gilt gerne als wenig intelligent oder gar feige. Aus diesem Grund bemühen sich analytische wie auch aggressive Spieler darum, ihr Ego vor Kränkung zu schützen. Die Poker-Antinomie bietet dabei ein hervorragendes Werkzeug, um sich die eigene Feigheit nicht eingestehen zu müssen: Solange der Bluff nämlich nicht profitabel sein dürfe, gibt es auch keinen Grund, den eigenen Mut unter Beweis zu stellen.
Definition. Die analytische Hälfte der Poker-Antinomie wird einer bekannten und durchaus richtigen Definition des Pokerspiels gerecht, und zwar derjenigen als KARTENSPIEL.
Poker mag zwar ein Kartenspiel sein, doch braucht es nicht unbedingt die besseren Karten, um zu gewinnen. Wir haben es auf recht ironische Weise mit einem Kartenspiel zu tun, bei dem man sich gar nicht für die Karten interessieren muss.
In dieser Hinsicht kann man in Poker auch ein WETTKAMPF-SPIEL sehen, in dem es darum geht, sich gegen andere Spieler durchzusetzen, und wo die Karten ohne Belang sind. Anstatt mit den eigenen Karten gegen die Karten des Gegenspielers anzutreten, spielt man auf einmal als Mensch gegen andere Menschen. Die Poker-Antinomie gestaltet sich hierbei wie folgt:
ERSTE DEFINITIONS-FORMEL der Poker-Antinomie
1. Kartenspiel: In Poker spielt man mit Karten gegen Karten.
2. Wettkampf-Spiel: In Poker spielt man als Mensch gegen Menschen.
Der Wettkampf-Aspekt des Spiels ist ein entscheidendes Argument, warum Poker kein reines Glücksspiel ist. Um nämlich von einem Glücksspiel sprechen zu können, müssten die Ergebnisse durch statistische Berechnungen vorhersehbar sein. Das ist jedoch nicht möglich, solange die Karten nicht aufgedeckt werden, und der Bluff sie obsolet macht.
Ansprüche und Willensstärke. Das Pokerspiel wehrt sich immer schon dagegen, bloß zum Spaß gespielt zu werden – wodurch auch eine bedeutsame Möglichkeit wegfällt, die eigenen Schwächen bzw. Niederlagen zu rechtfertigen. Wäre Poker nur ein „Spiel“, dann könnte man jederzeit sagen: „Mir war es nicht so wichtig, zu gewinnen.“ Stattdessen besitzt es jedoch eine maßgebliche Ernsthaftigkeit, die nicht ohne weiteres durch Spaß ersetzt werden kann. Wer deshalb den Spaß in den Vordergrund stellt, der überdeckt womöglich bloß den Ernst des Spiels, um sich nicht für die eigenen Verluste verantworten zu müssen.
In der Reflexion über den Spielcharakter von Poker ist eine bedeutsame Selbst-Reflexion enthalten – und zwar die Antwort auf die Frage, wie sehr man in Wirklichkeit gewinnen will. Versucht man, in Poker bloß ein Spiel zu sehen, dann offenbart sich darin die Unehrlichkeit sich selbst gegenüber. Man redet sich ein, nicht gewinnen zu wollen, weil man sich nicht eingestehen kann, nicht gewinnen zu können, falls man verlieren sollte.
Zusätzlich dazu bekommt das Pokerspiel hier das Gesicht einer sportlichen Disziplin, denn jeder Athlet muss sich fragen: Was will ich erreichen, und was bin ich bereit, dafür zu tun? Es geht also nicht nur darum, ehrlich sich selbst gegenüber zu sein; sondern man muss auch ANSPRÜCHE stellen können, und sie aktiv einfordern. Oder kurz: Man muss den Sieg auch wollen.
Hier stoßen wir erneut auf den Wettkampf-Aspekt des Pokerspiels, indem es die WILLENSSTÄRKE seiner Spieler auf die Probe stellt. Der Erfolg hängt demnach davon ab, wie sehr man bestrebt und in der Lage ist, sich gegen andere Spieler durchzusetzen.
Aus diesem Grund bin ich der Ansicht, dass erfolgreiche Pokerspieler unbedingt einen „Wettkampfgeist“ brauchen; und deshalb macht es auch Sinn, sich mit der Mentalität von Wettkämpfern zu beschäftigen.
Analytische Pokerspieler tendieren dazu, auf gute Karten zu warten, die nie gut genug sind. Ihr Pokerspiel ist konfrontationsscheu und entspricht nicht der Mentalität eines Wettkämpfers. Und obwohl sie einen Pot nach dem anderen verlieren, fühlen sie sich gleichzeitig tugendhaft. Sie sehen die Ausblendung der Emotion als eine ihre größten Stärken, während die vermeintliche Selbstbeherrschung zum Vorreiter einer im Grunde selbstverschuldeten Niederlage wird.
Motivation. Ein analytischer Spieler sieht den Wettkampf nicht, weil er der Ansicht ist, dass man die Karten nicht „austricksen“ könne. Dementsprechend wähnt er sich überhaupt von jeglichen unterbewussten Prozessen unabhängig.
Für die Berechnung eines statistischen Risikos muss man nicht ehrlich zu sich selbst sein oder irgendwelche Ansprüche stellen – sondern man gewinnt dann, wenn die Zahlen sagen, dass man gewinnt. Legen wir dem Pokerspiel eine rational-logische Vernunft zugrunde, dann gibt es keine verborgenen Mechanismen. Leiten wir hiervon doch eine Poker-Antinomie ab:
MOTIVATIONS-FORMEL der Poker-Antinomie
1. Vernunft: Pokerspieler treffen nur kontrollierte Entscheidungen auf Basis bewusster Überlegungen.
2. Trieb: Pokerspieler treffen unterbewusst motivierte und somit unvernünftige Entscheidungen.
Auf der ersten Seite der Poker-Antinomie gehorcht der Verstand vollständig seinen eigenen rationalen Vernunft-Kriterien. Wenn ein Spieler eine Entscheidung trifft, dann wird darunter das Resultat BEWUSSTER Überlegungen verstanden. Eins plus eins ist immer zwei, unabhängig davon, was ich mir als Ergebnis wünsche. Wo es jetzt aber keine „unterbewusste Vernunft“ gibt, kann auch das eigene Handeln nicht unterbewusst motiviert sein. Aus diesem Grund erlebt der analytische Spieler sein Handeln immer als KONTROLLIERT.
Selbstsabotage. Die Funktionsweise von Poker kann aber nicht zur Gänze mit Begriffen einer rationalen Vernunft erklärt werden, sondern das Pokerspiel gehorcht immer auch biologischen und psychologischen Gesetzen. So verspüren wir etwa eine Angst, wenn viel auf dem Spiel steht, oder wir zeigen unwillkürliche Poker-Tells, die uns nicht bewusst sind.
Unterbewusst motivierte Entscheidungen haben häufig die Gestalt einer SELBSTSABOTAGE: Ihr Prinzip liegt darin, ein kleines Übel in Kauf zu nehmen, um dadurch ein größeres zu verhindern. So entscheiden wir uns sogar freiwillig für eine Niederlage, sofern sie einen übergeordneten Zweck für uns erfüllt.
Stellen wir uns etwa vor, wir tragen ein großes Gefühl der Schuld mit uns, unter dem wir sehr leiden. Hier kann es dazu kommen, dass wir einer Strafe ent-gegensehnen, um unsere Schuld zu begleichen, und damit unsere quälenden Schuldgefühle zu besänftigen. Die Niederlage im Pokerspiel kann jetzt zur rituell vollzogenen Selbstbestrafung dienen. Dabei konstruieren wir unangenehme Niederlagen, weil wir sie brauchen, um uns besser über uns selbst fühlen zu können.
Ein entscheidender unterbewusster Prozess liegt für mich im SCHUTZBEDÜRFNIS DES EIGENEN EGOS. So leugnen analytische Spieler etwa die Profitabilität des Bluffs, um sich nicht für feige halten zu müssen, wenn sie folden. Solange ihr Ego verletzbar ist, müssen die Karten gleichfalls vor Kritik geschützt werden. Dadurch erweist sich die Auflösung der Poker-Antinomie auf die Seite der Karten aber auch als ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Und so sind sogar die Überzeugungen eines vernunftgelenkten Spiels (auf recht ironische Weise) von unterbewussten Mechanismen abhängig.
3 Der Zufall
Interpretationen der Freiheit. Die statistischen Berechnungen beruhen auf den Gesetzen des ZUFALLS. Dieser erlaubt zwar keine direkte Voraussage der nächsten Hand, doch ermöglicht er eine zuverlässige Schätzung anhand von Wahrscheinlichkeiten. Darüber hinaus macht er es als „höhere Macht“ aber auch möglich, Eigenverantwortung abzutreten.
Wenn wir uns zu einer Bet entschließen, dann setzen wir damit einen Willen in eine Handlung um. Überall dort aber, wo es einen Willen zum Handeln gibt, stellt sich auch die Frage nach seiner Freiheit.
Der aggressive Spieler möchte zunächst mit dem Bluff gewinnen, und fühlt sich demnach grundsätzlich von den Karten unabhängig. Sein Wille zum Handeln sollte frei sein. Beim analytischen Spieler müssen wir uns aber fragen, welche Auswirkungen der Zufall auf die eigene Willensfreiheit hat. Können wir nicht nur deshalb auf gute Karten setzen, weil der Zufall sie uns gewährt hat? Und folden wir nicht nur deswegen eine unterlegene Hand, weil uns eine bessere Alternative verwehrt worden ist? Wir können hier die folgende Poker-Anti-nomie formulieren:
ERSTE FREIHEITS-FORMEL der Poker-Antinomie
1. Unfreiheit: Der Zufall diktiert unser Handeln.
2. Freiheit: Unser Handeln ist frei.
Das große Problem des analytischen Spielers liegt hier darin, dass er seine vermeintliche Abhängigkeit vom Zufall eigentlich nicht zugeben darf. Dadurch würde er das Spiel nämlich zu einem reinen Glücksspiel machen und seine eigene Kompetenz infrage stellen. Gleichzeitig ist er aber darauf angewiesen, dass der Zufall eine Verantwortlichkeit für das eigene Handeln übernimmt, um das eigene Scheitern rechtfertigen zu können. Analytische Spieler scheinen also ständig zwischen zwei Interpretationen des Zufalls hin und her zu wechseln:
A. DER ZUFALL ALS VERBÜNDETER (WEICHE INTERPRETATION). Der Zufall gilt als gänzlich unparteiisch und fair, sodass auf lange Sicht jeder Spieler seinen „fair share“ bzw. fairen Anteil an guten Karten erhalten würde. In weiterer Folge würde es dem Pokerspieler selbst obliegen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Zufall allein würde keinen Spieler kompetent machen, sondern es käme vielmehr darauf an, wie man mit seinen Karten umgeht. Man würde zwar Glück brauchen, um zu gewinnen, doch sei es keine Garantie für einen Gewinn.
B. DER ZUFALL ALS SÜNDENBOCK (STRENGE INTERPRETATION). Gute Karten allein würden zwar nicht über den Ausgang eines Pokerspiels entscheiden können, doch müsse ein Gewinn von vornherein unmöglich sein, wenn der Zufall nicht auf der eigenen Seite steht. Solange man nur schlechte Karten bekommt, sei man ganz einfach den Launen des Zufalls „ausgeliefert“. Oder salopp formuliert: Ohne Karten kein Profit. In dieser „strengen“ Interpretation liegt die Verantwortung für den eigenen Erfolg zur Gänze beim Zufall.
Letztlich sind beide Interpretationen von einer für den analytischen Spieler typischen Unfreiheit geprägt. Diese steht dem freien Willen des aggressiven Spielers gegenüber, der scheinbar vom Zufall unbeeinflusst ist. Wie frei ist dessen Handeln aber tatsächlich? Kann ein Bluff denn gegen die beste Hand gewinnen? Der aggressive Spieler mag sich zwar für frei halten, doch deutet sich auch bei ihm die Unfreiheit des Zufalls an. Oder kurz gesagt: Die Karten machen immer unfrei.
Illusion. Die weiche Interpretation scheint auf den ersten Blick durchaus legitim. Ein Verlust muss hierbei nicht automatisch auf einem persönlichen Fehler beruhen, und so kann es auch notwendig sein, eine unterlegene Hand zu folden. Es würde bloß darum gehen, die „richtigen“ Entscheidungen zu treffen, und diese müssten nicht immer einen Profit bedeuten.
In einem solchen Fall verwandelt sich die weiche Interpretation des Zufalls jedoch plötzlich in eine strenge: Da man mit schlechten Karten nämlich nicht gewinnen könne, müsste der Zufall allein am eigenen Verlust schuld sein. Poker ist eben ein Spiel, wo man „alles richtig machen“ und trotzdem verlieren kann. Eine weit verbreitete Ansicht lautet demnach: „Pechsträhnen sind normal und gehören zum Spiel dazu.“ Diese Haltung ist aber durchaus problematisch, denn sie immunisiert einen Spieler gegen jede Eigen-Kritik.
Die Kombination beider Interpretationen des Zufalls ist sehr bequem, da sie die Rechtfertigung des eigenen Scheiterns ermöglicht, ohne sich eine unzureichende Kompetenz eingestehen zu müssen. Man könne noch so gut Poker spielen – es würde alles nichts bringen, solange die Karten unterlegen sind. Damit wird das „Aushalten-Können“ der Pechsträhne zum Prüfstein einer guten Spielweise, und der Fold zum Zeugnis der eigenen Kompetenz.
Demgegenüber kann es auch vorkommen, dass wir auf eine Hand setzen, von der wir nicht wissen, dass sie in Wirklichkeit unterlegen ist. Stellen wir uns doch die Situation vor, wonach wir unsere Karten falsch einschätzen und im Showdown gegen einen anderen Spieler verlieren. Hier mögen wir zwar einen Fehler gemacht haben, doch hätten wir sowieso nicht gewinnen können.
Auf diese Weise kann auch hier der Zufall als Sündenbock einspringen: Wie soll man sich denn selbst für einen Verlust verantworten, wo gar kein Gewinn möglich gewesen ist? Unter Zuhilfenahme des Zufalls kann man letztlich in jeder Spielweise eine gute Spielweise sehen.
Verbirgt sich in der weichen Interpretation nicht eine tiefe Unfreiheit? Können wir nicht nur deshalb auf gute Karten setzen, weil der Zufall uns von Pech verschont? Geht die weiche Interpretation des Zufalls nicht immer schon in der strengen Interpretation auf? Es drängt sich hier die Einsicht auf, dass jede „weiche“ Interpretation seit jeher bloß eine Illusion ist.
In dieser Hinsicht scheint der analytische Spieler zwar Verantwortung für sein Handeln übernehmen zu wollen – jedoch nur für seine Gewinne. Wenn man gewinnt, ist man kompetent; und wenn man verliert, dann ist der Zufall Schuld. Wie zuverlässig ist aber eine Einschätzung der eigenen Kompetenz, wenn es gar nicht möglich ist, inkompetent zu sein?
Wird der Zufall als Verbündeter hier nicht von seiner Funktion als Sündenbock „überschattet“? Offenbart sich in der selbstgerechten Beurteilung der eigenen Kompetenz nicht unsere Unfreiheit im Handeln? Solange wir nur für unsere Erfolge verantwortlich sein wollen, aber nicht für unsere Verluste – solange kann unser Handeln auch nicht als frei gelten. Denn überall dort, wo wir den Zufall als Sündenbock gebrauchen, diktiert er auch unser Handeln.
Wollten wir unser Handeln als frei begreifen, dann müssten wir beide Interpretationen des Zufalls ausschalten. Wir dürften in ihm weder einen Verbündeten noch einen Sündenbock sehen. Das bedeutet aber auch, dass wir vollständig die Verantwortung für unser eigenes Handeln übernehmen müssten: Ein freier Wille kennt keine fremde Schuld im Handeln, sondern nur die eigene.
Der Zufall verliert erst dann an Einfluss, wenn man zugibt, dass auch unterlegene Hände gewinnen können. Auf diese Weise ist es letztlich die Täuschungskomponente des Spiels, in der die eigentliche Freiheit eines Pokerspielers zum Ausdruck kommt. Das Spiel nach Karten will stattdessen die Lüge aus dem Spiel eliminieren und beschneidet gerade dadurch die eigene Freiheit.
Wer nicht lügen will, der braucht gute Karten, um zu gewinnen. Und wer nicht auf den Zufall angewiesen sein will, der muss ansonsten lügen können. Erst in der Lüge erlangt ein Pokerspieler seine Freiheit.
Entmenschlichung. Indem wir in Poker bloß ein vernunftgeleitetes Kartenspiel sehen, und uns hierfür dem Zufall anvertrauen, gelangen wir zu einer entscheidenden Konsequenz: Der Gegenspieler muss gar kein Mensch sein. Stattdessen wird er zuallererst durch die Karten repräsentiert, die er hat.
Die analytische Spielweise ist letztlich durch eine ENTMENSCHLICHUNG DES GEGENSPIELERS ausgezeichnet. Dies hat insbesondere damit zu tun, dass eine rational-logische Analyse (a) nichts mit den Motivationen und emotionalen Regungen von Menschen anzufangen weiß, sowie (b) gar nicht darauf angewiesen ist. Besonders deutlich wird dieser Aspekt natürlich im Online Poker, wo man gar nicht weiß, ob einem überhaupt ein Mensch gegenübersitzt.
Ein wesentlicher Punkt in diesem Kontext sind Poker-Tells. Manche Tells kann man nämlich nur dann wahrnehmen, wenn man seinen Gegenspieler auch als Menschen betrachtet. Beispiele hierfür sind eine pulsierende Halsschlagader oder wenn jemand beim Ansehen der Karten eine aufrechte Haltung einnimmt.
Daneben wird man aber auch verstärkt anfällig für die Lüge: Wo die Emotion nur als möglicher Störfaktor in Betracht gezogen wird. Die Folge ist eine Gutgläubigkeit, wonach man und dazu tendiert, einen Bluff zu glauben, anstatt die Wirklichkeit zu hinterfragen.
Wollte man den Gegenspieler als Menschen wahrnehmen, dann müsste man ihm jedenfalls die BEFÄHIGUNG ZUR LÜGE geben. Das ist aber nicht einfach so möglich, da es hieße, die Täuschung zu erlauben und sich auf ihre Freiheit einzulassen. Man müsste sich von den Fesseln des Zufalls befreien.
Umgekehrt kann man sich aber nicht vom Zufall losreißen, und sich auf einen Wettkampf einlassen, solange man im Gegenspieler keinen Menschen sieht. Damit wird das Mensch-Sein des Gegenspielers gleichermaßen zur hinreichenden wie notwendigen Bedingung für die eigene Freiheit: Wo es den Menschen gibt, dort wird man frei; und wo man frei sein will, dort braucht es den Menschen.
Analytische Spieler wollen das Spiel berechnen, und stoßen sich dabei am Problem, dass ein großer Faktor des Spiels – nämlich der Mensch – wesenhaft unberechenbar ist.
Entsubjektivierung und Solipsismus. Im analytischen Pokerspiel will man Entscheidungen treffen, die unabhängig von ihren Konsequenzen richtig sind. In der Spieltheorie würde man auch von einer „dominanten Strategie“ sprechen, wenn es egal ist, wie ein Gegenspieler handelt.
Ein analytischer Spieler macht seine Entscheidung aber nicht nur von den verschiedenen möglichen Handlungen des Gegenspielers unabhängig, sondern von seinem Handeln an sich. Es ist nicht bloß egal, was ein Gegenspieler macht, sondern ob er überhaupt etwas macht. Sein Handeln wird gar nicht in Erwägung gezogen. Ich spreche hierbei auch von einer QUASI-DOMINANTEN SPIELSTRATEGIE.
An dieser Stelle müssen wir überlegen, was es überhaupt bedeutet, handeln zu können. Das Handeln ist nämlich nicht nur eine Kompetenz unter vielen, sondern es ist auch entscheidend für unser Selbst-Verständnis als SUBJEKTE. Ohne Handeln sind wir bloß leblose Marionetten – und unser Tun ist nur mehr das Werk eines übermenschlichen Puppenspielers, der an Fäden unserer Glieder zieht. So mögen wir zwar in Bewegung sein, doch handeln wir nicht: Wir bewegen uns nämlich nicht selbst, sondern wir werden bewegt.
Indem sich der analytische Spieler nicht für das Handeln seines Gegenspielers interessiert, muss er ihn auch nicht als Subjekt begreifen, sodass es zu seiner ENTSUBJEKTIVIERUNG kommt.
Diese hat jetzt eine gravierende Konsequenz: Sie richtet die eigene Aufmerksamkeit strikt nach innen. Auf einmal ist es egal, was der Gegenspieler macht. Das einzige, was zählt, ist das eigene Handeln. Wo der Gegenspieler weder fühlen noch denken kann, ist es nicht mehr möglich, sich in diesen hineinzuversetzen. Er wird zu einer Statue ohne Herz und Hirn. In der Poker-Antinomie stellt sich diese Einstellung wie folgt dar:
ERSTE ERKENNTNIS-FORMEL der Poker-Antinomie
1. Solipsismus/Ich-Fokus: Die Welt besteht nur aus Objekten. Es sind keine anderen Welten denkbar als die eigene.
2. Realismus/Du-Fokus: Gegenspieler sind handlungskompetente Subjekte, die eine eigene Welt besitzen.
Hierbei handelt es sich um zwei verschiedene erkenntnistheoretische1 Zugänge zur Wirklichkeit. Für den analytischen Spieler besteht die Welt nur aus Objekten und es gibt keine anderen Subjekte außer ihm selbst. Das bedeutet aber auch, dass kein anderes Bewusstsein außer das eigene existiert – und somit auch keine andere Welt.
Hier kann man dem analytischen Spieler durchaus einen gewissen SOLIPSIS-MUS vorwerfen. Im philosophischen Sprachgebrauch versteht man darunter eine Position, wonach allein vom eigenen Bewusstsein eine gesicherte Existenz behauptet werden kann. Demnach darf es auch keine anderen Bewusstseine geben, und so ist die Wirklichkeit auch nur in der eigenen Bewusstwerdung verständlich. Für einen analytischen Spieler gibt es keine andere Welt als die eigene.
Gäbe es fremde Bewusstseine, dann würde die Welt an Objektivität einbüßen, indem sie subjektiv erfahrbar wird. Der aggressive Spieler geht dementsprechend davon aus, dass verschiedene Spieler eine unterschiedliche Einschätzung der Wirklichkeit haben, indem diese unabhängig von einem selbst existiert und bloß die Vorlage für ihre Wahrnehmung bildet. Es handelt sich dabei um die Position des REALISMUS.
Die solipsistische Weltsicht kommt der Sehnsucht nach der Eindeutigkeit des Objektiven sehr entgegen: Indem nämlich keine andere Perspektive auf die Welt möglich ist, verhindert sie die Lüge. Und wo es keine Lüge geben kann, müsse man auch nicht um die Objektivität der Realität fürchten.
Werfen wir einen Blick auf die zweite Seite der Poker-Antinomie, so muss der aggressive Spieler seinen Gegenspieler zwangsläufig als Subjekt sehen, um ihm die Möglichkeit der Lüge geben zu können. Gleichzeitig muss er aber auch deshalb ein Subjekt sein, damit man ihn zum Opfer der eigenen Lüge machen kann.
In dem Moment, wo die Lüge Einzug ins Pokerspiel hält, wird die Aufmerksamkeit von einem selbst notwendigerweise nach außen gerichtet. Eine Spielentscheidung kann dann nicht mehr unabhängig vom Handeln des Gegenspielers betrachtet werden. Ein Bluff hat ja überhaupt nur dann Erfolg, wenn der Gegenspieler foldet – wodurch die Konsequenzen des eigenen Handelns mindestens genauso wichtig werden wie das Handeln selbst.
Der analytische Spieler mag durchaus versucht sein, seine Entsubjektivie-rung des Gegenspielers zu verleugnen. So gibt es etwa den Begriff der „Fold Equity“, wenn man sich selbst ein Gewinn-Potential zuschreibt, das von der Fold-Wahrscheinlichkeit des Gegenspielers abhängt. Für mich ist das jedoch bloß ein Versuch, den Widerspruch im Rahmen der Poker-Antinomie zu beseitigen, ohne sich wirklich auf die aggressive Hälfte einlassen zu müssen, denn: Es gibt kein Handeln in Wahrscheinlichkeiten.
Analog dazu gibt es ein Spielmanöver, das gelegentlich als „Gegenteil“ bzw. Umkehrung des Bluffs gehandelt wird, und zwar die TRAP. In diesem Manöver setzt man bewusst wenig, um eine starke Hand zu vertuschen. Ein solches Spielmanöver entspricht für mich jedenfalls keiner analytischen Mentalität:
1) Um die Trap anwenden zu können, dürften nicht allein die Karten das eigene Handeln bestimmen.
2) Damit eine solche Lüge möglich ist, müsste der eigene solipsistische Blick nach außen gerichtet werden.
Unendlich. Das statistische Risiko ermöglicht eine ANTIZIPATION DER ZUKUNFT. Doch geht es dabei nicht um die konkrete Realisation eines bestimmten Ereignisses. So kann mir ja auch die 50%ige Wahrscheinlichkeit eines Münzwurfes nicht sagen, wie der nächste Wurf ausgehen wird. Die Statistik macht stattdessen Annahmen über einen längeren Zeitraum.
Gehen wir vom Beispiel aus, wonach wir eine 20%ige Gewinnwahrscheinlichkeit haben. Im Grunde beziehen wir uns hier auf eine abstrakte Sammlung unendlich vieler Wiederholungen derselben Hand. Das Ergebnis unserer Hand scheint zwar in der Wirklichkeit fundiert zu sein, doch befindet es sich zunächst bloß im fiktiven Pool unendlich vieler ungespielter Hände.
Der analytische Spieler projiziert diesen unendlichen Pool nun auf eine ebenso unendliche Zukunft. Mit ihrer vermeintlichen Unendlichkeit ist auch die Zukunft allein in der Lage, dem Versprechen der Statistik gerecht zu werden. Das Fazit lautet dahingehend, dass ein analytischer Spieler zu jedem gegenwärtigen Zeitpunkt immer schon Gewissheit über seine Zukunft zu haben vermeint.
Logischer Determinismus. Die rational-logische Vernunft des analytischen Spielers kennt keine Grauzonen von Wahrheit: Entweder etwas ist wahr oder es ist falsch. Darin liegt überhaupt der Grund für die große Sehnsucht des analytischen Spielers nach der Rationalität der Logik: Sie kann nämlich die Wahrheit garantieren und macht es möglich, mit Sicherheit für die Richtigkeit einer Spielentscheidung zu argumentieren.
Die logische Wahrheit mathematischer Aussagen ist aber auch die Quelle eines LOGISCHEN DETERMINISMUS. Dieser beinhaltet die Vorherbestimmung der Zukunft, indem sämtliche Aussagen über sie im Voraus bereits wahr oder falsch sein müssen.
Dabei darf sich der Wahrheitswert im Verlauf nicht ändern. Stellen wir uns doch vor, wir werfen sechs Mal hintereinander eine Münze. Zeigt diese jetzt sechs Mal Kopf, dann hat die Wahrscheinlichkeit für jeden Wurf trotzdem immer noch bei 50% gelegen, dass entweder Kopf oder Zahl zu liegen kommt.
In diesem logischen Determinismus liegt letztlich auch das fehlende Glied zwischen dem Zufall und dem eigenen Profit, denn ohne ihn wäre es nicht möglich, vom Zufall zu profitieren. Die analytische Spielweise funktioniert nur dadurch, dass man abstrakte Prognosen als Vorherbestimmung einer ungeschehenen Zukunft deuten kann. Oder anders formuliert: Als analytischer Spieler muss man glauben, seine Zukunft „berechnen“ zu können.
Die Sicherheit unserer Prognose gerät jedoch in Konflikt mit der Ungewissheit ihrer konkreten Realisation. Wir wissen zwar, dass in 50% der Fälle Kopf zu liegen kommen muss – doch verrät uns das nicht den Ausgang des Münzwurfs.
Es ist uns unangenehm, auf eine Hand setzen zu müssen, die in vier von fünf Fällen verliert – doch können wir nicht anders. Das Risiko macht uns unsere Unfreiheit bewusst, der wir uns widersetzen wollen. Unser Hoffen auf ein günstiges Ergebnis resultiert darum nicht nur aus einer Ungewissheit heraus, sondern es entspricht überhaupt einem Verlangen nach Freiheit.
Die Wirklichkeit des aggressiven Spielers kennt zwar eine Kausalität, aber keine kausale Determiniertheit. Das Vorhandensein von Ursache-Wirkungs-Beziehungen allein muss noch keine vorherbestimmte Zukunft bedeuten. Und die Kausalität der Wirklichkeit muss nicht notwendigerweise die Freiheit unseres Willens aufheben. Wir können hier eine neue Poker-Antinomie formulieren:
DETERMINISMUS-FORMEL der Poker-Antinomie
1. logisch determiniert: Die Zukunft ist gewiss und unveränderlich.
2. indeterminiert: Die Zukunft ist ungewiss und veränderlich.
Kollektiv. Ich vertrete die These, dass ein analytischer Spieler nicht auf individuelle Unterschiede seiner Gegenspieler Rücksicht nimmt. Er spielt nie gegen konkrete Gegenspieler, weil er gar nicht in der Lage ist, sie voneinander zu unterscheiden. Stattdessen kommt es hier zu einer DE-INDIVIDUALISIERUNG DES GEGENSPIELERS. Wenn man analytisch Poker spielt, dann spielt man nie gegen Individuen, sondern der eigene Blick ist vielmehr KOLLEKTIVISTISCH. Mitunter ist es nicht einmal notwendig, zwischen den Handlungen einzelner Gegenspieler zu unterscheiden, wenn diese nacheinander handeln.
Jede Form von Individualität muss unweigerlich zu Konflikten führen: Auf einmal tut sich nämlich die Frage nach der Freiheit des eigenen Willens auf, nach der Determiniertheit der eigenen Zukunft sowie nach der Möglichkeit „unvernünftiger“ Spiel-Entscheidungen – wenn nicht überhaupt deren Profitabilität. Die Existenz des Individuums eröffnet am Ende sogar die Möglichkeit der Lüge und damit des Bluffs. Hierdurch würde die gesamte objektive Realität an Eindeutigkeit verlieren, während die Sicherheit des rational-logischen Denkens verloren zu gehen droht.
Will man einen Gegenspieler als Individuum betrachten, dann muss man sich unweigerlich auf die zweite Hälfte der Poker-Antinomie einlassen. Ihr Gegensatz stellt sich wie folgt dar:
GEGENSPIELER-FORMEL der Poker-Antinomie
1. kollektivistisch: Alle Gegenspieler sind gleich.
2. individualistisch: Alle Gegenspieler sind voneinander unterschieden.
Durch die Individualität des menschlichen Denkens und Fühlens lassen sich Entscheidungen am Pokertisch nicht verallgemeinern. Jede Berechnung von Wahrscheinlichkeiten macht aber genau das: Sie gibt Zahlen für eine Situation an, die grundsätzlich nicht berechnet werden kann, weil das Pokerspiel nicht alleinig in den Karten aufgeht. Der analytische Spieler begeht den fatalen Irrtum, dass er den Faktor Mensch ausklammert und jeden Gegenspieler gleich behandelt.
1 Die Erkenntnistheorie als philosophische Disziplin beschäftigt sich u.a. mit den Bedingungen von Wahrheit.
4 Der Poker-Mythos
Definition. Der analytische Spieler hat seine Entsprechung im echten Leben: Es handelt sich dabei um den Gegenspieler, der ständig foldet, grundsätzlich nicht mit einem Bluff rechnet, und sich auch nicht gegen einen Bluff wehrt, weil er selber nicht bluffen kann.
Es ist sein Anspruch, das gesamte Spiel auf rein rational-logische Weise erklären und spielen zu können. Alle notwendigen Informationen seien demnach immer schon in den Karten enthalten. Dabei handelt es sich für mich jedoch um den wahrscheinlich größten Irrglauben in Bezug auf Poker, den es gibt – welchen ich auch als POKER-MYTHOS bezeichne.
Für mich resultiert er aus dem weit verbreiteten und hartnäckigen Wunsch, die Poker-Antinomie auf die Seite der Karten aufzulösen. Stellen wir uns doch jemanden vor, der seine erste Partie Poker spielt. Er kennt lediglich die Grundregeln des Spiels, weshalb er mit den vielen Eindrücken, die auf ihn einprasseln, überfordert ist. Die Frage, die ihm wahrscheinlich als Erstes durch den Kopf schießt, wird sein: Sind meine Karten gut genug?
Poker ist ein scheinbar einfaches Spiel, dessen Lösung nicht kompliziert genug sein kann. Woher kommt aber diese absonderliche Komplexität des Spiels? Hier sage ich: Vom Menschen her! Es ist die zweite Seite der Poker-Antinomie, die die analytische Spielweise so hartnäckig bemüht ist zu leugnen.
Virtuell. Mathematisch orientierte „Lösungsversuche“ von Poker gewannen vor allem durch das Aufkommen von ONLINE POKERRÄUMEN an Popularität. Ein solches Pokerspiel ist VIRTUELL. Es entspricht einer Transformation der im Spiel involvierten Gegenstände und Prozesse in eine virtuelle Form. Dabei passieren zumindest zwei entscheidende Dinge:
a) Der Vollzug von Spielentscheidungen wird zur Gänze auf ihr Ergebnis reduziert.
Im „realen“ Pokerspiel muss der eigene Wille nicht bloß in einen unsichtbaren Mausklick übersetzt werden, sondern er entspricht einer wahrnehmbaren körperlichen Reaktion. Das Handeln entspricht einem Vollzug. Im virtuellen Pokerspiel wird jedoch der ereignishafte Charakter des Handelns überbetont. Es scheint egal zu sein, warum sich jemand für eine bestimmte Handlung entschieden hat. Es geht nicht einmal mehr darum, ob jemand raist, sondern stattdessen bloß um „das Raise“.
Der Unterschied zwischen Vollzug und Ergebnis geht letztlich auf zwei verschiedene Vorstellungen zeitlicher Wirklichkeiten zurück, wonach eine Wirklichkeit entweder als VORGANG oder als EREIGNIS begriffen wird.
Sehen wir uns zunächst den Vorgang an, so ändert sich die Wirklichkeit dort in einem zeitlichen Ablauf. Dies ist für ein Verständnis der Kausalität wichtig und um eine Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wirklichkeiten denken zu können.
Im analytischen Pokerspiel besteht die Wirklichkeit jedoch nicht aus Vorgängen, sondern aus Ereignissen. Und nacheinander stattfindende Ereignisse kennen keine Veränderung. Sie haben keine Verbindung miteinander, sodass es auch keine Ursachen gibt. Unterschiedliche Wirklichkeiten begründen sich deshalb nicht gegenseitig, sondern lediglich sich selbst.
b) Sämtliche gegenständlichen Elemente des Spiels werden aufgelöst und auf ihren logischen Gehalt reduziert.
Es gibt keinen Dealer mehr, der die Karten austeilt, keinen Chip-Stapel und auch keine körperlich präsenten Gegenspieler. Stattdessen kommt es zu einer starken Abstraktion vom Spielgeschehen, bei der die gesamte Wirklichkeit in logische Gegenstände übersetzt wird.
Die allergrößte und einschneidendste Abstraktion passiert hierbei durch die vollständige Elimination der körperlichen Präsenz sämtlicher Spieler. Damit kommt es im Grunde auch zur vollständigen Elimination von Poker-Tells.
Sprechen wir noch über die LEIBLICHKEIT. Die deutsche Sprache macht es möglich, zwischen einem „Körper“ und einem „Leib“ zu unterscheiden, und so prägte der deutsche Philosoph HELLMUTH PLESSNER in seiner Philosophischen Anthropologie die zwei sich ergänzenden Begriffe von „Körper-Haben“ und „Leib-Sein“.
Im philosophischen Diskurs wurde das Problem der Leiblichkeit ausführlich diskutiert. Unser Körper ist dabei nicht bloß ein Ding wie jedes andere, das einen Raum einnimmt, und das man messen und beschreiben kann. Sondern in der Perspektive des Leibes ist er auch das Medium, das uns in der Welt verankert.
Wir „haben“ demnach zwar einen Körper – doch „sind“ wir ebenfalls ein Leib. Der französische Philosoph MERLEAU-PONTY sieht im Leib überhaupt eine existenzielle Bedingung des Menschen: „Der Leib vermag die Existenz zu symbolisieren, weil er selbst sie erst realisiert und selbst ihre aktuelle Wirklichkeit ist.“2
Um die Leibhaftigkeit eines Gegenspielers zu ergründen, braucht es jedoch dessen körperliche Präsenz – was der Online Pokerraum gerade dadurch verhindert, dass er seine Spieler „unsichtbar“ macht. Indem die körperliche Präsenz keine Rolle spielt, scheint die leibliche Existenz eines Spielers überhaupt unbedeutend zu sein. Das virtuelle Pokerspiel zerstört damit eine wesentliche Existenzbestimmung des Pokerspielers. Den analytischen Spieler kümmert das alles nicht: Er spielt ja nicht gegen Menschen, sondern gegen Karten.
Die Körperlichkeit des Menschen ist jedoch sehr bedeutsam, weshalb es auch Diskussionen darüber gibt, ob man bestimmte Accessoires am Pokertisch verbieten sollte. So gibt es etwa viele Dinge, die helfen, das Gesicht zu verdecken – wie Sonnenbrillen oder Schals. Die Mimik und die Augen sind wichtige Entstehungsorte von Poker-Tells. In ihnen offenbart sich die menschliche Komponente des Spiels. Ein altes Sprichwort sagt: „Die Augen sind das Tor zur Seele.“ Das gilt ganz besonders für Poker. Wer seine Augen hinter einer Sonnenbrille versteckt, der will sich über die Auslöschung seiner Körperlichkeit als Mensch aus der Spielsituation herausnehmen, indem er seine leiblich verfasste Existenz als Pokerspieler verbirgt.
Zuerst könnte man unter dem Aufsetzen einer Sonnenbrille bloß den einfachen Versuch sehen, die Produktion von Poker-Tells zu verhindern, welche die eigene Täuschungsabsicht sabotieren könnten. Dabei ist der Effekt viel tiefgreifender: In der Verhinderung der eigenen leiblichen Präsenz wird der Gegenspieler nämlich aufgefordert, sich lediglich auf die Karten und nicht auf den Menschen dahinter zu konzentrieren.
Wahrheit. Die Karten gelten als REPRÄSENTANTEN bzw. TRÄGER DER WAHRHEIT. Sie scheinen den Zugang zu einer Erkenntnis zu ermöglichen, die unveränderlich bzw. unkorrigierbar ist. Ihre Wahrheit sei unhintergehbar; und hinter jeder Lüge müsse eine objektive Realität stehen, die dem Einflussbereich der Täuschung unzugänglich ist.
Der analytische Spieler assoziiert mit den Karten eine Wahrheit, die unvollständig ist: Zum einen ist der Ausgang des Spiels von fünf Gemeinschaftskarten abhängig, die erst im Laufe eines Spiels aufgedeckt werden müssen. Andererseits sind auch die Karten des Gegenspielers verdeckt und nicht unmittelbar in Erfahrung zu bringen.
Das alles hindert den analytischen Spieler jedoch nicht, nach der Erkenntnis einer vollständigen Wahrheit zu streben. Er versucht, seine Erkenntnislücken durch die Anwendung mathematischer und statistischer Methoden zu schließen. Kurz: Die Vernunft wird zum Werkzeug der Erkenntnis.
Für den analytischen Spieler wird die mathematische bzw. statistische Berechnung zur LOGISCHEN WAHRHEIT. Hat man durch die objektive Realität der Karten zunächst bloß Zugang zu einer bruchstückhaften Wahrheit, so wird sie im rational-logischen Denken allmählich vollständig. Für den analytischen Spieler ist die Unvollständigkeit der objektiv erfahrbaren Wirklichkeit kein Hindernis. Im Gegenteil: Sie ist vielmehr Ausgangspunkt einer Erkenntnis durch Vernunft.
Nachteile. Der analytische Spieler strebt grundsätzlich nach Wahrheit – womit auch gewisse Nachteile verbunden sind. Ich möchte hier zwei anführen:
1) Zum einen liegt darin einer der Gründe für seine GUTGLÄUBIGKEIT: Der analytische Spieler sehnt sich so sehr nach der Wahrheit, dass er blind für die Unwahrheit wird. Seine Spielentscheidungen basieren auf logischen Wahrheiten: Er „braucht“ quasi die Wahrheit und fängt mit der Unwahrheit eigentlich nichts an. Wenn überhaupt, stört die Lüge bloß, indem sie den Blick auf die Wahrheit verstellt. Die Welt des analytischen Spielers muss wahr sein, damit sie Sinn macht. Nur die wahre Erkenntnis könne der Ausgangspunkt von Wissen sein.
Der analytische Spieler verbietet sich überhaupt die Möglichkeit der Unwahrheit: Seinem Wissen würde immer die objektive Realität der Karten zugrunde liegen, und deren Wahrheit müsse unkorrigierbar sein. Er argumentiert: Wenn alle Vernunft vom Unkorrigierbaren ihren Ausgang nimmt – wie kann dann ihr Ergebnis noch bezweifelt werden?
2) Sosehr der analytische Spieler auch nach Wahrheit strebt, so kann er der INTERPRETATIONSBEDÜRFTIGKEIT des Spiels dennoch nicht entgehen. Der analytische Spieler will aber nicht „raten“; und er will auch keine Risiken eingehen, wenn er ihnen keine wahre Erkenntnis zugrunde legen kann. Darin liegt seine RISIKO-SCHEUE.
Das Verlangen eines analytischen Spielers „auf Nummer sicher“ zu gehen, mag viele Ursachen haben. Ein fundamentaler Grund ist aber das Streben nach Wahrheit. Ein analytischer Spieler will sich auf die Objektivität seiner Welt verlassen können. Auf diese Weise schreckt er schließlich vor Risiken zurück, die nicht eindeutig aus der objektiven Realität hervorgehen.
Unwahrheit. Der aggressive Spieler hat ganz klar einen anderen erkenntnistheoretischen Zugang zur Wirklichkeit (einige Punkte werden im Laufe des Buches näher erläutert):
1) In der Anwendung der Lüge will er nicht die Wahrheit aufdecken, sondern er will selbst Unwahrheiten erzeugen. Die Welt soll also gar nicht wahr sein.
2) Für den aggressiven Spieler gibt es keine unmittelbar zugängliche Wahrheit, da sich ihre Erkenntnis der Aufdeckung der Täuschung verdankt. Dabei ist jede Wirklichkeit immer schon Gegenstand einer allgegenwärtigen Lüge.
3) Die Erkenntnis einer vollständigen Wahrheit sei unerreichbar, weshalb es auch keinen Sinn machen würde, nach ihr zu streben. Die Vernunft könne grundsätzlich keine Erkenntnislücken schließen.
4) Der aggressive Spieler kennt keine logische Wahrheit. Demnach verlässt er sich auch nicht auf die Vernunft, sondern auf seine Intuition. Seine Spielentscheidungen basieren auf einer gefühlsmäßigen Erschließung der Wirklichkeit.
5) Die objektive Realität der Karten sei nicht unkorrigierbar, sondern könne ebenfalls verfälscht werden. So kann man etwa nur so tun, als würde man bluffen, damit der Gegenspieler die Lüge aufdeckt – während man in Wirklichkeit eine starke Hand hat. Hierbei spreche ich auch von einer indirekten Täuschung.
6) Die Interpretation des Handelns könne nicht zur Wahrheit führen. Zum einen gilt das Handeln von den Objekten der Welt unabhängig. Andererseits sei es nicht repräsentativ für die Karten eines Spielers, sondern stattdessen für sein Begehren.
7) Die Wahrheit könne sich nicht offenbaren, solange es gar nicht zum Showdown kommt. In diesem Sinne will der aggressive Pokerspieler auch mit der unterlegenen Hand gewinnen, ohne sie herzeigen zu müssen.
In Zusammenschau können wir eine neue Poker-Antinomie formulieren:
ZWEITE ERKENNTNIS-FORMEL der Poker-Antinomie
1. Die Wahrheit liegt in den Karten und der Vernunft.
2. Alles Wirkliche ist unwahr.
Einen aggressiven Spieler interessiert die Wahrheit der Karten zunächst nicht. Er interessiert sich bloß dafür, auf welche Weise er belogen wird und wie er selbst seinen Gegenspieler belügen kann. Damit hat er eine SKEPTISCHE Haltung, die der Gutgläubigkeit des analytischen Spielers entgegengesetzt ist: Der aggressive Spieler traut seinen Gegenspielern grundsätzlich nicht.
Für einen aggressiven Spieler ist die Wirklichkeit keine objektive Vorlage, die durch den Zufall vorherbestimmt ist, sondern sie ist zuallererst ein Erzeugnis von Spielern. Sie ist immer schon manipuliert und manipulativ zugleich; oder kurz: Man sieht nur das, was man auch sehen soll. Dadurch erhält sie die AURA DES KÜNSTLICHEN bzw. GEMACHTEN.
Abhängigkeiten. Analytische und aggressive Spieler treffen ihre Entscheidungen aufgrund unterschiedlicher Informationen. So braucht der analytische Spieler etwa eindeutige Fakten als Grundlage für seine Entscheidungen – ein Anspruch, den die Karten als Repräsentanten der Wahrheit erfüllen. In diesem Sinne ist sein Handeln auch von den Karten abhängig: Sie sind die Ausgangsbasis sämtlichen Wissens über die Welt.
Ein aggressiver Spieler hingegen ist nicht daran interessiert, die Wahrheit ans Licht zu bringen, und hält die objektive Realität der Karten überhaupt für bedeutungslos. Sein Handeln ist letztlich von den Karten unabhängig. Im Rahmen der Poker-Antinomie stellt sich der Unterschied wie folgt dar:
ABHÄNGIGKEITS-FORMEL der Poker-Antinomie
1. abhängig: Die eigene Handlung basiert auf einer Einschätzung der Karten.
2. unabhängig: Die Karten spielen keine Rolle für das eigene Handeln.
Wir können uns die Abhängigkeit von den Karten bzw. ihrer Stärke durchaus als mathematische Funktion vorstellen, wonach die eigene Handlung eine Abbildung der Karten ist, die man hat. Doch ist dies nicht ganz unproblematisch.
Stellen wir uns doch vor, dass wir am Flop mit einem Raise konfrontiert werden und folden, weil wir unsere Karten für zu schlecht halten: Haben wir jetzt wirklich wegen unserer Karten gefoldet? Oder war der Grund nicht doch das Raise unseres Gegenspielers?
Für einen analytischen Spieler liegt das Problem darin, dass er nicht zugeben kann, wegen der Handlung des Gegenspielers gefoldet zu haben. Dies würde nämlich bedeuten, dass das eigene Handeln von den Objekten der Welt (und damit den Karten) unabhängig sein kann, während sich dadurch gleichzeitig die eigene Unfreiheit durch den Zufall offenbart.
Ein analytischer Spieler wehrt sich vehement gegen diese Vorstellung, weil sie die Möglichkeit eines freien Handelns eröffnen würde, und zudem die logische Determiniertheit der Zukunft gefährdet. Die Richtigkeit einer Entscheidung wäre stattdessen an die Konsequenzen des eigenen Handelns gebunden, für die man auch noch selbst Verantwortung übernehmen müsste.
Da der aggressive Spieler von den Karten unabhängig sein will, beeinflussen sie seine Entscheidungen auch nicht. Er macht sein eigenes Handeln stattdessen von den Handlungen seiner Gegenspieler abhängig – wobei gerade die Vorstellung zukünftigen Handelns der wesentliche Ansporn für einen Bluff ist. Die Grafik (Abb. 4.1, links) stellt die Ansichten des analytischen und aggressiven Spielers gegenüber.
Abb. 4.1 Abhängigkeiten analytischen und aggressiven Handelns (links), sowie die Moderator-Funktion der Karten (rechts)
Moderator-Funktion. Versuchen wir doch eine Versöhnung dieser beiden Hälften. Hierfür wollen wir einer Seite den Vorrang lassen, aber welcher?
Mit den Karten haben wir ein Problem: Die Abhängigkeit von den Karten ist nämlich mit einer Unfreiheit durch den Zufall verknüpft ist. Und wo man unfrei ist, kann man sich nicht zu einem freien Handeln entschließen – sonst wäre man ja gar nicht unfrei.
Umgekehrt ermöglicht die Freiheit des Bluffs lediglich die Imitation eines unfreien Handelns. Es entsteht bloß ein ANSCHEIN DER UNFREIHEIT.
Dieses Dilemma können wir nicht lösen, solange wir entweder mit den Karten oder dem Bluff gewinnen wollen. Um zu einer Lösung zu gelangen, dürfen wir keine der beiden Seiten eliminieren. Ein analytischer Spieler darf demnach die Profitabilität des Bluffs nicht leugnen, obwohl er mit den Karten gewinnen will. Sondern er müsste akzeptieren, dass er auch mit einem Bluff gewinnen könnte.
Letztlich nehmen die Karten für mich eine Vermittlerrolle ein: Anstatt bloß unabhängige Variable einer mathematischen Funktion zu sein, erfüllen sie die Aufgabe eines MODERATORS. Dabei handelt es sich um einen Begriff aus der Statistik. Er beschreibt, wie der Effekt einer unabhängigen auf eine abhängige Variable ausfällt. Die Grafik (Abb. 4.1, rechts) soll dies illustrieren.
Poker-Paradigmen. Jede Welt hat GESETZE, nach denen sie funktioniert. Unsere physikalische Welt gehorcht etwa den Naturgesetzen, sodass ein Apfel auch nach unten fallen muss, wenn ich ihn fallen lasse. Ein Pokerspieler befindet sich ebenfalls in einer Welt, für die es bestimmte Gesetze geben muss.
Betrachten wir zunächst die Welt des analytischen Spielers, so haben wir es mit einer Welt zu tun, die LOGISCH dargestellt und RATIONAL erklärt werden kann. Die Gesetze des analytischen Spielers müssen deshalb auch einer solchen Weltsicht gerecht werden. Sie müssen statistische Berechnungen und logische Operationen ermöglichen. Dementsprechend sind es auch MATHEMATISCHE sowie LOGISCHE GESETZE, die die Welt des analytischen Spielers zusammenhalten.
Wenden wir uns stattdessen dem aggressiven Pokerspiel zu, dann müssen wir auf andere Dinge Rücksicht nehmen. Die zwei folgenden Punkte zeichnen die Welt des aggressiven Spielers in besonderem Maße aus:
1) Es gibt keine vor uns ausgelegte bzw. „fertige“ Welt, die gänzlich objektiv ist und nur mehr darauf wartet, von uns untersucht zu werden. Stattdessen müssen wir die Gegenstände unserer Welt erst aktiv wahrnehmen und interpretieren. Ein Poker-Tell existiert beispielsweise erst dann, wenn wir ihn sehen und richtig bestimmen.
2) Der Gegenspieler gilt weniger als denkende Maschine, denn als fühlendes Wesen, das auch unterbewusst motivierte Entscheidungen treffen kann. Die Existenzweise des Pokerspielers ist keine rational-logische, sondern überhaupt eine leibliche. Demnach fühlen wir uns auch Bedrohungen ausgesetzt, auf die wir mit körperlichem Stress und Angst reagieren.
Es sollte nicht verwundern, wenn ich sage, dass wir mit mathematischen und logischen Gesetzen hier nicht unser Auslangen finden. Es müssen vielmehr Gesetze her, die auf die Erkenntnisse der medizinischen, biologischen und psychologischen Wissenschaft zurückgreifen. Wir brauchen sowohl PSYCHOLOGISCHE als auch BIOLOGISCHE GESETZE.
Darüber hinaus braucht es eine Vernetztheit von Psychologie und Biologie, weil die beiden Systeme vielfach nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. So ist die Angst etwa ein psycho-biologisches Phänomen: Auf der einen Seite ist es mit einem Gefühl der Bedrohung verbunden und eine unterbewusste Reaktion. Auf der anderen Seite kommt es jedoch zu einer Aktivierung bestimmter Gehirnareale und in weiterer Folge zur Ausschüttung von Hormonen, die eine körperliche Stress-Reaktion auslösen.