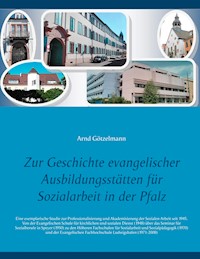
Zur Geschichte evangelischer Ausbildungsstätten für Sozialarbeit in der Pfalz E-Book
Arnd Götzelmann
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bald nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde in der Pfalz nach einer Möglichkeit gesucht, Fachkräfte für den Neuaufbau des Jugendpflege-, Fürsorge- und Wohlfahrtswesens in einer protestantischen Ausbildungsstätte zu qualifizieren. Vorbilder solcher evangelisch-sozialen Frauen- oder Wohlfahrtsschulen gab es seit Beginn des 20. Jahrhunderts auch in umliegenden Gebieten. Die Folgen des Zweiten Weltkrieges hatten es allerdings schwer gemacht, solche Ausbildungsstätten wieder oder neu zu eröffnen. Der Bedarf an Sozialarbeit und dafür gut ausgebildeten Fachkräften war angesichts der Nachkriegsnöte und sozialen Probleme jedoch groß. Die Verantwortlichen in der Pfälzischen Landeskirche gründeten im Jahr 1948 die "Evangelische Schule für kirchlichen und sozialen Dienst" in Speyer und boten dort zunächst zwei Ausbildungsgänge für Gemeindehelferinnen und für Wohlfahrtspflegerinnen an. Damit war die erste protestantische Ausbildungsstätte für Sozialarbeit und Gemeindepädagogik in der Pfalz und für Rheinland-Pfalz eröffnet. Aus ihr ging mit der staatlichen Anerkennung im Jahr 1950 das "Seminar für Sozialberufe", ab 1964 mit dem Zusatz "Höhere Fachschule für Sozialarbeit", hervor, das 1970 nach Ludwigshafen am Rhein in einen Neubau umzog und dort noch für ein gutes Jahr zu den "Höheren Fachschulen für Sozialarbeit und Sozialpädagogik" umfirmierte bzw. erweitert wurde, bevor diese in der zum Oktober 1971 eröffneten Fachhochschule der Pfälzischen Landeskirche aufgingen. Die vorliegende Untersuchung möchte gleichermaßen einen Beitrag zur Professions-, Disziplin- und Institutionengeschichte der Sozialen Arbeit und kirchlich-diakonischer Berufe wie zur Zeitgeschichte der evangelischen Kirche mit ihrer Diakonie leisten. Sie widmet sich den evangelischen Ausbildungsstätten in der Pfalz im sekundären Bildungsbereich in den Jahren 1948 bis 1971 mit der entsprechenden Vorgeschichte seit 1945. Angefügt ist zudem ein Überblick über die Entwicklungen der sich anschließenden Bildungseinrichtung des tertiären Bereiches, der Evangelischen Fachhochschule in Ludwigshafen, von 1971 bis 2008. Die hier erforschten Entwicklungen zeichnen exemplarisch den Prozess der Professionalisierung des Berufes und den Weg der disziplinären Akademisierung der Sozialen Arbeit und z.T. auch der Gemeinde- bzw. Religionspädagogik nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
gewidmet meinem Sohn Tim Götzelmann und meiner Tochter Mia Götzelmann sowie meinen Patenkindern Jonas Ahr, Tom Götzelmann und Justin Roscher
Inhalt
Vorwort und Einführung
Hintergründe zur Entstehung der ersten evangelischen Ausbildungsstätte für Wohlfahrtspflegerinnen und Gemeindehelferinnen in der Pfalz – die Vorgeschichte der Schulgründung
1.1. Not, Leid und soziale Probleme des Krieges in Deutschland
1.2. Besonderheiten in der französischen Zone und die soziale Situation in der Pfalz
1.3. Kirchlicher Wiederaufbau in Deutschland und der Beginn einer diakonischen Sozialen Arbeit in der Pfalz
1.4. Bedarf an ausgebildeten Fürsorgerinnen und Wohlfahrtspflegern in der Pfalz
1.5. Soziale Ausbildungsstätten im Umfeld der Pfalz
1.6. Die ersten Ideen zur Schulgründung in protestantischen kirchlich-diakonischen Kreisen der Pfalz
1.7. Gründe für die Schulerrichtung
1.8. Unterschiedliche Ziele für die Schule
1.9. Gründungsprobleme: Die Suche nach einer Schulleitung, die Auseinandersetzung um die Trägerschaft und die Formierung des Kuratoriums
Zum Leben und Wirken der Gründungsbeauftragten und der beiden ersten Schulleitungen
2.1. Die Gründungsbeauftragte, Abteilungsleiterin für die Wohlfahrtspflegerinnenabteilung und zweite Schulleiterin: Dr. rer. pol. Walda Rocholl
2.2. Der erste Schulleiter und Abteilungsleiter für die Gemeindehelferinnenausbildung: Prof. Lic. theol. Dr. phil. Carl H.O. Schneider
Die „Evangelische Schule für kirchlichen und sozialen Dienst“ in Speyer (1948-1950)
3.1. Der nur teilweise realisierte Plan für eine „evangelische Diakonie-Schule“
3.2. Erste Werbung für die „Evangelische Schule für kirchlichen und sozialen Dienst“ und Schuleröffnung im Frühjahr 1948
3.3. Modifikation der Ausrichtung und des Qualifikationsangebots im Jahr 1949
3.4. Erste Semesterberichte
3.5. Die erste staatliche Prüfung
3.6. Fortführung der Wohlfahrtsschule und Auflösung der Gemeindehelferinnenschule
3.7. Die fachliche Ausbildung und kirchliche Einbindung von Gemeindehelferinnen und Gemeindehelfern bzw. Diakonen bis in die 1970er-Jahre
Das „Seminar für Sozialberufe“ in Speyer (1950-1964)
4.1. Die Öffnung der Wohlfahrtsausbildung für Männer und weitere Konzeptänderungen
4.2. Die Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden
4.3. Stipendien und Wirtschaftsbeihilfen
4.4. Mitverwaltung der Studierenden
4.5. Alumni – Kontaktpflege zu Absolventinnen und Absolventen – Verband ehemaliger Studierender
4.6. Kooperationen
4.7. Das Kuratorium
4.8. Die Entwicklung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen
4.9. Die wechselnden Räumlichkeiten und erste Pläne für einen Neubau in Ludwigshafen
4.10.Die Finanzierung des Seminars
Die haupt- und nebenamtlichen Lehrerinnen und Lehrer und das weitere Personal (1948 bis 1970)
Das „Seminar für Sozialberufe – Höhere Fachschule für Sozialarbeit“ in Speyer (1964-1970)
6.1. Die neue Satzung von 1964
6.2. Die neue Seminardirektorin Dr. Gertraude Schulz
6.3. Räumliche Enge in der Kleinen Pfaffengasse 11, Speyer
6.4. Ausbildungsreform
6.5. Von der Jugendleiterin zur Sozialpädagogin
6.6. Schülerinnen und Schüler, Mitverwaltung der Studierenden, Alumni, Studienfahrten
6.7. Das Kuratorium
6.8. Das zwanzigjährige Jubiläum 1968
6.9. Der Neubau in Ludwigshafen
Die „Höheren Fachschulen für Sozialarbeit und Sozialpädagogik“ in Ludwigshafen am Rhein (1970-1971)
7.1. Aufwertung der Sozialarbeit im Bildungsbereich und staatliche Hochschulplanung in Ludwigshafen
7.2. Neue Fachrichtung Sozialpädagogik und Namensänderung der Höheren Fachschule
7.3. Studentenrevolte und Studienreform
7.4. Veränderungen der Studierendenschaft und des Lehrpersonals
7.5. Auflösung der Höheren Fachschulen bei Gründung der Fachhochschule
Überblick über den Fortgang der Entwicklung: Die Evangelische Fachhochschule Ludwigshafen (1971-2008)
Vier Entwicklungslinien der Ausbildungsgeschichte Sozialer Arbeit in Speyer und Ludwigshafen
9.1. Die Kleinkinderziehung und Jugendleiterinausbildung als erste Entwicklungslinie
9.2. Die sozialen Frauenschulen als zweite Entwicklungslinie
9.3. Die Sozialarbeit von Männern und Diakonenausbildung als dritte Entwicklungslinie
9.4. Die akademische Hochschulausbildung als vierte Entwicklungslinie
Quellen
Vorwort und Einführung
Zum Inhalt des Buches
Bald nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde in protestantischen kirchlich-diakonischen Kreisen nach einer Möglichkeit gesucht, Fachkräfte für den Neuaufbau des Jugendpflege-, Fürsorge- und Wohlfahrtswesens in der Pfalz auszubilden. Ansporn dazu boten zum einen die Kriegsfolgen und sozialen Probleme der Nachkriegszeit, zum anderen das Anliegen, den Bestrebungen auf der römisch-katholischen Seite, in Andernach für das junge Rheinland-Pfalz eine katholische Ausbildungsstätte zu gründen, eine protestantische Bildungseinrichtung entgegen zu setzen und zum dritten der Anspruch Fürsorgerinnen, Wohlfahrtspflegerinnen bzw. Sozialarbeiterinnen in einer eigenen evangelischen Ausbildungsstätte zuzurüsten, die zugleich fachlich gut qualifiziert und im evangelischen Sinne geprägt werden sollten.
Vorbilder für solche evangelisch-soziale Frauen- oder Wohlfahrtsschulen gab es seit Beginn des 20. Jahrhunderts auch in umliegenden Landeskirchen. Jedoch hatten die Nationalsozialisten diese evangelischen wie auch die Fachschulen in anderen Trägerschaften entweder geschlossen oder gleichgeschaltet. Die Folgen des Zweiten Weltkrieges und die Entnazifizierungen hatten es schwer gemacht, solche Ausbildungsstätten wieder oder ganz neu zu eröffnen, denn überall fehlten die Ressourcen dazu: Es gab kaum geeignete Räumlichkeiten oder Gebäude, zu wenige qualifizierte und zugleich entnazifizierte Lehrerinnen und Lehrer für diese Zwecke sowie kaum finanzielle Mittel, die nach der Währungsreform im Jahr 1948 auch bei den Kirchen zudem plötzlich erheblich einbrachen.
Den Verantwortlichen in der Pfälzischen Landeskirche um Pfarrer Eugen Herrmann gelang es dennoch, im Jahr 1948 die „Evangelische Schule für kirchlichen und sozialen Dienst“ in Speyer zu gründen und dort zunächst zwei Ausbildungsgänge für Gemeindehelferinnen und für Wohlfahrtspflegerinnen anzubieten. Damit war die erste protestantische Ausbildungsstätte für Sozialarbeit und Gemeindepädagogik in der Pfalz und für Rheinland-Pfalz eröffnet. Aus ihr ging mit der staatlichen Anerkennung im Jahr 1950 das „Seminar für Sozialberufe“ – ab 1964 mit dem Zusatz „Höhere Fachschule für Sozialarbeit“ – hervor, das im Jahr 1970 nach Ludwigshafen am Rhein in einen Neubau in der Maxstraße 29 umzog und dort noch für anderthalb Jahre zu den „Höheren Fachschulen für Sozialarbeit und Sozialpädagogik“ umfirmierte und um die Sozialpädagogik erweitert wurde, bevor diese Höheren Fachschulen in der zum Oktober 1971 eröffneten Fachhochschule der Pfälzischen Landeskirche aufgingen.
Die vorliegende Studie widmet sich den evangelischen Ausbildungsstätten im sekundären Bildungsbereich in den Jahren 1948 bis 1971 mit der entsprechenden Vorgeschichte seit 1945. Am Ende wird ein Überblick über die Entwicklungen der nachfolgenden tertiären Bildungseinrichtung, der Evangelische Fachhochschule in Ludwigshafen von 1971 bis 2008 gegeben und eine ausbildungshistorische Einordnung vorgenommen.
Die vorliegende Untersuchung möchte gleichermaßen einen Beitrag zur Professions-, Disziplin- und Institutionengeschichte der Sozialen Arbeit und kirchlich-diakonischer Berufe wie zur Zeitgeschichte der evangelischen Kirche mit ihrer Diakonie leisten. Die hier erforschten Entwicklungen zeigen exemplarisch den Prozess der Professionalisierung des Berufes und den Weg der disziplinären Akademisierung der Sozialen Arbeit auf. Damit wird am Beispiel der Pfälzer Bildungsinstitutionen eine in der Bundesrepublik Deutschland typische Transformation aufgezeigt, die zahlreiche Bildungseinrichtungen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik ähnlich durchlebten. Da ebenso die Entwicklung der Gemeindehelferinnenausbildung nach 1945 bis zum Studiengang „Religionspädagogik und kirchlich-theologische Bildungsarbeit“ mit aufgearbeitet wird, der in den 1970er-Jahren an der Fachhochschule der Pfälzischen Landeskirche in Ludwigshafen angeboten wurde, versteht sich die vorliegende Studie auch als kleiner regionaler Beitrag zur Berufs- und Ausbildungsstättengeschichte der Gemeindepädagogik und -diakonie bzw. Religionspädagogik.
Die Studie wertet zahlreiche zeitgeschichtliche Quellen aus und hält sich dicht an das historische Material. Sie versucht, die Dokumente zum Sprechen zu bringen, und will den Originalton der Zeit laut werden lassen. Deshalb tauchen eine Fülle von Begriffen auf, die meist nur im Kontext der Zeitgeschichte, ihrer Milieus und fachlichen Hintergründe verständlich werden. Sie werden sich mit der Lektüre dieses Buches und unter Zuhilfenahme von weiteren Informationsquellen hoffentlich klären. Hier ins Detail zu gehen, würde den Rahmen dieser Studie sprengen. Zur groben Einordnung sei nur erläutert, dass im großen Wortfeld des aktuellen Begriffs „Soziale Arbeit“ eine historische Abfolge der Termini „Armenpflege“ (Mittelalter), „Fürsorge“ (seit Ende 19. Jh.), „Wohlfahrtspflege“ (19./20.Jh.) und „Sozialarbeit“ (seit 1960er-Jahre, teils auch schon deutlich früher) enthalten ist. Hinzu kommt der in der Erziehungstradition stehende Begriff „Sozialpädagogik“ (seit Mitte 19. Jh.), der heute in die universitäre Pädagogik gehört und Erziehungs- und Bildungsaufgaben umfasst. Unterbrochen wird die Etymologie durch den Nationalsozialismus, in dessen Regime die Begriffe „Volkswohlfahrt“ und „Volkspflege“ ideologisch missbraucht wurden, weshalb sie nach 1945 diskreditiert und obsolet waren. Alle Begriffe wurden bzw. werden für den betr. gesellschaftlichen Funktionsbereich verwendet und auch zu Berufsbezeichnungen gemacht. Ins Wortfeld des biblischen und gegenwärtigen Begriffs „Diakonie“ gehören in chronologischer Abfolge die Termini „Innere Mission“ als eine Vielfalt von christlich-sozialen Vereinsinitiativen seit dem 19. Jahrhundert. und „Evangelisches Hilfswerk“ als evangelische Organisation zur Verteilung von internationalen Spenden in der BRD von 1945 bis in die 1960er-Jahre. Aus der Vereinigung von Hilfswerk und Innerer Mission entstanden seit den 1960er-Jahren „die Diakonie“ bzw. die „Diakonischen Werke“ auf diversen Ebenen.
Das Buch im Kontext des Forschungsprojektes „Die Entwicklung evangelischer Ausbildungsinstitutionen für Soziale Arbeit, kirchlich-diakonische Berufe und Pflege in der Pfalz – zeitgeschichtliche Studien“ (2018-2021)
Diese Monographie steht im größeren Kontext meines Forschungsprojektes mit dem Titel „Die Entwicklung evangelischer Ausbildungsinstitutionen für Soziale Arbeit, kirchlich-diakonische Berufe und Pflege in der Pfalz – zeitgeschichtliche Studien“, das bis 2021 laufen soll. Denn für das Jahr 2021 kommt das fünfzigjährige Jubiläum der Eröffnung der „Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen – Hochschule für Sozial- und Gesundheitswesen“, deren Name mehrfach geändert wurde, in den Blick. In dem Forschungsprojekt werden die Vorgeschichte, die Gründung, der Wandel und die Übergangsprozesse der genannten Bildungsinstitutionen zwischen kirchlich-diakonischer Trägerschaft und gesellschaftlich-fachlicher Transformation in ihrer Bedeutung für die Professionalisierung und Akademisierung der betreffenden Berufe und Disziplinen erforscht. Zur Anwendung kommt dabei ein Mixed-Methods-Forschungsverfahren aus Literaturstudium, zeitgeschichtlichen Archivrecherchen, Dokumentenanalysen und biografisch-narrativen Interviews mit Zeitzeuginnen und -zeugen.
Bislang wurden die entsprechenden Bestände des Zentralarchivs der Evangelischen Kirche der Pfalz (ZASP), des Archivs des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule Ludwigshafen am Rhein (ALU) und seines Prüfungsarchivs (PALU), des Stadtarchivs Ludwigshafen am Rhein (SALU) und des Stadtarchivs Speyer (SASP), des Alice Salomon Archivs (ASA), des Bundesarchivs Berlin (BAB), des Landeshauptarchivs Koblenz (LHAKO) und des Landesarchivs Speyer (LASP), persönliche und hochschuleigene Aktenbestände, Fachliteratur zur Berufs-, Disziplin- und Institutionengeschichte der Sozialen Arbeit, zur Zeitgeschichte des sekundären und tertiären Bildungssektors, zur evangelischen Kirchen- und Diakoniegeschichte etc. ausgewertet und sieben Interviews – zwei davon durch die Kolleginnen Prof. Dr. Ellen Bareis, Dozentin Antje Reinhard und meine Forschungsassistentin, Sozialarbeiterin (B.A.) Katja Reincke – geführt. Ihnen sei dafür auch an dieser Stelle herzlich gedankt.
Beim Forschungstag des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen am 16. Mai 2018 wurde die Methodologie des Projekts vorgestellt und ein zeitgeschichtlicher Einblick in die Entwicklungen der ersten beiden Bildungsinstitutionen gegeben sowie mit dem anwesenden Kollegium und einigen Studierenden diskutiert.
Zur akademischen Festveranstaltung der Hochschule Ludwigshafen a.Rh. am 26. September 2018 anlässlich der im Jahr 2008 vollzogenen Überführung der vormals kirchlichen in die staatliche Fachhochschule – bis dahin Hochschule für Wirtschaft – in Ludwigshafen, bei der Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Dekanin Barbara Kohlstruck vom protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen und Hochschul-Präsident Prof. Dr. Peter Mudra sprachen, wurde die von mir herausgegebene Jubiläumsschrift vorgelegt: Zweieinhalb Jubiläen. Der Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule Ludwigshafen am Rhein und seine Vorgeschichte seit 1948.1 Darin finden sich im ersten Teil eine fünfzigseitige chronologische Darstellung der Geschichte von 1946 bis 2008 und im zweiten Teil u.a. vier Zeitzeugeninterviews mit den drei ehemaligen Rektoren der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen Prof. Kurt Witterstätter – er war bereits hauptamtlich Lehrender am „Seminar für Sozialberufe“ in Speyer –, Prof. Dr. Dieter Wittmann und Prof. Jürgen Mangold – er war selbst noch Studierender am „Seminar für Sozialberufe“ in Speyer – sowie mit der früheren Fachhochschul-Assistentin Helga Mayer. Andere frühere Mitarbeitende, Lehrbeauftragte und ehemalige Studierende der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen kommen in dem Jubiläumsbuch in eigenen Beiträgen ebenso zu Wort wie hauptamtlich Lehrende und die beiden Präsidenten der seit 2008 gemeinsamen Fachhochschule. Die Entwicklung der ehemaligen und der gegenwärtig angebotenen Studiengänge und aktuellen Studiengangsentwicklungen werden dargestellt, Spezialitäten und Querschnittsthemen wie Internationales, Ethik, ästhetische Bildung und Frauen- bzw. Gleichstellungsarbeit thematisiert.
Neben anderen Jubiläumsbeiträgen in der Hochschulzeitschrift „Spektrum“ Nr. 28 sind als Print- und als Online-Ausgabe2 im Oktober 2018 zwei Aufsätze von mir erschienen:
70 Jahre Soziale Arbeit. Von der „Evangelischen Schule für kirchlichen und sozialen Dienst“ über das „Seminar für Sozialberufe“ in Speyer zur „Höheren Fachschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik“ in Ludwigshafen (1948 bis 1971), in: Spektrum. Zeitschrift der Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Oktober 2018, S. 18-21.
Die Evangelische Fachhochschule (1971-2008) als Vorläufer des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen, in: Spektrum. Zeitschrift der Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Oktober 2018, S. 22-25. Dieser Beitrag ist leicht erweitert und um Quellenangaben ergänzt in das achte Kapitel des vorliegenden Bandes eingegangen.
Im Rahmen meines Forschungsprojektes wird auch eine Monographie zur Geschichte der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen (1971-2008), die zum 50. Jubiläum im Jahr 2021 erscheinen soll, zur Publikation vorbereitet.
Danksagungen
Viele Menschen haben dieses Publikationsvorhaben auf unterschiedliche Weise unterstützt und ermöglicht. Sie sollen hier genannt werden.
Herzlichen Dank möchte ich den drei Alt-Rektoren der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen und Professoren Kurt Witterstätter, Dr. Dieter Wittmann und Jürgen Mangold sagen. Sie haben mir viele Informationen und Ideen für mein Forschungsprojekt sowie wertvolle Impulse für dieses Buch gegeben und mir Fotos zur Verfügung gestellt.
Bei Prof. em. Dr. Peter Reinicke, Berlin, bedanke ich mich herzlich für Fotos und Informationen zu Dr. Walda Rocholl. Ebenso herzlich bedanke ich mich bei den Leitungen und Mitarbeitenden der Archive, die für dieses Buch von kaum zu überschätzender Bedeutung und Hilfe waren: bei Direktorin Dr. Gabriele Stüber und ihren Mitarbeitenden des Zentralarchivs der Evangelischen Kirche der Pfalz in Speyer Hilda Gutjar, Georg Klein, Christine Lauer, Heidi Schmid u.a.; bei Sabine Amann vom Prüfungsarchiv des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule Ludwigshafen am Rhein; bei Lutz Möser vom Bundesarchiv Berlin, bei Brigitte Kramer vom Landeshauptarchiv Koblenz, bei Dr. Franz Maier vom Landesarchiv Speyer, bei Direktor Dr. Stefan Mörz vom Stadtarchiv Ludwigshafen und seiner Mitarbeiterin Frau Wagner sowie bei Mattis Pfänder vom Stadtarchiv Speyer.
Für die Umschlaggestaltung des Buches habe ich Fotos der fünf wichtigsten Domizile aus der langen Geschichte der betr. Institutionen ausgewählt. Die Nachweise finden sich vorne im Impressum. Mein großes Dankeschön für weitere Fotos geht an Dr. Elena Wassmann und Ute Sahmel. Herzlichen Dank möchte ich Marlen Rodewald für ihr Foto von Prof. Jürgen Mangold sagen.
Bei meiner Frau, Pfarrerin Claudia Enders-Götzelmann, bedanke ich mich für konstruktiv-kritische Anregungen bei der Erarbeitung des Buches. Meinem früheren Kollegen Diplom-Pädagoge Heinz Thiery danke ich herzlich für seine Ideen und Ratschläge zu dieser Publikation. Meinen Kollegen Prof. em. Dr. Dieter Wittmann und Prof. Dr. Hans Ebli gilt mein herzlicher Dank für das Korrekturlesen und manch anregende Gespräche zum Inhalt und Aufbau dieser Studie.
Bei allen Leserinnen und Lesern möchte ich mich für ihr Interesse an diesem Buch bedanken. Gern nehme ich Vorschläge zu Korrekturen und weitere Informationen zu den Sachverhalten in diesem Buch unter [email protected] oder in persönlichen Gesprächen entgegen.
Arnd Götzelmann, Speyer und Ludwigshafen am Rhein, im Januar 2019
1 Norderstedt: Books on Demand, 2018, 468 S. (davon 40 Farbseiten), Print ISBN: 978-3-75289789-0, E-Book ISBN: 978-3-7528-5754-2.
2https://www.hs-lu.de/fileadmin/user_upload/epaper/spektrum28/.
1. Hintergründe zur Entstehung der ersten evangelischen Ausbildungsstätte für Wohlfahrtspflegerinnen und Gemeindehelferinnen in der Pfalz – die Vorgeschichte der Schulgründung
Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges gab es eine Reihe von Anlässen, die in Gesellschaft und Kirche den Neuaufbau des Fürsorge- bzw. Wohlfahrts- und Jugendpflegewesens in den Städten und Kommunen sowie der Diakonie und Sozialarbeit in den Kirchengemeinden nötig machte, wofür Fachkräfte zu qualifizieren waren. Zu diesen Anlässen gehörten vor allem die infolge des Zweiten Weltkrieges entstandenen sozialen Probleme, die Sondersituation der Pfalz innerhalb der französischen Besatzungszone, der Wieder- und z.T. Neuaufbau von Kirche und Diakonie und der große Bedarf an Fachkräften der Sozialarbeit. Diese Hintergründe erscheinen für die Gründung einer evangelischen Ausbildungsstätte für Wohlfahrtspflegerinnen in der Pfalz nach 1945 relevant und sollen zunächst kurz erhellt werden.
1.1. Not, Leid und soziale Probleme des Krieges in Deutschland
Durch den Tod von rund sechs Millionen Soldaten und Zivilpersonen im Zweiten Weltkrieg war Deutschland, das unaussprechliches Leid über die Welt gebracht hatte, „ein Land der Frauen und Greise“3 geworden: 1945 standen 37 Millionen Frauen nur 29 Millionen Männern gegenüber – die Gruppe der Männer zwischen 18 und sechzig Jahren war in die Minderheit geraten.4 Die Kriegsgefangenen kamen nach und nach wieder heim, waren aber oft körperlich und psychisch versehrt. Aus dem Osten kamen Flüchtlinge gen Westen mit ihren eigenen von Armut und Leid geprägten Bedarfen. Eine allgemeine Arbeitspflicht wurde eingeführt, wer keine Arbeitsbescheinigung nachweisen konnte, erhielt auch keine Lebensmittelkarten. Es fehlte in den ersten Jahren nach dem Krieg an allem: Lebensmittel, Wohnraum, Infrastruktur, Medikamente. Zunächst mussten die riesigen Schuttberge weggeräumt werden, ab ca. 1950 begann die Arbeitslosigkeit zum Problem zu werden, denn die Industrie funktionierte noch nicht wieder. „Das größte Problem der Jahre 1945 bis 1947 ist die Versorgung der über 11 Millionen Flüchtlinge.“5 Neben der Flüchtlingsfürsorge wurde die Gesundheitsfürsorge wichtig angesichts der durch Mangelernährung, psychische Krisen und Kriegsverletzungen beeinträchtigten großen Bevölkerungsteile.6 Die Überlastung der Frauen durch fehlende arbeitsfähige Männer, schwere körperliche Arbeit beim Wegräumen der riesigen Trümmerberge, dem Wiederaufbau der Wohnungen, der Kinderbetreuung, der zunehmenden Berufstätigkeit etc. machte eine spezifische Gesundheitsfürsorge ebenso nötig wie den Wiederaufbau der Familienfürsorge. Angesichts der arbeitslosen Jugendlichen, der verwaisten Kinder und Jugendlichen und einer angestrebten demokratischen Neuorientierung der Jugend wurden alle Formen der Kinder- und Jugendhilfe und -arbeit relevant von der Jugendberufshilfe über die Heimerziehung und Jugendfürsorge bis hin zu neuen, internationalen Formen der Jugendarbeit und der Jugendbegegnungen.7
1.2. Besonderheiten in der französischen Zone und die soziale Situation in der Pfalz
In der Pfalz herrschten durch die französische Besatzung z.T. andere politische Bedingungen als die in den drei anderen Besatzungszonen. So genossen die Kirchen große Handlungsfreiheit: „Die französische Militärregierung, in deren Zone die Pfalz lag, verfolgte eine insgesamt recht liberale Kirchenpolitik, insoweit die Kirchen nicht gegen elementare Richtlinien der Besatzungspolitik verstießen.“8 Geopolitisch markierte der Rhein für die wirtschaftlich ehemals stärkeren Gebiete der Vorderpfalz eine wichtige Grenze zwischen der amerikanischen Zone auf seiner rechten und der französischen auf seiner linken Seite.9 Bis Ende der 1940er-Jahre waren Einreisegenehmigungen von der amerikanischen in die französische Zone nötig. Die frühe Nachkriegszeit „war eine Zeit der gedrückten Grundstimmung. Die Sorge um die ständig bedrohte Existenz beherrschte das alltägliche Denken… Dabei war der Hunger keineswegs das einzige Problem der Zeit, wohl aber das zentrale“, schreibt Rothenberger und sieht in der Pfalz eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ aus ausgebombten hungernden Städtern und der bäuerlichen vom Hunger kaum betroffenen Landbevölkerung.10 Deshalb gebe es auch „nicht eine einzige, gleichsam für jedermann gültige Alltagsgeschichte der Nachkriegszeit. Die Wirklichkeit des Alltags sah sehr unterschiedlich aus.“11 Rothenberger zeigt das an verschiedenen Bereichen auf. Durchschnittlich waren rund 26 % der Wohnungen im Regierungsbezirk Pfalz zerstört oder beschädigt. Allerdings gab es große Unterschiede zwischen den Regionen: So wiesen Ludwigshafen und Zweibrücken mehr als 75 % zerstörte und beschädigte Wohnung auf, Landau ca. 50 %, Pirmasens 32 %. Speyer und die meisten nord- und westpfälzischen Landkreise lagen bei unter 8 %. In den ersten Nachkriegswintern konnte oft nur ein Raum – meist die Küche – pro Wohnung oder Haus geheizt werden. In den Immobilien fehlte es an Möbeln aller Art. Die Hungersnot war im Winter 1946/47 am Größten, Lebensmittel rationiert und die Versorgung divergierend zwischen bäuerlichen „Selbstversorgern“ und sonstigen „Normalverbrauchern“.12 Durch Hilfen der Mennoniten konnten im Winter 1946/47 140.000 Pfälzerinnen und Pfälzer gespeist werden, amerikanische Quäker gaben Nahrungs-, Kleider- und Heizmittelspenden in die Pfalz.13 Der Sommer 1947 war extrem heiß und gering an landwirtschaftlichem Ertrag, so dass ausländische Hilfen besonders durch den Marshallplan wichtig wurden. Erst im März 1950 konnten die Ernährungsämter schließen, damit war die Rationierung der Nahrung beendet. Die Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur war weitgehend zerstört und musste über viele Jahre mühsam aufgebaut werden. Über Rhein, Mosel, Lahn und Nahe gab es keine festen Brücken mehr – nur noch die Trierer Römerbrücke. Das französische Militär baute zuweilen schwimmende Behelfsbrücken für eigene Zwecke auf, wie das in Speyer bereits Anfang April 1945 geschah, als General de Gaulle mit seiner Armee den Rhein nach Osten überquerte.14 Ansonsten übernahmen Motorboote den Flussquerungsverkehr von Zivilpersonen über den Rhein. In Speyer wurde seit 1948 das Personenfährboot „Katharina“ eingesetzt; vom 12. Februar 1950 bis zum 3. November 1956 transportierte die größere Auto-Schnellfähre „Pfalz“ mehr als 2 Mio. Fußgänger, knapp 1,5 Mio. Radfahrer, fast eine halbe Mio. Motorradfahrer, 1 Mio. PKWs, 330.000 LKWs und 60.000 Busse über den Rhein; erst im November 1956 wurde die neu gebaute Rheinbrücke eröffnet.15 Bis zur Währungsreform 1948 – und langsam abklingend auch danach – existierte eine bedeutsame „Schattenwirtschaft“ mit den Elementen Schwarzmarkt, Tauschhandel, Schmuggel und Hamsterwesen. Die sozialen Probleme waren immens, besonders in den Städten. Die Zahl der Geflüchteten war in den ersten Nachkriegsjahren in der französischen Besatzungszone deutlich geringer als in den anderen drei Zonen: „Nach einer Statistik des Alliierten Kontrollrates vom Oktober 1946 betrug der Anteil der Flüchtlinge an der Bevölkerung in der sowjetischen Zone 20,8 %, in der amerikanischen Zone 16,3 %, in der britischen Zone 13,9 %, in der französischen Zone 1,5 %.“16 Denn Frankreich hatte anfangs systematisch versucht, Flüchtlinge nicht in seine Zone zu lassen: „General Koenig rühmte sich noch Ende 1948 damit. Als Gründe nannte er die eigene schlechte wirtschaftliche Situation und die Furcht, mit der Übernahme von vielen Flüchtlingen ein Element der Destabilisierung in der eigenen Zone zu erhalten. 1949 vermehrte sich der Zustrom der Flüchtlinge. Frankreich hatte aus außenpolitischen Gründen seine restriktive Haltung aufgeben müssen…“17
1.3. Kirchlicher Wiederaufbau in Deutschland und der Beginn einer diakonischen Sozialen Arbeit in der Pfalz
In der Zeit unmittelbar nach der Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 gab es vorerst keine staatliche Zentralgewalt mehr. An die Stelle der NS-Reichsregierung war der Alliierte Kontrollrat in Berlin getreten, das alte Reichsgebiet großteils in vier Besatzungszonen aufgegliedert worden. Die Kirchen waren großteils in den Nationalsozialismus verstrickt gewesen, nur wenige christliche Einzelpersonen bzw. Gruppen waren offen oder im Untergrund in den Widerstand zum NS-Regime getreten. „Im Vergleich zu den staatlichen Stellen hatten die Kirchen den Krieg und die nationalsozialistische Gewaltherrschaft organisatorisch relativ unbeschadet überstanden. (…) sie waren die einzigen Institutionen, die – wenn auch mit Beschränkungen – zonenübergreifend arbeiten konnten und durften. Hinzu kam, dass sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche vom Ausland als Anwälte der Interessen der deutschen Bevölkerung akzeptiert, ja aufgefordert wurden, die Funktion zu übernehmen.“18 Schon vor Kriegsende begannen deutsche Kirchenvertreter in Abstimmung mit internationalen christlichen Organisationen, für die Nachkriegszeit Pläne zur Organisation von sozialen Hilfen zu machen. Ein erster Plan, diese Organisation komplett überkonfessionell bzw. ökumenisch in Kooperation von evangelischem und katholischem Christentum in Deutschland aufzubauen, scheiterte an den römisch-katholischen Strukturen. Wegweisend für den Aufbau der evangelisch-diakonischen Hilfsorganisation war die Gründung des Evangelischen Hilfswerkes auf der Kirchenversammlung von Treysa am 27. bis 31. August 1945, zu der der Württembergische Landesbischof D. Theophil Wurm eingeladen hatte.19 Dort stellte Dr. Eugen Gerstenmaier am 29. August sein Konzept vor, das schon vor Kriegsende mit Kirchenvertretern aus Genf, Schweden, USA etc. vorbesprochen war. Der Vertreter des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Dr. Schönfeld, aus Genf unterstützte Gerstenmaiers Ideen. Der US-Amerikaner Stuart Herman, stellvertretender Direktor der Wiederaufbau-Abteilung des ÖRK, stimmte zu und bat um Nachrichten über die tatsächlichen Notstände.20 Am 1. Oktober 1945 begann das Evangelische Hilfswerk mit seiner Geschäftsstelle des Hauptbüros Stuttgart offiziell zu arbeiten und eine Struktur von nationalen, landeskirchlich-regionalen und kirchenbezirklich- sowie kirchengemeindlich-kommunalen Zuständigkeiten aufzubauen.21 Im Dezember 1946 wurde im Bereich der Pfälzischen Landeskirche das Evangelische Hilfswerk, Hauptbüro Pfalz, in Speyer eröffnet und durch den Neuhofener protestantischen Pfarrer Eugen Herrmann geleitet. Er war eine maßgeblich treibende Kraft der diakonisch-sozialen Arbeit in der Pfalz der Nachkriegszeit, der als erster die Idee entwickelte und zielstrebig verfolgte, eine evangelische Bildungsinstitution für soziale Arbeit zu gründen. Da die Protestanten mit 55 % die Mehrheit der Bevölkerung in der Pfalz stellten – die Konfessionsstatistik für 1950 wies bei 1.051.054 Einwohnern der Pfalz 579.112 Protestanten aus22 –, war es angemessen, dass aus ihren Kreisen bald nach Kriegsende die Gründung einer Bildungsinstitution in der Pfalz betrieben wurde, die Wohlfahrtspflegerinnen qualifizieren sollte, um den sozialen Problemen der Zeit professionell begegnen zu können.
1.4. Bedarf an ausgebildeten Fürsorgerinnen und Wohlfahrtspflegern in der Pfalz
In der Pfalz gab es wegen der skizzierten sozialen Probleme nach dem Zweiten Weltkrieg einen großen Bedarf an ausgebildeten Fachkräften der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Eine exemplarische präzise Beschreibung die Erfordernisse evangelischer Fürsorgerinnen und Sozialpädagoginnen betreffend wurde – nach Arbeitsgebieten differenziert – in einem Schreiben der ersten Vorsitzenden des „Verbandes der Fürsorgerinnen von Rheinland-Pfalz“ Auguste Ehrgott23 vom 8. Dezember 194924 formuliert, das sich an die Verantwortlichen der „Evangelischen Schule für kirchlichen und sozialen Dienst“ richtete. Sie verweist darauf, dass der Verband neugegründet und „politisch und konfessionell neutral ist“. Folgende dringende Bedarfe nennt sie:
Es würden „Fürsorgerinnen“ als „geeignete Kräfte … für den Aufbau der weiblichen Kriminalpolizei“ benötigt, die „fast ausschließlich auf gefährdete Frauen und Jugendliche gerichtet ist“;
An „Fachkräften bei den Jugendämtern“ werde nach Informationen des Landesjugendamtes „in den kommenden Jahren ein erhöhter Bedarf“ bestehen;
Für „die Leitung von Erziehungsheimen“ würden mehr Fachkräfte benötigt, nachdem die evangelischen Heime wegen des mangelnden Nachwuchses an Diakonissen im Vergleich zu den katholischen Heimen schlecht abschnitten;
„Auf dem gesamten Gebiet der Wohlfahrtspflege, der Gesundheitsämter und vor allem der Familienfürsorge“ sieht die Verbandsvorsitzende einen hohen Fachkräftebedarf „für den Wiederaufbau unseres Volkes … aus bewusst christlicher Haltung heraus“.
Schließlich gebe es „neue Aufgaben“ „mit dem Eintreffen der längst erwarteten Flüchtlinge …, die mit den vorhandenen Kräften nicht zu lösen sind“.
Sie benennt auch einen „Mangel an männlichen Fürsorgekräften“, die neu heranzubilden seien, denn: „Die durch den Krieg in den Reihen der Diakone gerissenen Lücken sind für längere Jahre nicht ausgefüllt.“ Folgende Bedarfe an Fachkräften führt sie auf: „Erzieher für männliche Jugend in Erziehungsanstalten, Wanderarbeitsstätten, Aufnahmeheimen, Fürsorger für Innen- und Außendienst bei Jugend- und Wohlfahrtsämtern und nicht zuletzt hauptamtliche Kräfte für die Jugendpflege werden in Zukunft in erhöhtem Maße gefragt.“
1.5. Soziale Ausbildungsstätten im Umfeld der Pfalz
In den Nöten und Wirren der Nachkriegszeit begann man sich in der Pfälzischen Landeskirche bald nach 1945 aus den genannten Anlässen und Bedarfen darum zu bemühen, Fachkräfte für den kirchlichen Dienst und die soziale Fürsorge zu qualifizieren. In den umliegenden Landeskirchen hatte es bis zu ihren Schließungen oder Gleichschaltungen durch das NS-Regime längst solche Schulen gegeben. Zwischen 1899 und 1945 waren in Deutschland 69 Ausbildungsstätten für die soziale Berufsarbeit entstanden, die sich vorwiegend an Frauen richteten.25 Für Männer gab es nur wenige, mehrheitlich evangelische Ausbildungsstätten in Deutschland.26 Aufgrund der vorherrschenden Geschlechtsrollenbilder wurden Männer von Anfang an für Tätigkeiten im Jugendamt und in der Heimerziehung qualifiziert.27 In der Pfalz hatte es vor 1948 keine Soziale Frauenschule, Wohlfahrtsschule und auch kein NSV-Volkspflegerinnenseminar gegeben. Die nächstgelegenen Schulen mit längerer Tradition befanden sich in Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg, Darmstadt, Frankfurt am Main und Saarbrücken.28
Titelseite des Prospekts der Sozialen Frauenschule Mannheim von 1930, Quelle: ASA, Soziale Frauenschule Mannheim (+1918). Archiv DCV VIII 34 C, K-Z, Bd. X/32/1.
Die Soziale Frauenschule in Mannheim29 war für die Speyerer Schulgründung besonders wichtig, denn in Mannheim hatte während der NS-Zeit die spätere Speyerer Seminardirektorin die Schulleitung inne und Pfälzerinnen mit Beziehungen zur Pfälzer Pfarrerschaft hatten hier gelernt. Die Mannheimer Schule wurde im Oktober 1916 von der jüdischen Nationalökonomin Dr. Marie Bernays zusammen mit Elisabeth Altmann-Gottheimer gegründet und bis zu ihrer Amtsenthebung aus politisch-rassischen Gründen am 6. Mai 1933 geleitet. Erster Träger war die Abteilung Mannheim des Vereins Frauenbildung und Frauenstudium unter der Vorsitzenden Julie Bassermann.30 Die staatliche Anerkennung erfolgte bereits 1921. 1927 ging die Schule in städtische Trägerschaft über.
Die Nachfolge von Dr. Bernays trat im August oder September 1933 Dr. Walda Rocholl an, die 1948 nach ihrer Entnazifizierung nach Speyer berufen werden sollte.31 Die Mannheimer Sozialschule wurde zum 1. April 1938 ganz durch die Gauleitung mit dem neuen Namen und Konzept der „NSV-Frauenschule für Soziale und Sozialpädagogische Berufe“ übernommen und nach mehreren Umzügen (1943 nach Colmar im Elsass, 1944 nach Freiburg-Günterstal und 1945 zurück in Mannheim) geschlossen. Nach dem Krieg wurde 1948 oder 1949 in Mannheim aus Kreisen der Arbeiterwohlfahrt eine neue Ausbildungsstätte für Wohlfahrtspflegerinnen gegründet, die unter der Leitung von Hans Pfaffenberger im Jahr 1960 nach Düsseldorf-Eller verlegt wurde.32 Im Jahr 1967 entstand mit der Abendakademie in Mannheim eine Höhere Fachschule für Sozialberufe.33 Mit der Neugründung der Fachhochschule Mannheim im Jahr 1971 wurde diese Linie fortgesetzt.34
In den Archivalien der Landeskirche zur „Evangelischen Schule für kirchlichen und sozialen Dienst“ in Speyer findet sich u.a. eine Abschrift35 – vermutlich aus dem Jahr 1947 – des Prospektes der „Soziale(n) Frauenschule und Katechismusseminar“ der Evangelisch-lutherischen Diakonissenanstalt Neuendettelsau, die 1927 in Nürnberg gegründet, 1939 geschlossen und 1947 wieder eröffnet wurde.36 Auch auf die Evangelisch-soziale Frauenschule in Freiburg im Breisgau, deren Anfang unter dem Namen „Evangelische Frauenschule für kirchliche und soziale Arbeit Freiburg“ ins Jahr 1918 zurück geht, wird in den Speyerer Gründungsverhandlungen hingewiesen.37 Sie wurde am 1. Oktober 1918 mit zwölf Schülerinnen unter dem Namen „Evangelische Frauenberufsschule für kirchliche und soziale Arbeit“ in einer angemieteten Wohnung in der Marienstraße in Freiburg eröffnet. 1921 erhielt die Schule die staatliche Anerkennung, wurde in die Konferenz der Sozialen Frauenschulen Deutschlands aufgenommen und änderte den Namen in Evangelisch-Soziale Frauenschule. 1943 übernahm die Badische Landeskirche die Trägerschaft der Schule, so konnte sie vor dem Zugriff der Nationalsozialisten geschützt werden.38
Die Freiburger und die Nürnberger soziale Frauenschule dienten der neu zu gründenden Schule in Speyer in mancher Hinsicht als modellhaftes Vorbild. Sie durchliefen nach dem Zweiten Weltkrieg eine ähnliche Entwicklung von Sozialen Frauenschulen über die
Anerkennung als Höhere Fachschulen und schließlich zu Evangelischen Fachhochschulen.
In Rheinland-Pfalz wurden nach dem Zweiten Weltkrieg neue soziale Frauen- oder Wohlfahrtsschulen gegründet. Dazu gehörte die Soziale Frauenschule bzw. Wohlfahrtsschule und spätere Höhere Fachschule der Schönstätter Marienschwestern (gegr. 1954?).39 In Mainz gab es das Katholische Frauenseminar bzw. die Mütter- und Wohlfahrtsschule Mainz und in Andernach seit 1947 die Wohlfahrtsschule des Bistums Trier.40
1.6. Die ersten Ideen zur Schulgründung in protestantischen kirchlichdiakonischen Kreisen der Pfalz
Schon im Jahr 1946 hatte der Neuhofener Pfarrer Eugen Heinrich Herrmann,41 der zugleich Geschäftsführer des Landesvereins für Innere Mission in der Pfalz und des Evangelischen Hilfswerks Pfalz war, Ideen für die Gründung einer sozialen Frauen- bzw. „evangelischen Diakonie-Schule“ für die Pfalz in Speyer. Herrmann war eine entscheidende Figur für den diakonischen Aufbau in der Pfälzischen Landeskirche nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn er wurde zum ersten Leiter des „Sozialamtes“ – ab 5. Dezember 1946 umbenannt in Geschäftsführer des Evangelischen Hilfswerkes, Hauptbüro Pfalz – der Landeskirche ernannt, bei dem die wesentlichen Fäden von Innerer Mission und Hilfswerk zusammenliefen.42 Dieses wichtige Funktionspfarramt mit Sitz in Speyer trat er am 1. März 1946 an und nahm es nebenamtlich wahr, während er Gemeindepfarrer in Neuhofen blieb.
Organisationen diakonischer Arbeit in der Evangelischen Kirche der Pfalz – Stand: 1946 (eigene Darstellung in Anlehnung an Stüber 1997, S. 187)
Er war damit betraut, in kurzer Zeit eine neue diakonisch-soziale Struktur innerhalb der Landeskirche aufzubauen, die bestehenden Einrichtungen und Organisationsformen der Inneren Mission in der Pfalz mit denen des Evangelischen Hilfswerks zu vernetzen, die christliche Auslandshilfe (CARE, CRALOG etc.) und die kirchliche Selbsthilfe der Pfalz, die vorwiegend aus ehrenamtlichen evangelischen Frauenkreisen erwuchs, in die richtigen Bahnen zu lenken, miteinander zu koordinieren und zu fördern.43 Im Frühjahr 1946 initiierte Herrmann qua Amt die Gründung von 18 Dekanatsgeschäftsstellen des Evangelischen Hilfswerks und von zwanzig evangelischen Gemeindediensten zur Bündelung der diakonischen Arbeit in der Allgemeinen Fürsorge, der Erziehungs-, der Erholungs- und der Berufsfürsorge in solchen Kirchengemeinden, die mehr als 3000 Gemeindeglieder hatten.44
Seine Frau Elisabeth Herrmann, geb. Jaberg,45 hatte ihr Staatsexamen als „Volkspflegerin“ an der NS-Frauenschule in Mannheim wohl in den Kriegsjahren abgelegt.46 Als Leiterin für die zu gründende Schule fragte Pfarrer Herrmann am 18. November 1946 Dr. rer.pol. Walda Rocholl an, die in Mannheim von 1933 bis 1945 Leiterin der dortigen städtischen Sozialen Frauenschule bzw. ab 1. April 1938 der „NS-Frauenschule für Soziale und Sozialpädagogische Berufe“ war.47
Herrmanns Pläne kamen angesichts der ungeordneten kirchlichen und staatlichen Zuständigkeiten und des Ressourcenmangels der unmittelbaren Nachkriegszeit zunächst nicht voran. Auch war es schwer, Leitungs- und Lehrpersonal zu finden. Zudem gab es bei den Verantwortlichen in der Pfälzischen Landeskirche (bzw. dem damaligen Landeskirchenrat der Pfalz), dem Evangelischen Hilfswerk Pfalz, dem Landesverein für Innere Mission in der Pfalz und der Evangelischen Diakonissenanstalt Speyer unterschiedliche Vorstellungen von Ausrichtung, Organisationsform, Trägerschaft und Aufsicht der neuen evangelischen Diakonieschule:48 Pfarrer Herrmann konnte sich durchaus die promovierte Nationalökonomin und praxiserfahrene Jugendfürsorgerin Dr. Walda Rocholl als Leiterin der Schule vorstellen und strebte die Trägerschaft durch den Landesverein für Innere Mission an. Die Kirchenleitungsvertreter Präses Hans Stempel49 und Pfarrer Theodor Schaller50 wollten als Schulleiterin eine Theologin und die Trägerschaft bei der Landeskirche. Die Diakonissenanstaltsvertreter brachten eine dritte Position zur Frage der Schulgründung ein: Sie hielten offenbar überhaupt wenig von einer evangelischen Schule, die auch staatliche Abschlüsse in Wohlfahrtspflege und Fürsorge verleihen sollte, und wollten kein weibliches Konkurrenzmodell zur traditionellen Diakonisse. So hatte man divergierende Ideen und Konzepte für die neue Schule.
1.7. Gründe für die Schulerrichtung
Fachlich ging es darum, zunächst ausschließlich weibliche Fachkräfte in einem christlichen Sinn ganzheitlich und hochwertig zu qualifizieren, die staatlichen Positionen mit christlich-evangelischem Geist zu durchdringen und mit der katholischen Kirche und ihrer 1947 in Andernach gegründeten Wohlfahrtsschule gleich zu ziehen. Aus einem Schreiben, das undatiert und ohne einen Hinweis auf Autoren- oder Adressatenschaft wohl aus den Jahren 1948 bis 1950 stammt,51 wird das deutlich – es ist überschrieben mit: „Warum wurde die Evang. Schule für kirchlichen und sozialen Dienst in Speyer gegründet?“ Mehrere Gründe werden genannt:
Die „evang. Kirche in Rheinland-Pfalz“ sei für „die Durchführung der Aufgaben der christlichen Liebestätigkeit“ darauf angewiesen, „weibliche Fachkräfte“ von „interkonfessionellen Wohlfahrtsschulen“ anzustellen. Sie seien aber weniger gut qualifiziert als es „durch die zweijährige Ausbildung einer kirchlichen Schule“ möglich wäre. Nach den Zeiten der „vorwiegend materiellen Hilfe“ des Evangelischen Hilfswerkes, müsse „in anbetracht der eingetretenen Not … deshalb auch ein entsprechendes Angebot von Fachkräften bereitgestellt werden“. Der erste Grund hatte also mit der Professionalisierung der sozialen Arbeit der Zeit zu tun.
Der zweite Grund richtete sich darauf, „christlichen Einfluss nachhaltend geltend zu machen“ – und zwar nicht nur innerhalb der kirchlichen sozialen Arbeit, sondern auch in der öffentlichen Wohlfahrtspflege, „dass die dem Staat obliegende Fürsorge von christlichem Geist mehr als bisher durchdrungen wird“: „Nur durch evang. Wohlfahrtspflegerinnen, die z.B. beim Jugend-, Wohlfahrts-, Arbeits- und Gesundheitsamt ein Christentum der Tat verwirklichen, kann dem Notleidenden neben der leider meist unzureichenden materiellen Unterstützung die notwendige seelische Hilfe gewährt werden.“ Diese Begründung hatte einen volksmissionarischen Charakter, der von einem ganzheitlichen professionellen Anspruch geprägt war.
Das dritte Argument zielte auf die Gleichstellung der evangelischen Kirche mit der römisch-katholischen auf dem Feld der Wohlfahrtspflege. „In den Wettstreit der beiden christl. Konfessionen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit, sind wir in unserem Gebiet in manchen Punkten ins Hintertreffen geraten. Durch eine kluge, voraussehende Politik haben es die Katholiken verstanden, viele der Schlüsselstellungen in der offenen Wohlfahrtspflege zu besetzen. (…) Nur der Mangel an evang. Fürsorgerinnen … hat dadurch bei vielen Aemtern zu einer Ueberbetreuung des kath. Elements geführt.“ Diese Begründung wurzelte in konfessionellem Wettbewerb und zielte auf die paritätische Präsenz der beiden Kirchen im Bereich sozialer Berufsausbildung.
Dazu kam das vierte und letzte Argument: „Die kath. Kirche hat diesen Mangel schon früher erkannt und deshalb schon im Jahre 1947 eine kath. Wohlfahrtsschule in Andernach geschaffen. Um auch evang. Mädchen und junge Frauen unseres Landes für den Beruf der Wohlfahrtspflegerin … in grösserer Zahl als bisher zu gewinnen, wurde die Evang. Schule in Speyer gegründet.“ Diese Begründung zielte also darauf, die früher aktive, besser vernetzte und fachschulisch besser positionierte katholische Kirche in Rheinland-Pfalz auf dem Feld der Ausbildung von Wohlfahrtspflegerinnen aufzuholen.
Diese Motive für die Gründung der Evangelischen Schule stehen in einem gewissen Spannungsverhältnis zu den späteren Aussagen von Dr. Walda Rocholl, die auch Prof. Kurt Witterstätter in seinem Interview am 7. Juni 2017 in Speyer ähnlich aufgriff.
Auf die Frage: „Welches war der Anlaß für die Gründung der Ausbildungsstätte in Speyer 1948?“, antwortete Rocholl im Jahr 1978: „Das damalige Evangelische Hilfswerk wollte vorsorglich für die Betreuung der auch in der französischen Besatzungszone erwarteten Flüchtlinge aus dem Osten in der Sozialarbeit ausgebildete weibliche Kräfte zur Verfügung stellen.“52
Witterstätter sagte dazu 2017: „Da kam mir, dass im Grunde dieses Thema ‚Migration, Flucht, Heimatverlust‘ ein altes Thema dieser Ausbildungsstätte ist, denn im Jahre 1948 wurde ja die Vorgängereinrichtung … der späteren Evangelischen Fachhochschule gegründet und zwar vom damaligen Evangelischen Hilfswerk – den Begriff ‚Diakonisches Werk‘ kannte man ja noch nicht, das Hilfswerk wurde erst später das ‚Diakonische Werk‘. Der Grund war, weil in der damals Französischen Zone – die Französische Zone bestand ja aus Süd-Baden und Süd-Württemberg und eben Rheinland-Pfalz – dort erstmals Flüchtlinge vor allem aus den Ostgebieten erwartet wurden. Denn die französische Besatzungsmacht hatte es abgelehnt, bis nach 1947 überhaupt Ostflüchtlinge aufzunehmen, weil die Franzosen sagten, wir brauchen die Nahrungsvorräte, die Ressourcen, die Ernährungsgrundlagen für die Bevölkerung und für uns in Frankreich. (…) Das hat sich dann 1947 geändert. 1948 kamen dann die ersten Flüchtlinge und man wusste, dass man soziale Fachkräfte braucht, das hat das Hilfswerk der damaligen Pfälzischen Landeskirche gewusst, und hat dann den Anstoß gegeben, die Ausbildungsstätte, die Wohlfahrtsschule, wie es damals hieß, zu gründen.“53
Die Sozialarbeit für Flüchtlinge war jedoch nicht das vordergründige Motiv für die Speyerer Schulgründung. Darauf weisen die Bedarfsschilderungen der Verbandsvorsitzenden Ehrgott ebenso hin (vgl. Kap. 1.4.) wie das Papier zu den vier Gründen für die Schulgründung (vgl. Kap. 1.7.). Denn erst im Jahr 1949 kamen Flüchtlinge in nennenswerter Zahl in der französischen Zone (vgl. Kap. 1.2.) an, der die Pfalz zugehörte.
1.8. Unterschiedliche Ziele für die Schule
Bei den kontroversen Verhandlungen im Vorfeld der Gründung einer pfälzischen „evangelischen Diakonie-Schule“ im Herbst des Jahres 1947 traten die genannten Motive in den Hintergrund. Maßgeblich ging es um die fachliche Ausrichtung, die Frage der kirchlich-diakonischen Trägerschaft, das Problem, geeignete Räumlichkeiten zu finden und die schwierige Suche nach einer Schulleitung.
All diese Themen wurden unter Leitung des landeskirchlichen Präses D. Hans Stempel bei einer mittlerweile dritten Besprechung am 26. September 194754 nachmittags um 15 Uhr im Gebäude des Landeskirchenrats am Domplatz 5 in Speyer diskutiert. Dabei waren die relevanten Vertreterinnen und Vertretern der Diakonissenanstalt Speyer (Oberschwester Else Krieg55 und Vorsteher Pfarrer Otto Bauer56), des Landesverbandes und Landesvereins für Innere Mission Pfalz Dekan Karl Wilhelm Wien57, Pfarrer Eugen Herrmann und Pfarrer Friedrich Gottlieb Holzäpfel58 sowie die Vertreterin der Schulpädagogik Marie Conrad59 und die Vorsitzende des Fürsorgerinnenverbandes Ehrgott. Der in der Kirchenleitung zuständige Referent für das Schulwesen Pfarrer Theodor Schaller befand sich in Urlaub.
Ziel war es zunächst, Frauen für den kirchlichen Dienst als „Gemeindehelferinnen“ religions- und sozialpädagogisch sowie theologisch und diakonisch zu qualifizieren, ihre Aufgabe sollte es u.a. sein, in den Gemeinden die Kinder- und Jugendarbeit sowie Frauenarbeit zu leiten und Religionsunterricht in den Grund- und Berufsschulen zu erteilen, hier und da auch seelsorglich tätig zu werden.60 Als Vertreter des Landesvereins für Innere Mission und zugleich des Evangelischen Hilfswerks, Büro Pfalz, brachte Pfarrer Eugen Herrmann als zweites Ziel ein, dass „die Schule einen doppelten Charakter trage, einen katechetischen und einen fürsorgerischen“61





























