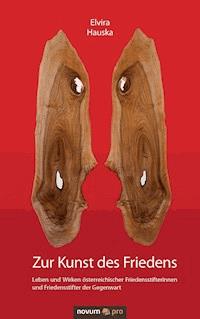
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Frieden und Krieg betreffen heute wesentlich mehr Menschen als nur jene, die mit wehenden Fahnen zur Verteidigung von Sicherheit und Wohlstand eines Staates oder eines Volkes eintreten. In Zeiten steigender Radikalisierung liegt es in der Verantwortung jedes Einzelnen, seinen eigenen Beitrag zu leisten. Konventionelle Maßnahmen zur Friedensstiftung geraten durch die ständig zunehmende Komplexität und Vielfalt immer öfter an ihre Grenzen. Vermehrt sind es die stillen Aktivitäten jener, die nicht im Rampenlicht stehen, die im Einzelfall nachhaltigen Frieden ermöglichen und sichern. Die Kunst des Friedens erscheint dadurch wie ein Geheimnis. Dieses Buch will einen Teil dieses Mysteriums aufklären. Anhand von Lebensgeschichten ausgewählter österreichischer Friedensstifterinnen und Friedensstifter der Gegenwart liefert es Denkanstöße, auch für das eigene Leben. Die Kunst des Friedens ist so vielfältig wie die Art und Weise, ein Bild zu malen. Erfahren Sie, wie andere diesen Weg gehen und ziehen Sie daraus Ihre eigenen Schlüsse. Sind Sie selbst Friedenstifterin oder Friedensstifter, lassen Sie auch andere an Ihren Erkenntnissen teilhaben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Einleitung Das Geheimnis des Friedens
1 Frieden und Wissen
Shirin Khadem-Missagh Leiterin von Bahá’í Kinderklassen
Anselm Eder Professor der Soziologie im Ruhestand
2 Frieden und Sicherheit
Oliver Jeschonek Berufssoldat, Coach und Mediator
3 Frieden in Bildung und Erziehung
Christine Haberlehner Wirtschaftspädagogin und Pionierin der Peer Mediation
Susanne Stahl Tagesmutter und Krisenpflegemutter
4 Frieden im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Sozialem
Margit Burger Expertin für Arbeitsintegration von psychisch erkrankten Menschen
5 Frieden und Gesundheit
Judith Jaindl Erste Pflegemediatorin in Österreich
Imre Márton Reményi Psycho- und Lehrtherapeut, Berater
6 Frieden und Medien
Nina Krämer-Pölkhofer Medienexpertin und Mediatorin
7 Frieden und Gerechtigkeit
Reinhard Dittrich Jurist und Mediator
Nicole Sveda Büroadministration Österreichischer Bundesverband für Mediation
8 Die Kunst des Friedensstiftens
Weiterführende Informationen
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2015 novum Verlag
ISBN Printausgabe: 978-3-99048-198-1
ISBN e-book: 978-3-99048-199-8
Lektorat: Dr. phil. Ursula Schneider
Umschlagfoto: Andreas Zauner, Bild „Konfrontation“, A-2500 Baden, www.furnierbilder.at; Bildl Taube: Doris Steiner
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Bild 1, 4, 7, 8, 13, 16, 19, 22, Bild Taube Doris Steiner, Studio 5 (Bild 7 nach einer Skizze von Imre Márton Reményi);Bild 25, 26©Nina Krämer Pölkhofer, www.hopetown.at;Bild 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30©Berndt Exenberger: [email protected]; <http://portfolio.fotocommunity.de/berndt-exenberger>
www.novumverlag.com
EinleitungDas Geheimnis des Friedens
„Der größte Feind einer Geschichte des Vermittelns sind zweifellos die Quellen. Da die Vermittlung selbst weithin zu den informellen Verfahren der Konfliktbeilegung gehört und vielfach ihr eigentliches Arbeitsfeld in der Sphäre des Geheimen und Verborgenen liegt, hinterlässt sie kaum schriftliche Spuren. Das ist noch heute der Fall.“
Hermann Kamp,Friedensstifter und Vermittler im Mittelalter, S. 10.
Der deutsche Historiker Kamp beschreibt das große Dilemma von Friedensstifterinnen und Friedensstiftern. Kämpfe und Kriege sind durch unterschiedliche Zeugnisse und Dokumente meist hinreichend gut belegt. Viele Friedensstifter der Vergangenheit haben sich durch Heldenmut und wehende Fahnen hervorgetan, während sie den Feind besiegten und damit zum Frieden beitrugen. Natürlich ist auch heute noch das Ende eines Krieges durch einen Friedensprozess gekennzeichnet, der von Menschen getragen wird. Dennoch wandelt sich das Bild des Friedens an sich und mit ihm auch jene, die sich für ihn einsetzen. Frieden und Krieg finden auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt. Die Bandbreite reicht von der zwischenstaatlichen Völkerverständigung bis hin zur inneren Zufriedenheit im Alltag einzelner Menschen. Frieden zeigt sich durch Verständnis füreinander und Vertrauen zu Bekannten, aber auch Fremden. Vorgänge, die Frieden ermöglichen und fördern, sind oft schwer durchschaubar. Das Auffinden und die Nennung jener Menschen, die maßgeblich dazu beitragen, ist für sich allein eine Kunst und auch ein Wagnis. Eine Beschränkung auf jene, die sich nur der Völkerverständigung, der Reduktion stehender Heere oder der Abhaltung von Friedenskongressen widmen, greift heute zu kurz. Es sind auch nicht immer allein jene, die in der Öffentlichkeit dafür gefeiert werden. Das Stiften von Frieden war und ist auch ein Geheimnis. Trotzdem findet es tagtäglich erfolgreich statt: in den Familien, am Arbeitsplatz, zwischen Freunden oder Feinden. Eine systematische Suche und Darstellung lohnt sich genauso wie das anhaltende Bemühen, selbst Frieden zu schaffen.
Viele Faktoren weisen darauf hin, dass die Kunst des Friedens im Verborgenen abläuft. Zu dieser Erkenntnis kommt auch die Enzyklopädie des Friedens aus Oxford, die historische Zusammenhänge untersuchte. Aktivitäten von Friedensstiftern sind oftmals vertraulich und in diesem Fall von außen nicht erkennbar. Die am Konflikt oder Krieg beteiligten Parteien haben oft kein Interesse daran, die Öffentlichkeit an diesem Prozess teilhaben zu lassen. Auch eine erfolgreiche Friedensstiftung hat nicht immer direkt messbare Konsequenzen. Kann eine kriegerische Auseinandersetzung abgewendet werden, so kann das auch die Aufrechterhaltung des Status quo bedeuten. Dadurch werden für Außenstehende keine Änderungen sichtbar, die dokumentiert werden könnten. Die Bewertung, welche einzelne Handlung welchen Effekt erzielt, ist selten möglich. Oft verursachen unterschiedliche Menschen Wendungen. Eine besonders schwerwiegende Bedeutung haben die gegenteiligen Auffassungen von Theoretikern und Praktikern zur Friedensstiftung.
Trotz der oben genannten Schwierigkeiten betrifft das Thema uns alle. Jeder hat seine persönlichen Konflikte, aus denen Kriege oder Frieden entstehen können. Die Entscheidung, welche Richtung er einschlägt, trifft jeder allein für sich. Die Welt wird wahrscheinlich weiter bestehen, unabhängig davon, ob die Menschheit überlebt oder die Erde zerstört. Den Menschen sollte es allerdings ein Anliegen sein, ihr kulturelles Erbe zu erhalten. Dazu gehört auch und vor allem die Kunst des Friedens. Auch wenn diese Kunst vielfältig ist, so ist es notwendig, sie anhand von konkreten Alltagsbeispielen zu dokumentieren und zu üben. Heute ist noch vieles unbekannt, was morgen sein wird. Es ist nicht klar, welche Eigenschaften und Fähigkeiten Friedensstifter unmittelbar brauchen. Die Kunst des Friedens ist vergleichbar mit anderen Künsten: So, wie es unendlich viele Möglichkeiten gibt, ein Bild zu malen oder Musik zu komponieren, so sind auch hier zahllose Varianten möglich. Es ist letztlich Geschmackssache, woran und wie jemand das Stiften des Friedens üben will. Es ist auch Ansichtssache, welchen Beitrag unterschiedliche Vorgehensweisen zum Frieden leisten. Dennoch, wenn die Menschen das Wissen um die Kunst des Friedens weiter vererben wollen, dann müssen sie es auch angemessen dokumentieren.
Es liegt mir sehr am Herzen, über die Aktivitäten jener zu berichten, die ich persönlich als Friedensstifterinnen und Friedensstifter erlebt habe. Nachdem ich schon viele Jahre den Wunsch gehegt hatte, ein eigenes Buch zu schreiben, war mir bald klar, dass ich mir nun den Wunsch mit diesem Thema verwirklichen werde. Ich wollte über die Lebensgeschichten von mir bekannten Menschen schreiben. Dabei war die Auswahl nicht einfach. In meiner Zeit als langjährige Funktionärin in unterschiedlichen Mediationsvereinen gab es viele Kandidatinnen und Kandidaten, die dafür infrage kämen. Ergänzend dazu wollte ich auch jene darstellen, die Mediation nicht als Beruf ausüben und dennoch in ihrem Leben Frieden stiften. Im Verlauf der Suche überraschte es mich, dass manche Menschen, die ich auserwählt hätte, sich nicht als Friedensstifter darstellen wollten – vor allem dann, wenn sie dies aufgrund der Befürchtung ablehnten, diesem Anspruch nicht zu genügen. Ich freue mich sehr, Beispiele aus unterschiedlichsten Lebensbereichen geben zu können. Bei der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten waren folgende Kriterien für mich wichtig:
• Friedensstifterinnen und Friedensstifter erkennen, dass Konflikte naturgegeben sind und die Zeiten des Friedens stören. Sie bemühen sich trotzdem, mit ihnen so umzugehen, dass Frieden wieder möglich ist.• Friedensstifterinnen und Friedensstifter wissen, dass sie selbst und andere nur dann zufrieden und glücklich werden können, wenn es auch ihrem Umfeld – und somit der ganzen Welt – gut geht.• Friedensstifterinnen und Friedensstifter akzeptieren und nutzen die Vielfalt unterschiedlicher Wege zum Frieden.Damit komme ich zu den Beitragsgebern dieses Buches. Durch ihre Offenheit zeigt sich die Vielfalt in eindrucksvoller Weise. Die Initiatorin der Bahá’í Kinderklassen in Baden bei Wien, Shirin Khadem-Missagh, weckt die Hoffnung auf die Verständigung zwischen den Religionen. Anselm Eder stellt seine langjährigen Erfahrungen als Professor der Soziologie der Universität Wien zur Verfügung. Seiner kritischen Durchsicht und seinen Impulsen verdanke ich auch die Qualität der ein- und überleitenden Texte sowie der Zusammenfassung. Dem Berufssoldaten und Mediator Oliver Jeschonek bin ich besonders für die Erkenntnis verbunden, dass das Österreichische Bundesheer der Zweiten Republik traditionell in seinem Grundverständnis eine friedensstiftende Einrichtung ist. Christine Haberlehner gibt als Wirtschaftspädagogin und Mediatorin Einblicke in Aufbau und Betrieb von Konfliktanlaufstellen in Österreichs Schulen. Susanne Stahl erzählt von ihren Erfahrungen als Tages- und Krisenpflegemutter. Margit Burger stellt die Arbeitsweise von Interwork als soziale Einrichtung zur Integration von psychisch erkrankten Menschen in das Arbeitsleben dar. Judith Jaindl zeigt Entstehung und Alltag ihrer beispiellosen Pionierarbeit als Pflegemediatorin. Imre Martón Reményi als Supervisor, Berater und Psychotherapeut verdient meine größte Hochachtung, weil er mir Klarheit über die drei Grundbedürfnisse des Lebens verschaffte, die er in diesem Buch auch selbst darstellt. Nina Krämer-Pölkhofer als Mediatorin und Medienexpertin zeigt Aspekte des Journalismus für den Frieden. Der Jurist und freiberufliche Mediator Reinhard Dittrich enthüllt hier ein paar seiner Geheimnisse erfolgreicher Mediationen, besonders im Wirtschafts- und Familienbereich. Nicole Sveda fasst ihre Erfahrungen in der mehrjährigen Arbeit als Büroadministratorin des größten österreichischen Verbands für Mediation zusammen. Auch wenn die hier dargestellten Menschen vorwiegend in Österreich wirken, so ist dies auch im Lichte der internationalen Entwicklung zu sehen. Ein- und Überleitungen zu den Biografien geben Blitzlichter in diese Rahmenbedingungen. Die Vielfalt ist ein Teil der Kunst des Friedens. Dies drückt sich auch in der Formulierung aus. Daher gehe ich bewusst von einer einheitlichen Sprache in Bezug auf unterschiedliche Geschlechter ab.
Abschließend zu dieser Einleitung möchte ich eine Entwicklung darstellen, die einen großen Beitrag zum Frieden leistete. Die Idee eines vereinten Europa gibt es schon sehr lange. Damit die Europäische Union in der heutigen Form entstehen konnte, brauchte es viele Menschen. Dennoch hat besonders die Pionierarbeit des Journalisten und Historikers Richard Coudenhove-Kalergi diesen Trend deutlich geformt. Er setzte mit seinem Buch „Pan-Europa“ im Jahr 1924 den Grundstein einer bedeutsamen Bewegung. Sie konnte zwar den Zweiten Weltkrieg nicht verhindern, dennoch bestand sie darüber hinaus. So schreibt Coudenhove-Kalergi:
„Die Europäische Frage lautet: ‚Kann Europa in seiner politischen und wirtschaftlichen Zersplitterung seinen Frieden und seine Selbständigkeit den wachsenden außereuropäischen Weltmächten gegenüber wahren – oder ist es gezwungen, sich zur Rettung seiner Existenz zu einem Staatenbunde zu organisieren?‘ Diese Frage stellen, heißt sie beantworten. … Ob ein Gedanke Utopie bleibt oder Realität wird, hängt gewöhnlich von der Zahl und der Tatkraft seiner Anhänger ab. Solange an Pan-Europa Tausende glauben – ist es Utopie; wenn erst Millionen daran glauben – ist es politisches Programm; sobald hundert Millionen daran glauben – ist es verwirklicht. Die Zukunft Pan-Europas hängt also davon ab, ob die ersten tausend Anhänger die Glaubens- und Werbekraft besitzen, um Millionen zu überzeugen und die Utopie von gestern in eine Wirklichkeit von morgen zu verwandeln.“
Wien, Richard Coudenhove-Kalergi,
Pan-Europa, Pan-Europa-Verlag, 1924, S. IX
Dieses Zitat des Verfechters eines „Vereinten Europa“ aus der Zwischenkriegszeit macht klar, dass auch eine kleine Gruppe Massen bewegen kann, wenn sie glaubwürdig viele Menschen erreicht. Die Utopie von Richard Coudenhove-Kalergi wurde zumindest teilweise Realität. Dennoch bleiben noch mehrere Lektionen zu lernen. Weder der Krieg noch der Frieden ist von der Natur vorgegeben. Unterschiedliche und oft scheinbar widersprüchliche Bedürfnisse erzeugen Konflikte. Sie sind unausweichlich. Je nachdem, wie Menschen mit ihnen umgehen, erzeugen sie Frieden oder Krieg. Je mehr Menschen sich aktiv für den Frieden einsetzen, umso mehr Friedenszeiten entstehen. Daher geht es auch konkret darum, Menschen zu motivieren, dies zu tun. Nachdem der Frieden von Natur aus vergänglich ist, liegt es an jedem, sich immer wieder darum zu bemühen. Daher sollten auch Sie als Leser sich der folgenden Frage stellen:
„Was werde ich ab jetzt zum Frieden beitragen?“
Wie Richard Coudenhove-Kalergi ausführt, bedeutet das Stellen von Fragen auch die Beantwortung von Fragen. So ist nun jeder Leser dieses Buches selbst aufgefordert, sie in seinem Sinne zu beantworten. Nur dann, wenn konkrete Vorstellungen existieren, wozu jeder beitragen kann, ist Friedensstiftung in großem Stil möglich. Richard Coudenhove-Kalergi hat sehr schön verdeutlicht, dass auch wenige dazu beitragen können, Programme aufzustellen und zu verwirklichen. Ob der friedliche Umgang mit Konflikten Utopie oder Wirklichkeit wird, hängt von allen Beteiligten ab. Was ich damit ausdrücken will: Es liegt in der Entscheidung jedes einzelnen Menschen, ob er Friedensstifter sein will, kann oder wird. Diese Gestaltungsfreiheit kann keine Macht der Welt einschränken. Die Verantwortung dafür ist auch nicht übertragbar. Sie braucht ausschließlich die eigene Vorstellungskraft und den nötigen Handlungswillen. Natürlich wünsche ich mir als bekennende Friedensstifterin, dass möglichst viele diese Richtung einschlagen. Um die vorhandene Vielfalt zu nutzen, lade ich Sie ein, dabei auch von den Erfahrungen anderer zu lernen. In diesem Sinne hoffe ich, dass die in dem Buch dargestellten Wege auch für Sie nützlich sind. Denn dann haben Sie in Zukunft noch mehr Möglichkeiten, die Kunst des Friedens persönlich zu üben. Das hilft Ihnen, aber auch anderen, mehr vom Geheimnis des Friedens zu entdecken.
1 Frieden und Wissen
Um Frieden zu stiften, ist Wissen notwendig. Solange wir keine Gewissheit darüber haben, was Frieden fördert, können wir trotz bester Absichten auch das Gegenteil bewirken. Dieses Dilemma begleitet Menschen in ihrer gesamten Geschichte. Einschlägige Überzeugungen und Meinungen sind vielfältig und von einem ständigen Wandel begleitet. Auch wenn wir heute mehr Forschung betreiben denn je, gibt es in den facheinschlägigen Werken über das Wissen der Welt keine allgemein akzeptierte Anleitung, wie Frieden gelingt. Es mag sein, dass irgendwo dieses Wissen verfügbar ist. Doch in der Fülle der Informationen verliert es sich. Die Fähigkeiten und die Technik zur Zerstörung der Erde sind bekannt. Gerade deshalb sollte es in unser aller Interesse sein, auch jene Mechanismen besser kennenzulernen, die es uns ermöglichen, in Frieden miteinander zu leben.
Das wohl größte Dilemma der Friedensstifter ist die unselige Polarisierung zwischen Krieg und Frieden. Sie stellt den Kampf gegen den Krieg als alleinige und wichtigste Maßnahme für die Friedensstifter in den Vordergrund. Es gibt jedoch nicht nur Frieden oder Krieg. Dazwischen stehen Konflikte, die „Unfrieden“ erzeugen. Die entscheidende Frage ist also nicht jene, ob das Friedensstiften allein mit friedlichen Mitteln möglich ist, sondern vielmehr, ob ein Krieg überhaupt notwendig ist. Die weitaus effektivere Vorgehensweise im Prozess des Friedensstiftens ist also, die Konfliktdynamik so zu nutzen, dass Kriege überflüssig werden. Dazu lohnt sich ein Blick auf die Konflikttheorie. Es gibt zwei Ideen über die Entstehung von Konflikten. Die erste meint, dass Konflikte ein naturgegebener Teil der Menschen sind. Die zweite stellt auf die Erfüllung grundlegender Bedürfnisse ab. Unerfüllte Bedürfnisse verursachen Konflikte. In einer Zeit, in der Menschen vielfältige Sehnsüchte und Möglichkeiten haben, steigt naturgemäß auch die Anzahl möglicher Konflikte. Dennoch liegt es am Einzelnen, ob aus Konfliktzeiten Frieden oder Krieg entsteht. Im „Kriegszustand“ erfolgt eine deutliche Abgrenzung einer Partei von den anderen „Kriegsparteien“. Das ist in der Familie nicht anders als zwischen Nationen. Jeder der Beteiligten wähnt sich als „Guter“, der das „Böse“ bekämpft, und hat dafür eine Reihe guter Gründe. Krieg setzt als Taktik die bewusste Verletzung der anderen ein. Er legitimiert in letzter Konsequenz alle Mittel, die der Vernichtung des Feindes dienlich sind. Im Kriegszustand geht es nicht mehr darum, die verursachenden Konflikte zu regeln, sondern darum, den anderen so zielgerichtet wie möglich außer Gefecht zu setzen. Auch das zwangsweise Ende eines Krieges wegen fehlender Ressourcen oder der Anerkenntnis der Überlegenheit des Gegners löst den Ursprungskonflikt nicht. Daher kann der Einsatz von Zwang oder Gewalt Frieden nur im Ausnahmefall ermöglichen. Meistens erfolgt dadurch maximal die Rückführung des Kriegs- in den Konfliktzustand.
Diese Betrachtungen gelten nicht nur für die offiziell ausgetragenen, zwischen- und innerstaatlichen Konflikte. Sie finden in unterschiedlichsten Situationen ihre Anwendung. Die Kunst des Friedens besteht nicht darin, Konflikte zu verhindern. Diese sind unvermeidlich. Die Kunst des Friedens ist vielmehr, einen sinnvollen Umgang mit ihnen zu finden. Idealerweise ist dann auch Frieden möglich. Ein mit Krieg sehr häufig in Verbindung gebrachtes Wort ist Gewalt. Allein der Begriff der Gewalt macht Angst. Er vermittelt Verbrechen und Verabscheuung. Er hat aber auch eine faszinierende Anziehungskraft. Gewalt ist mit Macht verbunden, die andere zwingen kann, nach eigenem Willen zu handeln. Welche Handlung tatsächlich jemand als gewalttätig einstuft, ist eine individuelle Einschätzung. So hatten beispielsweise die Heckenschützen der Berliner Mauer den ausdrücklichen Auftrag, jene zu erschießen, die über die Mauer nach Westberlin flüchten wollten. Konnten die Schützen jemanden an der Flucht hindern, so waren sie Nationalhelden. Jahre später wurden dieselben Menschen zu Freiheitsstrafen verurteilt. Die Einschätzung, welche der unterschiedlichen Gewalten hier vermeidbar oder aber auch am verabscheuungswürdigsten war, obliegt dem Leser. Dennoch zeigt dieses Beispiel sehr deutlich, dass die Auffassung dessen, welche Gewalt erwünscht ist, sehr vielfältig ist und großen Schwankungen unterliegt.
In Zeiten zunehmender Radikalisierung wird verständlicherweise auch die Forderung nach Gewaltfreiheit stärker. Gewalt wird dann ein Übel, das beseitigt werden muss. Dennoch kann Gewaltlosigkeit niemand erzwingen, auch nicht durch Hungerstreik oder gar Selbstmord. Er würde dann selbst zum Gewalttäter, weil er durch sein eigenes Handeln jenes der anderen einschränkt. Auch Zwang ist ein Naturgesetz. Es gibt beschränkte Ressourcen, die es zu verteilen gilt. Der Tod oder die Vernichtung eines Wesens kann das Weiterleben eines anderen ermöglichen. Nicht jeder Zwang oder jede Gewalthandlung ist beabsichtigt und hat den Zweck, andere zu schädigen. Hindert ein Vater seinen Sohn mit Gewalt daran, über eine stark befahrene Straße zu laufen, so wird niemand ihm ein Fehlverhalten unterstellen. Im Gegenteil, es wird von ihm erwartet. Was macht die Gewalt nun so schwer aushaltbar? Es ist wohl die Vorstellung, dass ein anderer etwas gegen den eigenen Willen durchsetzt. Je mehr jemandem bewusst wird, dass ihm etwas Wichtiges genommen oder vorenthalten wird, umso größer ist sein Bestreben, es sich mit Gewalt zu verschaffen. Die Frage, wann jemand zu Recht oder Unrecht Gewalt einsetzt, ist wohl nicht allgemein zu beantworten. Die Menschen können das nur im Einzelfall nach subjektivem Einschätzen entscheiden.
Jede Zeit hat und braucht seine Friedensstifter, sonst würden aus Konflikten nur Kriege entstehen, die ewig dauern. Dennoch stehen Friedensstifterinnen und Friedensstifter von heute vor ganz besonderen Herausforderungen. Es gibt trotz vieler Bemühungen noch immer keine allgemeingültige Regel, nach der Friedensstiftung gelingt. Im Gegenteil, je komplexer die Welt wird, umso unüberschaubarer sind die Mechanismen, nach denen Konflikte ablaufen. Die Geschichte lehrt uns, dass Frieden nicht allein durch den Glauben an Gott entsteht. Auch die Wissenschaft ist bislang noch den Stein der Weisen schuldig, der Kriege erübrigt. Frieden kann auch in unserer kapitalistisch orientierten Welt nicht mit Geld erkauft werden. Er entsteht durch ein ständiges Bemühen der Menschen, einen Ausgleich zwischen den eigenen Interessen und den Erfordernissen seiner Umwelt zu schaffen. Eine notwendige Voraussetzung dafür ist der persönliche, innere Frieden. Dieser stellt sich dann ein, wenn zumindest die grundlegenden Bedürfnisse erfüllt sind. Mediation oder Vermittlung zielt genau darauf ab. Sie klärt die Voraussetzung und die Möglichkeit der bedürfnisorientierten Friedensstiftung. Frieden entsteht in der Form freiwillig und wird sogleich als solcher wahrgenommen. Auch die zwangsweise Friedensstiftung ist möglich. Sie führt allerdings nicht sofort zum inneren Frieden, weil sie auch die Trauer über den Verlust oder das Verlieren beinhaltet.
Eine wesentliche Rolle beim Wissenserwerb spielen der Glaube und die Religionen. Es handelt sich hierbei um jenes Wissen, das entsprechend der Meinung der Gläubigen keine Beweise braucht, weil es unmittelbar von Gott kommt. Der Glaube hat seit Menschheitsbeginn eine immense Auswirkung darauf, ob eine Gemeinschaft in Frieden miteinander leben kann oder nicht. Die dokumentierte Geschichtsschreibung liefert unzählige Beispiele für die friedensstiftende Wirkung von Religionen und deren Anhängern. Doch zumindest ebenso viele Zeugnisse gibt es von ihrer zerstörerischen Wirkung. Auch die von Gott gegebene Orientierung braucht Regeln. Heute sind zehn Gebote offenbar nicht mehr ausreichend, weil Religionsstifter wie -verbreiter Bücher füllen, nach welchen Gesetzen „Gottestreue“ zu leben haben. In der Geschichte hatten vor allem jene Probleme, die von sich behaupteten, das Wort Gottes unmittelbar zu verkünden. Das führte oft zur Ablehnung und Verfolgung. Auch bei der jüngsten der Weltreligionen, dem Bahá’ítum, kam es vor wenigen Generationen erst zu umfangreichen Verfolgungen und Massenhinrichtungen – vor allem in Persien, wo Bahá’í bis heute keine Religionsfreiheit haben.
Aktuell gibt der Islam mit seinen radikalen Strömungen in der westlichen Welt Anlass zur Ablehnung. So dient Religion heute noch zur Rechtfertigung von Terroranschlägen sowie deren gewalttätige Bekämpfung. Dennoch weisen viele Schriften auf die Notwendigkeit und Bedeutung der Friedensstiftung hin. Ábdu’l-Bahá, der Sohn des Religionsstifters der Bahá’í, erklärt die Friedensstiftung mit den Worten: „Die Liebe ist der eigentliche Kern des Friedens … Die Liebe, die von Gott kommt, ist die Grundlage … Jeder sieht in der Seele des anderen einen Spiegel der Schönheit Gottes. Und hat er diesen Grad der Ähnlichkeit entdeckt, fühlt er sich in Liebe zum anderen hingezogen … Diese Liebe wird wahre Übereinstimmung ermöglichen und den Grundstein zu echter Einigung legen.“
Religion hat in der Geschichte der Friedensstiftung eine ganz besondere Stellung. Alle Religionen berufen sich auf die allumfassende Weisheit eines Gottes oder mehrerer Götter. Niemand kann diese infrage stellen. Die Interpretationen der Meinungen von Gott bzw. Göttern weichen jedoch voneinander ab. Menschen initiierten unter Berufung auf Gott sowohl Frieden als auch Kriege. Ein religiös motivierter Terrorist schätzt sich selbst wahrscheinlich auch als Friedensstifter ein. Seiner Meinung nach gibt es zwei Möglichkeiten des Friedensstiftens. Entweder nehmen alle den eigenen Glauben an oder sie müssen eliminiert werden, damit sich der wahre Glaube richtig entfalten kann. Menschen mit demselben Glauben sind Freunde, Andersgläubige sind Feinde. Können Radikalisten von dieser Vorstellung abgehen, müssen sie nicht mehr zwangsläufig Kriege gegen Andersgläubige führen. Dann können sich Anhänger unterschiedlichster Religionen auf Augenhöhe begegnen. Sie können wechselseitig hinterfragen, was sie brauchen, um in Frieden nebeneinander leben zu können. Im Idealfall sehen alle Religionsanhänger in allen anderen Menschen einen Spiegel der Schönheit Gottes. Der dadurch entstehende Weltfriede wäre zwar nicht frei von Konflikten und Kämpfen, doch würden diese Glück und Zufriedenheit nicht stören. Niemand würde dann vorsätzlich jemand anderem Schaden zufügen. Können in angemessener Zeit alle wesentlichen Bedürfnisse aller Gläubigen erfüllt werden, erübrigen sich Kriege von selbst und müssen nicht mehr bekämpft werden.
Shirin Khadem-MissaghLeiterin von Bahá’í Kinderklassen
Erfahrungen in Kindheit und Jugend
Ich wurde in eine Familie hineingeboren, in der ich viel Liebe empfangen durfte. Dafür bin ich dankbar. Ich war das erste Enkelkind von beiden Seiten meiner Großeltern und es wurde mir daher das besondere Privileg zuteil, die Wärme und Zuneigung von allen Verwandten unmittelbar erleben zu dürfen. Die ersten Jahre wohnten wir in Mumbai in Indien, danach übersielten wir nach Panchgani, wo meine Eltern an der New Era Bahá’í Schule unterrichteten. Nach einigen Jahren kehrten wir nach Mumbai zurück. Mein Vater war Kaufmann, meine Mutter zu Hause. Beide waren Bahá’í. Sie haben uns in allen Dingen unterstützt und gefördert. Wir hatten eine sehr gute Beziehung zu allen unseren Familienmitgliedern. Meine beiden jüngeren Brüder leben heute noch in Indien und sind renommierte Ärzte. In Mumbai besuchte ich eine christliche Schule. Hier habe ich das Studium der Bibel geschätzt. Das war ein Freifach, das mich sehr interessierte.
Mein Vater hat viele Jahre ehrenamtlich in leitender Funktion am Bau des Bahá’í Hauses der Andacht in Neu-Delhi gearbeitet. In Form einer Lotusblüte ist es als „Lotus Tempel“ und als „Taj Mahal des 20. Jahrhunderts“ zu einem Wahrzeichen Neu-Delhis geworden. Es ist ein wunderschönes Gebäude, das Menschen aller Religionen offen steht. Die heiligen Schriften und Gebete aller Religionen werden hier gelesen oder gesungen.
Ich selbst habe mich mit fünfzehn Jahren zum Glauben der Bahá’í bekannt. Im Bahá’í Glauben gibt es keine Taufe und der Mensch hat Entscheidungsfreiheit, was die Religion betrifft. Daher war das Bekenntnis zur Bahá’í Religion ein bewusster Schritt für mich. Ich war damals sehr berührt vom Leben Bahá’u’lláhs, dem Religionsstifter. Er wurde – ähnlich wie Jesus – deswegen verfolgt, weil er den Anspruch als Gottesoffenbarer erhoben hat. Er war über 40 Jahre aus diesem Grund in Verbannung und Gefangenschaft. Schon damals wurden über 20.000 Gläubige in Persien grausam umgebracht, weil sie sich zu dem Glauben bekannten. All das erinnerte mich an die frühen Christen. Die gesamte Geschichte des Glaubens hat mich sehr berührt, seine Lehren haben mich bewegt und mein Leben geprägt.
Glaubensinhalte als Wertschöpfung
Vor Gott sind alle Menschen gleichwertig. Das betrifft Mann und Frau gleichermaßen wie auch Menschen unterschiedlicher Herkunft oder Hautfarbe. Wir sind „eins“. Diese Kernaussage des Bahá’í Glaubens war ein wesentlicher Beweggrund für meine Entscheidung. Mir gefiel auch, dass den Menschen die Prüfung des Glaubens nicht abgenommen wird. Es gibt keine blinde Übernahme der Traditionen von Eltern, Großeltern oder Nachbarn. Jeder Mensch hat die Verantwortung, selbst zu prüfen, was wahr ist.
Ich erlebte es selbst in Indien, wie Religionen als Begründung für Gewalt herangezogen wurden. In Indien gibt es alle Religionen. Kommt man nach Mumbai, ist klar zu erkennen, dass beispielsweise eine spezielle Gegend von Hindus bewohnt wird. In anderen leben vorwiegend Moslems. Die Parsis, die Zoroastrier, leben in Kolonien, die nur durch ein großes Tor erreichbar sind. Das ist bedauernswert, denn Menschen kapseln sich ab und stellen Barrieren zwischen verschiedenen Glaubensgemeinschaften auf. Es gibt dann immer wieder Zeiten, wo durch politische Unruhen religiöse Gefühle missbraucht werden. Dann werden ganze Wohnviertel in Brand gesetzt. Das gibt es heute auch noch. Dabei werden auch Menschen umgebracht – Familien mit Kindern –, die unschuldig sind. Das kann keinesfalls der Zweck von Religion sein. Religion sollte Menschen zusammenführen, nicht trennen. Wo eine Religion Ursache von Zwietracht ist, sagt Bahá’u’lláh, ist es besser, ohne eine solche zu sein. Ich fand in der Bahá’í Religion die für mich wesentlichen Punkte, dass es nur einen Schöpfer gibt und dass alle Religionen in ihrem Ursprung vom gleichen Schöpfer inspiriert sind. Daher ist der Kampf der Vertreter der Religionen gegeneinander ein Widerspruch. Die Religionen sind ein fortschreitender Prozess in der Erziehung der Menschheit, wenn wir die Jahrtausende betrachten. Ausgehend von Sippen, Völkern, Nationen und Staaten stehen wir jetzt an der Schwelle zur Einheit der Menschheit auf einem Planeten Erde. Bahá’u’lláh sagt: „Diese Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger.“ Wenn man sich das überlegt, fallen alle Grenzen logischerweise weg. Wissenschaftlich ist das gut dokumentiert. Ein Satellitenbild zeigt deutlich nur einen einzigen Planeten Erde. Die politischen Staaten sind dabei nicht erkennbar. Die geistige Erkenntnis, dass wir eine Menschheit sind, fehlt uns noch. Dadurch, dass wir diese Einheit nicht haben, können wir derzeit noch nicht zu den Lösungen der Probleme der Welt kommen.
Eine Vorbedingung für die Einheit ist die Gerechtigkeit. Bahá’u’lláh sagt: „Der Zweck der Gerechtigkeit ist das Zustandekommen von Einheit unter den Menschen.“ In einer Familie, in der ein Mitglied bevorzugt oder vernachlässigt wird, kann es keine Einheit geben. Wir alle sind wie die Geschwister einer Familie. Wenn es einem Mitglied schlecht geht, müssten wir alle um ihn besorgt sein. Auch wenn es niemals sein wird, dass es allen gleich gut geht, so müsste allen ein Mindestmaß an Wohlergehen zukommen. Diese Gedanken habe ich als Kind bereits durch meine Erziehung – auch in den Kinderklassen der Bahá’í – mitbekommen.
Ein besonderer Wegbegleiter in meiner Jugend
In jungen Jahren habe ich Herrn Faizi kennengelernt, der mein Leben stark geprägt hat. Er kam ursprünglich aus dem Iran und hat viele Jahre in Haifa gelebt. Er war ständig weltweit auf Reisen und hat Bahá’í Gemeinden besucht. Vor allem als junger Mensch war ich sehr von seiner Güte beeindruckt. Er hatte mich damals bewegt, ein Lied über Hiroshima zu schreiben, weil er mir vermittelte, dass dieses Thema für die Zukunft sehr wichtig sei.
Er verkörperte für mich die reine Liebe. Als Kind und in meiner Jugend hat er mir oft Karten aus unterschiedlichen Ländern geschickt. Durch seine ermutigenden Worte fühlte ich mich so, als ob ich das einzige Kind für ihn gewesen wäre. Später habe ich erfahren, dass er das für Hunderte von jungen Menschen weltweit gemacht hat. 1980 ist er verstorben. Diese Liebe zu Kindern und die Arbeit, die ich jetzt mit Kindern mache, ist sicher von ihm beeinflusst.
Der Werdegang meiner Familie
Mein Mann Bijan ist Geiger und Dirigent und wir haben uns auf seiner Konzerttournee in Indien kennengelernt. Er ist auch Bahá’í und so bin ich ihm erstmals im Bahá’í Center in Mumbai begegnet. Später haben wir korrespondiert und schließlich geheiratet. Ich war damals sehr verliebt. Das hat mir den Mut gegeben, meine Heimat und meine Lieben zu verlassen und nach Österreich zu kommen. In Indien war ich gut in die Gesellschaft integriert und mitten im Medizinstudium. Im ersten Jahr in dem neuen Land fiel es mir schwer, die neue Sprache zu lernen. Nach einem Jahr war das schon einfacher. Ich bin auch heute noch nicht perfekt in Deutsch und mache Fehler bei den Artikeln. Aber ich habe mich hier immer sehr wohlgefühlt, weil mich auch in Österreich die Familie meines Mannes mich liebevoll aufgenommen hat. Wir lebten in einer eigenen Wohnung, waren aber in Kontakt mit den hier lebenden Verwandten und einer Menge von Bahá’í Freunden. Ich hatte immer das Gefühl, willkommen zu sein. Hier studierte ich Musikpädagogik. Drei Jahre nach unserer Hochzeit kam unser Sohn Vahíd zur Welt. Er wuchs zusammen mit unserer Tochter Martha auf, die zwei Jahre nach ihm geboren wurde. Unsere jüngste Tochter Dorothy kam dreizehn Jahre danach zur Welt.
Es ist eine schöne Zweisamkeit mit meinem Mann. Der geistige Austausch ist sehr bereichernd. Wir träumen manchmal sogar das Gleiche. Es kommt auch vor, dass ich etwas denke, was er dann ausspricht. Ich habe eine sehr innige Verbundenheit mit ihm.
Über Beziehung und Kommunikation
Es ist mir wichtig zu lernen, miteinander zu kommunizieren. Damit meine ich auch das Ansprechen von schwierigen Situationen und Problemen. Da musste ich selbst lange an mir arbeiten. Anfangs konnte ich mich nicht gut artikulieren, wenn mich etwas gestört oder verletzt hat. Ich wollte niemandem zu nahe treten oder verletzen. In der Hinsicht musste ich viel üben. Da habe ich darüber nachgedacht, ob das lange Schweigen und Herumtragen von negativen Gefühlen nicht sinnlos sei. Irgendwann kam die Erkenntnis, dass es besser ist, Probleme bald anzusprechen, weil sie dann früher gelöst und bereinigt werden können. Das ist ein wesentlicher Faktor in unserem Zusammenleben, egal ob in der Familie, im Beruf oder mit den Nachbarn. Es ist eine hohe Kunst, unangenehme Situationen anzusprechen, ohne die anderen dabei zu verletzen. Dabei erlebte ich, dass es nicht notwendigerweise zu einer Verletzung der Gefühle anderer Menschen kommt. Was passiert, hängt stark von der Formulierung ab. Statt jemandem vorzuwerfen, dass er etwas Schlechtes getan hat, sollten wir eher davon reden, welche Gefühle wir selbst in Bezug auf das Problem haben. Selbstverständlich ist es auch sinnvoll, daran die Frage zu knüpfen, wie das in Zukunft besser gehen könne. Damit verbunden ist die Feststellung, dass der andere es wahrscheinlich gar nicht böse mit mir gemeint, sondern sich einfach nichts dabei gedacht hat. Und es ist schade, wenn wir Situationen in einer Weise interpretieren, wie sie nicht waren. Durch das Schweigen bleibt die Situation bestehen, durch die Aussprache wird sie bereinigt. Die Familie war und ist hier das erste Übungsfeld. In diesem Zusammenhang bleiben wir Übende. Es geht darum, dass jeder Tag besser sein sollte als der Tag zuvor.
Veränderungen – damals und heute
Der Kontakt zu meinen Eltern und meinen Verwandten in Indien wurde durch die Entwicklung der Technik wesentlich erleichtert. Am Beginn meiner Zeit in Österreich mussten wir Telefongespräche noch beim Postamt buchen. Dann mussten wir den ganzen Tag zu Hause warten, weil wir nicht wussten, wann das Gespräch durchkommt. Die Zeit war auf drei Minuten beschränkt und sehr teuer. Auf Wunsch konnten wir das Gespräch auf weitere drei Minuten verlängern. Dann kam die Stimme des „Telefon Operators“, der uns darüber informierte, dass unsere Zeit vorbei sei. Auch die persönlichen Reisen waren damals sehr anstrengend. Es gab aus Wien keine direkten Flüge nach Mumbai. Das ist inzwischen alles besser. Heute kann man so lange reden, wie man will. Noch Jahre zuvor war das undenkbar, wie Science-Fiction oder ein Traum. Aber das ist alles wahr geworden. Daran denke ich auch immer, wenn uns Leute weismachen wollen, dass es die Einheit der Menschen nie geben werde. Wenn sie sagen, dass Frieden eine Utopie sei und die Menschen sich immer bekriegen würden und nie dazulernten. Daran glaube ich nicht. Wir sind in einer Phase, die zu einer höheren Ebene des Zusammenlebens führt. Der Weltfrieden ist nicht nur möglich, sondern unumgänglich.
Rückblickend würde ich nichts anders wünschen, als wie es geschehen ist. Inzwischen haben wir vier Enkelkinder, die ich großartig finde. Bei unserer jüngsten Tochter war vieles schon leichter, weil ich erlebt hatte, was aus unseren älteren Kindern geworden ist. Bei ihnen hatte ich das Aufblühen schon gesehen. Daher habe ich das große Potenzial auch in dem kleinen Kind schon erkannt. Die vielen Fähigkeiten und guten Eigenschaften sehe ich jetzt in allen Kindern, mit denen ich zusammenkomme. Es tut mir manchmal weh, wenn ich eine Mutter erlebe, die ihrem Kind immer wieder sagt, dass es etwas nicht kann oder schafft. Das ist eine Erniedrigung statt einer Ermutigung. Ich habe gesehen, was in Kindern steckt und welch großartige Menschen sie geworden sind.
Wir organisieren in der Bahá’í Gemeinde in Baden seit 1996 die Familientage. Es ist uns ein echtes und ernsthaftes Anliegen, zum Wohl der Gesellschaft beizutragen. Das beginnt in der Familie, denn sie ist der Humus, in der die nächste Generation aufwächst und der somit die Zukunft prägt.
Kinderklassen zur geistigen Erziehung
Das Abhalten von Kinderklassen habe ich von meiner Mutter gelernt. Ab dem Zeitpunkt, wo ich eigene Kinder hatte, habe ich andere Kinder zu mir eingeladen. Später habe ich mit Freunden kleine Gruppen je nach Alter gebildet. Das Ziel dieser Klassen ist es, zur Charakterbildung beizutragen und Werte zu vermitteln. Es gab zwar Bahá’í Familien in Baden, als ich nach Österreich kam, doch keine Kinderklassen. Wir haben damals, im Jahr 1976, kurz nach der Geburt von unserem Sohn Vahíd damit begonnen. Am Anfang waren es zwei Kinder. Dann kamen bis zu 40 Kinder zu uns ins Haus. Inzwischen haben diese Kinder Familien gegründet und eigene Kinder, die auch zu uns kommen. Das bedeutet für mich, dass ich bereits zwei Generationen der Freude in den Kinderklassen erlebte. Es ist für mich sehr schön zu sehen, wie sich Kinder entwickeln und zu glücklichen Erwachsenen werden. So tragen sie auch zum Wohl der Gesellschaft bei und fördern die Einheit.
Jedes Kind ist wie „ein Bergwerk, reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert. Nur die Erziehung kann bewirken, dass es seine Schätze enthüllt und die Menschheit daraus Nutzen zu ziehen vermag.“ Diese Erziehung erfolgt in drei Bereichen: im körperlichen, im menschlichen und im geistigen Bereich. Die körperliche Dimension bezieht sich auf die körperlichen Bedürfnisse, wie z. B. Schlafen, Essen, Sport oder Hygiene. Im menschlichen Bereich ist es die Förderung des sozialen Umgangs, das Erwerben von Wissen und die Schulung der Begabungen. Es muss aber noch die geistige Erziehung dazukommen. Es ist dies die Beziehung zum Schöpfer. Das Kind muss selbst seine Beziehung zu Ihm finden können. Dadurch erhält es Sicherheit und ein Urvertrauen. Es geht hier um die Vermittlung der geistigen Eigenschaften, wie z. B. Liebe, Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit oder Gerechtigkeit. Es ist notwendig, alle diese Tugenden gemeinsam mit körperlicher und menschlicher Bildung zu lernen. Das ist wie ein Baum, der in allen Bereichen Nahrung braucht. Er braucht das Wasser von der Erde, aber auch das Licht der Sonne. Der Mensch braucht die materielle körperliche und menschliche Erziehung von dieser Welt und die geistige durch Gott. Dabei geht es mir um die Quellen, um das, was Jesus oder die anderen Religionsstifter selbst gelehrt haben, und nicht um das, was die jeweiligen Machthaber der Religionen heute predigen. Die Quellen sind der Ursprung der überlieferten Schriften, nicht die Hasspredigten der Religionsführer.
Ein schönes Erlebnis mit Kindern war für mich die Aufführung von zwei Musicals, eines davon in Zusammenarbeit mit der heutigen Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule in Baden. Mehrere Mütter haben mich dabei auch organisatorisch unterstützt. So konnten wir mit 24 Kindern ein Musical aufführen. Es war das internationale Jahr des Friedens. Wir haben auch eine Tournee gemacht, bei der wir im Brucknerhaus in Linz, im Stadttheater in Wiener Neustadt und für die Roma im Oho Zentrum in Oberwart im Burgenland Aufführungen hatten. Das eine Musical handelte von der Suche nach dem Glück und das zweite von der Einheit auf der Welt. Die Kinder haben in dem Zusammenhang auf die verschiedensten Probleme aufmerksam gemacht: Umwelt, Hungersnöte, Kriege. Jeder hat damals versucht, einen Teilbereich zu lösen, was natürlich so nicht funktionieren konnte. Sie haben im Stück dargestellt, dass die Einheit fehlt. Das war eine großartige Erfahrung für uns alle. Am meisten haben wahrscheinlich die mitwirkenden Kinder davon profitiert.
Ich hatte auch die Kindermusikgruppe „Lotus“ gegründet. Mit ihnen habe ich CDs produziert und bin auf Reisen durch Österreich gegangen. Die Kinder haben Lieder gesungen und auf verschiedenen Instrumenten gespielt und Geschichten über Werte und Eigenschaften erzählt. Das war sehr rührend. Es ist für Erwachsene besonders ergreifend, wenn sie aus dem Kindermund geistige Inhalte erfahren.
Lange Zeit habe ich selbst auch in der Musikgruppe Dawn Breakers mitgearbeitet. In dieser Gruppe habe ich gesungen, aber auch Lieder für sie geschrieben. Wir haben gemeinsam viele Tourneen gemacht – von Europa bis nach Afrika. Auch mit dieser Gruppe haben wir mehrere Platten produziert, die heute noch erhältlich sind. Wir wollten dabei den Friedensgedanken durch die Lieder zum Ausdruck bringen. Durch die Künste kann man Inhalte besser vermitteln. Sie erreichen den Kopf und das Herz. Gehen Reden nur in den Verstand ein, so geraten sie leicht in Vergessenheit. Aber was das Herz berührt, behält man lange.
Gemeinsame Ideen verwirklichen
In Indien habe ich ein Medizin- und Klavierstudium begonnen. In Österreich hätte ich Latein nachlernen müssen, um das Medizinstudium fortzusetzen. Deshalb habe ich mich entschlossen, Musikpädagogik zu studieren. Ich liebe die Welt der Musik. Darin bin ich aufgegangen. Als ich geheiratet habe, habe ich einen Geiger an meiner Seite gehabt. Heute habe ich drei Geiger und eine Pianistin in meiner Familie, da sich die Musik in unseren Kindern großartig fortgesetzt hat. Ich habe das Üben aller Familienmitglieder zu Hause wahrlich genossen.
Mein Mann war sehr erfolgreich und hat viele Auszeichnungen für seine Arbeit erhalten. Gemeinsam haben wir vieles aufgebaut. Wir besprechen alles miteinander und bekommen dadurch wechselseitige Impulse. Wo es möglich war, begleitete ich ihn auf seinen Konzertreisen, wenn es die Familiensituation erlaubte.
Nach der Gründung des Festivals Allegro Vivo durch meinen Mann übernahm ich die Unterstützung der Kurse der Kinder und die Betreuung der Eltern. Diese bilden einen großen Zweig der Sommerakademie des Festivals. Es sind jährlich rund hundert Kinder, die daran teilnehmen. Auch bei der Gründung von GLOBArt war ich gemeinsam mit meinem Mann Bijan involviert. Wir haben die Idee auf einer Zugreise, von Budapest kommend, besprochen. Das Projekt bestand darin, Wissenschaften und Künste für den Fortschritt der Gesellschaft zu verbinden. Es sind beide Aspekte der menschlichen Kultur, die zusammenwirken müssen. Heute werden jährlich Akademien in Österreich zu bestimmten Themen abgehalten. Es ist zu einer großen Institution gewachsen. In diesem Jahr gab es ein Projekt mit dem amerikanischen Pädagogen John Hunter. Er entwickelte das Spiel „World Peace Game“. Dabei werden Kinder mit den schwierigsten Problemen in der Welt, wie Umwelt, Ressourcen, Kriege, Hungersnot oder Katastrophen, konfrontiert. Sie bilden Gruppen und müssen innerhalb einer Woche Lösungen für die Probleme finden. Dabei spielen die Kinder höchst verantwortliche Posten und Institutionen wie Präsidenten, Minister, Weltbank oder Vereinte Nationen. Sie lernen dabei, miteinander zu verhandeln, und erkennen, dass Kriege nichts außer Zerstörung bringen. Heute bin ich noch immer im Vorstand von GLOBArt und mein Mann ist Ehrenpräsident.
Frieden zur gegenseitigen Entwicklung





























