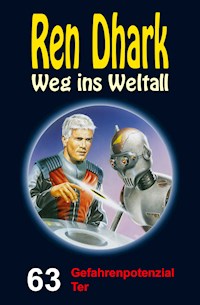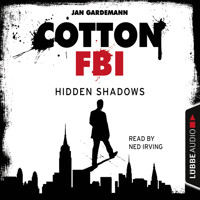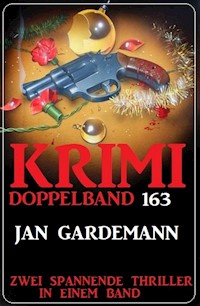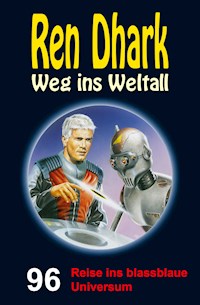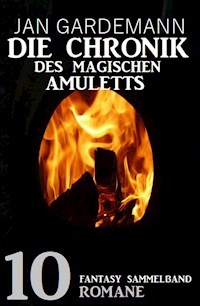Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Federheld
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2066 ist die Scharia in Europa allgemeingültiges Gesetz. Die Demokratie, die während ihrer Spätphase von zum Islam konvertierten Abgeordneten und Ministern gnadenlos ausgehöhlt wurde, ist längst Geschichte und unter dem wütenden Feuersturm der Gläubigen blutig untergegangen. Der grüne Gürtel des Islam erstreckt sich von Indonesien über Afrika, den Staaten des Baltikums bis nach Europa. Doch die Vereinigten Puritanischen Staaten, das Neo-Katholische Rom und die Orthodoxen Großreiche im Osten trotzen noch dem Einfluss der Islamisten, die sich mit ihnen in einem ständigen Dschihad befinden. Diese Entwicklung bestimmt den Alltag von Ludwig Rauber, Bürger der Islamistischen Republik Deutschland und Mitarbeiter des Instituts für Netzsicherheit, das darüber entscheidet, welche Informationen im streng abgeriegelten muslimischen Datennetzwerk zur Verfügung gestellt werden und welche nicht. Ludwig erkennt, dass im islamistischen Deutschland nicht alles so läuft, wie es den Gläubigen weisgemacht wird. Eine Erkenntnis, die sein Leben auf den Kopf stellt und seine Existenz nachhaltig bedroht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zwangsbekehrt
Dystopischer Roman
von
Jan Gardemann
I M P R E S S U M
© 2017 Jan Gardemann
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Federheld.com
Inhaber: Jan Gardemann
Gänsekamp 7
29556 Suderburg
Titelbild und Gestaltung: Jan Gardemann
weitere Informationen:
www.federheld.com
facebook: Federheld.com
Vervielfältigung und Nachdruck des Textes und des Covers (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet.
Inhalt:
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
1. Kapitel
Die Moscheen sind unsere Kasernen,
die Minarette unsere Bajonette,
die Kuppeln unsere Helme
und die Gläubigen unsere Soldaten.
(Ziya Gökalp, Türkischer Dichter)
»Erhebt Euch, denn das Gebet ist süßer als der Schlaf!«
Der von Lautsprechern verstärkte Ruf des Muezzins hallte über die eisverkrusteten Dächer der klassizistischen Bauwerke hinweg, die vom Minarett der Fadlah-Moschee weit überragt wurden. Die Schultern hochgezogen, um sich gegen den eisigen Februarwind zu schützen, beschleunigte Ludwig Rauber seinen Schritt. Der Kragen seines bis zum obersten Knopf geschlossenen Mantels ließ den blonden Vollbart vorwitzig abstehen. Ludwigs hektisch darüber hinweg streichender Atem hatte sich in dem drahtigen Haar verfangen und bildete Eiskristalle.
Während er durch die Schatten der alten Alleebäume eilte, spähte er zu dem Muezzin unter dem vergoldeten Zwiebeldach des Minaretts empor. Der Mann hatte die Kapuze seines grünen Parka tief in die Stirn gezogen. Aus der Entfernung waren von seinem Gesicht nur der breite dunkle Vollbart und die Augen zu erkennen, in denen sich fahl das Licht der verhangenen Morgensonne spiegelte.
Der Muezzin wandte sich ab, tauchte in den Schatten ein und verschwand.
Nervös presste Ludwig die Lippen aufeinander. Zum Glück hatte er sein Ziel fast erreicht. Es wurde höchste Zeit, dass er sich irgendwo, wo man ihn sah, zum Gebet niederließ.
Ohne sich umzublicken sprang er zwischen den Bäumen hervor, verließ den breiten Mittelstreifen und überquerte die Straße der Einzigen Wahrheit mit langen Schritten. Die Fahrbahn lag genauso verwaist da wie die Gehwege: Überall im islamistischen Berlin waren die Bürger in diesem Moment damit beschäftigt, den Gebetsteppich nach Mekka auszurichten und den Tag mit dem Morgengebet zu beginnen.
Ein paar Tauben, von der blechernen Stimme des Muezzins aufgescheucht, landeten flügelschlagend vor dem Institut für Netzsicherheit und pickten nach Brotkrumen, die der alte Pförtner vor den Eingang gestreut hatte.
»Verschwindet! «, fauchte Ludwig ungehalten und sprang in den Vogelschwarm hinein. Während die Tauben seitlich fort stoben, überwand er die drei Eingangsstufen des Gebäudes, drückte die schwere Eichentür mit der Schulter auf, stolperte in die schummerig beleuchtete Eingangshalle und steckte seine Kennkarte in das Erfassungsgerät.
Der Pförtner hatte seinen Posten hinter dem Empfangstresen bereits verlassen und stand barfuß vor seinem nach Südost weisenden Gebetsteppich. Dem Eindringling, der ihn dabei störte, sich auf sein Zwiegespräch mit Gott vorzubereiten, warf er unter unwillig zusammengezogenen buschigen Brauen einen mürrischen Blick zu.
Ludwig nickte dem Mann freundlich zu und zog einen zusammengerollten Gebetsteppich aus dem Regal, das den Wartebereich räumlich von der Eingangshalle trennte. Um diese frühe Morgenstunde hatte sich noch kein Bürger mit besonderem Anliegen im Institut eingefunden. Der Wartebereich war leer, die Teppichrollen lagen an ihrem Platz – abgesehen von dem, den er genommen hatte.
»Mein Wagen ist im Tiergarten stehen geblieben«, erklärte Ludwig und lächelte gezwungen aus seinem langsam auftauenden Bart hervor. »Motorschaden. Nehme ich an.«
Mit einer ausholenden Bewegung entrollte er den Teppich gekonnt in der Luft und ließ ihn neben dem des Pförtners zu Boden gleiten. »Warten Sie einen Moment auf mich, Herr Suhr?«
Der Angesprochene nickte nicht gerade begeistert, dann schielte er zu der Überwachungskamera hinauf, deren Linse direkt auf die beiden Männer gerichtet war.
Ludwig, der seinen Wintermantel ausgezogen und über den Empfangstresen geworfen hatte, eilte zu dem kleinen Waschbecken im Wartebereich. Er schob die Hemdsärmel bis über die Ellenbogen zurück und führte die rituelle Waschung durch, indem er vorgeschriebene Worte murmelte und zuerst sein Gesicht und dann Hände und Arme wusch. Als er sich mit den nassen Händen übers Haar fuhr, war er mit den Füßen schon aus den Stiefeln geschlüpft. Nachdem er auch die Fersen benetzt hatte, kehrte er barfüßig an die Seite des Pförtners zurück.
Einen Moment lang stand Ludwig schweigend da. Dann gab er Suhr mit einem Nicken zu verstehen, dass er bereit war.
Die Männer hoben die Hände neben den Kopf und sprachen: »Allahu akbar.« Dann verschränkten sie die Hände vor dem Bauch und schlossen die Augen.
»Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes«, rezitierte Ludwig. Er hörte, dass Suhr dieselben Worte sprach.
Während sie zusammen die erste Sure aufsagten, schweiften Ludwigs Gedanken ab. Er machte sich Sorgen um seinen Gläubigen, den er am Rand der Straße des 11. September hatte stehen lassen müssen: Der Motor war plötzlich ausgegangen und hatte nicht wieder anspringen wollen. Den Fahrzeugen der traditionsreichen Glaubensgemeinschaftswerke hatte einst der Ruf angehaftet, unverwüstlich zu sein. Doch dies schien ausgerechnet auf die neue Baureihe der „Gläubigen“ nicht zuzutreffen. Seit er das Fahrzeug von der Bewilligungsstelle zugewiesen bekommen hatte, war der Ärger nicht abgerissen.
Offenbar will Allah meine Geduld und meinen Glauben mit diesem Auto prüfen, dachte er sarkastisch. Er verneigte sich und legte die Handflächen oberhalb der Knie auf die Beine.
»Allahu akbar.«
Während er eine Lobpreisung des Allmächtigen dreimal aussprach, versuchte er die aufkeimenden Gedanken an den Räumdienst zu verdrängen, der seinen am Rand der Straße des 11. September unrechtmäßig abgestellten Wagen entfernen würde, falls der schon verständigte Reparaturdienst den Wagen nicht schnell genug abholte.
In den Dreißigerjahren des 21. Jahrhunderts waren in der Dekade der Bekehrung in den deutschen Großstädten regelmäßig Autobomben explodiert. Abgesehen von den zivilen Opfern waren dabei auch zahlreiche Gebäude zerstört oder beschädigt worden. Das damals verhängte Parkverbot in den Stadtzentren war nicht wieder aufgehoben worden: Noch immer gab es religiöse Eiferer, die sich aufgefordert fühlten, Autobomben zu platzieren, wo sie einen Ungläubigen vermuteten oder die Scharia missachtet wähnten. Aus diesem Grund durfte man Fahrzeuge in diesen Stadtgebieten nur in so genannten Parkbunkern abstellen, über die alle größeren öffentlichen Gebäude inzwischen verfügten – und auch das Ifnes, das Institut für Netzsicherheit, in dem Ludwig arbeitete.
Die beiden Männer richteten sich wieder auf. »Möge Gott den erhören, der ihn preist. Dir, mein Herr, die Lobpreisung.«
Ludwig ließ sich mit einem weiteren »Allahu akbar« auf die Knie sinken und berührte mit der Stirn den Gebetsteppich. »Ruhm sei Gott, dem Höchsten«, murmelte er und dachte, dass er sich glücklich schätzen konnte, das Institut zum Morgengebet trotz der Autopanne noch rechtzeitig erreicht zu haben. Hätte er das Gebet in einem anderen öffentlichen Gebäude oder an einem videoüberwachten Platz verrichten müssen, hätte ihm dies einige Unannehmlichkeiten bereitet: Dem für das Ifnes zuständigen Beamten der Glaubenspolizei wäre sein Fehlen vom Überwachungssystem unweigerlich gemeldet worden. Es hätte Ludwig wertvolle Minuten gekostet, den Beweis zu erbringen, dass er das Morgengebet nicht etwa versäumt, sondern nur an einem anderen Ort ausgeführt hatte.
Schwerfällig setze er sich auf die Fersen und legte die Hände auf die Oberschenkel. »Mein Gott, vergib mir, erbarme dich meiner.« Und bewahre meinen Gläubigen davor, vom Räumdienst abgeschleppt zu werden, fügte er in Gedanken hinzu. Er berührte abermals mit der Stirn den Boden.
Der erste Gebetsabschnitt war damit abgeschlossen. Ludwig verharrte einen Moment auf den Fersen. Er musterte die Weltkarte an der Wand neben dem Wartebereich. Sie war der einzige Schmuck in der sonst trostlos erscheinenden Eingangshalle. Die Kontinente und Länder waren ihrer religiösen Zugehörigkeit entsprechend farblich gekennzeichnet. Der islamistische Machtbereich war grün gefärbt, der der Vereinigten Puritanischen Staaten scharlachrot, der des Neo-Katholischen Rom weiß. Die orthodoxen Großreiche im Osten waren in verschiedenen Grautönen gehalten, während die wenigen jüdischen Festungsenklaven pechschwarz waren.
Der grüne Machtbereich erstreckte sich von Indonesien über den südlichen Teil Indiens und den gesamten afrikanischen Kontinent bis zu den Staaten des Baltikums und den hohen Norden Europas. Die verhassten Puritaner hatten Nord- und Südamerika, die Britischen Inseln und Australien für sich erobert, während die Neo-Katholiken auf das Gebiet von Italien zurückgedrängt worden waren. Die orthodoxen Reiche, über die nur wenig bekannt war, hatten ihren Wirkungsbereich nur unwesentlich über Russland und China hinaus ausgedehnt. Die zu Festungen ausgebauten Enklaven der Juden waren hingegen über die gesamte südliche Hemisphäre verteilt und wirkten wie wahllos über die Kontinente gekleckerte Flecke.
Während Ludwig zusammen mit dem Pförtner den zweiten Gebetsabschnitt begann, versuchte er sich die Worte zu vergegenwärtigen, die er auf den Anrufbeantworter des Reparaturdienstes gesprochen hatte. Die Werkstatt wurde von Jussuf Wiedler geleitet. Mit ihm hatte er zusammen in der Koranschule die Schulbank gedrückt.
Damit die Mechaniker nicht in der Vorbereitung des Morgengebets gestört wurden, hatte Wiedler den Anrufbeantworter eingeschaltet. Ludwig, wegen der Panne sehr aufgebracht, konnte sich beim besten Willen nicht mehr erinnern, ob seine auf das Band gesprochene Ortsangabe verständlich gewesen war. Er fürchtete, dass er vor lauter Angst, er könne das Morgengebet versäumen, konfus gewesen war: Er hatte kaum einen zusammenhängenden Satz zustande gebracht. Bestimmt würde der Räumdienst seinen Wagen zu spät aufspüren und mit dem Schleppseil in den kastenförmigen gepanzerten Auflader ziehen. Diese Spezialbehälter konnten die Sprengkraft von dreihundert Kilogramm TNT absorbieren. In ihrem Innern umherschwirrende Nägel, Splitter und Schrapnelle kratzten die Wandung im schlimmsten Fall nur an.
Ludwig nahm sich vor, Wiedler unverzüglich anrufen, sobald das Morgengebet beendet war. Vielleicht konnte er doch noch verhindern, dass sein teurer Gläubiger in die Fänge des Räumdienstes geriet.
Routiniert vollzog er die rituellen Handlungen. Als der letzte Gebetsabschnitt beendet war, schaute er nach rechts. »Der Friede sei mit euch und die Barmherzigkeit Gottes«, murmelte er und hörte, dass Suhr es ihm gleichtat. Als Ludwig nach links schaute und sein Gesicht dem Pförtner zugewandt war, stieg ihm der dumpfe Geruch des alten Mannes in die Nase.
Hastig wiederholte er die Grußworte und erhob sich. Als er sah, wie der Pförtner sich quälte, fasste er seinen Arm und half ihm auf.
»Danke«, murmelte Suhr. Er rieb seine schmerzenden Knie. »Würde mein Glaube mich nicht anhalten, die Gebetsgymnastik fünfmal am Tag durchzuführen, wären meine Gelenke wohl schon eingerostet«, scherzte er lahm.
»Sicher.« Ludwig lächelte unverbindlich. »Es ist eine Wohltat, seinen Glauben täglich mehrmals aufs Neue zu bezeugen.«
Während Suhr seinen Gebetsteppich zusammenrollte und schlurfend hinter dem Empfangstresen verschwand, zog Ludwig seinen Mantel an.
»Sie arbeiten doch eigentlich lange genug für das Ifnes, um zu wissen, wie viel Zeit Sie für die Fahrt ins Büro veranschlagen müssen«, sagte der Pförtner und verstaute die Teppichrolle unter dem Tresen. »Es würde ein schlechtes Licht auf die Belegschaft der zweiten Abteilung werfen, wenn ein Mitarbeiter aus Fahrlässigkeit ein Gebet versäumt.«
»Mein Gläubiger hatte eine Panne – das habe ich doch schon gesagt.« Ludwig hatte sein Mobiltelefon hervorgeholt und drückte die Wahlwiederholungstaste.
Suhr schüttelte den Kopf. »Sie glauben doch nicht, dass die Glaupo diese Ausrede gelten lässt.«
In diesem Moment wurde das Telefongespräch entgegengenommen. Ludwig atmete erleichtert durch, als er nicht die neutrale Stimme des elektronischen Anrufbeantworters vernahm, sondern das raue Organ seines Kameraden aus der Koranschule. Auf dem kleinen Bildschirm war das markante Gesicht eines Deutschstämmigen zu sehen, das trotz des zotteligen Vollbarts einen offenen, freundlichen Eindruck machte.
»El-salam aleikum«, grüßte Wiedler.
»Salam«, erwiderte Ludwig kurz und stapfte barfüßig in den Wartebereich. Er hielt das Mobtel mit leicht angewinkeltem Arm vor sein Gesicht. »Hast du das Band abgehört, Jussuf?«
»Wir haben das Morgengebet eben erst beendet.«
»Du musst sofort mit einem Abschleppwagen in die Straße des 11. September!«
Wiedler lachte rau. »Jetzt sag nicht, du hast schon wieder Ärger mit deinem Gläubigen.«
»In diesem Wagen steckt der Schaitan.« Erzürnt setzte sich Ludwig auf den Boden, klemmte das Mobiltelefon zwischen Ohr und Schulter und begann sich die Stiefel anzuziehen. »Der Motor ist während der Fahrt plötzlich ausgegangen. Der Wagen steht am östlichen Ende des Tiergartens am Straßenrand. Du musst ihn da wegholen, ehe der Räumdienst auftaucht.«
»Ich schick gleich ein paar Kollegen los«, versprach Wiedler.
»Und verständige den Räumdienst, dass der Gläubige am Ende der Straße des 11. September harmlos ist.«
»Die werden mir kaum glauben, Ludwig. Was glaubst du, was die Mitarbeiter der Sprengabfuhr von potenziellen Glaubenskriegern schon alles gehört haben, wenn die sie davon abhalten wollen, ihre Bombenautos unschädlich zu machen.«
Ludwig seufzte entnervt. »Bei Allah – schick endlich deine Leute los. Ich hab den Gläubigen erst seit vier Monaten und über ein Jahr auf die Zuteilung gewartet. Ich will ihn nicht wieder verlieren. Hörst du?«
»Ich melde mich, wenn es etwas Neues gibt.« Wiedler unterbrach die Verbindung.
Ludwig schnaufte verärgert. Er steckte das Mobtel in die Manteltasche, band sich die Stiefel und räumte den Gebetsteppich fort. Anschließend hastete er den schlecht beleuchteten Hauptkorridor entlang. Wenn er zu spät in seiner Abteilung auftauchte, würde man ihn zum Strafdienst einteilen. Und der endete erst zwei Stunden nach dem Sonnenuntergangsgebet. Da die öffentlichen Verkehrsmittel ihren Betrieb nach Dunkelwerden einstellten, müsste er dann zu Fuß nach Hause gehen oder ein Taxi nehmen. Ludwig wohnte im zehn Kilometer entfernten Stadtteil Berlin-Westend und konnte sich aussuchen, ob er sich nach dem Strafdienst lieber Blasen an die Hacken laufen oder einen Teil seines Wochenlohns für eine Taxifahrt opfern wollte.
Nichts von beidem erschien ihm im Moment besonders erstrebenswert.
*
Die Großraumbüros des Instituts für Netzsicherheit befanden sich im Verwaltungsgebäude einer ehemaligen Krankenversicherung, das unmittelbar an das altehrwürdige klassizistische Gebäude angrenzte, in dem in vorislamischer Zeit eine Botschaft untergebracht war und das nun die Büros der Institutsvorstände beherbergte.
Heutzutage waren Krankenversicherungen und Botschaften nicht mehr erforderlich. Wer krank wurde, suchte ein Hospiz auf, wo er unentgeltlich eine angemessene Grundversorgung erhielt. Wer mehr benötigte, musste die nicht unerheblichen Zusatzkosten selbst tragen. So hatte Ludwig, als ihm vor einem Jahr ein Backenzahn gezogen werden musste, lieber auf das Einpflanzen eines kostspieligen Implantats verzichtet und nahm es seitdem in Kauf, schwer zu zerkleinernde Kost mit der linken, noch intakten Gebisshälfte zu zerkauen.
Konferenzen mit Vertretern anderer islamistischer Staaten wurden in repräsentativen Prunkbauten abgehalten; Angelegenheiten mit nichtislamistischen Ländern klärte man auf dem Schlachtfeld.
Da die Eingänge des ehemaligen Verwaltungsgebäudes verrammelt waren, hatte Ludwig, um seinen Arbeitsplatz zu erreichen, zuerst die alte Botschaft betreten müssen, in deren Eingangshalle der alte Suhr residierte und in der auch der Erfassungsapparat stand. Der Hauptkorridor, den er nun entlang eilte, endete vor dem Durchbruch ins Nachbargebäude.
Die Halle, die er nun betrat, lag verlassen da. Die Männer und Frauen hatten die Gebetsräume im Erdgeschoss längst verlassen und waren in ihre Abteilungen gegangen.
Immer zwei Stufen auf einmal nehmend eilte Ludwig die Treppe hinauf. Seine Abteilung befand sich im 2. Stockwerk. Als er das Großraumbüro erreichte, saßen seine Kollegen bereits in den engen Kabinen vor ihren Arbeitsstationen. Die Luft war erfüllt vom Surren der Stationsrechner, dem Scharren von Schuhsohlen und dem Hüsteln, das hin und wieder einer der etwa fünfzig Mitarbeiter von sich gab.
Der Geruch von grüner Seife und Kölnisch Wasser stieg Ludwig in die Nase. Kaum einer blickte über die Schulter zu ihm hin als er durch den Mittelgang strebte. Die wenigen auf dieser Etage arbeitenden Frauen trugen schlichte graue Gewänder, die bis an die Fußknöchel reichten. Ihr Haar war unter einfarbigen Kopftüchern verborgen; die untere Gesichtshälfte verschleiert. Auch die Kleidung der Männer war schlicht und eintönig. Nur wenige hatten den Vollbart getrimmt oder wie Ludwig den Oberlippenbart gestutzt: Er konnte den wüsten Anblick nicht ertragen, den er sonst am Morgen im Badezimmerspiegel bot.
Ludwig hatte die einzige unbesetzte Arbeitsstation fast erreicht, als die Tür des Abteilungsleiterbüros plötzlich aufschwang. Hannes Elia schob seinen korpulenten Leib durch die Öffnung.
Ludwig verdrehte innerlich die Augen und legte den Rest der Strecke zu seinem Arbeitsplatz mit einem Sprung zurück.
»Ludwig!«, rief der Abteilungsleiter polternd. »Sie werden mir doch wohl hoffentlich nicht nachlässig!«
In seiner behäbigen Art kam er auf Ludwig zu, der hastig aus dem Mantel glitt und ihn auf den Kleiderhaken seiner Arbeitskabine hängte. Dann nahm er auf dem Bürostuhl Platz, denn er wusste, dass es dem kleinwüchsigen Elia nicht behagte, wenn sein Gesprächspartner stand und er zu ihm aufblicken musste.
Besitzergreifend stützte sich der Abteilungsleiter mit einer Hand auf die schulterhohe Trennwand und mit der anderen auf die Rückenlehne von Ludwigs Stuhl. Dann neigte er den Oberkörper vor, als wolle er zwischen sich und seinem Untergebenen eine vertrauliche Atmosphäre schaffen. Seine von einem grau melierten Vollbart umgebenen Lippen lächelten gönnerhaft.
»Ich will offen sein, Ludwig«, sagte er mit gedämpfter Stimme. »Sie gehören zu den fähigsten Mitarbeitern meiner Abteilung. Offenbar haben Sie ein gutes Gespür dafür, welche Meldungen für das islamistische Datennetzwerk geeignet sind und welche nicht. Sie haben der uns übergeordneten Prüfungsstelle bisher keinen Anlass gegeben, ein von Ihnen freigeschaltetes Dokument zu beanstanden.«
Ein unterkühlter Ausdruck trat in seine hellbraunen Augen. »In den höheren Etagen ist man so voll des Lobes für Sie, dass ich schon davon träume, Sie könnten mir eines Tages meinen Posten streitig machen.«
»So etwas würde ich mir nie anmaßen«, beeilte Ludwig sich zu versichern.
»Schweigen Sie!«, zischte Elia aufgebracht. »Selbstverständlich werden Sie mich nicht aus meiner Position drängen. Dazu wären Sie gar nicht in der Lage. Es war doch nur ein Traum.«
Er richtete sich auf. Ludwig ahnte, was nun kam.
»Mein Vater ist ein bekannter Märtyrer«, erklärte Elia prompt. »Er hat sich in der Redaktion einer einst im ganzen Land weit bekannten Tageszeitung in die Luft gesprengt und über hundert dekadente ungläubige Journalisten mit in den Tod gerissen.«
»Ich weiß«, rutschte es Ludwig heraus. Um die Peinlichkeit abzuwenden, fuhr er übergangslos fort: »Der Märtyrertod Ihres Vaters hat in den zwanziger Jahren eine ganze Welle von Anschlägen auf Presseorgane ausgelöst, die sich abfällig über den Islam oder den Propheten geäußert haben. Dann kam es zu Anschlägen auf journalistische Hetzer und Fernsehmoderatoren. Ihr Vater war der Katalysator dieses reinigenden Zornesausbruchs der Gläubigen. Er hat das Ende der so genannten freien Presse in Deutschland eingeläutet und den Weg für den islamistischen Informationsdienst geebnet, wie wir ihn heute kennen.«
Ein lauernder Ausdruck trat ins Gesicht des Abteilungsleiters. »Sie sind meiner Geschichte anscheinend überdrüssig.«
»Wo denken Sie hin?« Ludwig setzte eine ernste Miene auf. »Ich wollte Ihnen lediglich demonstrieren, dass ich mich in der jüngsten Geschichte unseres Landes bestens auskenne.«
Elia nickte angestrengt. »Nun – Sie sind ein fähiger Mann. Wie ich schon sagte. Nur aus diesem Grund hat man Sie trotz der Schande, die Ihre leibliche Mutter über Ihren Vater brachte, beim Ifnes überhaupt eingestellt.«
Ludwig spürte, dass ihm das Blut aus dem Gesicht wich. Fahrig wischte er mit plötzlich schweißnassen Händen über die noch inaktiven Tastfelder seiner Arbeitsstation. Innerlich verfluchte er Elia, der die verwundbaren Stellen seiner Untergebenen genau kannte und keine Skrupel hatte, dieses Wissen auszunutzen, um seine Glaubensgenossen klein zu halten.
»Ich würde jetzt gern arbeiten, Herr Elia«, sagte er mit belegter Stimme.
»Das werden Sie, Ludwig – nachdem Sie sich angehört haben, was ich Ihnen sagen muss.«
Elia beugte sich wieder tiefer hinab. »Sie könnten mit Ihrem jüngst an den Tag gelegten Verhalten dazu beitragen, dass meine Abteilung in Verruf gerät und unser aller Gehaltsniveau zurückgestuft wird.«
Ludwig schluckte trocken. »Habe ich mir etwas zuschulden kommen lassen?«
»Wenn es so wäre, säßen Sie jetzt nicht hier«, erwiderte Elia kalt. »Ihre Nachlässigkeit heute Morgen gibt mir jedoch stark zu denken. Ich erkenne die Zeichen, glauben Sie mir. Ich erwarte von jedem meiner Mitarbeiter vorbildliches Verhalten. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder?«
Ludwig wusste: Es hatte keinen Sinn, seinen liegen gebliebenen Gläubigen zu erwähnen. »Es kommt bestimmt nicht wieder vor, dass ich ein Gebet nicht zur rechten Zeit beginne«, versprach er.
Elias Miene blieb ausdruckslos. »Wie alt sind Sie jetzt, Ludwig?« Natürlich kannte er die Antwort.
»Ich bin im letzten Fastenmonat neunundzwanzig geworden.«
»Und mit wie vielen Frauen sind Sie verheiratet?«
Ludwig zögerte einen kurzen Moment. »Ich bin Junggeselle, Herr Elia. Das wissen Sie doch.«
Der Abteilungsleiter tat trotzdem verwundert. »Warum denn das? Sie sind doch ein stattlicher Mann mit einem sicheren Einkommen. Sie können Ehefrauen die Geborgenheit und Sicherheit bieten, die jede ordentliche Muslima sich wünscht.« Seine Miene verdüsterte sich. Seine Stimme wurde zu einem Flüstern. »Fühlen Sie sich etwa nicht zum weiblichen Geschlecht hingezogen?«
»Doch – schon.« Ludwig rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Am liebsten wäre er abgehauen, um sich irgendwo zu verstecken.
»Da bin ich aber froh.« Elia gab sich übertrieben erleichtert. »Sie wissen ja, was Männern blüht, die es nach dem Fleisch anderer Männer gelüstet.«
»Sie werden enthauptet, wenn sie nicht bereuen«, sagte Ludwig tonlos.
Elia nickte. »Sie sollten sich schleunigst verheiraten, um etwaigen Gerüchten entschieden entgegenzutreten. Nehmen Sie sich ein Beispiel an mir. Ich habe mir gleich zwei Ehefrauen zugelegt. Es ist praktisch, und angenehm zugleich.« Er richtete sich auf. »Ich würde ungern auf Ihre fachliche Kompetenz verzichten, Ludwig. Befolgen Sie die Scharia und heiraten Sie. Andernfalls sind Sie für meine Abteilung nicht tragbar.«
Ludwig spürte das heftige Verlangen, den Mann zu fragen, wo im Koran geschrieben stand, dass ein Mann heiraten musste. Doch er verkniff sich die Frage. Er ahnte, dass er Elia Misstrauen dadurch nur schüren würde.
»Und nun machen Sie sich endlich an die Arbeit.« Elias wandte sich ab, um mit dem morgendlichen Rundgang durch das Großraumbüro zu beginnen.
Verstimmt schwenkte Ludwig auf seinem Stuhl zu der Arbeitsstation herum, rieb die verschwitzen Hände an seinen Hosenbeinen trocken und legte die Linke dann flach auf den Handlinienspürer. Die Körperwärme löste den Thermoschalter aus. Das Gerät begann, die Handfläche mit einem Lesestrahl abzutasten.
El-salam aleikum, Ludwig Rauber, sagten kurz darauf arabesk verschnörkelte Lettern auf dem in der Stirnwand der Kabine eingelassenen Bildschirm.
Den Zeigefinger auf dem Tastfeld lenkte Ludwig den auf dem Schirm dargestellten Pfeil auf ein verschlungenes Ornament, in dem das Wort Wahrheit eingearbeitet war. Nachdem er die Schaltfläche aktiviert hatte, wechselte die Darstellung und präsentierte Ludwig eine Liste von Eintragsersuchen, die er an diesem Tag abarbeiten musste.
*
Ludwigs Arbeitsstation war, wie die seiner Kollegen, direkt mit dem Sekundärspeicher des Bereitstellungsapparats im Keller des Ifnes-Gebäudes verbunden. Von dort wurden die Daten auf den Rechner der Arbeitsstation überspielt, wenn eine Zeile in der Liste der Eintragsgesuche angeklickt wurde, was Ludwig nun tat. Damit es nicht zu Überschneidungen kam, wurde die Originaldatei im Sekundärspeicher gelöscht, sobald sie in die Arbeitsstation übertragen wurde.
Die meisten Gesuche um einen Eintrag ins islamistische Datennetzwerk erreichten das Institut in der Straße der einzigen Wahrheit auf dem Postweg. Es bestand aber auch die Möglichkeit, die Datenträger von Boten abliefern zu lassen. Einige Autoren erschienen sogar persönlich.
Der alte Suhr nahm die Datenträger in Empfang und reichte sie an die technische Prüfstelle weiter, die ihre Büros im Erdgeschoss der ehemaligen Botschaft hatte. Dort wurden die Daten ausgelesen, technisch geprüft und auf einen einheitlichen Massenspeicher überspielt. War dieser voll, musste Suhr ihn in Begleitung eines weiteren Ifnes-Mitarbeiters in den Keller bringen und in den Sekundärspeicher des Bereitstellungsapparates überspielen. Von dort wurden die Gesuche dann unter Verwendung eines Zufallsgenerators den Mitarbeitern der 2. Abteilung zugewiesen.
Wie allen Muslimen weltweit war es auch den Bürgern der Islamistischen Republik Deutschland gestattet, Informationen aus dem Datennetzwerk abzufragen, auf den Schirmen ihrer Heimanlagen darzustellen oder auszudrucken. Andersherum war es ihnen aber nicht möglich, Daten direkt in einen Bereitstellungsapparat einzuspeisen. Gleichschaltungsaggregate, die auf der Erfindung eines deutschen Ingenieurs basierten, neutralisierten alle Impulse, die aus dem Netz in die Bereitstellungsapparate gelangten und machten diese somit nahezu unangreifbar.
Diese Schutzmaßnahme wurde mit Hinweis auf zu befürchtende Angriffe seitens der ungläubigen Staaten gerechtfertigt. Ludwig vermutete jedoch, dass es den Muftis eher darum ging, ihr Hoheitsrecht für die Auswahl der abrufbaren Informationen zu wahren. Nicht jeder Gläubige sollte seine Gedanken und Ansichten im Muslimnetz verbreiten dürfen. Es war aber jedem freigestellt einen Beitrag, den er für veröffentlichungswürdig hielt, dem Institut für Netzsicherheit zur Überprüfung vorzulegen. Wurde der Beitrag positiv bewertet, speicherte man ihn später im Datenkubus im Keller des Infnes-Gebäudes ab, sodass er von den Nutzern abgerufen werden konnte.
Das erste Datenpaket, das an diesem Morgen auf Ludwigs Stationsrechner überspielt wurde, stammte vom islamistischen Informationsdienst: Die Videoaufzeichnung eines Interviews, das vor einer Woche im Fernsehen ausgestrahlt worden war und nun auf der Heimseite des Berliner Zentralsenders für die Nutzer zum Herunterladen bereitgestellt werden sollte.
Eine einfachere Aufgabe hätte Ludwig sich für diesen bisher unerfreulich verlaufenen Morgen nicht wünschen können. Bevor eine Sendung ausgestrahlt wurde, wurde sie von der Prüfstelle des Senders genau unter die Lupe genommen. Das Interview war also schon bereinigt. Falls das Gespräch bedenkliche Passagen aufgewiesen hatte, waren sie entfernt oder durch Störgeräusche unkenntlich gemacht worden.
Trotzdem würde Ludwig sich nicht verleiten lassen, das Gespräch auch nur oberflächlich zu verfolgen. Immerhin könnten den Prüfern Fehler unterlaufen sein, die er zu seinen eigenen machte, wenn er sie nicht aufspürte und beseitigte.
Er steckte den Knopflautsprecher in sein linkes Ohr und startete die Aufzeichnung.
Auf dem Bildschirm erschien ein hoher, in warmes Orange gehaltener Raum. In der Mitte saßen sich zwei Männer an einem kleinen runden Tisch gegenüber. Helles Tageslicht, das durch die Sprossenfenster hereindrang, erhellte die Szene auf freundliche Weise.
Wie üblich hingen an den Wänden weder Gemälde noch Fotografien. Der einzige Raumschmuck bestand aus einigen üppigen Rosensträußen, die in bauchigen, mit Ornamenten verzierten Vasen steckten.
Einer der Männer trug konventionelle westliche Kleidung und hatte einen langen Spitzbart, der ihm bis auf die Brust reichte. Sein dunkelbraunes Haar wies erste silberne Strähnen auf, die blauen Augen hinter der Nickelbrille wirkten klug und wachsam.
Der zweite, ältere Mann hatte einen schwarzen Kaftan angelegt. Sein Kopf war von einem weißen Turban bedeckt, der seine Ohren unvorteilhaft niederdrückte, sodass sie extrem abstanden und sein faltiges Gesicht breiter erscheinen ließen als es war. Das unter dem Turban hervorlugende Haar und der breite, drahtige Vollbart waren stark ergraut.
»Wir befinden uns hier in einem Salon von Schloss Bellevue«, sagte der Mann in dem dunklen Herrenanzug mit andächtig gedämpfter Stimme. Ludwig kannte ihn natürlich: Er hieß Karel Sivas und war ein in Berlin stadtbekannter Fernsehmoderator, der durch gottgefällige Spitzzüngigkeit von sich Reden machte.
»Neben mir sitzt Scheich Mohammad Hamdillah, ein führender Religionspolitiker der Vereinigten Arabischen Kalifate, die sich inzwischen über ein Gebiet erstrecken, das Nordafrika, Saudi-Arabien und die Nah-Ost Staaten zwischen Syrien und Pakistan umfasst.«
Sivas drehte sich halb zu seinem Gesprächspartner um. »Eminenz, Sie haben Deutschland im Rahmen eines wechselseitigen Austausches aufgesucht, der das Bündnis zwischen Europa und unseren Glaubensbrüdern im Nahen Osten stärken soll. Zu Anfang dieses Jahrhunderts wurde noch von einem drohenden Zusammenprall der Kulturen dieser beiden längst im Glauben vereinten Lebensbereiche gesprochen.«
Der Scheich rekelte sich behaglich auf dem Sessel und strich über seinen Bart. »Die radikalen Muslime von damals haben nie bezweifelt, dass der Islam am Ende über das dekadente Europa siegen wird. Die Frage war nur, wann die Zeit für eine umfassende Islamisierung gekommen war. Dies sahen die Europäer, die von einer Kollision der Kulturen sprachen, genauso. Und es machte ihnen natürlich Angst, weil sie befürchteten, von den krankhaften Gewohnheiten ablassen zu müssen, die sie sich in ihrem gottlosen Leben angeeignet hatten.«
Am Gehabe des Scheichs glaubte Ludwig zu erkennen, dass Hamdillah wie fast alle führenden Religionspolitiker der Vereinigten Arabischen Kalifate in Europa studiert hatte. Er beherrschte die deutsche Sprache nahezu perfekt und sprach sicherlich auch perfekt Französisch und Spanisch.
»Wie sich gezeigt hat, ist die Frage der Kulturunterschiede letztendlich belanglos«, fuhr der Scheich fort. »Der Islam lässt sich von Menschen, die in der europäischen Lebensweise verwurzelt sind, ebenso praktizieren wie von Menschen jedes anderen Kulturkreises.«
Hamdillah stützte den rechten Unterarm auf die Armlehne. »Der Schlüssel für die erfolgreiche Durchdringung einer Fremdkultur durch den Islam ist die Scharia. Die auf Allah und seinen Propheten Mohammed gründende Lebens- und Rechtsordnung ist über Jahrhunderte hinweg von islamischen Theologen und Rechtsgelehrten entwickelt und zur Reife gebracht worden. Dass die Scharia nicht den staatlichen Machtwillen verkörpert, sondern dem Gläubigen zeigt, wie er sein Leben nach dem Koran auszurichten hat, macht sie so durchsetzungsfähig und stark. Sie zerstört alles Überflüssige, Kranke in einer Gesellschaft, wie es ja auch in Deutschland geschehen ist, als die demokratischen Machtstrukturen hinweggefegt wurden, weil die Scharia von immer mehr Konvertiten gelebt und verteidigt wurde.«
Der Scheich lächelte breit. »Sie sehen also, Karel, es hat eigentlich nie die Gefahr eines Zusammenpralls zwischen der islamischen und der europäischen Kultur gegeben, weil die europäische Lebensweise durch Dekadenz geschwächt war und für die Islamisten gar keinen Widerpart darstellte. Von einigen Unbekehrbaren mal abgesehen, die für ihren Unglauben hart bestraft wurden und nun in der Hölle schmoren, sind Islam und Scharia von den Deutschen und anderen Europäern gern angenommen worden. Der Islam wird sich letztendlich über die gesamte Welt ausbreiten.«
»Noch aber trotzen die Puritaner dem Einfluss des Islams«, wandte Sivas ein. »Auch die Neo-Katholiken in Neurom leisten den in den italienischen Alpen stationierten Glaubenskriegern erbitterten Widerstand.«
Ludwig schreckte auf seinem Bürostuhl hoch. Er konnte nicht fassen, dass die Prüfer des Senders diese impertinente Zwischenbemerkung des Moderators nicht entfernt hatten. Es war zwar nicht verboten, den heiligen Krieg zu erwähnen, ganz im Gegenteil, denn er wurde den Deutschen in den Medien immer wieder vor Augen geführt, doch war es nicht statthaft, in diesem Zusammenhang davon zu sprechen, dass der Feind dem Islam trotzte oder erbitterten Widerstand leistete. Es durfte kein Zweifel daran gelassen werden, dass die Puritaner und Katholiken den islamistischen Gotteskriegern unterlegen waren und kurz vor der Kapitulation standen.
Ludwig, der die Wiedergabe instinktiv gestoppt hatte, kennzeichnete den Abschnitt, um ihn später entsprechend zu bearbeiten. Dann ließ er die Filmdatei weiterlaufen, um zu hören, wie der Scheich auf die Anfeindung seitens des Moderators reagierte.
Dieser ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und antwortete gelassen: »Wie zuvor den verblendeten Europäern, geht es den verhassten Neo-Katholiken und Puritanern nicht darum, ihren unterlegenen Glauben durchzusetzen. Sie haben es auf die Ressourcen der islamistischen Länder abgesehen und bekämpfen uns, weil sie uns berauben wollen. Allein aus diesem Grund haben sich diese fehlgeleiteten Glaubensrichtungen überhaupt erst ausbreiten können, während der Islam in Indien und Europa erstarkte. Diese Ungläubigen betreiben ihren Krieg, den sie unzweifelhaft verlieren werden, aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus, während wir für die Verbreitung des einzig wahren Glaubens streiten. Der Kampfwille der Muslime ist weitaus stärker als der der Ungläubigen, die nur aus Habgier und aus Furcht vor der Minderung ihres Wohlstandes handeln.«
Hamdillah lehnte sich entspannt zurück. »Würden diese Ungläubigen genau hinschauen, müssten sie erkennen, dass Ihre Angst idiotisch ist. Seit Europa islamistisch ist, leben die Menschen hier in Frieden und Eintracht, weil sie die Scharia achten.«
Ludwig hatte Mühe sich zu konzentrieren. Zu oft schon hatte er diese Argumente gehört.
»Weil wir im wahren Glauben vereint sind, unterhalten Europäer und Vereinigte Arabische Kalifate Handelsbeziehungen, die auf Gerechtigkeit und gegenseitiger Achtung beruhen«, fuhr der Scheich fort. »Wir haben Frieden und Eintracht gebracht. Zum Dank erhalten wir die technischen Produkte des Westens zu einem angemessenen und gottgefälligen Preis. Wohlstand und Komfort haben stark zugenommen, weil wir für die Rohstoffe, die wir unseren westlichen Glaubensbrüdern liefern, endlich angemessen bezahlt werden. Die Menschen bei uns leiden keine Not mehr und können von der Technik und den Erfindungen der Europäer endlich umfassend profitieren.«
Ludwig erinnerte sich, vor einem halben Jahr Fotos geprüft zu haben, die ein in Berlin lebender Reporter während einer Reise durch die Vereinigten Arabischen Kalifate geschossen hatte. Die Aufnahmen sollten auf einer Heimseite erscheinen, auf der die Fortschritte im Nahen Osten dokumentiert wurden. Sie zeigten blühende, prosperierende Städte, die sich von denen in Europa nur in der Architektur und der Mode der Einheimischen unterschieden. Auf üppig bestückten orientalischen Märkten wurde reger Handel getrieben, und die Läden in den Geschäftsvierteln waren gut besucht. Die Kaftane der Männer und die Burkas der Frauen waren aus erlesenen Stoffen gefertigt; auf den Straßen fuhren die neuesten Modelle aus den deutschen Werken von Glaubensgemeinschaftswagen und Morgenstern.
Auch die Industriegebiete, die sich um die traditionsreichen alten Städte gebildet hatten, hatte der Fotograf besucht. Moderne Werkshallen und Fabriken, von den Markenzeichen europäischer Großkonzerne gekrönt, erstreckten sich entlang breiter, von Palmen gesäumter Alleen.
Der Landbevölkerung ging es offenbar ebenfalls prächtig: Die Bauern arbeiteten mit modernsten Maschinen und Robotern. In jedem größeren Ort gab es Schulen, Krankenhäuser und prächtige Moscheen.
Als Ludwig diese Fotos durch ein Analyseprogramm hatte laufen lassen, hatte er feststellen müssen, dass es sich um Fälschungen handelte. Die Aufnahmen waren nicht nur nachgebessert oder retuschiert worden. Es handelte sich um Kollagen und komplett am Rechner erstellte Szenarien.
Ludwig hatte nicht gewusst, wie er mit diesen Aufnahmen verfahren sollte. Er hatte den Abteilungsleiter um Rat gefragt. Der hatte gleich drauflos gepoltert und wissen wollen, wieso er die Aufnahmen für bedenklich hielt, da sie doch genau das zeigten, was ein guter deutscher Islamist von seinen Glaubensbrüdern in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu sehen wünschte.
Ludwig war nicht ganz wohl bei der Sache gewesen. Trotzdem hatte er die Fälschungen schließlich mit einem Unbedenklichkeitssiegel versehen. Vage meinte er sich daran zu erinnern, dass seine Mutter ihm einst von den Zuständen in den Ländern berichtet hatte, die zu den VAK gehörten. Statt die Steuergelder für Infrastruktur und Bildung auszugeben, schaffte man Waffen für den Dschihad an und mehrte den Wohlstand der Machthaber. Misswirtschaft, Korruption und Bestechlichkeit wären an der Tagesordnung, während unter der Bevölkerung Armut, Elend und Hunger herrschten.