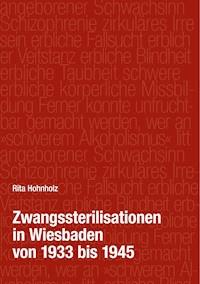
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Nach Inkrafttreten des "Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" (GzVeN) vom 1. Januar 1934 wurden zwischen 1934 und 1945 in Wiesbaden mindestens 1.064 Menschen zwangsweise sterilisiert. Vorgenommen wurden die – zumeist operativen – Eingriffe in den Wiesbadener Städtischen Krankenanstalten, dem evangelischen Krankenhaus "Paulinenstift", dem Rotkreuz-Krankenhaus sowie in der bei Kiedrich im Rheingau gelegenen Heil- und Pflegeanstalt Eichberg, der damals für Wiesbaden zuständigen psychiatrischen Einrichtung. Orientiert am Schicksal der in Wiesbaden zwangssterilisierten Frauen und Männer untersucht die vorliegende Studie u.a. die Diagnosen, die dazu führten, dass die Betroffenen sich dem Eingriff zur Unfruchtbarmachung unterziehen mussten. Außerdem hinterfragt sie die diagnostizierten Leiden und untersucht in diesem Zusammenhang, ob diese tatsächlich erblich bedingt waren, wie es das GzVeN suggerierte, oder ob soziale Werturteile bzw. "rassische" – nach heutiger Diktion rassistische – Gründe das Diagnoseverfahren bestimmten. Darüber hinaus wird geschildert, welche kommunalen oder staatlichen Behörden und welche privaten oder kirchlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel Erziehungsheime, Waisenhäuser und Schulen, sowie deren Führungs- oder medizinisches Personal in die Zwangssterilisationsverfahren verwickelt waren. Wie auch in anderen Orten hat sich die Wissenschaft in Wiesbaden bislang wenig bis gar nicht mit der Aufarbeitung des NS-Unrechts beschäftigt, das den von Zwangssterilisation betroffenen Menschen widerfahren ist. Die vorliegende Studie leistet einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke in Bezug auf die Stadt Wiesbaden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RITA HOHNHOLZ, Jahrgang 1964, studierte von 1996–2003 Medizinpädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin mit Abschluss Diplom. 2016 Promotion zum Dr. phil. an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Erziehungswissenschaften/Pädagogik mit der vorliegenden Arbeit. Seit 2000 Lehrbeauftragte an Berufsfach- sowie Hochschulen mit Schwerpunkt Gesundheitswesen.
Inhalt
Einleitung
1.1 Aufbau der Studie und Quellenlage
1.2 Literatur
Zur Entstehung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
Der allgemeine Verfahrensverlauf bei Zwangssterilisationen: Ein Überblick
Zwangssterilisationen in Wiesbaden 1933 bis 1945: Die Betroffenen
4.1 Diagnosen
4.1.1 Angeborener Schwachsinn
4.1.2 Schizophrenie, Erbliche Fallsucht, Manisch-depressives Irresein, Schwerer Alkoholismus
4.2 Die Zwangssterilisation der »Rheinlandbastarde« in Wiesbaden
4.3 Die Zwangssterilisation der Sinti in Wiesbaden
4.4 Die Sterilisationsmethoden
4.4.1 Beispiele für Sterilisationsmethoden bei Männern
4.4.2 Beispiele für Sterilisationsmethoden bei Frauen
4.4.2.1 Sterilisationsmethoden mittels Strahlenbehandlung
4.4.2.2 Sterilisation und Schwangerschaft
4.4.2.3 Mit Polizeigewalt ins Krankenhaus
4.4.2.4 Komplikationen und Folgen der Zwangssterilisationseingriffe
4.5 Alter der Betroffenen zum Zeitpunkt der Zwangssterilisation
4.6 Berufe der Betroffenen
4.7 Die ausführenden Krankenhäuser
4.7.1 Die Heil- und Pflegeanstalt Eichberg
4.7.2 Katholische Krankenhäuser und Einrichtungen: Das »Hospiz zum Heiligen Geist«, das »Sankt Josefs-Hospital« und das »Johannesstift« in Wiesbaden sowie das »Sankt Vinzenz-Stift« in Aulhausen und das »Sankt Valentinus-Haus« in Kiedrich
4.7.3 Die Wiesbadener Privatkliniken
4.7.4 Das Rotkreuz-Krankenhaus vom »Verein vom Roten Kreuz«
4.7.5 Die Städtischen Krankenanstalten: Frauenklinik und Chirurgische Klinik
4.7.6 Das Krankenhaus »Paulinenstift« des »Diakonissen-Mutterhauses der Paulinenstiftung«
4.7.7 Massiver Rückgang der Zwangssterilisationen nach 1939
Die Wiesbadener Gesundheitsfürsorge von 1933 bis zum bzw. nach dem Erlass des »Gesetzes zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens« (GVG) 1935
5.1 Das Wiesbadener Gesundheitsamt bis April 1935
5.2 Die öffentliche Gesundheitspflege nach dem Erlass des »Gesetzes zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens« im April 1935
5.2.1 Die öffentliche Gesundheitspflege in Wiesbaden nach dem Inkrafttreten des GVG
5.3 Verschiedene Wiesbadener Institutionen, Einrichtungen, Anstalten und Heime
5.3.1 Die Abteilung »Erb-und Rassenpflege«
5.3.2 Die »Fürsorge- und Beratungsstelle für Nerven- und Gemütskranke« und die »Fürsorge- und Beratungsstelle für Alkoholkranke und offene Irrenpflege«
5.3.3 Das Wohlfahrts- und Jugendamt
5.3.4 Der Stadtarzt, der städtische Vertrauensarzt sowie der schul- und schulzahnärztliche Dienst
5.3.5 Die Wiesbadener Schulverwaltung und verschiedene Heime
5.3.5.1 Das Erziehungsheim auf dem Geisberg
5.3.5.2 Das Antoniusheim
5.3.5.3 Das Katholische Kinderheim und Waisenhaus »Sankt Michael«
5.3.5.4 Die »Hilfsschulen«
5.3.6 Das Standesamt Wiesbaden
Fazit
Epilog
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Personenverzeichnis
Verzeichnis der in der Arbeit erwähnten Krankenhäuser, Anstalten, Heime und deren Orte
Bibliographie
1. Einleitung
Die während des »Dritten Reiches« in Wiesbadener Krankenhäusern und der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg durchgeführten zwangsweisen Sterilisationen an mehreren Hundert Männern und Frauen haben über einen langen Zeitraum keine umfassende wissenschaftliche Beachtung erfahren. Dabei ist es nicht so, dass die im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden vorhandenen Erbgesundheitsgerichtsakten, die das Schicksal der Betroffenen widerspiegeln, bis dato nie genutzt worden sind. Tatsächlich wurden sie im Zusammenhang mit dem Projekt »Widerstand und Verfolgung in Hessen zwischen 1933 und 1945« herangezogen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Schicksale und Lebenswege der von NS-Verfolgung betroffenen Personen sowie derjenigen, die sich gegen den nationalsozialistischen Unrechtsstaat zur Wehr setzten, zu dokumentieren. Auf diese Weise entstand eine Datenbank, die personenbezogene Recherchen ermöglicht. Dort sind auch die Menschen erfasst, die auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Hessen zwangssterilisiert worden sind.
Von Zwangssterilisation betroffen waren selbstverständlich auch Menschen aus Wiesbaden, wobei der Fokus der folgenden Untersuchung auf Personen liegt, die in Wiesbadener Krankenhäusern sowie der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg zwangsweise unfruchtbar gemacht wurden. Folglich sind in der Studie nicht alle Wiesbadener Bürger – oder Einwohner – erfasst, die sich zwischen 1934 und 1945 diesem Eingriff unterziehen mussten, denn mancher Wiesbadener war in anderen Orten (des heutigen) Hessens oder gar des Reiches zwangssterilisiert worden. Der Rechercheaufwand, der notwendig gewesen wäre, um Menschen, die in Wiesbaden geboren oder lange Zeit dort gelebt hatten, in alten Unterlagen und Dokumenten, darunter aus Einwohnermeldeämtern usw., ausfindig zu machen, um zu erfahren, wann und an welchem Ort sie zwangssterilisiert worden sind, wäre enorm gewesen und hätte ein Scheitern impliziert, weil die Informationen, nicht zuletzt aufgrund von Kriegseinwirkungen, nicht mehr erhalten sind. Folglich ist es fast unmöglich, eine Untersuchung vorzulegen, die Wiesbaden und sämtliche Wiesbadener Bürger, die hier geboren worden sind oder hier gelebt haben, berücksichtigt. Deshalb wurde der Ausgangspunkt »Wiesbadener Krankenhäuser« gewählt.
Obwohl die Suchmöglichkeiten, die die Datenbank »Widerstand und Verfolgung« anbietet, vielfältig sind, konnte sie doch den gewählten Schwerpunkt nicht vollständig abbilden und daher nicht alle Betroffenen auflisten. Dennoch stellte die Datenbank, die sich in Bezug auf die Wiedergabe der Schicksale und Lebenswege der Zwangssterilisierten, u. a. auf Erbgesundheitsgerichtsakten stützt, einen wichtigen Meilenstein bei der Erstellung der vorliegenden Untersuchung dar.
Ergänzt und erweitert wurden die in der Datenbank vorgehaltenen Informationen u. a. durch das Heranziehen und Auswerten von Erbgesundheitsgerichtsakten vornehmlich aus Wiesbaden, Frankfurt/Main, oder Limburg/Lahn.1 Hinzu kamen Akten von Landratsämtern, zum Beispiel des Rheingaukreises, des Rheingau-Taunus-Kreises, des Obertaunuskreises oder des Landratsamts Gelnhausen2, außerdem Akten aus dem Bestand des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main, bei dem das für Wiesbaden zuständige Erbgesundheitsobergericht angesiedelt war, dem Amtsgericht Wiesbaden, dem das örtliche Erbgesundheitsgericht angegliedert war, oder dem Landgericht Wiesbaden (Staatsanwaltschaft).3 Berücksichtigt wurden darüber hinaus Unterlagen aus dem Bestand der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg4, den (hessischen) Regierungspräsidien als Entschädigungsbehörde5, dem Hessischen Staatsarchiv Darmstadt6 und dem Hessischen Staatsarchiv Marburg7. Einblick wurde auch in die Gestapo-Kartei Frankfurt/Main genommen, die teilweise in fotokopierter Form im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden vorhanden ist. Außerdem die im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden vorhandenen Aktenunterlagen in Bezug auf das Wiesbadener Gesundheitsamt. Wichtig waren im Übrigen die im Stadtarchiv Wiesbaden vorhandenen Akten und Amtsbücher.8
Die Auswertung der genannten Materialien ergab, dass in Wiesbadener Krankenhäusern sowie der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg, die die für die Stadt zuständige psychiatrische Einrichtung darstellte, insgesamt 1.064 Frauen und Männer zwangssterilisiert wurden.
Zusammenfassend ist festzuhalten: Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit den Frauen und Männern, die in Wiesbadener Krankenhäusern bzw. der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg zwangssterilisiert worden sind. In diesem Zusammenhang erfolgt eine kurze Auseinandersetzung mit den Kliniken, in denen die Eingriffe vorgenommen wurden, sowie dem dort tätigen medizinischen Führungspersonal. Eingegangen wird darüber hinaus auf die Formen der zwangsweisen Sterilisation sowie die Diagnosen, die dazu führten, dass sich Menschen dem Eingriff unterziehen mussten. Analysiert wird in Bezug auf die diagnostizierten Leiden, ob diese tatsächlich genetisch bedingt bzw. vererbbar waren, wie es das am 1. Januar 1934 in Kraft getretene »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« suggerierte, oder ob es sich in Wirklichkeit nicht um sozial oder »rassisch« bzw. rassistisch motivierte Indikationen handelte. Selbstverständlich wird hierbei auch nach den Gründen für rassistisch oder sozial indizierte Diagnosen gefragt. Des Weiteren befasst sich die vorliegende Studie mit den kommunalen bzw. staatlichen Behörden und Einrichtungen, die in das System der Zwangssterilisationen involviert waren, darunter das zunächst kommunale, ab 1935 dann staatliche Gesundheitsamt in Wiesbaden, sowie andere Ämter, wie zum Beispiel die Schulverwaltung oder das Wohlfahrtsamt. Untersucht werden aber auch nicht-staatliche Einrichtungen, die mit Menschen zu tun hatten, die zwangssterilisiert wurden, darunter u. a. kirchlich geführte Institutionen, wie das katholische Waisenhaus Sankt Michael oder die unter evangelischer Leitung stehende »Erziehungsanstalt« auf dem Geisberg. Alle Bereiche der Studie werden durch die beispielhafte Darstellung der Schicksale der in Wiesbaden zwangssterilisierten Frauen und Männer ergänzt und untermauert.
1.1 Aufbau der Studie und Quellenlage
Die Konzentration auf die Wiesbadener Krankenhäuser als Orte der Durchführung der zwangsweisen Sterilisation verlangte nach einer Auseinandersetzung mit der Geschichte des jeweiligen Hauses, seiner Leitung, Philosophie sowie religiösen bzw. weltanschaulichen Ausrichtung sowie dem dort führenden medizinischen Personal. Infolgedessen werden die Städtischen Kliniken, das Krankenhaus »Paulinenstift«, das Sankt Josefs-Hospital, aber auch das Rotkreuz-Krankenhaus eingehender untersucht.
Bei der Beschäftigung mit dieser Thematik stellte sich allerdings heraus, dass die historische Überlieferung für sämtliche Wiesbadener Kliniken – mit Ausnahme der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg – rudimentär bis nicht vorhanden ist. In Bezug auf die Heil- und Pflegeanstalt Eichberg ist festzustellen, dass der Schwerpunkt der Untersuchungen, die sich mit der Einrichtung während der NS-Zeit beschäftigen, auf der Einbindung der Anstalt in die »Euthanasie« liegt. Das Thema Zwangssterilisationen im Eichberg ist dagegen bislang noch nicht erschöpfend dargestellt worden.
Im Fall der Städtischen Kliniken fanden sich weder im Hauptstaatsarchiv Wiesbaden noch in den Beständen des Wiesbadener Stadtarchivs Unterlagen. Auch die in gedruckter Form vorliegenden Materialien erwiesen sich als spärlich. Dass das Thema Zwangssterilisationen keinerlei Berücksichtigung in den vorhandenen Texten findet, überrascht angesichts der Einstellung zu zwangsweisen Unfruchtbarmachungen vor und nach 1945 nicht. Erstaunlich ist hingegen, dass die Geschichte des Städtischen Krankenhauses in Wiesbaden sowohl vor, während als auch nach der NS-Zeit bislang auf wenig Interesse gestoßen ist. Eine umfassende Darstellung der medizinischen Einrichtungen in Wiesbaden – abseits des Kur- und Badewesens – existiert jedenfalls nicht. Als ergiebigstes Werk erwies sich die von Herbert Müller-Werth verfasste Festschrift »75 Jahre Städtische Krankenanstalten Wiesbaden« – im Rahmen der 600jährigen Wiesbadener Hospitalgeschichte 1879–1954 aus dem Jahr 1954.9
Ähnlich überschaubar war die Quellen- und Literaturlage in Bezug auf das Krankenhaus »Paulinenstift« und das Krankenhaus des Roten Kreuzes. Auch hier musste auf Festschriften zurückgegriffen werden, bei denen die Zeit des »Dritten Reiches« nicht im Mittelpunkt stand. Vielmehr zielten die Texte darauf ab, dem Leser lediglich einen allgemein und knapp gehaltenen Überblick über die Zeit des Bestehens der jeweiligen Einrichtung zu liefern.10
Gleiches galt für die Entwicklung der katholischen Krankenhäuser in Wiesbaden.11 Die stellten allerdings insofern eine Ausnahme dar, als in diesen Kliniken keine Zwangssterilisationen durchgeführt worden sind. In diesem Fall war es notwendig, sich mit den Gründen für die Nichtbeteiligung an den zwangsweisen Sterilisationen zu beschäftigen. Die hierzu vorhandene Literatur erwies sich als umfassend und aussagekräftig.12
Hinsichtlich des medizinischen Personals, insbesondere der Mediziner, die hauptsächlich für die Eingriffe verantwortlich zeichneten, konnte – zumindest in einigen Fällen – auf die im Hessischen Hauptstaatsarchiv aufbewahrten Spruchkammerakten zurückgegriffen werden, so dass es möglich war, zumindest einen Überblick über die Verstrickung der beteiligten Ärzte in das NS-System zu erhalten.13 Nicht anders verhielt es sich mit leitendem Pflegepersonal oder führenden Mitarbeitern in Behörden und Einrichtungen, einschließlich sozialen oder kirchlichen Institutionen, wie zum Beispiel dem evangelischen Erziehungsheim auf dem Geisberg, dem katholischen Johannesstift oder dem katholischen Waisenhaus Sankt Michael, beide in der Platter Straße.14 Auch hier ließen sich so gut wie gar keine personenbezogenen Unterlagen ausfindig machen. Sekundärliteratur existiert ebenfalls so gut wie keine, was schon in Bezug auf die Historie der jeweiligen Häuser thematisiert wurde. Es kann daher nicht überraschen, dass Informationen über die Mitarbeiterschaft in gedruckten Quellen oder Literatur nicht auszumachen sind.
Das zentrale Element der vorliegenden Studie aber stellen selbstverständlich die von der Zwangssterilisation betroffenen Männer und Frauen dar. Die meisten in Wiesbaden zwangssterilisierten Männer und Frauen erhielten die Diagnose »angeborener Schwachsinn«, gefolgt von »Schizophrenie«. Die von einem Arzt, häufig einem Vertreter des Gesundheitsamts, festgestellte »Erbkrankheit« war, wie die Studie zeigt, vorwiegend sozialindiziert und basierte keinesfalls auf einer tatsächlich vererblichen Krankheit. Diesbezüglich unterscheidet sich das Ergebnis für Wiesbaden nicht von dem in anderen Städten und Gemeinden in der Region bzw. im Deutschen Reich.15 Das gilt auch für die in Wiesbaden angewendeten Sterilisationsmethoden. Hier wie andernorts wurden die Betroffenen durch einen operativen Eingriff unfruchtbar gemacht. Nur selten kamen Röntgenstrahlen zum Einsatz.
Die Untersuchung legt eingehend dar, welche Personen aus welchen Gründen und in welchem Zeitraum zwangssterilisiert wurden und schildert darüber hinaus das entsprechende Diagnoseverfahren, das angewendet wurde, um die angebliche Erbkrankheit festzustellen. Darüber hinaus wird geschildert, wie das Verfahren im Fall einer Zwangssterilisation generell ablief, zeigt also auf, welche Institutionen und Personen darin verwickelt waren, wie zum Beispiel das Wiesbadener Gesundheitsamt, das für die meisten Antragsstellungen in der vorliegenden Arbeit verantwortlich zeichnete.
Im Vergleich dazu zurückhaltend verhielten sich hingegen niedergelassene Mediziner und Angehörige anderer Medizinalberufe, obwohl auch sie verpflichtet waren, ihnen »bekannte« Erbkranke beim Gesundheitsamt zu melden, um dadurch das Zwangssterilisationsverfahren einzuleiten. Neben diesem Personenkreis waren auch – wie bereits erwähnt – Mitarbeiter von Behörden, insbesondere solchen, die mit Menschen zu tun hatten, die sozial auffällig oder wirtschaftlich vom Staat abhängig waren und den Nationalsozialisten daher als fortpflanzungsunwürdig erschienen, aufgefordert, Männer und Frauen zu melden, die als potenzielle Sterilisanden in Frage kamen. Tatsächlich haben vor allem Sozialbehörden, wie zum Beispiel das Wohlfahrtsamt, aber auch Hilfsschulen oder Institutionen, die Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen zu betreuen hatten, darunter auch kirchlich geführte Einrichtungen, wie das Sankt Valentinus-Haus in Kiedrich oder das Sankt Vinzenz-Stift in Aulhausen, das Waisenhaus Sankt Michael, dem Gesundheitsamt oder teilweise zunächst der Wiesbadener Schulverwaltung gemeldet.
Allerdings wurden nicht alle benannten Personen zwangssterilisiert. Interessant ist, dass nach dem Erlass des »Gesetzes zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens« im Jahr 1935, das das bislang uneinheitlich gegliederte Gesundheitswesen vereinheitlichen sollte, zwar die Möglichkeiten des Zugriffs des – fortan nicht mehr kommunalen, sondern staatlichen – Gesundheitsamts auf sämtliche Daten von Behörden und Institutionen privater wie öffentlicher Natur erheblich verbesserte, aber der damit zu erwartende signifikante Anstieg der Zwangssterilisationen in Wiesbaden ausblieb. In diesem Zusammenhang ist nach den Gründen zu fragen.
Auf der Hand liegt hingegen, weshalb ab Sommer 1939 die Zahl der zwangsweisen Unfruchtbarmachungen in Wiesbaden deutlich zurückging. Hierfür verantwortlich zeichnete die »Erbpflegeverordnung« vom 31. August 1939, die Zwangssterilisationen nur noch in besonders »dringenden« Fällen vorsah, weil (medizinisches) Personal und Ressourcen geschont werden mussten, da dieses für den Einsatz im Krieg bzw. im Zusammenhang mit dem Krieg benötigt wurde.
Aufgrund der teilweise unvollständigen Überlieferung von Akten und Unterlagen konnten nicht alle Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem Thema Zwangssterilisationen in Wiesbaden auftraten, erschöpfend beantwortet werden. Es wäre allerdings denkbar, dass in der Folgezeit noch Materialien aufgefunden werden, die die noch offenen Fragen zu beantworten vermögen. In diesem Zusammenhang sei beispielsweise auf den recht umfangreichen Bestand »Erbgesundheitsobergericht« in Frankfurt/ Main hingewiesen, der erst kürzlich – im Herbst 2014 – an das Hessische Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden abgegeben worden und bis dato noch unverzeichnet ist. Es besteht demnach die Möglichkeit, dass in der Zukunft ähnliche »Funde« gemacht werden, die die Forschung zum Thema »Zwangssterilisationen« – nicht nur in Wiesbaden, sondern darüber hinaus – weiterbringt.
1.2 Literatur
Zu den Autoren, die sich vor allem mit lokal- oder regionalgeschichtlicher Aufarbeitung des Themas Zwangssterilisationen im NS-Staat im Rhein-Main-Gebiet beschäftigt haben, gehören beispielsweise Monika Daum und Hans-Ulrich Deppe sowie Jessika Hennig oder Frederic Ruckert. Auch Horst Dickel und Peter Sandner, die sich mehr mit der Euthanasie auseinander setzen, gehen auf die Zwangssterilisationen im Rheingau bzw. in der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg ein.
Dickels 1988 erschienene Arbeitsmaterialien für Schüler gehörten zu den ersten Texten, die sich in der Region Rhein-Main überhaupt mit dem Thema Zwangssterilisationen und Euthanasie auseinandergesetzt haben.16 Sein Schwerpunkt lag dabei auf dem Rheingau und dort insbesondere auf der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg. Auch Peter Sandner geht in seiner 2003 erschienenen Studie »Verwaltung des Krankenmordes« auf die in dieser Anstalt durchgeführten Zwangssterilisationen sowie das hierfür zuständige und verantwortliche Personal ein.17 Allerdings war Sandners Arbeit für die vorliegende Studie auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie über die bei der Bezirksregierung in Wiesbaden angesiedelte und von Dr. Wilhelm Stemmler geleitete Abteilung für Erb- und Rassenpflege Auskunft gibt, die sich schon ab 1934 bemühte, eine »Erbkartei« anzulegen, um »rassisch« oder anderweitig »minderwertige« Männer und Frauen zu erfassen. Interessant ist dabei besonders der Umstand, dass die im Landeshaus in Wiesbaden angesiedelte staatliche Institution schon vor dem Inkrafttreten des »Gesetzes zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens« und der damit verbundenen Vereinheitlichung des Gesundheitswesens aktiv war.
Im Fokus von Daum und Deppe stand zu Beginn der 1990er Jahre die Stadt Frankfurt/Main. Auch diese beiden Autoren zeigen die Verstrickung verschiedener Verwaltungsbehörden in das System der Zwangssterilisationen auf. Dazu gehört selbstverständlich das Frankfurter Gesundheitsamt ebenso wie zum Beispiel die Sozial- und Wohlfahrtsbehörde oder nichtkommunale, also kirchliche oder anderweitig geförderte Erziehungs- und Sozialeinrichtungen, des Weiteren Ärzte und Krankenhäuser. Die Autoren gehen aber nicht nur darauf ein, wie das »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« (GzVeN) in Frankfurt/Main angewendet wurde, wer also betroffen war, sondern auch auf den Widerstand, den die Menschen gegen das »Urteil« Zwangssterilisation leisteten. Dazu gehören zum Beispiel die Beschwerden, die gegen den Beschluss des Erbgesundheitsgerichts erhoben wurden.18 Auch in der vorliegenden Studie wurde, soweit möglich, darauf eingegangen, dass es eine gewisse Anzahl Betroffener gab, die – mit mehr oder weniger Erfolg – versuchten, sich gegen die Verurteilung zur Zwangssterilisation zur Wehr zu setzen. Allerdings liegt der Schwerpunkt der Arbeit zu Wiesbaden eher auf »Taten und Tätern«.
Ganz ähnlich geht auch Jessika Hennig vor, die sich in ihrer im Jahr 2000 erschienenen Dissertation mit Offenbach/Main und den dort zwangssterilisierten Männer und Frauen beschäftigt. Sie geht – neben der obligatorischen Darstellung des Verfahrensablaufs – vor allem auf die nach ihrer Erkenntnis überwiegend willkürlich gestellten Diagnosen der antragstellenden Ärzte ein. In Offenbach/Main wurde – wie auch in Wiesbaden – die Mehrheit der Zwangssterilisierten aufgrund fragwürdiger Sozialdiagnosen unfruchtbar gemacht, die aber, wie Hennig zeigt, durch das Erbgesundheitsgericht mehrheitlich anerkannt wurden. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem ärztlichen Gutachten seitens des Erbgesundheitsgerichts erfolgte demnach nicht, obwohl dem Gericht zwei Mediziner angehörten, die sich über die Zweifelhaftigkeit der im GzVeN aufgelisteten »Erbkrankheiten« im Klaren sein mussten. Diese Feststellung Hennigs wird durch die Studie zu Wiesbaden bestätigt. Auch hier wurden die ärztlichen Gutachten durch das Erbgesundheitsgericht in der Regel widerspruchslos akzeptiert, wie die vergleichsweise hohen Durchführungszahlen im Vergleich zu der Zahl der zurückgewiesenen Anträge dokumentiert. Darüber hinaus verweist auch Hennig auf die Zusammenarbeit von verschiedenen Einrichtungen und Behörden sowie verschiedenen Berufsgruppen bei der »Identifizierung« potenzieller Sterilisanden.19
Die Studie von Frederic Ruckert aus dem Jahr 2012 beschäftigt sich mit dem Thema Zwangssterilisationen in Mainz. Während für Wiesbaden nicht klar ist, wie viele Akten verloren gegangen, von den Nationalsozialisten vernichtet oder durch Kriegs- oder Nachkriegseinwirkungen zerstört worden sind, konnte Ruckert für Mainz feststellen, dass sämtliche Unterlagen für männliche Zwangssterilisierte fehlen.20 Da aufgrund der vorliegenden lokalen und regionalen Vergleichsstudien, wie zum Beispiel von Daum/Deppe oder Hennig, aber auch aufgrund der überregionalen Untersuchungen von Christina Vanja und anderen nachgewiesen werden konnte, dass es keine Städte oder Gemeinden gab, in denen ausschließlich Männer oder Frauen zwangssterilisiert wurden, steht außer Frage, dass es auch in Mainz Männer gegeben haben muss, die zwangsweise unfruchtbar gemacht wurden. Für die Studie zu Wiesbaden aber war Ruckerts Arbeit insofern wichtig, als es sich um eine medizinhistorische Dissertation handelt, die u. a. die Arten der Eingriffe bei Frauen sowie die daraus resultierenden möglichen Folgen verständlich und nachvollziehbar schildert und sich darüber hinaus mit den angeblichen Erbkrankheiten, die das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses auflistete, kritisch und dem aktuellen Stand der Forschung entsprechend auseinandersetzt.
Rund zehn Jahre vor Dickels Studie zum Thema Zwangssterilisationen und Euthanasie im Rheingau erschien 1979 die Arbeit von Reiner Pommerin, der sich mit der zwangsweisen Unfruchtbarmachung der »Rheinlandbastarde« beschäftigt.21 Der von Pommerin untersuchte Personenkreis hat insofern eine besondere Bedeutung für die Erforschung des Themas Zwangssterilisationen in Wiesbaden und Umgebung, als die »Rheinlandbastarde« eine Besonderheit in der hiesigen Region darstellten. Bei den Betroffenen handelte es sich um Kinder von Angehörigen der französischen Besatzungstruppen mit deutschen Frauen, die vor allem dann auffielen, wenn die Väter eine andere Hautfarbe hatten. Pommerin beschreibt, dass die Nationalsozialisten danach strebten, diese Kinder zwangsweise zu sterilisieren, um zu verhindern, dass sie ihr »schlechtes« Erbgut weitergaben. Allerdings gestaltete es sich aus außenpolitischen Gründen schwierig, die Nachkommen der französischen Besatzungssoldaten zwangsweise unfruchtbar zu machen. Die Vertreter des »Dritten Reiches« konnten in diesen Fällen nicht handeln, wie sie wollten. Diese Erkenntnis Pommerins wird durch die hier vorgelegte Studie unterstrichen. Da auch Wiesbaden bis Ende 1925 französisch besetzt war, gab es hier ebenfalls sogenannte »Rheinlandbastarde«, die erfasst wurden, um sie dem Zwangssterilisationsverfahren zu unterwerfen. Allerdings scheint es, als ob die Majorität der Betroffenen – zumindest jene, deren Namen dank noch vorhandener Akten unterschiedlicher Wiesbadener Behörden und Institutionen bekannt sind – nicht zwangsweise unfruchtbar gemacht worden sind.
Regionalstudien zum Thema Zwangssterilisation gibt es allerdings nicht nur im Rhein-Main-Gebiet, sondern inzwischen deutschlandweit. Vor allem seit den 1990er Jahren rücken die von zwangsweiser Unfruchtbarmachung betroffenen Personen immer stärker in den Fokus der Forschung. Das hat u. a. damit zu tun, dass Zwangssterilisierte inzwischen als Opfer von NS-Verfolgung anerkannt werden, wenngleich nicht im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes. Die gesellschaftliche Einstellung zu dem Betroffenenkreis hat sich demnach – spätestens seit den 1980er Jahren – gewandelt. Hierfür verantwortlich zeichnet nicht zuletzt der Generationenwechsel. Zu diesem Zeitpunkt amtierten so gut wie keine Personen mehr in Behörden, Gerichten oder vergleichbaren Institutionen, die entweder selbst oder infolge familiärer Verflechtungen in das NS-Herrschaftssystem verflochten waren.
Zu den ab diesem Zeitpunkt außerhalb des Rhein-Main-Gebiets erschienenen Lokal- und Regionalstudien gehören beispielsweise die Arbeiten von Thomas Koch22, der sich 1993 mit der Praxis von Zwangssterilisationen im Universitätsfrauenklinikum Göttingen beschäftigte, oder Christoph Braß23, der sich im gleichen Jahr mit den Zwangssterilisationen im Saarland befasste. Etwa im gleichen Zeitraum erschien die medizinhistorische Dissertation von Christiane Rothmaler24, die sich mit Zwangssterilisationen in Hamburg beschäftigte. Rund 20 Jahre später, nämlich 2010, erschien dann die Arbeit von Susanne Doetz25, bei der es um Zwangssterilisationen in der Universitätsfrauenklinik Berlin zwischen 1942 und 1944 ging. Die genannten Arbeiten wurden zur Erstellung der vorliegenden Studie herangezogen, weil sie sich einerseits mit dem »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« selbst und andererseits mit der Umsetzung desselben beschäftigten, wodurch ein Vergleich mit dem Vorgehen in Wiesbaden möglich wurde.
Ergänzt werden die genannten Publikationen durch Arbeiten mit ausgewählten thematischen Schwerpunkten. Hierzu zählt die 1985 erschienene Arbeit von Christian Ganssmüller, der sich aus rechtswissenschaftlicher Sicht mit dem Thema Zwangssterilisationen beschäftigt.26Jürgen Simon hat sich mit dem eugenischen Rassismus, der im nationalsozialistischen Deutschland die ideologische und rechtspolitische Grundlage bildete und somit zur praktischen Umsetzung der Zwangssterilisationen führte, auseinandergesetzt.27
Diese Studien sind – obgleich zuweilen für den juristischen Experten verfasst, und daher nicht immer leicht zu verstehen – ausgesprochen wichtig, weil sie dazu beitragen, das Thema von unterschiedlichen Sichtweisen aus zu betrachten. Abgesehen davon helfen sie, die juristischen Hintergründe für die zeitgenössische und gegenwärtige Umgehensweise mit Zwangssterilisationen und Zwangssterilisierten zu verstehen. Das gilt ganz besonders für die in dem Sammelband des »Bundes der »Euthanasie«-Geschädigten und Zwangssterilisierten e.V.«, 2005 erschienenen Aufsätze von Andreas Scheulen, der sich mit der »Rechtslage und Rechtsentwicklung« des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses im Dritten Reich auseinander gesetzt hat sowie Rolf Surmann, der sich mit der nach 1945 »verweigerten Entschädigung« während der NS-Zeit von Zwangssterilisation und Euthanasie betroffenen Personen, beschäftigte.28
Auch Astrid Ley hat 2004 eine thematisch fokussierte Studie – ihre Dissertation – zum Thema Zwangssterilisationen vorgelegt.29 In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit der Ärzteschaft und ihrer Verstrickung in der nationalsozialistischen Bevölkerungs- und Selektionspolitik, also einem Thema, das für Wiesbaden aufgrund der mageren Quellenlage nicht umfassend dargestellt werden konnte. Ley wies in ihrer Dissertation nach, dass viele Ärzte – unabhängig von ihrer Konfession – an Zwangssterilisationen beteiligt waren. In diesem Fall gilt also nicht, dass beispielsweise katholische Mediziner Eingriffe dieser Art überwiegend ablehnten. Dieses interessante und wichtige Ergebnis ließ sich auch für Wiesbaden feststellen.
Ganz wichtig für die vorliegende Studie waren darüber hinaus die Arbeiten von Alfons Labisch und Florian Tennstedt, die sich in ihren Texten intensiv mit dem »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« sowie dem »Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens« – einschließlich seiner Entstehung und der daran beteiligten Personen und Institutionen – auseinandersetzten und die Verstrickung der Gesundheitsbehörden bzw. des gesamten Gesundheitssystems in das System der Zwangssterilisationen aufdeckten.30 Wie Labisch und Tennstedt feststellten, wurde das Gesundheitssystem, dessen Vereinheitlichung durch Verreichlichung die Nationalsozialisten durchsetzen wollten, nicht im gewünschten Maße erreicht. Zwar war es ab 1935 leichter, an die Daten potenzieller Sterilisanden zu gelangen, doch zu den angestrebten vereinfachten (Verwaltungs-)Abläufen kam es nicht. Das Gesundheitssystem arbeitete nicht stringent und leicht nachvollziehbar, sondern komplex und verschlungen. Das lässt sich auch für Wiesbaden nachweisen. Die Zuständigkeiten der einzelnen Ämter und Einrichtungen überschnitten sich (auch weiterhin); hinzu kam der Versuch der Einmischung nationalsozialistischer Vereine und Verbände, die in Behörden und nicht-amtlichen Einrichtungen die Oberhoheit zu gewinnen versuchten oder in Konkurrenz zu ihnen zu treten versuchten. Erwähnt sei hier vor allem die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV).
Unverzichtbar waren darüber hinaus die herangezogenen Werke von Hans-Walter Schmuhl und Gisela Bock. Sie gehörten zu den ersten, die sich Mitte der 1980er Jahre des Themas »Zwangssterilisation« umfassend annahmen und somit »Pionierarbeit« leisteten. Während Schmuhl sich mit Eugenik, Rasse, Zwangssterilisation und Euthanasie beschäftigte31, stand bei Bock32 der frauenspezifische Aspekt im Mittelpunkt. Beide Arbeiten stellen die Basis für die Beschäftigung mit dem Thema Zwangssterilisationen dar. Darüber hinaus regten sie die Wissenschaft zu weiterer Auseinandersetzung mit dem Forschungsgebiet an, u. a. zu der Beschäftigung mit der Frage, ob Zwangssterilisationen den Auftakt zur »Euthanasie« bildeten, oder ob es sich um zwei mehr oder weniger unabhängig voneinander ablaufende Verfahren handelte.
Zu denjenigen, die sich ebenfalls sehr intensiv und darüber hinaus seit vielen Jahren mit dem Thema Zwangssterilisationen befasst, gehört Christina Vanja. Ihre Untersuchungen zu verschiedenen Heil- und Pflegeanstalten, darunter Hadamar, Herborn und der Eichberg, deren Patienten ebenfalls zwangsweise sterilisiert wurden, u. a. dann, wenn sie zur Entlassung anstanden, waren für die vorliegende Studie beispielgebend, insbesondere im Hinblick auf die Heil- und Pflegeanstalt Eichberg.33
1 Vgl. Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStAW): Erbgesundheitsgericht Wiesbaden (Abt. 473/4), Erbgesundheitsgericht Frankfurt/Main (Abt. 473/1), Erbgesundheitsgericht Limburg/Lahn (Abt. 473/3), sonstige Erbgesundheitsgerichte (Abt. 473/5).
2 Vgl. HHStAW: Preußisches Landratsamt des Rheingaukreises (Rüdesheim) (Abt. 415), Hessisches Landratsamt des Obertaunuskreises (Abt. 658), Hessisches Landratsamt des Rheingau-Taunus-Kreises (Abt. 659), Hessisches Landratsamt Gelnhausen (Abt. 653).
3 Vgl. HHStAW: Oberlandesgericht Frankfurt/Main (Abt. 458, Abt. 458 Zugang 94/2014 (Erbgesundheitsobergericht)), Amtsgericht Wiesbaden (Abt. 469/33), Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Wiesbaden (Abt. 468).
4 Vgl. HHStAW: Heil- und Pflegeanstalt Eichberg (Abt. 430/1).
5 Vgl. HHStAW: Regierungspräsidien als Entschädigungsbehörde (Abt. 518).
6 Vgl. Hessisches Staatsarchiv Darmstadt (HStAD): Abt. G 29 U Erbgesundheitsgerichte.
7 Vgl. Hessisches Staatsarchiv Marburg (HStAM): Bestand (Best.) 279 Erbgesundheitsgerichte Hanau, Kassel, Marburg.
8 Vgl. HHStAW: Gestapo-Kartei Frankfurt/Main, Regierungspräsidium Wiesbaden (Abt. 405). Vgl. Stadtarchiv Wiesbaden (StAW): Akten und Amtsbücher 1866–1945 (Wi/2: insbesondere Wi/2 Nr. 4907: Durchführung des Erbgesundheitsgesetzes, Sterilisationen; Wi/2 Nr. 4538–4665: Patientenakten der Medizinischen Klinik) sowie Akten und Amtsbücher seit 1945 (Wi/3 Nr. 7310–7355. Hier insbesondere Nr. 7334).
9 Vgl. Müller-Werth, Herbert: 75 Jahre Städtische Krankenanstalten Wiesbaden im Rahmen der 600jährigen Wiesbadener Hospitalgeschichte 1879–1954. Wiesbaden 1954 (Ritter) (im Folgenden Müller-Werth, Herbert: 75 Jahre).
10 Vgl. Hackel, Karin: 100 Jahre Diakoniegemeinschaft Paulinenstift Asklepios Paulinen Klinik. Wiesbaden 1996 (Dinges und Frick) (im Folgenden Hackel, Karin). Vgl. Weber, Ulrich: Von der Mägdeherberge zur Diakoniegemeinschaft – 150 Jahre Paulinenstift Wiesbaden (1857–2007). Mainz-Kastell 2007 (mww.druck und so …GmbH) (im Folgenden Weber, Ulrich). Vgl. Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (ZEKHN): Bestand 242 Nr. 201: Abschrift der »Chronik des Diakonissen-Mutterhauses Paulinenstiftung Wiesbaden 1930–1945«. S. 1–17 (im Folgenden Chronik). Bestand 104 Nr. 479: Abschrift des Manuskripts von August Kortheuer »Zum 100-jährigen Jubiläum des Paulinenstiftes in Wiesbaden«. S. 1–9 (im Folgenden Manuskript). Vgl. Schmidt-Meinecke, Sigrid: Rotes Kreuz Schwesternschaft Oranien e.V. Wiesbaden 1885–1975. Speyer – ohne Datum (Elfert) (im Folgenden Schmidt-Meinecke, Sigrid).
11 Vgl. Franz, W.: 100 Jahre Sankt Josefs-Hospital in Wiesbaden. In: 100 Jahre Sankt Josefs-Hospital Wiesbaden. Wiesbaden 1976 (Carl Nass) (im Folgenden Franz, W.).
12 Vgl. Nowak, Kurt: Geschichte des Christentums in Deutschland. Religion, Politik und Gesellschaft vom Ende der Aufklärung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. München 1995 (Beck). S. 249–251 (im Folgenden Nowak, Kurt: Geschichte des Christentums in Deutschland). Vgl. Nowak, Kurt: »Euthanasie« und Sterilisierung im »Dritten Reich«. Die Konfrontation der evangelischen und der katholischen Kirche mit dem »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« und der »Euthanasie«-Aktion. Göttingen 1978 (Vandenhoeck). S. 111–114 (im Folgenden Nowak, Kurt: »Euthanasie«). Vgl. Kretschmann, Carsten: Eine Partie für Pacelli? Die Scholder-Repgen-Debatte. In: Brechenmacher, Thomas (Hg.): Das Reichskonkordat 1933. Forschungsstand, Kontroversen, Dokumente. Paderborn 2007 (Schöningh). S. 13–24. Hier S. 15 (im Folgenden Kretschmann, Carsten). Vgl. Adolph, Walter: Die katholische Kirche im Deutschland Adolf Hitlers. Berlin 1974 (Morus). S. 16–18 (im Folgenden Adolph, Walter). Vgl. Volk, Ludwig: Das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933. Von den Ansätzen in der Weimarer Republik bis zur Ratifizierung am 10. September 1933. Mainz 1972 (Grünewald). S. 169 (im Folgenden Volk, Ludwig). Vgl. Rotte, Ralph: Die Außen- und Friedenspolitik des Heiligen Stuhls. Eine Einführung. Wiesbaden 2007 (VS). S. 181–184 (im Folgenden Rotte, Ralph). Vgl. Kaminsky, Uwe: Zwangssterilisation und »Euthanasie« im Rheinland. Evangelische Erziehungsanstalten sowie Heil- und Pflegeanstalten 1933–1945. Köln 1995 (Rheinland) S. 159 (im Folgenden Kaminsky, Uwe). Vgl. Laun, Rudolf: Das Reichskonkordat von 1933. Rechtsgutachten. Wiesbaden 1955 (Ritter). S. 5 (im Folgenden Laun, Rudolf). Vgl. Zentner, Christian/Bedürftig, Friedemann (Hg.): Das große Lexikon des Dritten Reiches. Augsburg 1993 (Südwest). S. 323–324 (im Folgenden Zentner, Christian/Bedürftig, Friedemann).
13 Vgl. HHStAW: Spruchkammerakten, zum Beispiel zu: Prof. Dr. Otto Kleinschmidt (Abt. 520/Wiesbaden Nr. 1548), Prof. Dr. Karljohann von Oettingen (Abt. 520/Wiesbaden Nr. 645), Prof. Dr. Oskar Wiedhopf (Abt. 520/Marburg und Biedenkopf Nr. 1500 und Abt. 501 R Nr. 28543), Dr. Karl Weber (Abt. 520/Wiesbaden Nr. 47), Dr. Walter Gronemann (Personalakte: Bestand 650 B und 649 Nr. 8/56–3/14) und Spruchkammerakte (Abt. 520/Wiesbaden Nr. 1531), Dr. Wilhelm Stemmler (Abt. 520 BW Nr. 5947), Dr. Margarete Everken (Abt. 520/Wiesbaden Nr. W 1521). Vgl. StAW: Personalakten: Prof. Dr. Otto Kleinschmidt (Wi/P Nr. 4264), Prof. Dr. Karljohann von Oettingen (Wi/P Nr. 3659).
14 Vgl. HHStAW: Spruchkammerakten: Elisabeth Müller, Fürsorgerin (Abt. 520/ Wiesbaden Nr. (NB) A-Z), Paul Kinkel, Lehrer/Direktor des evangelischen Erziehungsheims auf dem Geisberg (Abt. 520/Wiesbaden Nr. 6245).
15 Vgl. Daum, Monika/Deppe, Hans-Ulrich: Zwangssterilisation in Frankfurt/Main 1933–1945. Frankfurt / Main 1991 (Campus) (im Folgenden Daum, Monika/Deppe, Hans-Ulrich). Vgl. Hennig, Jessika: Zwangssterilisation in Offenbach am Main 1934–1944. Frankfurt/Main 2000 (Mabuse) (im Folgenden Hennig, Jessika). Vgl. Ruckert, Frederic: Zwangssterilisationen im Dritten Reich 1933–1945. Schicksal der Opfer am Beispiel der Frauenklinik des Städtischen Krankenhauses und der Städtischen Hebammenlehranstalt Mainz. Stuttgart 2012 (Steiner) (im Folgenden Ruckert, Frederic). Vgl. Bock, Gisela: Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik. Opladen 1986 (Westdeutscher) (im Folgenden Bock, Gisela: Zwangssterilisation). Vgl. Braß, Christoph: Rassismus nach Innen – Erbgesundheitspolitik und Zwangssterilisation. In: Beiträge zur Regionalgeschichte. Heft 14: Braune Jahre – Wie die Bevölkerung an der Saar die NS-Zeit erlebte. St. Ingbert 1993 (VFG) (im Folgenden Braß, Christoph). Vgl. Rothmaler, Christiane: Sterilisationen nach dem »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« vom 14. Juli 1933. Eine Untersuchung zur Tätigkeit des Erbgesundheitsgerichtes und zur Durchführung des Gesetzes in Hamburg in der Zeit zwischen 1934 und 1944. Husum 1991 (Matthiesen). S. 22–27 (im Folgenden Rothmaler, Christiane: Sterilisationen). Vgl. Rothmaler, Christiane: Zwangssterilisationen nach dem »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses«. In: Bleker, Johanna/Jachertz, Norbert (Hg.): Medizin im »Dritten Reich«. Köln 1993 (Deutscher Ärzte-Verlag). S. 137–149 (im Folgenden Rothmaler, Christiane: Zwangssterilisationen).
16 Vgl. Dickel, Horst: »Die sind ja doch alle unheilbar.« Zwangssterilisationen und Tötung der »Minderwertigen« im Rheingau. 1934–1945. Materialien zum Unterricht, Sekundarstufe I. Heft 77/Projekt »Hessen im Nationalsozialismus«. Wiesbaden 1988 (HIBS) (im Folgenden Dickel, Horst: »Die sind ja doch alle unheilbar«).
17 Vgl. Sandner, Peter: Verwaltung des Krankenmordes. Der Bezirksverband Nassau im Nationalsozialismus. Historische Schriftenreihe des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Hochschulschriften. Band 2. Gießen 2003 (Psychosozial/Haland und Wirth) (im Folgenden Sandner, Peter: Krankenmord).
18 Vgl. Daum, Monika/Deppe, Hans-Ulrich.
19 Vgl. Hennig, Jessika.
20 Vgl. Ruckert, Frederic.
21 Vgl. Pommerin, Reiner: Sterilisierung der Rheinlandbastarde. Das Schicksal einer farbigen deutschen Minderheit 1918–1937. Düsseldorf 1979 (Droste) (im Folgenden Pommerin, Reiner).
22 Vgl. Koch, Thomas: Zwangssterilisation im Dritten Reich. Das Beispiel der Universität Göttingen. Frankfurt/Main 1994 (Mabuse) (im Folgenden Koch, Thomas).
23 Vgl. Braß, Christoph.
24 Vgl. Rothmaler, Christiane: Sterilisationen. Vgl. Rothmaler, Christiane: Zwangssterilisationen.
25 Vgl. Doetz, Susanne: Alltag und Praxis der Zwangssterilisation. Die Berliner Universitätsfrauenklinik unter Walter Stoeckel 1942–1944. Dissertation Berlin (Charité) 2010 (im Folgenden Doetz, Susanne: Alltag).
26 Vgl. Ganssmüller, Christian: Die Erbgesundheitspolitik des Dritten Reiches – Planung, Durchführung und Durchsetzung. Köln 1987 (Böhlau) (im Folgenden Ganssmüller, Christian).
27 Vgl. Simon, Jürgen: Kriminalbiologie und Zwangssterilisation. Eugenischer Rassismus 1920–1945. Münster 2001 (Waxmann) (im Folgenden Simon, Jürgen).
28 Vgl. Scheulen, Andreas: Zur Rechtslage und Rechtsentwicklung des Erbgesundheitsgesetzes 1934. In: Hamm, Margret (Hg.): Lebensunwert zerstörte Leben – Zwangssterilisation und »Euthanasie«. Frankfurt/Main 2005 (VAS). S. 212–219 (im Folgenden Scheulen, Andreas). Vgl. Rolf Surmann: Was ist typisches NS-Unrecht? Die verweigerte Entschädigung für Zwangssterilisierte und »Euthanasie«-Geschädigte. In: Hamm, Margret (Hg.): Lebensunwert zerstörte Leben – Zwangssterilisation und »Euthanasie«. Frankfurt/Main 2005 (VAS). S. 198–211 (im Folgenden Surmann, Rolf).
29 Vgl. Ley, Astrid: Zwangssterilisation und Ärzteschaft. Hintergründe und Ziele ärztlichen Handelns 1934–1945. Frankfurt/Main 2003 (Campus) (im Folgenden Ley, Astrid: Ärzteschaft).
30 Vgl. Labisch, Alfons/Tennstedt, Florian: Der Weg zum »Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens« vom 3. Juli 1934. Entwicklungslinien und –momente des staatlichen und kommunalen Gesundheitswesens in Deutschland. Düsseldorf 1985. Teil 1–2 (Akademie für öffentliches Gesundheitswesen) (im Folgenden Labisch, Alfons/Tennstedt, Florian: Der Weg zum …).
31 Vgl. Schmuhl, Hans-Walther: Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie – Von der Verhütung zur Vernichtung »lebensunwerten Lebens«, 1890–1945. Göttingen 1987 (Vandenhoeck) (im Folgenden Schmuhl, Hans-Walter: Rassenhygiene). Vgl. Schmuhl, Hans-Walter: Grenzüberschreitungen: das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik 1927–1945. Göttingen 2005 (Wallstein) (im Folgenden Schmuhl, Hans-Walter: Grenzüberschreitungen).
32 Vgl. Bock, Gisela: Zwangssterilisation.
33 Vgl. Vanja, Christina: Von der herzoglichen Irrenanstalt zum modernen Gesundheitskonzern. Die Geschichte der nassauischen Psychiatrie. In: Nassauische Annalen. Bd. 123. Wiesbaden 2012. (Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung) S. 603–633 (im Folgenden Vanja, Christina: Irrenanstalt). Vgl. Vanja, Christina/Vogt, Martin: Zu melden sind sämtliche Patienten … – Ein Überblick zur Einführung. In: Euthanasie in Hadamar. Die nationalsozialistische Vernichtungspolitik in hessischen Anstalten. Begleitband. Eine Ausstellung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Historische Schriftenreihe des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Kataloge Band 1. Kassel 1991 (Landeswohlfahrtsverband Hessen). S. 13–49 (im Folgenden Vanja, Christina/Vogt, Martin: Zu melden sind sämtliche Patienten).
2. Zur Entstehung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
Am 14. Juli 1933 wurde das »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« verabschiedet, das am 1. Januar 1934 in Kraft trat.34
Die Rechtsregelung stützte sich auf eine Vorlage des preußischen Innenministeriums vom 19. Dezember 193235, das in erster Linie auf dem Ergebnis der Zusammenkunft des preußischen Landesgesundheitsrats vom 2. Juli 1932 basierte.36 Die dort anwesenden Mitglieder der preußischen Medizinalverwaltung sowie führende Vertreter aus Wissenschaft, Behörden, Parteien, Verbänden und dem preußischen Landesparlament hatten sich mit dem Thema »Eugenik im Dienste der Volkswohlfahrt37“ beschäftigt und nach einer Antwort auf die Frage gesucht, wie das »Anwachsen eines Bevölkerungsteils [verhindert werden konnte], der unfähig ist, sich in die menschliche Gesellschaft einzuordnen oder das Leben selbst zu meistern, der zum Teil eine Bedrohung der Gemeinschaft darstellt und dennoch von ihr unterhalten werden muß«38. Die Experten kamen zu dem Ergebnis, dass dieser Bevölkerungsteil im Interesse der »erbgesunden Familien« möglichst klein gehalten werden musste, weshalb eugenisch indizierte Sterilisationen durchgeführt werden sollten.39
Nach den Vorstellungen des preußischen Landesgesundheitsrats und der preußischen Medizinalverwaltung hatte die Sterilisation freiwillig zu erfolgen. Eine zwangsweise Unfruchtbarmachung war nicht vorgesehen. »Eine Person, die an erblicher Geisteskrankheit, erblicher Geistesschwäche, erblicher Epilepsie oder an eine[r] sonstigen Erbkrankheit leidet oder Träger krankhafter Erbanlagen ist, kann operativ sterilisiert werden, wenn sie einwilligt […].« Die Sterilisation sollte durchgeführt werden können, wenn ein staatlicher Ausschuss, bestehend aus einem Richter und zwei Ärzten, dem Antrag zugestimmt hatte.40
Somit war definiert, welcher Personenkreis auf freiwilliger Basis unfruchtbar gemacht werden durfte, und welche Indikationen zu einem solchen Eingriff berechtigten. Nun bedurfte es noch der Verabschiedung eines reichsweit gültigen Sterilisationsgesetzes, um die notwendige Rechtssicherheit zu schaffen, die es bis dahin nicht gegeben hatte.41
Die bislang in Deutschland vorgenommenen Sterilisationen waren sowohl juristisch als auch ethisch umstritten gewesen, allen voran jene, die der sächsische Mediziner Gustav Boeters hatte durchführen lassen. Auf seine Veranlassung hin waren mehrere Personen, deren Fortpflanzung er für unerwünscht hielt, sterilisiert worden. Grundsätzlich plädierte er dafür, von Geburt an geistig oder körperlich behinderte Menschen unfruchtbar zu machen sowie sozial indizierte Sterilisationen vornehmen zu dürfen, zum Beispiel an »Sittlichkeitsverbrecher[n] und solche[n] Personen, die zwei oder mehr uneheliche Kinder geboren haben, deren Vaterschaft zweifelhaft ist«.42 Boeters’ Fordern und Handeln löste in den frühen 1920er Jahren eine intensive Debatte sowohl über die rechtlichen Grundlagen der Sterilisation als auch über den Personenkreis und die medizinischen, sozialen sowie ökonomischen Indikationen für eine Unfruchtbarmachung aus.43
Da mit den Vorschlägen des preußischen Landesgesundheitsrats diese seit Jahren umstrittenen und vieldiskutierten Fragen und Probleme geklärt zu sein schienen44, legte das preußische Innenministerium im Dezember 1932 die Ergebnisse der Beratungen des preußischen Landesgesundheitsrats dem preußischen Ministerpräsidenten vor, verbunden mit der Bitte, sie dem Reichsinnenministerium zuzuleiten, das das vorgeschlagene (Reichs-) Sterilisationsgesetz auf den Weg bringen sollte. Ein solches Gesetz diene nicht nur der »biologische[n] Entwicklung des Deutschen Volkes«, sondern erspare den ohnehin belasteten öffentlichen Kassen viel Geld, denn »die Ausgaben für erblich belastete Personen und Familien in der Wohlfahrtspflege, Fürsorge und auch im Strafvollzug« seien enorm, begründeten die Vertreter des preußischen Innenministeriums ihr Ansinnen.45
Am 5. Mai 1933 leitete der preußische Ministerpräsident – als solcher amtierte inzwischen Hermann Göring – den Gesetzentwurf wunschgemäß an das Reichsinnenministerium weiter.46
Das inzwischen von Wilhelm Frick geführte Reichsinnenministerium übernahm die Vorlage im Großen und Ganzen, verschärfte sie aber insofern, als die Sterilisation nicht mehr freiwillig erfolgte, sondern zwangsweise durchgeführt wurde47: »Wer erbkrank ist,« so hieß es in Paragraph 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses«, »kann durch [einen] chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht […] werden […].«48
Als erbkrank im Sinne des Gesetzes galt eine Person, wenn sie von folgender Diagnostik betroffen war: angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, zirkuläres (manisch-depressives) Irresein (bipolare Störung), erbliche Fallsucht (Epilepsie), erblicher Veitstanz (Chorea Huntington), erbliche Blindheit oder Taubheit, schwere erbliche körperliche Missbildung sowie schwerer Alkoholismus.49
Die Liste der »Erbkranken«, die zur Durchführung einer Zwangssterilisation berechtigten, umfasste demnach keineswegs »nur« Menschen, die tatsächlich an einer erblichen Krankheit litten, sondern zielte außerdem auf Personen ab, die den Nationalsozialisten aus sozialen oder »rassischen« – also rassistischen – Gründen missliebig waren. Hierzu gehörten u. a. unehelich Geborene sowie nach nationalsozialistischer Diktion unsittlich und kriminell Veranlagte, »Asoziale«, »Fremdrassige«, Juden, Sinti und Roma, damals als Zigeuner bezeichnet, oder Mischlinge, wie zum Beispiel die sogenannten Rheinlandbastarde, die einen Elternteil mit einer anderen Hautfarbe hatten.50
Dass dieser, den Nationalsozialisten missliebige Personenkreis keine explizite Erwähnung im »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« fand, hatte vor allem folgenden Grund: Der NS-Staat befand sich in der damaligen Zeit noch in der Konsolidierungsphase. Folglich war der politische und soziale Umbau von Staat und Gesellschaft längst noch nicht so weit gediehen, so dass Gegenwehr aus der Bevölkerung oder Protest von Kirchen und anderen Institutionen gegen Maßnahmen des NS-Staats zu erwarten war. Demnach musste mit Schwierigkeiten gerechnet werden, wenn gegen Menschen vorgegangen wurde, deren »Vergehen«, zum Beispiel »Asozialität« war, welches wiederum nicht explizit definiert war, und folglich die Möglichkeit bestand, den Vorwurf beliebig und im Prinzip gegen jedermann zu erheben.51
Um diesen Kreis der den Nationalsozialisten missliebigen Menschen trotzdem an der Fortpflanzung hindern zu können, ordnete man ihnen kurzerhand eine im Gesetz erwähnte Diagnose zu, vorzugsweise »angeborener Schwachsinn« oder Schizophrenie, eine Diagnose, die offenbar häufig in Anstalten Verwendung fand52. Sodann war es den NS-Behörden möglich, ein den rechtlichen Regeln entsprechendes Zwangssterilisationsverfahren einzuleiten.53
34 Vgl. Vossen, Johannes: Erfassen, Ermitteln, Untersuchen, Beurteilen. Die Rolle der Gesundheitsämter und ihrer Amtsärzte bei der Durchführung von Zwangssterilisationen im Nationalsozialismus. In: Hamm, Margret (Hg.): Lebensunwert zerstörte Leben. Zwangssterilisation und »Euthanasie«. Frankfurt/Main 2005 (VAS). S. 94 (im Folgenden Vossen, Johannes: Erfassen). Vgl. Vossen, Johannes: Die Umsetzung der Politik der Eugenik bzw. Rassenhygiene durch die öffentliche Gesundheitsverwaltung im Deutschen Reich. Das Beispiel der Sterilisationspolitik (1923–1939). S. 1–8. Hier S. 1–2; abrufbar unter: https://dg.philhist.unibas.ch/forschung/tagung-eugenik [19.10.2014] (im Folgenden Vossen, Johannes: Umsetzung). Vgl. Winau, Rolf: Biologismus in der Medizin seit dem 19. Jahrhundert. Von der Eugenik zur Präimplantationsdiagnostik. S. 1–12. Hier S. 5; abrufbar unter: www.100-jahre-sozialmedizin.de/CD_DGSMP/PdfFiles/Texte/R_W.Pdf. [22.10.2014] (im Folgenden Winau, Rolf: Biologismus). Vgl. Weigend, Jana: Zwangssterilisationen in Herborn. In: Vanja, Christina (Hg.): Hundert Jahre Psychiatrie in Herborn. Rückblick, Einblick, Ausblick. Marburg 2011 (Jonas). S. 126–135. Hier S. 126 (im Folgenden Weigend, Jana). Vgl. Doetz, Susanne: Zwangssterilisierung. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses und seine praktische Anwendung. In: Kampmeyer, Margret: Tödliche Medizin. Rassenwahn im Nationalsozialismus. Göttingen 2009 (Wallstein). S. 34–43. Hier S. 34 (im Folgenden Doetz, Susanne: Zwangssterilisierung). Vgl. Scheulen, Andreas. S. 212.
35 Vgl. Vossen, Johannes: Umsetzung. S. 5.
36 Vgl. Vossen, Johannes: Umsetzung. S. 4. Vgl. Simon, Jürgen. S. 49.
38 Vgl. Vossen, Johannes: Umsetzung. S. 4–5.
39 Vgl. Vossen, Johannes: Umsetzung. S. 4. Vgl. Weingart, Peter/Kroll, Jürgen/Bayertz, Kurt: Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Frankfurt/Main 1988 (Suhrkamp). S. 294–295 (im Folgenden Weingart, Peter/ Kroll, Jürgen/Bayertz, Kurt).
40 Vgl. Vossen, Johannes: Umsetzung. S. 5. Vgl. Weingart, Peter/Kroll, Jürgen/Bayertz, Kurt. S. 295. Vgl. Braß, Christoph. S. 10. Vgl. Scheulen, Andreas. S. 212. Vgl. Simon, Jürgen. S. 49.
41 Vgl. Vossen, Johannes: Umsetzung. S. 4. Vgl. Weingart, Peter/Kroll, Jürgen/Bayertz, Kurt. S. 295.
42 Vgl. Vossen, Johannes: Umsetzung. S. 2. Vgl. Vossen, Johannes: Gesundheitsämter im Nationalsozialismus. Rassenhygiene und offene Gesundheitsfürsorge in Westfalen 1900–1950. Essen 2001 (Klartext). S. 316 (im Folgenden Vossen, Johannes: Gesundheitsämter im Nationalsozialismus). Vgl. Weingart, Peter/Kroll, Jürgen/Bayertz, Kurt. S. 291–292. Vgl. Simon, Jürgen. S. 48–49.
43 Vgl. Gütt, Arthur: Verhütung krankhafter Erbanlagen. Eine Übersicht über das Erbkrankheitsgesetz mit Texten. Langensalza 1936 (Beyer). S. 16–17 (im Folgenden Gütt, Arthur: Verhütung krankhafter Erbanlagen). Vgl. Vossen, Johannes: Umsetzung. S. 1–2. Vgl. Weingart, Peter/Kroll, Jürgen/Bayertz, Kurt. S. 291–292. Vgl. Winau, Rolf: Biologismus. S. 5. Vgl. Hofmann-Mildebrath, Brigitte: Zwangssterilisation an (ehemaligen) Hilfsschülerinnen und Hilfsschülern im Nationalsozialismus – Fakten/AKTEN gegen das Vergessen – regionalgeschichtliche Studie im Raum Krefeld. Dissertation Dortmund 2004. S. 109 (im Folgenden Hofmann-Mildebrath, Brigitte).
44 Vgl. Vossen, Johannes: Umsetzung. S. 3.
45 Vgl. Vossen, Johannes: Umsetzung. S. 5. Vgl. Weingart, Peter/Kroll, Jürgen/Bayertz, Kurt. S. 293–295. Vgl. Surmann, Rolf. S. 201–202. Vgl. Jakobi, Helga/Chroust, Peter/ Hamann, Matthias: Aeskulap & Hakenkreuz. Zur Geschichte der Medizinischen Fakultät in Gießen zwischen 1933 und 1945. Frankfurt/Main 1989 (Mabuse). S. 13–14 (im Folgenden Jakobi, Helga/Chroust, Peter/Hamann, Matthias).
46 Vgl. Vossen, Johannes: Umsetzung. S. 5–6.
47 Vgl. Vossen, Johannes: Umsetzung. S. 6. Vgl. Weingart, Peter/Kroll, Jürgen/Bayertz, Kurt. S. 294–297. Vgl. Jakobi, Helga/Chroust, Peter/Hamann, Matthias. S. 14. Vgl. Doetz, Susanne: Zwangssterilisierung. S. 34. Vgl. Winau, Rolf: Biologismus. S. 5. Vgl. Hofmann-Mildebrath, Brigitte. S. 111.
48 Gütt, Arthur/Rüdin, Ernst/Ruttke, Falk: Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 (Reichsgesetzblatt I. S. 529). In: Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 mit Auszug aus dem Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24. November 1933. München 1934 (Lehmann). § 1 Abs. 1. S. 56 (im Folgenden Gütt, Arthur/Rüdin, Ernst/Ruttke, Falk: GzVeN).
49 Vgl. Gütt, Arthur/Rüdin, Ernst/Ruttke, Falk: GzVeN. § 1 Abs. 2 und 3. S. 56.
50 Vgl. Bock, Gisela: Nationalsozialistische Sterilisationspolitik. In: Henke, Klaus-Dietmar (Hg.): Tödliche Medizin im Nationalsozialismus. Von der Rassenhygiene zum Massenmord. Köln 2008 (Böhlau). S. 85–99. Hier S. 91 (im Folgenden Bock, Gisela: Nationalsozialistische Sterilisationspolitik). Vgl. Daum, Monika/Deppe, Hans-Ulrich. S. 164–170. Vgl. Ganssmüller, Christian. S. 85–89. Vgl. Pommerin, Reiner. S. 52. Vgl. Surmann, Rolf. S. 201–202.
51 Vgl. Ganssmüller, Christian. S. 85–89.
52 Vgl. Koch, Thomas. S. 30. Vgl. Ley, Astrid: Ärzteschaft. S. 57.
53 Vgl. HHStAW: Erbgesundheitsgerichtsakten – Exemplarische Beispiele: Abt. 473/4 Nr. 425, 670, 747; Abt. 468 Nr. 230. Vgl. StAW: Wi/2 Nr. 4521: Liste der Bastardkinder (Knaben) vom Kaiser-Wilhelm-Institut, Berlin – ohne Datum (wahrscheinlich Datum vom 04.01.1935).
3. Der allgemeine Verfahrensverlauf bei Zwangssterilisationen: Ein Überblick
Die zwischen 1933 und 1945 durchgeführten Verfahren zur Unfruchtbarmachung verliefen im gesamten Deutschen Reich – und so auch in Wiesbaden – nach einem festgelegten Schema und dauerten, von der Antragstellung bis zur Durchführung des Eingriffs, im Durchschnitt mehrere Monate. Bei längeren Verfahren waren meistens Beschwerden die Gründe oder auch Krankheit des Betroffenen, die einen Eingriff wegen Gefährdung der Person zeitlich nach hinten verschoben haben.54
Das Sterilisationsverfahren selbst begann zwar stets mit der Antragstellung, jedoch konnte zuvor auch eine Anzeige erstattet werden. Hierzu wurden alle Ärzte und Zahnärzte und sonstige im Gesundheitswesen tätigen Personen, wie zum Beispiel Anstaltsleiter, selbständige Hebammen und Pflegekräfte, Masseure und Heilpraktiker verpflichtet, unverzüglich eine Anzeige beim zuständigen Amtsarzt zu erstatten, wenn ihnen in ihrer beruflichen Tätigkeit Personen auffielen, die an einer im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Paragraph 1 Absatz 1 bis 3 aufgeführten Erbkrankheiten oder unter schwerem Alkoholismus litten bzw. auch nur der Verdacht daraufhin bestand.55 Bei Nichteinhaltung der Anzeigepflicht drohte eine Geldstrafe bis zu 150 Reichsmark.56
War eine Person – in Behörden, Organisationen oder Einrichtungen, die in irgendeiner Form mit gesundheitlichen oder mit Wohlfahrts- oder Fürsorgeangelegenheiten – als potenziell erbkrank ausfindig gemacht worden, erhielt der Betroffene eine Vorladung zum Gesundheitsamt. Dort wurde er einem Amtsarzt vorgestellt, der ihn untersuchte und anschließend ein mehrseitiges Gutachten über dessen physischen und psychischen Zustand sowie seine intellektuellen Fähigkeiten erstellte. Auf der Basis dieser Expertise wurde sodann entschieden, ob die betroffene Person tatsächlich als erbkrank im Sinne des Erbgesundheitsgesetzes galt oder nicht. Erging die Diagnose »erbkrank«, stellte der Amtsarzt einen Antrag auf Unfruchtbarmachung beim zuständigen Erbgesundheitsgericht (EG). Dem Antrag beigefügt wurde das medizinische Gutachten.57 Im Allgemeinen konnte auch der Leiter einer Kranken-, Heil- und Pflegeanstalt oder eines Gefängnisses einen Antrag auf Unfruchtbarmachung beim Erbgesundheitsgericht stellen sowie der Betroffene selbst, sein Vormund oder Pfleger oder ein Angehöriger.58 In der Regel waren es jedoch die Vertreter des Gesundheitsamtes, die Kreis- oder Amtsärzte oder dort tätigen Hilfsärzte, die die Anträge auf Zwangssterilisation stellten. Dies trifft auch für Wiesbaden zu (vgl. Abb. 3a und b. S. → im Abbildungsverzeichnis). Selbstanträge gab es vergleichsweise wenig.59 Dabei waren sie seitens des NS-Staats durchaus erwünscht, weil der Verweis auf die Existenz solcher Eigenanträge den Zwangscharakter des Gesetzes zu verschleiern half.60 Es ist davon auszugehen, dass diejenigen, die selbst einen Antrag auf Unfruchtbarmachung stellten, sich über die Konsequenzen nicht – oder nicht vollständig – im Klaren waren oder zu dem Selbstantrag genötigt wurden. Darauf lässt vor allem folgende Erläuterung zum Erbgesundheitsgesetz schließen, in der es heißt: »Hält der beamtete Arzt die Unfruchtbarmachung für geboten, so soll er dahin wirken, dass der Unfruchtbarzumachende selbst […] den Antrag stellt.«61 Der Amtsarzt sollte sich anschließen, im Falle des Zurücknehmens des Antrags vom Betroffenen.62
Die »Institutionen« Erbgesundheitsgericht bzw. Erbgesundheitsobergericht wurden nach Inkrafttreten des »Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« am 1. Januar 1934 in Deutschland eingerichtet. 1935 gab es reichsweit schon mehr als 200 Erbgesundheitsgerichte und 30 Erbgesundheitsobergerichte. Die Erbgesundheitsgerichte waren den Amtsgerichten angegliedert. Ein Erbgesundheitsgericht setzte sich aus einem Amtsrichter, der als Vorsitzender wirkte, sowie zwei Ärzten als Beisitzer – einer davon beamtet, der andere approbiert und »mit der Erbgesundheitslehre besonders vertraut« – zusammen. Die Entscheidung, ob eine Person zwangssterilisiert werden sollte oder nicht, erging zumeist nach Aktenlage. Folglich kam der Betroffene vor Gericht persönlich zumeist nicht zu Wort und konnte sich daher auch nicht gegen die Feststellungen des Gutachters beim Gesundheitsamt durch eine Art »Augenscheinbeweis« erwehren. In jedem Fall lag die Beweispflicht – nicht an einer »Erbkrankheit« zu leiden – bei dem Betroffenen.63
Sofern ein Beschluss, wie das Urteil des Erbgesundheitsgerichts im Sprachgebrauch der damaligen Zeit genannt wurde, zur Unfruchtbarmachung ergangen war, trat erneut das Gesundheitsamt in Aktion. Der Amtsarzt forderte den Betroffenen auf, sich binnen 14 Tagen in einem bestimmten, vom Gesundheitsamt festgelegten Krankenhaus zur Durchführung der Unfruchtbarmachung einzufinden. Die Kosten für den ärztlichen Eingriff übernahm entweder die Krankenkasse des Sterilisanden oder, im Fall seiner Bedürftigkeit, die Fürsorge. Wer versuchte, sich der angeordneten Unfruchtbarmachung zu entziehen, in dem er sich beispielsweise nicht zum angeordneten Zeitpunkt in einer der zugewiesenen Klinik einfand, musste mit Zwangsmaßnahmen bis hin zur polizeilichen Vorführung rechnen.64
Es bestand allerdings auch die Möglichkeit, sowohl gegen die Antragstellung als auch gegen den Beschluss des Erbgesundheitsgerichts Beschwerde einzulegen. Von diesem Recht Gebrauch machen konnte sowohl der Betroffene selbst als auch sein gesetzlicher Vertreter oder ein Angehöriger und auch der Amtsarzt. Bei einer Beschwerde gegen den Beschluss des Erbgesundheitsgerichts, fiel das Verfahren in die Zuständigkeit der Erbgesundheitsobergerichte (EOG), einer den Erbgesundheitsgerichten übergeordnete und an einem Oberlandesgericht angesiedelten Instanz.65
Das EOG bestand aus »einem Mitglied des Oberlandesgerichts« als Vorsitzenden, »einem beamteten Arzt und einem weiteren für das Deutsche Reich approbierten Arzt, der mit der Erbgesundheitslehre besonders vertraut« war.66 Sie wurden – anders als beim Erbgesundheitsgericht, für dessen Besetzung der Landgerichtspräsident verantwortlich zeichnete – vom Präsidenten des Oberlandesgerichts für mindestens ein Geschäftsjahr bestellt.67 Das Verfahren des Erbgesundheitsobergerichts unterschied sich nur insofern von dem des Erbgesundheitsgerichts, als die Entscheidung des Erbgesundheitsobergerichts endgültig war.68 Eine weitere Beschwerdemöglichkeit gab es demnach nicht bzw. sie hatte keine Gültigkeit mehr.
Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens trug im Übrigen die Staatskasse, und zwar unabhängig davon, ob das Erbgesundheitsgericht oder das Erbgesundheitsobergericht angerufen worden war.69 Die scheinbar großzügige Übernahme sowohl der Gerichts- als auch der Krankenhauskosten durch den Staat bzw. die Krankenkassen oder die Fürsorge wurde u. a. damit begründet, dass die Summe der Leistungen, die für einen angeblich Erbkranken im Laufe seines Lebens von der Allgemeinheit erbracht werden müssten, deutlich darüber läge. Damit waren beispielweise Aufenthalte in Heil- und Pflegeanstalten, Krankenanstalten oder auch ärztliche Behandlungen dieser Personengruppe gemeint.70
Um zu vermeiden, dass sowohl die Unklarheiten in Bezug auf die Diagnostik als auch die Details hinsichtlich des Zustandekommens und des Ablaufs der Zwangssterilisationsverfahren zur Kenntnis der Bevölkerung gelangten und möglicherweise kritische Reaktionen hervorriefen, verliefen die Verfahren vor den Erbgesundheits- und den Erbgesundheitsobergerichten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Hinzu kam, dass aufgrund eines Erlasses des Reichsinnenministers vom 31. Mai 1935 alle am Zwangssterilisationsverfahren beteiligten Personen der Schweigepflicht unterlagen. Die offizielle Begründung für die nicht-öffentliche Verhandlung und die Schweigepflicht war jedoch eine andere, vorgeblich zum Schutz der betroffenen Person. Angeblich sollte vermieden werden, dass ihr durch Bekanntwerden ihres Schicksals »in ihrem bürgerlichen Leben« Nachteile entstanden.71 Einmal mehr versuchte der NS-Staat also, seine tatsächlichen Absichten sowie seine konkrete Vorgehensweise zu verschleiern, um möglichst ungehindert agieren zu können.
54 Vgl. HHStAW: Erbgesundheitsgericht Wiesbaden (Abt. 473/4), Erbgesundheitsgericht Frankfurt/Main (Abt. 473/1), Erbgesundheitsgericht Limburg/Lahn (Abt. 473/3), sonstige Erbgesundheitsgerichte (Abt. 473/5), Preußisches Landratsamt des Rheingaukreises (Rüdesheim) (Abt. 415), Heil- und Pflegeanstalt Eichberg (Abt. 430/1), Oberlandesgericht Frankfurt/Main (Abt. 458, Abt. 458 Zugang 94/2014 (Erbgesundheitsobergericht)), Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Wiesbaden (Abt. 468), Amtsgericht Wiesbaden (Abt. 469/33), Hessisches Landratsamt Gelnhausen (Abt. 653), Hessisches Landratsamt des Obertaunuskreises (Abt. 658), Hessisches Landratsamt des Rheingau-Taunus-Kreises (Abt. 659), Regierungspräsidien als Entschädigungsbehörde (Abt. 518), Gestapo-Kartei Frankfurt/Main. Vgl. HStAD: Abt. G 29 U Erbgesundheitsgerichte. Vgl. HStAM: Best. 279 Erbgesundheitsgerichte Hanau, Kassel, Marburg. Vgl. StAW: Akten und Amtsbücher 1866–1945 (Wi/2: insbesondere Wi/2 Nr. 4907: Durchführung des Erbgesundheitsgesetzes, Sterilisationen; Wi/2 Nr. 4538– 4665: Patientenakten der Medizinischen Klinik) sowie Akten und Amtsbücher seit 1945 (Wi/3 Nr. 7310–7355. Hier insbesondere Nr. 7334). Vgl. HHStAW: Exemplarische Beispiele zur Verschiebung des Eingriffstermins: Abt. 473/4 Nr. 312, 483, 701, 936, 843 und Abt. 458 Zugang 94/2014 (Erbgesundheitsobergericht). Vgl. Hennig, Jessika. S. 102. Vgl. Daum, Monika/Deppe, Hans- Ulrich. S. 115. Vgl. Ley, Astrid: Ärzteschaft. S. 67–99. Vgl. Braß, Christoph. S. 11–29.
55 Vgl. Gütt, Arthur/Rüdin, Ernst/Ruttke, Falk: Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 mit Auszug aus dem Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24. November 1933. München 1934 (Lehmann). S. 64 und S. 140 (im Folgenden Gütt, Arthur/ Rüdin, Ernst/Ruttke, Falk: Gesetz und Erläuterungen). Vgl. Gütt, Arthur: Verhütung krankhafter Erbanlagen. S. 24. Vgl. Erbacher, Angela/Höroldt, Ulrike: »Die Unfruchtbarmachung des/r … wird angeordnet«. Erbgesundheitsgerichtsbarkeit auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz. In: Meyer, Hans-Georg/Berkessel, Hans (Hg.): »Eine nationalsozialistische Revolution ist eine gründliche Angelegenheit.« Die Zeit des Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz. Bd.1. Mainz 2000 (Hermann Schmidt). S. 311–322. Hier 315 (im Folgenden Erbacher, Angela/Höroldt, Ulrike). Vgl. Nitschke, Asmus: Die »Erbpolizei« im Nationalsozialismus. Zur Alltagsgeschichte der Gesundheitsämter im Dritten Reich. Wiesbaden 1999 (Westdeutscher Verlag). S. 109 (im Folgenden Nitschke, Asmus). Vgl. Schmuhl, Hans-Walther: Rassenhygiene. S. 145. Vgl. Hofmann-Mildebrath, Brigitte. S. 107. Vgl. Vossen, Johannes: Erfassen. S. 87. Vgl. Bock, Gisela: Nationalsozialistische Sterilisationspolitik. S. 86. Vgl. Hennig, Jessika. S. 105. Vgl. Ruckert, Frederic. S. 26. Vgl. Ley, Astrid: Ärzteschaft. S. 69–70. Vgl. Braß, Christoph. S. 11.
56 Vgl. Gütt, Arthur/Rüdin, Ernst/Ruttke, Falk: Gesetz und Erläuterungen. S. 66. Vgl. Koch, Thomas. S. 58. Vgl. Jakobi, Helga/Chroust, Peter/Hamann, Matthias. S. 16. Vgl. Hofmann-Mildebrath, Brigitte.S. 118.
57





























