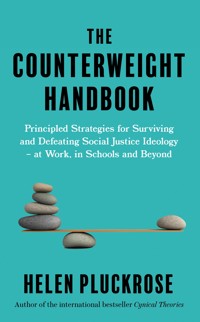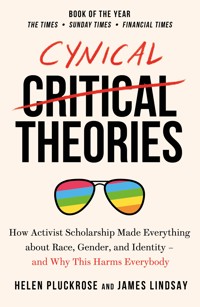16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nur weiße Menschen können Rassisten sein, nur Männer sind zu toxischem Verhalten fähig, es gibt kein biologisches Geschlecht, unsere Sprache ist sexistisch – ein neuer moralischer Kanon erobert westliche Universitäten und erschüttert die liberale Gesellschaft. Aber macht er die Welt auch wirklich besser? Helen Pluckrose und James Lindsay begeben sich in ihrem Bestseller auf die Spuren eines wissenschaftlichen Aktivismus, der überall nur noch Feinde sieht. Postmoderne Denker wie Michel Foucault oder Jacques Derrida haben die Strukturen westlicher Gesellschaften so tiefgreifend dekonstruiert wie niemand vor ihnen. Ihr radikaler Skeptizismus hatte jedoch einen Preis. Helen Pluckrose und James Lindsay zeichnen in ihrem kontroversen Buch nach, wie die Grundannahmen der postmodernen Theorie seit den 1980er Jahren im Postkolonialismus, in der Critical-Race-Theorie, im intersektionalen Feminismus, in den Gender Studies und in der Queer-Theorie für den politischen Aktivismus scharf gemacht wurden. Ihr zentraler Befund lautet, dass ein freier Austausch wissenschaftlicher Argumente durch den aus diesen Reihen immer aggressiver vorgetragenen Anspruch auf Deutungshoheit zunehmend unmöglich wird. Damit erweisen der neue wissenschaftliche Aktivismus und seine Wächter den Minderheiten, für die sie sich angeblich einsetzen, jedoch einen Bärendienst: Drängende soziale Probleme werden von einer völlig überzogenen Sprachkritik und Cancel Culture überlagert – und potenziell wohlmeinende Unterstützer ziehen sich entnervt zurück, weil sie im erhitzten Diskursklima vorschnell dem reaktionären Lager zugeschlagen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Helen Pluckrose James Lindsay
ZYNISCHE THEORIEN
Wie aktivistische Wissenschaft Race, Gender und Identität über alles stellt – und warum das niemandem nützt
Aus dem Englischen übersetzt von Sabine Reinhardus und Helmut Dierlamm
C.H.Beck
Zum Buch
Postmoderne Denker wie Michel Foucault oder Jacques Derrida haben die Strukturen westlicher Gesellschaften so tiefgreifend dekonstruiert wie niemand vor ihnen. Ihr radikaler Skeptizismus hatte jedoch einen Preis. Helen Pluckrose und James Lindsay zeichnen in ihrem kontroversen Buch nach, wie die Grundannahmen der postmodernen Theorie seit den 1980er Jahren im Postkolonialismus, in der Critical-Race-Theorie, im intersektionalen Feminismus, in den Gender Studies und in der Queer-Theorie für den politischen Aktivismus scharfgemacht wurden. Ihr zentraler Befund lautet, dass ein freier Austausch wissenschaftlicher Argumente durch den aus diesen Reihen immer aggressiver vorgetragenen Anspruch auf Deutungshoheit zunehmend unmöglich wird. Damit erweisen der neue wissenschaftliche Aktivismus und seine Wächter den Minderheiten, für die sie sich angeblich einsetzen, jedoch einen Bärendienst: Drängende soziale Probleme werden von einer völlig überzogenen Sprachkritik und Cancel Culture überlagert – und potenziell wohlmeinende Unterstützer ziehen sich entnervt zurück, weil sie im erhitzten Diskursklima vorschnell dem reaktionären Lager zugeschlagen werden.
Über die Autoren
Helen Pluckrose ist liberale Publizistin, Gründerin der Plattform «Counterweight» und ehemalige Chefredakteurin des «Areo Magazine». Sie hat zahlreiche Essays über die Postmoderne, den Liberalismus, Säkularismus und den Feminismus verfasst. Pluckrose lebt in London, England.
James Lindsay ist Mathematiker und Buchautor. Seine Essays sind in zahlreichen Zeitungen und Magazinen erschienen, darunter das Wall Street Journal, die Los Angeles Times und Time. Lindsay lebt in Tennessee, USA.
Inhalt
Einführung
1 Postmodernismus
Eine Revolution des Wissens und der Macht
Wurzeln, Prinzipien und Themen des Postmodernismus
Zwei Prinzipien und vier Themen
Das postmoderne Wissensprinzip
Das politische Prinzip der Postmoderne
1. Das Verwischen von Grenzen
2. Die Macht der Sprache
3. Kultureller Relativismus
4. Die Verabschiedung von Begriffen des Individuellen und des Universellen zugunsten von Gruppenidentitäten
Ist der Postmodernismus denn nicht tot?
2 Die Wende zum angewandten Postmodernismus
Repression sichtbar machen
Die Mutation der Theorie
Der neue Standard
Das Nichtanwendbare anwenden
Postmoderne Prinzipien und Themen in der Anwendung
Das Aufkommen der Social-Justice-Wissenschaft
3 Postkoloniale Theorie
Den Westen dekonstruieren, um das Andere zu retten
Der Postkolonialismus als Projekt des angewandten Postmodernismus
Ein Vergleich der Geisteshaltungen
Alles dekolonisieren
Wie man Forschungsgerechtigkeit erreicht
Die Aufrechterhaltung des Problems in reaktionärem Gewand
Eine gefährliche, bevormundende Theorie
4 Queer-Theorie
Die Freiheit vom Normalen
Eine kurze Geschichte der Queer-Theorie
Queer als Verb und als Substantiv
Das queere Erbe von Sexualität und Wahrheit
Die drei Patinnen der Queer-Theorie
Die postmodernen Prinzipien und Themen der Queer-Theorie
5 Critical-Race-Theorie und Intersektionalität
Den Rassismus beenden, indem man ihn überall sieht
Ein kritischer Ansatz
Die Ausbreitung der Critical-Race-Theorie
Die Critical-Race-Theorie als angewandter Postmodernismus
Intersektionalität
Die Intersektionalität und die Wende zum angewandten Postmodernismus
Komplex, aber auch schrecklich einfach
Das Kastensystem der Social-Justice-Bewegung
Das Meme der Social Justice
Edle Ziele, schreckliche Mittel
6 Feminismen und Gender Studies
Vereinfachung als Raffinement
Feminismus, damals und heute
Eine «immer raffiniertere» Theorie
Doing Gender Studies
Der Tod des liberalen Feminismus
Irrungen und Wirrungen der Diversitäts-Theorie
Eine klassenblinde Theorie
Von Maskulinitäten und Männern
Zusammenfassung der Verschiebungen
7 Disability Studies und Fat Studies
Identitätstheorie für Selbsthilfegruppen
Disability Studies
Ableismus
Die wohlmeinende Fürsprache führt auf Abwege
Fat Studies
Theorie – Eine paranoide Fantasy-Fabel
Die Selbsthilfegruppe als Forschungsgemeinschaft
8 Social Justice und das Denken
Die Wahrheit der Social Justice
Der Postmodernismus entfaltet sich
Eine Menagerie neuer Begriffe
Du bist, was du weißt
Eine andere Art von Farbenblindheit
Du sollst der Theorie nicht widersprechen
Zusammenfassung – Wie postmoderne Prinzipien und Themen zur Realität werden
9 Social Justice in Aktion
Theorien sehen auf dem Papier immer gut aus
Was geschieht an unseren Universitäten, und warum ist es wichtig?
Auswirkungen auf den Rest der Welt
Verhätschelung und Opferkultur
Die Institutionalisierung von Social Justice: Eine Fallstudie
Auf dem Papier sieht Theorie immer gut aus
10 Eine Alternative zur Social-Justice-Ideologie
Liberalismus ohne Identitätspolitik
Warum freie Debatten so wichtig sind
Die Theorie versteht den Liberalismus nicht
Liberale Wissenschaft
Die Prinzipien und Themen der Social-Justice-Bewegung aus der Sicht des Liberalismus
Das postmoderne Wissensprinzip
Das politische Prinzip des Postmodernismus
Das Verwischen von Grenzen
Der Fokus auf die Macht der Sprache
Kulturrelativismus
Die Verabschiedung des Individuellen und des Universellen
Munition für die Identitätspolitik der extremen Rechten
Eine kurze Diskussion von Lösungen
Ein Fazit und ein Statement
Prinzipieller Widerspruch: Beispiel 1
Prinzipieller Widerspruch: Beispiel 2
Prinzipieller Widerspruch: Beispiel 3
Prinzipieller Widerspruch: Beispiel 4
Danksagung
Ausgewählte Bibliografie
Anmerkungen
Einführung
1 Postmodernismus
2 Die Wende zum angewandten Postmodernismus
3 Postkoloniale Theorie
4 Queer-Theorie
5 Critical-Race-Theorie und Intersektionalität
6 Feminismen und Gender Studies
7 Disability Studies und Fat Studies
8 Social Justice und das Denken
9 Social Justice in Aktion
10 Eine Alternative zur Social-Justice-Ideologie
Einführung
In der Moderne und insbesondere in den vergangenen beiden Jahrhunderten hat sich in den meisten westlichen Ländern ein breiter Konsens zugunsten einer politischen Philosophie, dem sogenannten Liberalismus, entwickelt. Dessen wichtigste Grundsätze bestehen in politischer Demokratie, in der Einhegung und Begrenzung der Regierungsmacht, der Entwicklung universeller Menschenrechte, rechtlicher Gleichheit erwachsener Bürger, Meinungsfreiheit, dem Respekt für die gesellschaftliche Bedeutung von Meinungsvielfalt, offenen Debatten, Evidenz und Vernunft, der Trennung von Kirche und Staat und der Religionsfreiheit. Diese liberalen Werte wurden zu Idealen, und es bedurfte jahrhundertelanger Kämpfe gegen Theokratie, Sklaverei, Patriarchat, Kolonialismus, Faschismus und viele andere Formen der Diskriminierung, um sie in dem Maß wertzuschätzen, wie das heute, wenn auch mit Einschränkungen, der Fall ist. Doch der Kampf um soziale Gerechtigkeit wurde immer dann am wirkungsvollsten geführt, wenn er die universelle Geltung liberaler Werte einklagte; sie sollten auf alle Menschen gleichermaßen angewandt werden, nicht nur auf reiche weiße Männer. Halten wir hier fest, dass philosophische Positionen, die wir als «Liberalismus» bezeichnen, mit einer breit gefächerten Reihe von Positionen in Bezug auf politische, ökonomische und soziale Fragen einhergehen, darunter auch solche, die in Amerika als «liberal» (und in Europa als «sozial-demokratisch») gelten, sowie gemäßigte Formen dessen, was Menschen auf der ganzen Welt unter «konservativ» verstehen. Dieser philosophische Liberalismus ist ein Gegenpol zu autoritären Bewegungen jeglicher Couleur, mögen diese nun links- oder eher rechtsgerichtet sein, eher säkular oder theokratisch. Den Liberalismus stellt man sich daher am besten als gemeinsamen Nenner vor, der uns einen Rahmen für Konfliktlösungen vorgibt und es Menschen mit den unterschiedlichsten Ansichten im Hinblick auf politische, ökonomische und soziale Fragen erlaubt, rationale Debatten über die öffentliche Ordnung zu führen.
Allerdings haben wir mittlerweile einen Punkt in der Geschichte erreicht, an dem Liberalismus und Moderne, als Herzstück der westlichen Zivilisation, in ihren fundamentalen Ideen ernsthaft bedroht sind. Die genaue Natur dieser Bedrohung ist nicht einfach zu durchschauen. Sie entsteht aus mindestens zwei mächtigen Richtungen: einer revolutionären und einer reaktionären, deren Verfechter[1] miteinander ringen, um ihr jeweiliges illiberales Gesellschaftsbild durchzusetzen. Rechtsextreme populistische Bewegungen nehmen für sich in Anspruch, eine letzte Lanze für Liberalismus und Demokratie zu brechen und sich gegen die nahende Flut des Fortschritts und Globalismus zu stemmen, die überall auf der Welt auf dem Vormarsch sei. Zunehmend setzt dieser Abwehrkampf auch auf die Führung von Diktatoren und starken Männern, um «westliche» Souveränität und Werte zu schützen und zu sichern. Unterdessen stellen sich die Kreuzritter aus dem linksgerichteten progressiven Lager als die einzig aufrechten Verfechter des sozialen und moralischen Fortschritts dar, ohne dessen Errungenschaften die Demokratie bedeutungslos bleibe und ausgehöhlt werde. Sie treiben ihre Sache nicht nur durch revolutionäre Zielsetzungen voran, die im offenen Widerspruch zum Liberalismus stehen und diesen als Instrument der Unterdrückung brandmarken, sondern bedienen sich in ihrem Kampf auch zunehmend autoritärer Mittel, indem sie versuchen, eine durch und durch dogmatische, fundamentalistische Ideologie im Hinblick auf die Ordnungsprinzipien unserer Gesellschaft durchzusetzen. In dieser Schlacht sehen sich beide Lager jeweils als den Feind schlechthin und stacheln sich zu immer größeren Exzessen an. Der Kulturkrieg, der hier tobt, bestimmt mehr und mehr die Politik und zunehmend auch die Gesellschaft am Anfang des 21. Jahrhunderts.
Obwohl die politische Rechte durchaus ein ernstes Problem ist und gewiss einer sorgfältigen Analyse bedarf, haben wir uns eine gewisse Expertise angeeignet, was das Problem der politischen Linken betrifft. Während sich beide Seiten immer stärker radikalisieren, liegt das spezifische Problem der politischen Linken aus unserer Sicht darin, dass diese sich von ihrem historischen Ursprung, dem Liberalismus, abwendet, der einst ihre Vernunft und Stärke begründete. Genau dieser Liberalismus ist jedoch entscheidend, um den Fortbestand unserer säkularen und liberalen Demokratie künftig zu gewährleisten. Wie wir bereits an anderer Stelle beschrieben haben, liegt die Ursache des Problems darin, dass
die progressive Linke sich nicht der Moderne, sondern der Postmoderne zurechnet, welche die objektive Wahrheit als einen fantastischen Traum der naiven und/oder arroganten, bigotten Denker der Aufklärung verwirft, die wiederum die unheilvollen Folgen des Fortschritts innerhalb der Moderne unterschätzten.[2]
Genau damit möchten wir uns in diesem Buch eingehend auseinandersetzen und hoffentlich zu einer Klärung des Problems des Postmodernismus beitragen. Wir wollen das postmoderne Denken nicht nur im Hinblick auf seine in den Sechzigerjahren aufkommende Ursprungsvariante ins Visier nehmen, sondern auch seine Weiterentwicklung in den vergangenen fünfzig Jahren kritisch betrachten. Je nach Blickwinkel hat sich der Postmodernismus entweder zu einer der intolerantesten und autoritärsten Ideologien seit dem großflächigen Niedergang des Kommunismus und dem Zusammenbruch der weißen Vorherrschaft und des Kolonialismus entwickelt oder sie hat einer solchen Ideologie Vorschub geleistet. Der Postmodernismus, ursprünglich eine intellektuelle und kulturelle Reaktion auf diese gesellschaftlichen Veränderungen, entwickelte sich zunächst in den eher abgelegenen Winkeln des akademischen Betriebs. Seit den Sechzigerjahren hat sich diese Denkströmung jedoch auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen ausgebreitet, im politischen Aktivismus, in der Bürokratie, und ist mittlerweile im Schulsystem und allen daran anschließenden Bildungseinrichtungen angekommen. Von dort aus ist sie in breite Gesellschaftsschichten eingesickert, bis zu einem Punkt, an dem der Postmodernismus und ebenso vernünftige wie reaktionäre Gegenpositionen die gesamte soziale und politische Landschaft dominieren, während wir uns mühsam ins dritte Jahrzehnt des neuen Jahrtausends vorarbeiten.
Die sogenannte Social-Justice-Bewegung (in Deutschland eher bekannt unter dem Stichwort der identitätspolitischen Linken; Anm. der Übersetzer) verfolgt nominell ein weit gefasstes Ziel namens «soziale Gerechtigkeit», von dem sich auch ihr Name ableitet. Der Begriff ist beinahe zweihundert Jahre alt. Verschiedene Denker haben ihm zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Bedeutungen verliehen, die jedoch alle in der einen oder anderen Hinsicht über die Gewährleistung rechtlicher Gleichheit hinausreichende Fragen sozialer Ungleichheit aufwerfen und zu lösen versuchen, insbesondere was Klasse, Race[3], Gender, Geschlecht und Sexualität betrifft. Als einer der berühmtesten Vertreter wäre hier vielleicht John Rawls zu nennen, ein liberaler, progressiver Philosoph, der sich hauptsächlich mit den Bedingungen beschäftigt, unter denen eine sozial gerechte Gesellschaft organisiert werden könnte. Dabei spielte er ein universalistisches Gedankenexperiment durch, in dem eine sozial gerechte Gesellschaft eine Gesellschaft wäre, der jedes Individuum, unter Absehung von seiner sozialen Herkunft vor die Wahl gestellt, zustimmen könnte.[4] Ein anderer, explizit anti-liberaler und anti-universalistischer Ansatz, der ebenfalls das Ziel verfolgt, soziale Gerechtigkeit zu erreichen, wurde insbesondere seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts gleichermaßen populär. Dieser Ansatz geht auf die kritische Theorie[5] zurück. Kritische Theorie bzw. Ideologiekritik setzt sich hauptsächlich damit auseinander, versteckte Vorurteile und nicht überprüfte Annahmen im herrschenden Denken offenzulegen, meist, indem sie auf das sogenannte «Problematische», ja das Falsche hinweist, das mit einer Gesellschaft und dem System, nach dem sie organisiert ist, einhergeht.
In gewisser Hinsicht ist der Postmodernismus ein Ableger der kritischen Theorie und ging zunächst eigene Wege, bis er in den Achtziger- und Neunzigerjahren von Aktivisten für soziale Gerechtigkeit (die sich übrigens kaum je auf John Rawls beziehen) aufgegriffen wurde. Die so entstandene Bewegung bezeichnet ihre Ideologie dreist als «Social Justice», als ob sie allein nach einer gerechteren Gesellschaft strebe, während alle anderen für gänzlich andere Ziele einträten. Die Bewegung ist in den Vereinigten Staaten daher unter dem Begriff «Social Justice Movement» bekannt geworden, firmiert im Netz gelegentlich der Kürze halber unter SocJus oder auch, immer häufiger, als «wokeism» (was die Überzeugung zum Ausdruck bringen soll, dass ausschließlich diese Bewegung uns für soziale Ungerechtigkeit sensibilisiert, dass sie uns «erweckt» habe). Social Justice mit Großbuchstaben bezieht sich daher auf eine hinreichend spezifische und doktrinäre Interpretation des Begriffes «soziale Gerechtigkeit» sowie auf die Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, wobei eine dogmatische und geradezu orthodoxe Terminologie zum Pflichtprogramm gehört. Obwohl wir dieser illiberalen und ideologischen Bewegung nur widerstrebend die im Kern liberale Zielbestimmung der sozialen Gerechtigkeit überlassen möchten, ist sie unter diesem Namen bekannt und wird aus Gründen der Klarheit in diesem Buch auch als Social Justice benannt. Dagegen verweist der Ausdruck soziale Gerechtigkeit auf die breitere, allgemeine Bedeutung des Begriffs. Und um unsere sozialen und politischen Prioritäten unmissverständlich deutlich zu machen: Wir sind grundsätzlich für soziale Gerechtigkeit, aber gegen Social Justice.
Der zunehmende Einfluss der Social-Justice-Bewegung auf die Gesellschaft ist mittlerweile unübersehbar, besonders hervorzuheben sind hierbei «Identitätspolitik» und «politische Korrektheit». Beinahe jeden Tag lesen wir von jemandem, der entlassen, «gecancelt» oder in den sozialen Medien gemobbt wurde, weil er oder sie etwas gesagt oder getan hat, das als sexistisch, rassistisch oder homophob interpretiert werden könnte. Manchmal sind die Anschuldigungen begründet und wir können uns mit dem Gedanken beruhigen, dass ein Fanatiker zu Recht für seine oder ihre hasserfüllten Äußerungen «zensiert» wurde. Andererseits lässt sich mit zunehmender Häufigkeit feststellen, dass die Vorwürfe auf sehr freien Auslegungen und fragwürdigen Begründungen beruhen. Mitunter hat man den Eindruck, sogar Menschen mit den besten Absichten und auch jene, die Freiheit und Gleichheit wertschätzen, könnten versehentlich etwas äußern, das dem neuen Sprach-Code zuwiderläuft und verheerende Folgen für Karriere und Ruf nach sich zieht. Das ist verwirrend und widerspricht einer Kultur, die doch die Würde des Menschen an erste Stelle setzt und Meinungsvielfalt toleriert. Wenn verdiente Leute sich selbst zensieren, um nichts «Falsches» zu sagen, hat das, im besten Fall, einen Abschreckungseffekt auf die Kultur der freien Meinungsäußerung, von der liberale Demokratien in den vergangenen zweihundert Jahren in hohem Maße profitiert haben. Schlimmstenfalls ist es ein Fall von bösartigem Mobbing und kommt – institutionalisiert – einer Art Autoritarismus in der Mitte unserer Gesellschaft gleich.
Diese Tendenz verdient eine Erklärung oder verlangt genauer gesagt danach, denn derartige gesellschaftliche Veränderungen, die sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit vollziehen, sind schwer zu begreifen. Das liegt daran, dass sie auf eine sehr spezifische Sicht der Welt zurückgehen, die sich obendrein sogar einer eigenen Sprache bedient. Innerhalb der angelsächsischen Welt ist das zwar das Englische, doch die Wörter des täglichen Gebrauchs erfahren dabei eine Umdeutung. Wenn beispielsweise von «Rassismus» gesprochen wird, bezieht sich das Wort nicht auf rassistische Vorurteile, sondern vielmehr, nach Definition der Social-Justice-Bewegung, auf ein grundlegend rassistisches System, das die gesamte Gesellschaft durchzieht und weitgehend unsichtbar und unbemerkt bleibt; es kann nur von denjenigen erkannt werden, die Rassismus selbst erfahren oder die richtigen «kritischen» Methoden erlernt haben, mit deren Hilfe sich dieser allgegenwärtige, versteckte Rassismus aufspüren lässt. (Dabei handelt es sich um Menschen, die in dieser Hinsicht als «woke» bezeichnet werden.) Dieser sehr präzise, technische Gebrauch des Wortes «Rassismus» führt viele Menschen in die Irre.
Diese akademischen Aktivisten bedienen sich nicht nur einer spezifischen Sprache – umgedeutete Wörter des alltäglichen Gebrauchs, von denen Menschen fälschlicherweise annehmen, sie verstünden sie –, sondern repräsentieren auch eine Kultur, die sich von unserer vollständig unterscheidet und zugleich in sie eingebettet ist. Menschen, die aktivistische Ansichten vertreten, mögen uns physisch nahe sein, sind aber, in intellektueller Hinsicht, Welten von uns entfernt; sie zu verstehen und mit ihnen zu kommunizieren, ist unglaublich schwierig. Sie sind besessen von einem Geflecht aus Macht, Sprache und Wissen. Sie nehmen die Welt durch eine Brille wahr, die jede Interaktion, jede Äußerung, jedes kulturelle Artefakt nur als Ausdruck einer Machtdynamik erkennen lässt, selbst wenn diese nicht offensichtlich oder nicht einmal real ist. Diese Weltanschauung ist auf soziale und kulturelle Missstände fixiert und zielt darauf ab, alles auf ein Nullsummenspiel des politischen Kampfes zu reduzieren, der sich ausschließlich um Identitätsmarker wie Race, Geschlecht, Gender, sexuelle Orientierung und viele andere dreht. Ein Außenstehender hat schnell den Eindruck, er habe es mit einer Kultur von einem anderen Planeten zu tun, dessen Bewohner keinerlei Kenntnisse über sich sexuell reproduzierende Spezies besitzen und infolgedessen alle menschlichen und sozialen Interaktionen auf die denkbar zynischste Art auslegen. Tatsächlich sind derart absurd erscheinende Verhaltensweisen jedoch nur allzu menschlich. Sie bezeugen unsere wieder und wieder unter Beweis gestellte Fähigkeit, uns komplexe spirituelle Weltanschauungen anzueignen, deren Bandbreite von animistischen Stammesreligionen und dem Spiritualismus der Hippie-Bewegung bis hin zu ausdifferenzierten Weltreligionen reicht. Jede einzelne nimmt die Welt durch einen eigenen Bezugsrahmen wahr und legt sie entsprechend aus. Bei der Weltanschauung, die uns hier beschäftigt, handelt es sich eben nur um eine sehr spezifische Sicht auf bestimmte Machtformen und deren Vermögen, Ungleichheit und Unterdrückung hervorzubringen.
Wer den Austausch mit Anhängern dieser Sichtweise sucht, muss dafür im Werkzeugkasten nicht nur deren Sprachgebrauch parat haben – und allein das stellt schon eine ziemliche Herausforderung dar –, sondern sollte auch über ihre Sitten und ihre Mythologie Bescheid wissen, wenn sie gegen die «systemischen» und «strukturellen» Probleme kämpfen, die unserer Gesellschaft, unseren Gesellschaftssystemen und Institutionen innewohnen. Wie jeder erfahrene Reisende weiß, reichen Sprachkenntnisse allein für die Kommunikation mit einer vollkommen andersartigen Kultur nicht aus. Man sollte außerdem typische Redewendungen, unterschwellige Bedeutungen, kulturelle Referenzen und Umgangsformen kennen. Nicht selten benötigen wir dabei die Hilfe einer Person, die nicht nur als Übersetzer fungiert, sondern als Dolmetscher im weitesten Sinn: als Bote zwischen den Welten, der sich mit den Sitten hüben wie drüben gleichermaßen gut auskennt – und genau diese Absicht verfolgen wir mit diesem Buch. Es soll als Führer dienen und uns mit Sprache und Gebräuchen eines derzeit unter dem freundlichen Begriff «Social Justice» subsumierten Phänomens bekannt machen. Wir sehen uns hier als die Vermittler zwischen den Welten, die in Sprache und Kultur der Social-Justice-Forschung und des dazugehörigen Aktivismus bewandert sind. Wir möchten unsere Leser auf eine Reise in diese außerirdische Welt mitnehmen. Und wir möchten die Entwicklung der Ideen, die sie geprägt hat, von ihren Ursprüngen vor rund fünfzig Jahren bis in die heutige Zeit hinein verfolgen.
Unsere Schilderung setzt in den Sechzigerjahren ein, als eine Reihe theoretischer Konzepte sich mit Themen wie Wissen, Macht und Sprache zu beschäftigen begann. Diese Konzepte tauchten in unterschiedlichen geisteswissenschaftlichen Disziplinen auf und wurden später unter dem Begriff Postmodernismus bekannt. Im Kern verwarf der Postmodernismus alles, was er als Metanarrative bezeichnete – also breite, zusammenhängende Erklärungen von Welt und Gesellschaft. Der Postmodernismus verwarf das Christentum und den Marxismus. Und er verwarf die Wissenschaft, die Vernunft und das Erbe der Aufklärung, die Säulen der westlichen Demokratie. Postmoderne Ideen mündeten in das, was seither meist als Theorie[6] («Theory») bezeichnet wird – und das ist gewissermaßen der Hauptgegenstand dieses Buches. Unserer Ansicht nach ist es entscheidend, die Entwicklung der Theorie von den Sechzigerjahren bis in die Gegenwart zu verstehen, wenn wir die raschen Veränderungen, die sich seit der Einführung des Begriffs und insbesondere seit 2010 vollzogen haben, verstehen und mit ihnen zurechtkommen wollen. Angemerkt sei hier noch, dass sich in diesem Buch der kursiv geschriebene Begriff Theorie (und verwandte, kursiv geschriebene Wörter wie etwa Theoretiker und theoretisch) durchgängig auf jenen Ansatz der Sozialphilosophie bezieht, der auf den Postmodernismus zurückgeht.
Zynische Theorien erklärt, wie die Theorie zur treibenden Kraft im kulturellen Krieg der späten Zehnerjahre unseres Jahrtausends avancierte – und schlägt zugleich eine liberale philosophische Alternative vor, um dieser Denkströmung in Wissenschaft, Aktivismus und Alltag zu begegnen. Das Buch zeichnet nach, wie sich die einzelnen Zweige einer zynischen postmodernen Theorie in den letzten fünfzig Jahren herausbildeten, und zeigt dabei auf eine für den Leser nachvollziehbare Weise den Einfluss der Theorie auf unsere heutige Gesellschaft auf. In Kapitel 1 führen wir durch die Schlüsselideen der Postmoderne in den Sechziger- und Siebzigerjahren; unser Hauptaugenmerk gilt dabei zwei Prinzipien und vier Themenkomplexen, die auch für die gesamte spätere Theorie von zentraler Bedeutung geblieben sind. Kapitel 2 erklärt, wie diese Ideen sich wandelten, festigten und schließlich in eine Reihe neuer Theorien mündeten, die in den späten Achtziger- und den Neunzigerjahren zur Grundlage politischen Handelns heranreiften – ein Prozess, den wir mit dem Begriff des angewandten Postmodernismus umreißen. In den Kapiteln 3 bis 6 widmen wir uns detailliert folgenden Theorien: dem Postkolonialismus, der Queer-Theorie, der Critical-Race-Theorie und dem intersektionalen Feminismus. In Kapitel 7 werfen wir einen Blick auf die Neuzugänge Disability Studies (Studien zu oder über Behinderung) und Fat Studies.
In Kapitel 8 untersuchen wir die zweite Evolutionsstufe dieser postmodernen Ideen. Sie setzt in den Zehnerjahren ein und postuliert die absolute Wahrheit postmoderner Prinzipien und Themen. Diesen Ansatz bezeichnen wir als verdinglichten Postmodernismus, da mit einem Mal behauptet wird, der Postmodernismus gäbe reale und objektive Wahrheiten wieder – nämlich die Wahrheit nach Lesart der Social Justice. Dieser Paradigmenwechsel fand statt, als Wissenschaftler und Aktivisten die bestehenden Theorien und Studien zu einer einfachen, dogmatischen Methodologie zusammenführten, die unter dem Begriff «Social-Justice-Forschung» am geläufigsten ist.
Ziel dieses Buches ist es, zu erzählen, wie der Postmodernismus seine zynischen Theorien anwandte, um das zu dekonstruieren, was wir als «die alten Religionen» des menschlichen Geistes bezeichnen könnten – ein Begriff, der konventionelle Glaubensrichtungen wie das Christentum und säkulare Ideologien wie den Marxismus und darüber hinaus auch kohäsive moderne Systeme wie die Wissenschaft, den philosophischen Liberalismus und den «Fortschritt» umfasst –, und sie durch eine neue Religion eigener Machart namens «Social Justice» ersetzte. Dieses Buch erzählt davon, wie sich die ursprüngliche Verzweiflung eines Denkens wandelte, das zu neuem Selbstvertrauen fand und schließlich in eine unverrückbare Überzeugung übergegangen ist, der man mit nahezu religiöser Inbrunst anhängt. Dieser Glaube ist absolut postmodern: Statt die Welt mit subtilen geistigen Kräften wie Sünde oder Magie zu erklären, konzentriert er sich auf subtile materielle Kräfte wie etwa schwer auszumachende, aber gleichwohl allgegenwärtige Systeme der Macht und der Privilegien.
Obwohl diese neue Überzeugung signifikante Probleme hervorgebracht hat, ist es andererseits hilfreich, dass die Theorie ihre Ideen und Ziele zunehmend selbstbewusster und klarer vertritt. Das macht es Liberalen – ob liberalkonservativ oder linksliberal – einfacher, sie zu adressieren und ihnen entgegenzutreten. Andererseits ist die Entwicklung auch besorgniserregend, denn die für breitere Kreise verständlicher gewordene Theorie eröffnet jenen Anhängern, die gesellschaftliche Veränderungen anstreben, deutlich mehr Handlungsmöglichkeiten. Das zeigt sich in ihren gegen Wissenschaft und Vernunft gerichteten Angriffen, die nicht ohne Wirkung bleiben. Und es wird ebenso offensichtlich in Behauptungen, die von der simplifizierenden Annahme ausgehen, die Gesellschaft sei in dominante und marginalisierte Identitäten aufgeteilt und ihr lägen unsichtbare Systeme zugrunde, wie etwa die weiße Vorherrschaft, das Patriarchat, heteronormative Geschlechtsmodelle, Cis-Geschlechtlichkeit, Behindertenfeindlichkeit und Fett-Phobie. Wir sehen uns mit einer zunehmenden Demontage von basalen Unterscheidungen wie Wissen und Überzeugung, Vernunft und Gefühl, Mann und Frau konfrontiert und dem steigenden Druck ausgesetzt, unsere Sprache zu zensieren und in Übereinstimmung mit der Wahrheit der Social Justice zu formulieren. Wir werden mit radikalem Relativismus in Form von Doppelmoral konfrontiert, etwa der Überzeugung, dass sich ausschließlich Männer sexistisch verhalten und nur Weiße rassistisch sind, oder der pauschalen Ablehnung einheitlicher Nichtdiskriminierungsprinzipien. Es wird daher immer schwieriger oder sogar gefährlich, zu argumentieren, jeder Mensch solle als Individuum behandelt werden, oder angesichts einer spaltenden und verengten Identitätspolitik auf die Anerkennung unseres gemeinsamen Menschseins zu drängen.
Obwohl viele von uns diese Probleme erkennen und intuitiv spüren, wie unvernünftig und intolerant solche Ideen sind, kann es dennoch schwierig sein, angemessen darauf zu reagieren. Denn alle Einwände werden häufig und fälschlicherweise als Widerstand gegen echte soziale Gerechtigkeit – ein legitimes Anliegen, das eine gerechte Gesellschaft anstrebt – dargestellt. Verständlicherweise schreckt das viele Menschen mit guten Absichten davon ab, sich überhaupt zu äußern. Und wer die Methoden der Social-Justice-Bewegung kritisiert, muss nicht nur fürchten, als Feind sozialer Gerechtigkeit gebrandmarkt zu werden. Eine echte Auseinandersetzung wird noch von zwei weiteren Stolpersteinen erschwert. Zum einen ist der Wertekanon der Social-Justice-Bewegung kontraintuitiv und nur schwer zu verstehen. Zum anderen ist es ein Novum, wenn wir liberale Ethik, Vernunft und evidenzbasierte Erkenntnisse plötzlich denen gegenüber verteidigen müssen, die doch für sich in Anspruch nehmen, für soziale Gerechtigkeit einzutreten. Bis vor kurzem galt es schließlich als ausgemacht, dass ebendiese liberalen Werte in hohem Maße zu sozialer Gerechtigkeit beitragen können. Nachdem wir die Prinzipien, die der Social-Justice-Theorie zugrunde liegen, verdeutlicht haben, diskutieren wir, wie man sie erkennt und welche Argumente man gegen sie vorbringen kann. In Kapitel 9 untersuchen wir, auf welche Weise die Ideen den Weg aus den Universitäten herausgefunden haben und in der Lebenswelt wirksam geworden sind. In Kapitel 10 werden wir dafür plädieren, diesen Ideen durch ein entschlossenes und breites Bekenntnis zu universalen, liberalen Prinzipien und strenger, wissenschaftlicher Forschung entgegenzutreten. Und mit ein bisschen Glück werden wir in den letzten beiden Kapiteln aufzeigen, wie der Schlussakt in der Geschichte der Theorie geschrieben werden kann – der zu ihrem hoffentlich stillen und unrühmlichen Ende führen wird.
Das Buch richtet sich in erster Linie an den Laien ohne wissenschaftlichen Hintergrund und an alle, die den Einfluss der Social-Justice-Bewegung auf die Gesellschaft wahrnehmen und verstehen möchten, was dahintersteckt und wie er funktioniert. Es ist für Liberale gedacht, die eine gerechte Gesellschaft wichtig finden, die unweigerlich erkannt haben, dass die Social-Justice-Bewegung nicht zu diesem Ziel beiträgt, und die mit einer liberalen, schlüssigen und integren Antwort gegensteuern wollen. Zynische Theorien wendet sich an die Anhänger der Meinungsfreiheit, die es uns erlaubt, Ideen zu überprüfen, sie zu diskutieren und die Gesellschaft dadurch voranzubringen, und an all jene, die in der Lage sein möchten, sich mit tieferliegenden Vorstellungen der Social-Justice-Bewegung auseinanderzusetzen.
Das Buch zielt nicht darauf ab, den liberalen Feminismus, den liberalen Aktivismus gegen Rassismus oder liberale Kampagnen für die Gleichberechtigung von LGBT zu untergraben. Ganz im Gegenteil: Zynische Theorien ist entstanden, weil wir uns zu Gender-, Race- und LGBT-Gleichberechtigung bekennen und beunruhigt sind, deren Wert und Wichtigkeit könnten durch den Ansatz der Social-Justice-Bewegung ausgehöhlt werden. Das Buch ist auch kein Angriff auf Forschung oder Universität im Allgemeinen. Wir verteidigen hier die strenge, evidenzbasierte wissenschaftliche Lehre und die Universität als ein Wissenszentrum, das sich gegen anti-empirische, anti-rationale und anti-liberale Strömungen der Linken zur Wehr setzt, die ihrerseits wiederum anti-intellektuelle, gegen Gleichheit gerichtete anti-liberale Strömungen der Rechten anzutreiben drohen.
Letztlich will das Buch eine liberale Kritik an der Social-Justice-Bewegung vorstellen und argumentiert, dass der ihr zugrunde liegende wissenschaftliche Aktivismus weder soziale Gerechtigkeit noch die Gleichheit innerhalb der Gesellschaft fördert. Gewiss werden sich einige Wissenschaftler in dem Feld, das wir kritisieren, abfällig über unsere Ziele äußern und behaupten, wir seien in Wahrheit Rechte, die wissenschaftliche Erkenntnisse über gesellschaftliche Ungleichheit in marginalisierten Gruppen torpedierten. Diese Sicht auf unsere Beweggründe lässt sich jedoch bei ehrlicher Lektüre unseres Buches nicht aufrechterhalten. Andere Wissenschaftler innerhalb der Bewegung werden unsere liberale, empirische und rationale Haltung zwar anerkennen, sie jedoch als eine modernistische Illusion verwerfen, die auf weiße, männliche, westliche und heterosexuelle Wissenskonstruktionen ausgerichtet ist und somit einen ungerechten Status quo aufrechterhält, indem sie die Gesellschaft auf naive Weise schrittweise zu verbessern versucht. «Du kannst das Haus des Herren nicht mit den Werkzeugen des Herren abreißen»,[7] werden sie sagen. Ihnen gegenüber sei hier eingeräumt, dass wir die liberale Gesellschaft und empirische rationale Wissenskonzepte tatsächlich nicht abzuschaffen gedenken, sondern vielmehr auf ihren bemerkenswerten Fortschritten in puncto soziale Gerechtigkeit aufbauen möchten. Das Haus ist solide gebaut, das Problem besteht eher im begrenzten Zugang zu diesem Haus. Und gerade der Liberalismus ist in der Lage, die Zugangsbarrieren zu diesem soliden Gebilde abzubauen, das jedem Schutz zu bieten und jede zu stärken vermag. Gleicher Zugang für alle zu einem Schutthaufen halten wir für kein erstrebenswertes Ziel. Zu guter Letzt werden noch einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus dem kritisierten Lager unserer Kritik an der Social-Justice-Forschung etwas abgewinnen können und in eine förderliche Diskussion mit uns eintreten. Auf diesen Austausch freuen wir uns schon jetzt, ebenso wie auf alle Auseinandersetzungen, die uns zu produktiven und vielseitigen Gesprächen über soziale Gerechtigkeit zurückführen.
1 Postmodernismus
Eine Revolution des Wissens und der Macht
In den Sechzigerjahren kam es zu einer umwälzenden Veränderung in der Geistesgeschichte. Diese Veränderung wird mit einer Reihe von französischen Theoretikern in Verbindung gebracht, deren Namen, selbst wenn sie vielleicht nicht allgemein bekannt sein mögen, durchaus einem breiteren Publikum etwas sagen, wie etwa Michel Foucault, Jacques Derrida und Jean-François Lyotard. Mit einer radikalen, neuen Konzeption der Welt und unserer Beziehung zu ihr revolutionierten sie die Sozialphilosophie und womöglich auch alles andere Soziale. Im Lauf der Jahrzehnte hat diese Denkrichtung nicht nur grundlegend verändert, was und wie wir denken, sondern auch wie wir über das Denken selbst denken. Esoterisch, akademisch und anscheinend völlig entrückt vom alltäglichen Leben hat diese Revolution dennoch tiefgreifenden Einfluss darauf ausgeübt, wie wir mit der Welt und miteinander interagieren. Der Kern der Denkrichtung ist eine radikale Weltsicht, die als Postmodernismus bekannt wurde.
Eine Definition des Postmodernismus ist ein schwieriges Unterfangen, vielleicht weil er bewusst so angelegt ist. Im Wesentlichen stellt er eine Sammlung von Ideen und Denkweisen dar, die als Reaktion auf einen spezifischen historischen Kontext zu sehen sind; dazu gehören die kulturellen Auswirkungen der beiden Weltkriege und deren Ausgang, die weitgehende Ernüchterung in Bezug auf den Marxismus, die schwindende Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft religiöser Glaubensrichtungen im postindustriellen Zeitalter sowie der rasante technologische Fortschritt. Wahrscheinlich ist es am sinnvollsten, die Postmoderne bzw. den Postmodernismus als Ablehnung von Modernismus und Moderne zu verstehen: Modernismus als jene intellektuelle Bewegung, die das ausgehende 19. und das 20. Jahrhundert bis in die Fünfzigerjahre prägte, und die Moderne als eine vom Ende des Mittelalters bis (wahrscheinlich) in unsere heutige Zeit hineinreichende Epoche. Der neue radikale Skeptizismus gegenüber der Möglichkeit, objektives Wissen zu erlangen, hat seit den Sechzigerjahren aus den Universitäten heraus an Einfluss gewonnen und fordert unser soziales, kulturelles und politisches Denken mit bewusst disruptiven Methoden heraus.
Postmoderne Denker reagierten auf den Modernismus, indem sie bestimmte Grundannahmen des modernen Denkens verwarfen und von anderen behaupteten, sie gingen nicht weit genug. Allen voran wiesen sie das modernistische Bedürfnis nach Authentizität, vereinheitlichenden Narrativen, Universalismus und Fortschrittsglauben zurück, das durch wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologie befeuert wurde. Zugleich trieben sie die gemäßigte, aber gleichwohl pessimistisch getönte modernistische Skepsis gegenüber Tradition, Religion und aufklärerischer Selbstgewissheit – mitsamt deren Selbstbewusstsein, Nihilismus und ironischen Formen der Kritik – auf die Spitze.[1] Der Postmodernismus hat die Struktur unseres Denkens und der Gesellschaft so radikal angezweifelt, dass schließlich eine Art Zynismus daraus wurde.
Auch ist der Postmodernismus eine Reaktion auf die beziehungsweise eine Ablehnung der Moderne, womit «jene tiefgreifende kulturelle Veränderung» gemeint ist, «in deren Folge die repräsentative Demokratie aufkam, das Zeitalter der Wissenschaft anbrach, die Vernunft an die Stelle des Aberglaubens trat und die individuellen Freiheiten verwirklicht wurden, damit jeder nach seinem eigenen Wertekanon leben konnte».[2] Obwohl der Postmodernismus ganz offen die Grundlagen der Moderne verwirft, hat er dennoch tiefgreifenden Einfluss auf das Denken, die Kultur und die Politik der Gesellschaften ausgeübt, die auf eben diesen Errungenschaften der Moderne beruhen. Wie der Literaturwissenschaftler Brian McHale unterstreicht, wurde die Postmoderne zu «der dominierenden kulturellen Strömung (oder vielleicht sollte man hier sicherheitshalber von einer dominierenden Strömung sprechen) in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts in westlichen Industriegesellschaften und verbreitete sich von dort aus allmählich in andere Regionen der Welt».[3]
Seit seinen revolutionären Anfängen hat sich der Postmodernismus in viele verschiedene Formen verzweigt, die den ursprünglichen Prinzipien und Themen jedoch treu geblieben sind und zunehmend Einfluss im Bereich der Kultur, des Aktivismus und der Wissenschaft erlangten, namentlich in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Den Postmodernismus zu verstehen ist daher ein Unterfangen von einiger Dringlichkeit, gerade weil er die Grundlagen, auf denen die heutige hochentwickelte Gesellschaft entstanden ist, ablehnt und folglich potentiell unterhöhlt.
Der Postmodernismus lässt sich nur schwer definieren und bekanntlich noch viel schwieriger zusammenfassen. Er war und ist ein Phänomen mit vielen Facetten und bespielt ein breites intellektuelles, künstlerisches und kulturelles Feld. Damit nicht genug, ist die Abgrenzung der Inhalte, Formen, Zwecke, Werte und Anhänger des Postmodernismus seit jeher umstritten. Das passt im Grunde ganz gut zu einer Strömung, die sich einer pluralistischen, widersprüchlichen und mehrdeutigen Denkweise rühmt, ist andererseits aber wenig hilfreich, wenn man den Postmodernismus oder seine philosophischen und kulturellen Erben zu begreifen versucht.
Diese Definitionsschwierigkeiten beschränken sich nicht nur auf philosophische Fragen, sondern sind auch räumlicher und zeitlicher Natur, weil es sich nie um eine einheitliche Strömung handelte. Die Ursprünge des «Postmodernismus» um 1940 waren zunächst eher in der Kunst angesiedelt, doch in den ausgehenden Sechzigerjahren hatte die Denkströmung weitaus größeren Einfluss auf geistes- und sozialwissenschaftliche Disziplinen, eingeschlossen die Psychoanalyse, Linguistik, Philosophie, Geschichtswissenschaft und Soziologie. In jedem dieser Bereiche nahm der Postmodernismus zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Ausprägungen an. Das hat zur Folge, dass kein postmoderner Gedanke wirklich neu ist, zumal sich schon die ursprünglichen Denker bei ihren Vorläufern aus dem Surrealismus, der antirealistischen Philosophie und der revolutionären Politik bedienen. Zudem stellt sich der Postmodernismus von Nation zu Nation vollkommen anders dar und bezieht eine Vielzahl unterschiedlicher Positionen zu gemeinsamen Themen. So rücken etwa die italienischen Postmodernisten ästhetische Elemente in den Vordergrund und sehen dies als eine Weiterführung der Moderne an, während die amerikanischen Postmodernisten zu schnörkellosen und pragmatischen Ansätzen neigen. Die französischen Postmodernisten konzentrierten sich stärker auf das Gesellschaftliche und brachten in ihrer Kritik der Moderne revolutionäre und dekonstruktive Ansätze ins Spiel.[4] Für uns ist der französische Ansatz von besonderem Interesse, denn es sind vor allen Dingen einige der französischen Ideen, insbesondere was Wissen und Macht betrifft, die sich, über verschiedene Spielarten hinweg, zum zentralen Thema der postmodernen Theorie entwickelt haben. In einfacheren und konkreteren Formen sind diese Ideen in den Social-Justice-Aktivismus eingeflossen, in die Wissenschaft und in das allgemeine soziale Bewusstsein – wobei dies interessanterweise im angelsächsischen Sprachraum erheblich ausgeprägter ist als in Frankreich selbst.
Da wir uns letztlich auf angewandte postmoderne Denkmodelle konzentrieren, die inzwischen sozial und kulturell einflussreich – ja, sogar mächtig – geworden sind, verfolgen wir in diesem Kapitel nicht das Anliegen, das weite Feld der Postmoderne umfassend darzustellen.[5] Wir werden auch nicht die aktuelle Debatte aufgreifen, welcher Denker denn nun zu Recht als «postmodern» gelten darf oder ob «Postmodernismus» überhaupt ein sinnvoller Begriff ist oder ob es nicht besser wäre, Kritiker der Postmoderne von den Poststrukturalisten und der Arbeit derjenigen, die sich vornehmlich mit Methoden der Dekonstruktion befassen, zu trennen. Natürlich müssen bestimmte Unterscheidungen getroffen werden, aber solche Klassifizierungen sind in erster Linie von akademischem Interesse. Stattdessen werden wir einige der Themen beleuchten, die dem Postmodernismus seit langem zugrunde liegen. Mittlerweile haben sie sich zu den Treibern des heutigen Aktivismus entwickelt, üben im Bildungsbereich beträchtlichen Einfluss auf Theorie und Praxis aus und prägen unsere öffentlichen Diskurse. Zu diesem Themenfeld gehören Skepsis in Bezug auf eine objektive Realität, die Wahrnehmung von Sprache als ein Instrument, das Wissen konstruiert, die Konstitutionsbedingungen des Individuums – und die Rolle der Macht bei all diesen Dingen. Genau diese Faktoren sind entscheidend für die «postmoderne Wende», die sich hauptsächlich in den Sechziger- und Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts vollzogen hat. Im Rahmen dieses umfassenden Wandels möchten wir insbesondere erklären, wie diese Ideen populär und durch die Universitäten legitimiert wurden und schließlich ein konzeptuelles Schisma herbeiführten, das vielen unserer zeitgenössischen sozialen, kulturellen und politischen Konfliktlinien zugrunde liegt.
Wurzeln, Prinzipien und Themen des Postmodernismus
Wann genau der Postmodernismus auftauchte, ist strittig, es muss wohl zwischen 1950 und 1970 gewesen sein – je nachdem, ob man sich eher für die künstlerischen oder die sozialen Aspekte interessiert. Die frühesten Veränderungen zeichneten sich in der bildenden Kunst ab, und wir können sie, etwa in der Arbeit des argentinischen Künstlers Jorge Luis Borges, bis in die Vierzigerjahre des 20. Jahrhunderts zurückverfolgen. Für unsere Zwecke sind jedoch die Sechzigerjahre dieses Jahrhunderts entscheidend, denn zu diesem Zeitpunkt betraten französische Sozialtheoretiker wie Michel Foucault, Jacques Derrida und Jean-François Lyotard die Bühne, Architekten einer Bewegung, die im angelsächsischen Raum als «Theory» bekannt werden sollte.
Um 1950 kam es in Europa zu einer Reihe von tiefgreifenden sozialen Veränderungen. Die beiden Weltkriege hatten das Vertrauen der Europäer in den Fortschritt nachhaltig erschüttert und Angst vor der Macht der Technik geschürt. Die intellektuelle Linke in Europa betrachtete den Liberalismus und die westliche Industriegesellschaft mit neuer Skepsis; schließlich hatten sie, nicht zuletzt aufgrund der Stimmen verelendeter Wähler, den Aufstieg des Faschismus zugelassen und damit die verhängnisvolle Entwicklung überhaupt erst eingeleitet. Imperien waren untergegangen, und der Kolonialismus war für die meisten Menschen moralisch kompromittiert. Die Bewohner der ehemaligen Kolonien migrierten in die westlichen Gesellschaften, was linke Intellektuelle dazu veranlasste, ethnischen oder kulturellen Ungleichheiten mehr Aufmerksamkeit zu widmen und sich insbesondere mit Machtstrukturen auseinanderzusetzen, die diese beförderten. Die Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten und Aktivismus im Namen von Frauen und Homosexuellen erhielten mehr und mehr Unterstützung in der Öffentlichkeit, während die Ernüchterung über den orthodoxen Marxismus – bisher der große gemeinsame Nenner der Linken im Kampf für soziale Gerechtigkeit – innerhalb der politischen und kulturellen Linken zunahm. Angesichts der katastrophalen Auswirkungen des Kommunismus, die sich in allen kommunistisch regierten Staaten zeigten, war diese Desillusionierung nur allzu begründet und führte zu einer radikalen Neujustierung der Weltsicht der linken kulturellen Elite. In der Folge geriet auch das Vertrauen in die Wissenschaft, die zu diesem Zeitpunkt noch in jeder Hinsicht im Aufstieg begriffen war, zum ersten Mal ins Wanken; gerade die Wissenschaft hatte ja dazu beigetragen, die zuvor undenkbaren Gräuel des 20. Jahrhunderts überhaupt zu ermöglichen und zu rechtfertigen. Parallel dazu entstanden eine lebendige, aufregende Jugendkultur und mit ihr eine populäre Kultur von enormer Strahlkraft, die der tradierten «Hochkultur» den Kampf ansagte. Auch der technologische Fortschritt entwickelte sich rasant, was im Zusammenspiel mit der Massenproduktion von Konsumgütern nach den Entbehrungen der Kriegs- und der unmittelbaren Nachkriegszeit ein neues, ungebremstes Verlangen nach Kunst, Musik und Unterhaltung auslöste. Diese Entwicklung rief ihrerseits Befürchtungen hervor, die Gesellschaft degeneriere zu einer künstlichen, hedonistischen, kapitalistischen und ausschließlich konsumorientierten Erlebniswelt.
Letzteres schlug sich in jenem weitverbreiteten Pessimismus nieder, der das postmoderne Denken kennzeichnet; es schürte die Angst vor der Hybris des Menschen und beförderte Klagen über den Verlust von Sinnhaftigkeit und Authentizität. Die Verzweiflung war derart heftig, dass man den Postmodernismus beinahe als tiefgreifende kulturelle Vertrauens- und Authentizitätskrise bezeichnen könnte, die mit einem wachsenden Misstrauen in die liberale Sozialordnung Hand in Hand ging. Zunehmende Ängste vor Sinnverlust, ausgelöst durch den rasanten technologischen Fortschritt, sind charakteristisch für diese Zeit.
Der Postmodernismus war besonders skeptisch, was die Wissenschaft und andere kulturell dominante Praktiken betraf, die Behauptungen zu «Wahrheiten» erhoben und diese mit großen, umfassenden Erklärungen legitimierten. Solche Erklärungsmodelle bezeichneten die Theoretiker der Postmoderne als Metanarrative[6] und sahen darin eine Art kultureller Mythen, einen Ausdruck menschlicher Kurzsichtigkeit und Arroganz. Gegenüber diesen Narrativen bezog der Postmodernismus die Position eines radikalen und absoluten Skeptizismus. Diese Skepsis war derart tiefgreifend, dass sie sich besser als eine Spielart des Zynismus im Hinblick auf die Geschichte des menschlichen Fortschritts begreifen lässt, und als solche war sie eine Pervertierung eines bereits seit langem bestehenden kulturellen Skeptizismus. Denn Skepsis in Bezug auf Metanarrative – die allerdings ohne Zynismus auskam – fand sich auch im Denken der Aufklärung und der Moderne und hatte, als der Postmodernismus in den Sechzigerjahren aufkam, in westlichen Gesellschaften bereits seit mehreren Jahrhunderten an Fahrt gewonnen.
In seinen früheren Ausprägungen war ein breiter, aber auf Vernunft beruhender Skeptizismus ein entscheidendes Element innerhalb der Wissenschaft und anderen Formen aufklärerischen Denkens, das sich von den dominanten Großerzählungen der Vergangenheit (meist religiöser Natur) lösen musste. Beispielsweise wurde das Christentum als eine Folge der Reformation im Lauf des 16. Jahrhunderts umgeschrieben (wobei sich die religiöse Gemeinschaft in eine Vielzahl protestantischer Zweige auffächerte, die sowohl gegen die mächtige Orthodoxie als auch gegeneinander kämpften). Schriften, die allmählich gegen Ende des 16. Jahrhunderts erschienen und den Atheismus anprangerten, legen außerdem nahe, dass viele Menschen den Glauben an Gott verloren hatten. Im 17. Jahrhundert kam es zu umwälzenden Entwicklungen in Medizin und Anatomie. Diese Disziplinen, die sich zuvor am Wissen der alten Griechen orientiert hatten, durchliefen nun revolutionäre Umwälzungen und förderten immer schneller neue Erkenntnisse über den menschlichen Körper zutage. Die naturwissenschaftliche Revolution schließlich war das Ergebnis der Infragestellung allgemeingültiger Wahrheiten und der raschen Entwicklung von unterschiedlichsten Arten der Wissensproduktion. Auch der Fortschritt in den wissenschaftlichen Methoden im 19. Jahrhundert beruhte auf Skepsis und der Notwendigkeit von zunehmend strengeren Test- und Falsifizierungsverfahren.
Abgesehen von ihrem zynischen «Skeptizismus» trieb insbesondere die französischen Vertreter der postmodernen Theorie auch die Sorge um, in der modernen Gesellschaft gingen Authentizität und Sinnhaftigkeit unwiederbringlich verloren. Ein Exponent dieser Strömung ist Jean-Louis Baudrillard, dessen nihilistische Verzweiflung über den Verlust des «Wirklichen» sich in weiten Teilen auf das Werk des französischen Psychoanalytikers Jacques Lacan stützt. Baudrillard hielt alle Wirklichkeiten nur noch für Simulationen (Imitate von Phänomenen der realen Welt und ihrer Systeme) und Simulakren («Kopien», von denen kein Original existiert).[7] Baudrillard beschrieb drei Stadien der Simulakren, die er der Vormoderne, der Moderne und der Postmoderne zuordnete. In der Vormoderne – also der Epoche vor dem aufklärerischen Denken, das unsere Beziehung zum Wissen von Grund auf veränderte – existierten ihm zufolge einzigartige Wirklichkeiten, die der Mensch zu imitieren suchte. In der Moderne löste sich diese Verbindung mit der beginnenden Massenproduktion auf, die von jedem Original identische Kopien herstellte. In der Postmoderne, so schloss er, existieren keine Originale mehr, sondern nur noch Simulakren, also bloße Simulationen und Bilder des Realen. Diesen Zustand beschreibt Baudrillard als hyperreal.[8] Hier zeigt sich die Tendenz der postmodernen Theoretiker, die Wurzeln der Sinnhaftigkeit in der Sprache zu suchen und sich übermäßig damit zu beschäftigen, wie Sprache die soziale Realität durch ihre Fähigkeit prägt, Wissen – das, was das Wahre repräsentiert – zu beschränken, zu formen und abzubilden.
Solche Phänomene, die die Authentizität bedrohen, waren auch für eine Reihe weiterer postmoderner Denker von zentraler Bedeutung. So argumentierten die französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari beispielsweise, das Selbst werde durch die kapitalistische Konsumgesellschaft beschränkt.[9] Eine ähnliche Haltung findet sich bei dem amerikanischen Marxisten Frederic Jameson, der insbesondere die Seichtigkeit der postmodernen Gesellschaft beklagte, deren Oberflächlichkeit keine tiefere Sinnhaftigkeit besitze. Wie Baudrillard betrachtete er den postmodernen Status quo als einen der Simulation – alles ist künstlich und besteht nur aus Kopien ohne Original. Typisch für die Verzweiflung des Postmodernismus, diagnostiziert er einen Verfall der Emotion (waning of affect). Jameson zufolge absorbiert die Oberflächenästhetik unsere gesamte Aufmerksamkeit; Distanziertheit und Zerstreuung verhindern, dass der Mensch enge Bindungen eingeht. Noch seine Kritik an der Postmoderne, der er Zynismus vorwirft, folgt demselben Tenor. «Der Tod des Subjektes», wie Jameson es bezeichnet, ist auf den Verlust der Individualität und das mangelnde Vertrauen in ein konsistentes Selbst zurückzuführen. Mit dem Verschwinden des individuellen Subjekts habe das «Pastiche» die Parodie ersetzt: Die Nachahmung verliert im postmodernen Zeitalter des Spätkapitalismus ihren tieferen Zweck, Imitate ohne Original werden in einem unendlichen Prozess ausgeborgt und recycelt. Die Bedürfnisbefriedigung mittels permanent verfügbarer und problemlos zugänglicher Erfahrungen erzeugt eine konstante Erhabenheit (sublime) – eine perpetuelle künstliche Euphorie. Darüber hinaus verursachen die Ziel- und Zwecklosigkeit und die mangelnde Erdung des eigenen Tuns Nostalgie – eine beständige Vergangenheitsorientierung, um die Gegenwart handhabbar zu machen.[10] Halten wir hier fest, dass diese tiefe Hoffnungslosigkeit in der Kritik des postmodernen Zeitalters zunächst eher deskriptiv statt präskriptiv war. Die Arzneien gegen das Übel sollten erst später verordnet werden.
Die rückschrittliche Skepsis in Bezug auf die Moderne, wie sie das postmoderne Denken charakterisiert, äußert sich insbesondere in der Unzufriedenheit mit Technologie und Konsumgesellschaft und der Angst vor beidem. Diese Haltung führte, zumindest in der akademisch fundierten Kulturkritik, zu einem Zustand, den der Philosoph, Soziologe und Kulturkritiker Jean-François Lyotard 1979 unter dem Begriff «la condition postmoderne» zusammenfasste. Er beschrieb ihn als eine tiefgehende Skepsis, was die Möglichkeit jeder sinnstiftenden, übergreifend legitimierenden gesellschaftlichen Struktur betrifft. Der Anthropologe und Geograf David Harvey bezeichnet diese Gemengelage wiederum als «the condition of postmodernity» und erkennt darin das Resultat des «Zusammenbruchs der Aufklärung».[11] Letztlich beziehen sich beide Denker auf ein weitverbreitetes Empfinden, wonach die wissenschaftlichen und moralischen Gewissheiten, die das Denken der Moderne prägten, nicht länger haltbar waren; der damit verbundene Verlust der bevorzugten Analyseinstrumente machte die Situation vollends hoffnungslos. Ihre Beschreibungen des postmodernen Zustands zeichnen das Bild eines radikalen Skeptizismus und tiefgehenden Zynismus, was Sprache, Wissen, Macht und das Individuum betrifft.[12]
Aber was genau ist nun eigentlich der Postmodernismus? In der Encyclopedia Britannica findet sich online die folgende Definition:
Der Postmodernismus ist eine Bewegung des ausgehenden 20. Jahrhunderts, kennzeichnend sind ein tiefgehender Skeptizismus, Subjektivismus oder Relativismus; eine grundsätzliche Infragestellung der Vernunft; und eine besondere Sensibilität hinsichtlich der Rolle, die Ideologie bei der Durchsetzung und Aufrechterhaltung politscher und ökonomischer Macht spielt.[13]
1996 beschreibt Walter Truett Anderson die vier Säulen des Postmodernismus folgendermaßen:
Die soziale Konstruktion des Selbst: Identität wird durch kulturelle Einflüsse konstruiert und ist dem Menschen nicht aufgrund von Traditionen zugeschrieben.
Relativismus der Moral und der moralischen/ethischen Diskurse: Moral ist nicht vorgegeben, sie wird hergestellt. Moral beruht also weder auf kulturellen oder religiösen Traditionen noch kann sie als Mandat des Himmels verstanden werden. Sie wird vielmehr durch Diskurs und Entscheidung konstruiert. Dabei handelt es sich um eine relativistische Position, aber nicht etwa im Sinne einer grundsätzlichen Unvoreingenommenheit, sondern in dem Sinne der Annahme, alle moralischen Haltungen seien sozial konstruierte kulturelle Weltsichten.
Dekonstruktion in Kunst und Kultur: Hier liegt das Augenmerk auf der endlosen, spielerischen Improvisation, dem Durchspielen und Variieren bestimmter Themen und einem kulturellen Mix aus «Hoch- und Massenkultur».
Globalisierung: Grenzen aller Arten sind aus dieser Perspektive nur noch soziale Konstrukte, die überschritten und umgebaut werden können; infolgedessen neigen viele dazu, ihre überlieferten «Stammesregeln» weniger ernst zu nehmen.[14]
Viele Beobachter stimmen darin überein, dass einige spezifische Themen im Zentrum des Postmodernismus stehen, auch wenn postmoderne Theoretiker dieser Ansicht widersprechen mögen. (Diese spezifischen Themen könnte man als Grundannahmen eines «postmodernen Metanarrativs» bezeichnen.) Für Steinar Kvale, Professor für Psychologie und Leiter des Zentrums für qualitative Sozialforschung in Oslo, gehören zu den zentralen Themen der Postmoderne der Zweifel, dass jede von Menschen postulierte Wahrheit eine objektive Repräsentation der Realität darstellt, die Konzentration auf Sprache und auch auf die Art und Weise, wie sie gesellschaftlich verwendet wird, um eine jeweils eigene lokale Realität herzustellen, sowie das Leugnen des Universalen.[15] Daraus, so Kvale, ergebe sich ein zunehmendes Interesse an Narrativen und am Storytelling, und zwar ganz besonders dann, wenn «Wahrheiten» in spezifische kulturelle Konstrukte eingebettet sind; hinzu kommt ein Relativismus, der akzeptiert, dass verschiedene Beschreibungen der Realität nicht endgültig – also: objektiv – aneinander gemessen werden können.[16]
Laut Kvale ist dabei entscheidend, dass die postmoderne Wende zu einer bedeutsamen Verschiebung führte, nämlich weg von der Dichotomie der Moderne, die zwischen dem objektiven Allgemeinen und dem subjektiven Individuellen unterschied, hin zu lokalen Narrativen (und den gelebten Erfahrungen der Erzähler).[17] Anders ausgedrückt: Die Grenze zwischen dem, was objektiv wahr ist, und dem, was subjektiv erfahren wird, ist hinfällig und wird nicht länger akzeptiert. Die Wahrnehmung der Gesellschaft als etwas, das sich aus Individuen zusammensetzt, die auf unverwechselbare Weise mit einer universalen Realität interagieren – eine Wahrnehmung, die den liberalen Prinzipien der individuellen Freiheit, uns allen gemeinsamen Menschlichkeit und Chancengleichheit zugrunde liegt –, wurde ersetzt durch die Idee vielfältiger, vermeintlich ebenso valider Wissensformen und Wahrheiten, die Gruppen mit gemeinsamen Identitätsmarkern – welche sich aus ihrer Stellung innerhalb der Gesellschaft ableiten – konstruieren. Daher sind Wissen, Wahrheit, Sinnhaftigkeit und Moral dem postmodernen Denken zufolge kulturelle Konstrukte und relative Produkte einzelner Kulturen, die jeweils nicht über die notwendigen Werkzeuge oder Begriffe verfügen, um sich gegenseitig zu evaluieren.
Im Kern ist die postmoderne Wende daher sowohl eine Reaktion auf Moderne und Neuzeit als auch eine Absage an beide Epochen.[18] Folgt man dem Denken der Aufklärung, können wir die objektive Realität durch mehr oder weniger verlässliche Methoden erkennen. Dank wissenschaftlicher Methoden erwarben wir Wissen über die objektive Realität, was es uns überhaupt erst erlaubte, in das Zeitalter der Moderne einzutreten und uns weiterhin darin zu bewegen. Die Postmoderne dagegen sieht Realität nur als das Produkt unserer Sozialisation und gelebten Erfahrungen, als ein Konstrukt aus Sprachsystemen.
Der Soziologe Steve Seidman, auf den der Begriff der «postmodernen Wende» zurückgeht, erkannte, wie weitreichend diese Veränderung war. «Ein umfassender sozialer und kultureller Wandel vollzieht sich in westlichen Gesellschaften. Das Konzept der ‹Postmoderne› bildet zumindest einige Aspekte dieser sozialen Veränderungen ab.»[19] Walter Truett Anderson schreibt 1996 prägnanter: «Wir befinden uns inmitten einer gewaltigen, verwirrenden, anstrengenden und äußerst vielversprechenden historischen Übergangszeit, die nicht so sehr mit einer Veränderung dessen zu tun hat, was wir glauben, sondern wie wir glauben… Überall auf der Welt spielt sich dieser Überzeugungswandel ab – oder genauer gesagt, der Wandel unserer Überzeugungen über unsere Überzeugungen.»[20] Seidman und Anderson beschreiben hier epistemologische Veränderungen – also wie wir Wissen erlangen und was wir unter Wissen verstehen. Charakteristisch für die postmoderne Wende ist die Zurückweisung der Werte der Aufklärung, vorzugsweise solcher, die sich auf die Wissensproduktion beziehen und von Postmodernisten mit Macht und Machtmissbrauch in Verbindung gebracht werden. Folglich haben die Postmodernisten ein sehr verkürztes Bild von der Aufklärung, das es erleichtert, sich zynisch über sie zu äußern.[21] Letztlich ist jene Aufklärung, die postmoderne Theoretiker verwerfen, definiert durch ihren Glauben an objektive Erkenntnis, universell gültige Wahrheiten, Wissenschaft (oder, allgemeiner ausgedrückt, Beweise) als Methode, um zu objektiven Erkenntnissen zu kommen, die Macht der Vernunft, die Fähigkeit, mittels Sprache direkt miteinander zu kommunizieren, eine universale menschliche Natur und den Individualismus. Postmoderne Theoretiker verwarfen außerdem den Gedanken, dass westliche Gesellschaften durch die Aufklärung signifikante Fortschritte erzielten und auch weiterhin erzielen werden, wenn sie diese Überzeugungen aufrechterhalten.[22]
Zwei Prinzipien und vier Themen
Mit auffallend unterschiedlichen Ansätzen machten sich postmoderne Denker daran, die Moderne und das aufklärerische Denken abzulehnen, insbesondere im Hinblick auf universal gültige Wahrheiten, objektive Erkenntnisse und Individualität. Einige durchgängige Themenkomplexe lassen sich dennoch erkennen. Die postmoderne Wende beinhaltet zwei untrennbar miteinander verknüpfte Grundprinzipien – eines betrifft das Wissen, das andere Politik –, die als Basis für vier Kernthemen dienen.
Diese Prinzipien sind:
Das postmoderne Wissensprinzip: Radikaler Skeptizismus gegenüber objektivem Wissen oder objektiver Wahrheit und das Bekenntnis zum kulturellen Konstruktivismus.
Das politische Prinzip des Postmodernismus: Die Überzeugung, dass die Gesellschaft auf Machtsystemen und Hierarchien aufgebaut ist, die darüber entscheiden, was als Wissen oder Wahrheit gilt und wie.
Die vier Themen des Postmodernismus sind:
Das Verwischen von Grenzen (und klarer Begrifflichkeit)
Die Macht der Sprache
Kulturrelativismus
Die Ablehnung von Begriffen des Universalen und des Individuellen (zugunsten von Gruppenidentitäten)
Diese zwei Prinzipien und vier Themen ermöglichen es, postmodernes Denken zu erkennen und seine Funktionsweise zu verstehen. Es sind die Kernprinzipien der Theorie, die größtenteils unverändert geblieben sind, selbst wenn sich der Postmodernismus von seinen dekonstruktiven und von Verzweiflung geprägten Anfängen mittlerweile zu einem streitbaren, beinahe religiösen zeitgenössischen Aktivismus entwickelt hat.
Genau diese Entwicklung möchten wir untersuchen: die Entstehung des Postmodernismus im 20. Jahrhundert aus unterschiedlichen Ansätzen der Geisteswissenschaften, insbesondere innerhalb der sogenannten Kulturwissenschaften, und dessen Transformation zu jener postmodernen Social-Justice-Forschung, jenem Aktivismus und jener Kultur, die heute so präsent sind.
Das postmoderne Wissensprinzip
Radikaler Skeptizismus gegenüber objektivem Wissen oder objektiver Wahrheit und ein Bekenntnis zum kulturellen Konstruktivismus
Der Postmodernismus zeichnet sich durch radikalen Skeptizismus in Bezug auf objektive Wahrheit aus. Statt wie im Sinne der Aufklärung und des modernen Wissenschaftsverständnisses objektive Wahrheit als etwas anzuerkennen, das durch fortlaufende Experimente, Verfahren der Falsifizierung oder die Anfechtbarkeit von Ergebnissen vorläufig angenommen werden kann (oder dem man sich dadurch annähert), bläht der postmoderne Ansatz ein winziges, beinahe schon banales Körnchen Wahrheit auf: Da unsere Fähigkeit, etwas zu wissen, begrenzt ist und wir Wissen durch Sprache, Begriffe und Kategorien ausdrücken, wird darauf beharrt, dass alle Wahrheitsbehauptungen nichts anderes sind als mit Werten aufgeladene Kulturkonstrukte. Das nennt sich kultureller Konstruktivismus oder auch sozialer Konstruktivismus. Wissenschaftliche Methodik wird nicht als beste Möglichkeit betrachtet, Wissen zu produzieren und zu legitimieren, sondern sie ist nach dieser Auffassung lediglich ein kulturbedingter Ansatz unter vielen und ebenso korrumpiert durch voreingenommenes Denken wie jeder andere.
Der Begriff kultureller Konstruktivismus besagt nicht, dass Realität tatsächlich durch kulturelle Überzeugungen erschaffen wird. Beispielsweise wird nicht behauptet, dass, als wir noch fälschlicherweise glaubten, die Sonne drehe sich um die Erde, dieser Glaube irgendeine Auswirkung auf das Sonnensystem und dessen Dynamik gehabt hätte. Hier wird vielmehr die Position vertreten, der Mensch sei so eng in seinen kulturellen Kontext eingebettet, dass alle seine Wahrheiten oder alle Wissensansprüche lediglich Repräsentationen dieser kulturellen Rahmenbedingungen darstellen – wir haben beschlossen, es als «wahr» oder «bekannt» vorauszusetzen, dass die Erde sich um die Sonne dreht, weil wir in unserer derzeitigen Kultur die Wahrheit auf eine bestimmte Art festlegen. Obgleich sich die Realität nicht unseren jeweils wechselnden Überzeugungen anpasst, ändert sich gleichwohl das, was wir in Bezug auf die Realität als wahr betrachten (oder als falsch oder «verrückt»). Wären wir Angehörige einer Kultur, die Wissen auf andere Weise produziert oder legitimiert, könnte es, innerhalb der Parameter dieser Kultur, durchaus «wahr» sein, dass, sagen wir einmal, die Sonne sich um die Erde dreht. Wer etwas anderes behauptete, würde dann als «verrückt» betrachtet.
Obwohl die Behauptung, dass wir «durch unsere kulturelle Prägung Wahrheit erzeugen», nicht dasselbe ist wie die Behauptung, dass wir «aufgrund unserer kulturellen Prägung entscheiden, was wahr/bekannt ist», spielt diese Unterscheidung in der Praxis keine Rolle. Der postmoderne Ansatz leugnet, dass objektive Wahrheit oder objektives Wissen einer auf Evidenzen basierenden Realität entspricht – und zwar unabhängig vom fraglichen Zeitraum oder der fraglichen Kultur und unabhängig davon, ob die jeweilige Kultur daran glaubt, dass sich Wahrheit oder Wissen am besten durch Beweise belegen lassen. Der postmoderne Ansatz mag gegebenenfalls noch einräumen, dass so etwas wie objektive Realität existiert, sein Schwerpunkt liegt jedoch auf der Bildung von Theorien, die nachweisen sollen, dass das Wissen über diese objektive Realität aufgrund unserer kulturellen Voreingenommenheit stets stark begrenzt sein muss.[23]
Darauf bezieht sich der amerikanische postmoderne Philosoph Richard Rorty, wenn er schreibt: «Wir müssen zwischen der Behauptung, dass die Welt dort draußen ist, und der Behauptung, dass die Wahrheit dort draußen ist, unterscheiden.»[24] In diesem Sinne beruht der Postmodernismus auf einer umfassenden Zurückweisung der Korrespondenztheorie der Wahrheit: dass Aussagen genau dann wahr sind, wenn sie mit den Tatsachen in der objektiven Welt übereinstimmen.[25] Dass reale Wahrheiten über eine objektive Wirklichkeit dort draußen existieren und wir sie erkennen können, ist natürlich eine der Grundlagen des aufklärerischen Denkens und von ausschlaggebender Bedeutung für die Entwicklung der Wissenschaft. Eine radikal skeptische Haltung gegenüber dieser Idee ist ausschlaggebend für das postmoderne Denken über das Wissen.
Der französische Philosoph Michel Foucault – einer der zentralen Denker des Postmodernismus – äußert ähnliche Zweifel, wenn er argumentiert, es gebe «in einer Kultur und in einem bestimmten Augenblick immer nur eine Episteme, die die Bedingungen definiert, unter denen jegliches Wissen möglich ist. Ob es sich nun um das handelt, das in einer Theorie manifest wird, oder das, was schweigend durch eine Praxis eingehüllt wird, spielt dabei keine Rolle.».[26] Foucaults besonderes Interesse galt der Beziehung zwischen Sprache, oder genauer, Diskursen (wie man über etwas spricht) und der Produktion von Wissen und Macht. In den Sechzigerjahren widmete er sich diesen Themen in einflussreichen Werken wie Wahnsinn und Gesellschaft (1961), Die Geburt der Klinik (1963), Die Ordnung der Dinge (1966) und Archäologie des Wissens (1969).[27] Für Foucault übermittelt eine Aussage nicht nur Informationen, sondern auch Regeln und Bedingungen des Diskurses. Diese bestimmen dann ihrerseits die Konstruktion von Behauptungen über Wahrheit und Wissen. Dominante Diskurse sind wirkungsvolle Machtapparate, denn sie legen fest, was innerhalb eines jeweiligen Raum-Zeit-Gefüges als wahr gilt. In Foucaults Analysen determiniert die soziopolitische Macht und nicht die objektive Übereinstimmung mit der Realität, was als wahr gilt. Foucault war von der Frage, inwieweit Macht unser Wissen beeinflusst, so fasziniert, dass er 1981 dafür sogar den Begriff Macht-Wissen-Komplex bzw. pouvoir-savoir prägte, um das unentwirrbare Geflecht von hegemonialem Diskurs und Wissen abzubilden. Foucault bezeichnete ein dominantes Set von Ideen und Werten als eine Episteme, weil es darüber entscheidet, wie wir Wissen identifizieren und mit Wissen interagieren.
In seinem Werk Die Ordnung der Dinge argumentiert Foucault gegen die Vorstellung, es gebe eine objektive Wahrheit, und schlägt vor, dass wir stattdessen in «Wahrheitsregimen» denken, die sich je nach der spezifischen Episteme einer Kultur und Epoche verändern. Infolgedessen vertritt Foucault die Position, dass fundamentale Prinzipien, die die Wahrheit zu enthüllen vermögen, nicht existieren und dass jedes Wissen des wissenden Subjekts «lokal verortet» sei – diese Vorstellungen sollten die Grundlage des postmodernen Wissensprinzips bilden.[28] Foucault bestritt dabei keineswegs die Existenz von Wahrheit schlechthin, zweifelte jedoch an der Fähigkeit des Menschen, seine kulturelle Voreingenommenheit zu überwinden, um zu dieser Wahrheit vorzudringen.
Postmoderner Skeptizismus ist demnach keine jener Spielarten des Skeptizismus, die man auch als «begründeten Zweifel» bezeichnen könnte – ein Skeptizismus also, der in den Naturwissenschaften und anderen rigorosen Formen der Wissensproduktion üblich ist, der die Frage stellt «Wie kann ich sicher sein, dass diese Aussage wahr ist?» und nur das als vorläufige Wahrheit akzeptiert, was wiederholt Versuchen der Widerlegung standhält. Diese Aussagen bringen Modelle hervor, d.h. vorläufige gedankliche Konstrukte, die danach beurteilt werden, wie gut sie Phänomene erklären und vorhersagen können. Das unter Postmodernisten verbreitete Prinzip des Skeptizismus firmiert hingegen häufig unter der Bezeichnung «radikaler Skeptizismus». Es behauptet: «Jedes Wissen ist konstruiert: Das Interessante daran ist die theoretische Betrachtung der Frage, warum Wissen auf eine bestimmte Art konstruiert wurde.» Radikaler Skeptizismus unterscheidet sich daher erheblich von wissenschaftlichem Skeptizismus, der die Aufklärung prägte. Die postmoderne Sichtweise besteht fälschlicherweise darauf, dass wissenschaftliches Denken nicht in der Lage ist, besonders zuverlässig oder rigoros zu bestimmen, was wahr ist und was nicht.[29] Wissenschaftliche Beweisführung wird als ein Metanarrativ konstruiert – eine pauschale Erklärung dafür, wie Dinge funktionieren –, gegen das der Postmodernismus eine radikal skeptische Position bezieht. Im postmodernen Denken ist das, was wir wissen, auf ein kulturelles Paradigma beschränkt, das eben dieses Wissen produziert und somit Machtsysteme repräsentiert. Infolgedessen ist Wissen aus postmoderner Sicht partikular und intrinsisch politisch.
Diese Sichtweise wird vor allem mit Jean-François Lyotard verbunden, der Wissenschaft, Aufklärung und Marxismus als Paradebeispiele für moderne Metanarrative einer grundlegenden Kritik unterzog. Lyotard befürchtete letztlich sogar, Wissenschaft und Technologie konstituierten lediglich ein «Sprachspiel» – eine Form, Wahrheitsansprüche zu legitimieren –, das alle anderen Sprachspiele zu dominieren begann. Er beklagte den Niedergang des lokalen «Wissens», das in Erzählungen weitergegeben wurde, und betrachtete den Verlust der Bedeutungsstiftung, der durch wissenschaftliche Abstraktion verursacht wird, als Verlust wertvoller Geschichten. Lyotards berühmte Losung von der «Skepsis gegenüber Metanarrativen» hat den Postmodernismus als Denkrichtung, analytisches Werkzeug und Weltanschauung stark beeinflusst.[30]
Der wichtigste Beitrag des Postmodernismus zum Wissen und zur Wissensproduktion bestand nicht etwa in der skeptischen Neubewertung von etablierten Überzeugungen. Vielmehr war es sein Fehlschluss, wissenschaftliche und andere Formen liberalen Denkens (wie etwa die argumentative Verteidigung der Demokratie und des Kapitalismus) seien Metanarrative (auch wenn sie solche Metanarrative bisweilen fördern) und keine unabgeschlossenen, sich selbst korrigierenden (Lern-)Prozesse, die eine produktive und nachvollziehbare Form des Skeptizismus allem gegenüber anwenden, ihre eigenen Überlegungen eingeschlossen. Dieser Irrtum führte die Postmodernisten zu ihrem gleichfalls fehlgeleiteten politischen Projekt.
Das politische Prinzip der Postmoderne
Die Überzeugung, dass die Gesellschaft auf Machtsystemen und Hierarchien aufgebaut ist, die darüber entscheiden, was als Wissen oder Wahrheit gilt und wie.
In politischer Hinsicht kennzeichnet den Postmodernismus, dass er überall in der Gesellschaft Macht als bestimmendes Strukturprinzip erkennt, und seine Infragestellung objektiven Wissens hängt damit unmittelbar zusammen. Macht und Wissen sind untrennbar miteinander verbunden – besonders anschaulich kommt diese Überzeugung in Foucaults Werk zum Ausdruck, das sich auf Wissen als «Macht-Wissen-Komplex» bezieht. Auch Lyotard beschreibt eine «Koppelung» zwischen der Sprache der Wissenschaft und der Sprache der Herrschaft bzw. der Moral; Derridas besonderes Interesse gilt den Dynamiken der Macht, die seiner Meinung nach als hierarchische Binarität von Über- und Unterordnung in die Sprache eingeschrieben sind.[31] Auf vergleichbare Weise gehen Gilles Deleuze und Félix Guattari davon aus, dass der Mensch durch verschiedene Macht- und Zwangssysteme codiert wird und sich nur innerhalb kapitalistischer Geldströme frei bewegen kann. Laut der postmodernen Theorie entscheidet Macht nicht nur darüber, was faktisch korrekt, sondern auch, was moralisch gut ist: Macht läuft auf Beherrschung hinaus, was immer schlecht ist; alle Formen der Hierarchie implizieren Unterdrückung, die es stets zu unterlaufen gilt. So kann die vorherrschende Haltung an der Sorbonne im Paris der Sechzigerjahre veranschaulicht werden, dem Bollwerk der frühen postmodernen Theorie.
Ihre Beschäftigung mit Machtdynamiken führte die Postmodernisten zu der Annahme, die Machtabsicherung durch die Herrschenden erfolge gleichermaßen bewusst und unbewusst. Bestimmte (Herrschafts-)Diskurse werden dabei als wahr legitimiert, bevor sie sich in der Gesellschaft verselbstständigen und zu sozialen Regeln gerinnen, die fortan überall als gesunder Menschenverstand gelten. Macht verstetigt sich demzufolge durch bestimmte, innerhalb der Gesellschaft legitimierte oder verordnete Diskurspraktiken; dazu gehören etwa auch bestimmte Höflichkeitserwartungen, das Prinzip der rationalen argumentativen Rede und Gegenrede, Methoden objektiver Beweisführung und sogar syntaktische und grammatische Regeln der Sprache. Von außen nur schwer zu durchdringen, gleicht diese postmoderne Sichtweise im Prinzip einer Art Verschwörungstheorie. Doch die Verschwörung, auf die sie anspielt, erfolgt auf äußerst subtile Weise. Sie ist streng genommen gar keine Verschwörung, denn es fehlen die koordinierten Einzelakteure, die im Hintergrund die Fäden ziehen: Wir sind vielmehr alle in sie verstrickt. Die postmoderne Theorie ist folglich eine Art Verschwörungstheorie ohne konkrete Verschwörer. Macht wird nicht unmittelbar und sichtbar von oben ausgeübt, wie es noch zu den Grundannahmen der marxistischen Klassentheorie gehörte, sondern durchzieht alle sozialen Interaktionen und kulturellen Diskurse, in denen sich ein bestimmtes Verständnis der Welt ausdrückt. Dieses übergreifende Machtgefüge zementiert – etwa in Form des Rechtssystems oder der gängigen wissenschaftlichen Publikationspraxis – vielschichtige Hierarchien und die Positionierung von Menschen in der Gesellschaft. Festzuhalten bleibt, dass hier stets die inhärenten Machtdynamiken des Systems als Ursache der Unterdrückung angesehen werden, weniger irgendwelche individuellen Akteure mit eigener Agenda. Gesellschaftliche Institutionen folgen nach dieser Lesart einer repressiven Logik, ohne dass die Menschen dabei selbst notwendigerweise offen repressive Sichtweisen an den Tag legen müssten.