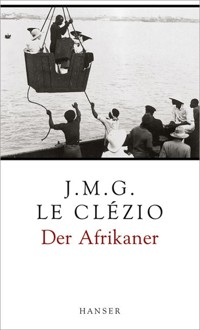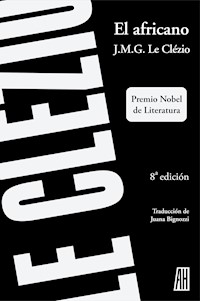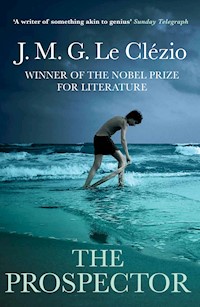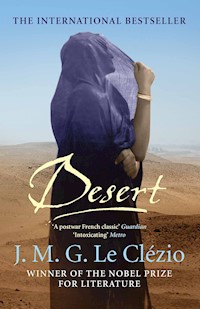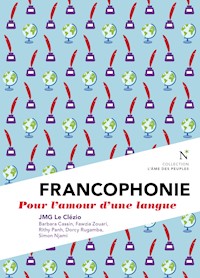19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
»Eine Liebeserklärung an die Insel Mauritius« Le Figaro. In seinem neuen Roman erzählt Nobelpreisträger J.M.G. Le Clézio die Geschichte eines Wissenschaftlers, der nach Mauritius kommt, um nach Spuren des ausgestorbenen Dodos zu suchen und der stattdessen die Geschichte seiner Familie und seinen eigenen Platz in dieser Geschichte findet. Mauritius – eine Perle im Indischen Ozean. Als Jéremy Felsen dort ankommt, weiß er nur, dass seine Familie dort jahrhundertelang auf der Plantage Alma erst Tabak, dann Zuckerrohr angebaut hat. Doch all das ist lange her, die Plantage existiert nicht mehr. Die Moderne hat Einzug gehalten, mit Flugverkehr, Touristen, Supermärkten. Zwar findet Jéremy, der zuvor noch nie auf der Insel war, nicht das, was er eigentlich suchen wollte, nämlich Spuren des ausgestorbenen Vogels Dodo, dafür aber gibt es überall Spuren seiner Familie, auf die er in vielen Gesprächen mit Inselbewohnern und bei ausgedehnten Streifzügen stößt. Und es gibt Dominique – genannt Dodo – Felsen, der auf der Insel geboren wurde und der parallel zu Jéremy seine Geschichte erzählt. Eine Geschichte von Krankheit und Kolonialismus, aber auch von Neugier und Lebensfreude. Für Jéremy führt der Aufenthalt auf Mauritius zu der Erkenntnis, dass, auch wenn er nicht dort lebt, seine Herkunft immer ein Teil von ihm sein wird, dass er Alma und die Insel in seiner Seele und seinem Herzen trägt. Geschickt verwebt Le Clézio die Geschichten seiner beiden Figuren zu einem eindringlichen Roman über Kolonialismus und Moderne, über Natur und Kultur und zu einer Hommage an die Schönheit und Einzigartigkeit der Insel Mauritius.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Ähnliche
J. M. G. Le Clézio
Alma
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über J. M. G. Le Clézio
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Motto
Anstelle eines Vorworts, die Namen
Mein Name ist Dodo
Zobeide
Der Stein aus dem Muskelmagen
Die Mare aux Songes
La Louise
Krystal
Alma
Maya
Crève-Cœur
Macchabée
L’Harmonie
Emmeline,
Geschichte von Topsie
Krystal
… Dodo …
Im Wald
Pomponnette
Eine Fußwaschung
Krystal (Fortsetzung)
Eine Wette
Geschichte von Marie Madeleine Mahé
Paris
Eine Falle
Aditi
Geschichte von Ashok
Dodo auf Reisen
Les Marres
Eine Hochzeit
Eine Erscheinung
Geschichte von Saklavou
Bras d’Eau
Eidechse
Der Prophet
Krystal im Gefängnis
Ditis Geburt
Die letzte Reise
Nach Süden
Das Meer
Zwei Häuser
Letzte Tage im Paradies
Mein Name ist Nieman’
Der Fremdling, anstelle eines Nachworts
GRATIAS AGO
Inhaltsverzeichnis
For auld lang syne, my dear
For auld lang syne
We’ll take a cup of kindness yet
For auld lang syne
Robert Burns, 1786
Inhaltsverzeichnis
Anstelle eines Vorworts, die Namen
Bilden sie eine Familie, ein Volk? Gibt es sie wirklich? Seit meiner Kindheit sind sie in mir, umschweben und umflattern mich wie aufgeregte Schmetterlinge, manche von ihnen kenne ich, seit ich die Sprache verstehe, zufällig ins Gespräch geworfene Namen, sei es durch meinen Vater, meine Tanten oder meine Mutter, obwohl sie mit alldem nichts zu tun hatte, und andere, die ich zufällig auf den Lokalseiten des Mauricien Cernéen gelesen habe, den mein Vater jede Woche erhielt und von dem ein ganzer Stapel auf einem Regal neben seinen Ökonomiebüchern und den Bänden der Encyclopaedia Britannica lag, und wieder andere, die ich auf Briefumschlägen oder auf der Rückseite von Fotos gefunden habe. Der Nachweis dieser Namen findet sich in einem kleinen, in braunes Leder gebundenen Buch aus der Zeit von Axel Thomas Felsen, das auf dem obersten Regal des Bücherschranks stand und das ich in meiner Kindheit gelesen habe, als handele es sich um so etwas wie ein Telefonbuch des damaligen Jahrhunderts:
The Mauritius Almanach
and Colonial Directory
for A. D. 1814
Dieses Buch enthielt neben der Gezeitentabelle und der Aufzählung der Wirbelstürme ein Verzeichnis aller Bewohner der Insel, die den Passagieren eines riesigen Floßes aus Stein glichen – tatsächlich waren sie alle eines Tages mit dem einen oder anderen Schiff eingetroffen –, das mitten im Indischen Ozean vor Anker lag, auf einem Meer, in dem die antarktischen Strömungen, die ununterbrochene Flut des Südatlantiks vor der afrikanischen Küste, die warmen Gewässer der südostasiatischen Inselwelt und die langen Wellen, die von der Westküste Australiens kommen, miteinander verschmelzen. Hier auf dieser Insel haben sich die Zeiten, die Geschlechter, die Leben, die Legenden, die berühmtesten Abenteuer und die unbekanntesten Ereignisse, die Seeleute, die Soldaten, die Söhne aus gutem Hause, aber auch die Pflüger, die Arbeiter, die Dienstboten und die Besitzlosen miteinander vermischt. All diese Namen von Menschen in jungen Jahren, im besten Alter oder auf dem Sterbebett, die immer wieder ersetzt und von Generation zu Generation weitergegeben werden und wie grüne Gischt, die eine halb aus dem Wasser ragende Klippe überspült, auf ein unvorhersehbares, unvermeidliches Ende zugleiten.
Diese Namen will ich nennen, wenigstens einmal, um sie in Erinnerung zu rufen und sie dann wieder der Vergessenheit zu überlassen:
Die Architekten Delabarre, Gastambide, Sardou, die Künstler Mademoiselle Élisa Bénard, Mademoiselle Malvina, Constant Haudouart, Fleury, die Rechtsanwälte d’Épinay, Faidherbe, die Maurer Marchall, Hétimier, die Pferdehändler Baker, Brown, Julot, Manquin, Salice, die Landvermesser Hoart, Hallot, die Zuckerbäcker Baude, Bérichon, Cooper, Dumoulin, die Kaufleute Ferrère, Florens, Fontemoing, Gillan, Godshall, Courrège, Lachauvelay, Lafargue, Le Bonhomme, L’Échelle, Legal, Lenoir, Mabille, Maillard, Marchais, Perrine, Pigneguy, Rivière, Roustan, Suffiled, Tasdebois, Vigoureux, Yardin, die Kontoristen Bega, Benech, Boulay, Bouton, Charroux, Coombes, Corson, Demiannée, Drouin, Dupré, Giquel, Goolamies, Jersey, Knell, Koch, Leclezio, Marin, Martois, Pasquier, Penlong, Querel, Salesse, Sauzier, Savard, Truquez, Tyack, Virieux, Zamudio, die Schneiderinnen Witwe Brode, Annette Maisontourne, Mauraux, Nogara, Saint-Amand, die Versteigerer Chasteau, Marigny, Mongoust, die Fuhrleute Bretonache, Lafouche, Lagoardette, die Ölmüller Barbe, Lapotaire, Pathé, die Blechschmiede Bareau, Dubois, Legour, die Uhrmacher Allen, Chedel, Esnouf, die Musiker Mademoiselle Lelièvre (Klavier), Périchon (Geige), Widet (Flöte), Zanadio (Gitarre), die Hebamme Witwe Vallée, die Offiziere der Gesundheitsbehörde Blanchette, Bernard, die Großhändler Antelme, Curé, Froberville, Lesage, Pitot, Sibbald, Wiehe, Wohrnitz und all die anderen, die freie Bevölkerung, die Handwerker und Angestellten, Louis Coupidon, Éloi Janvier, Zéphire François, Jules Buirette, Jean-Baptiste Sans-Souci, Mehmed Aly, Abdoul Azim, Madame Batouta, Kador, Badour Khan, Zoumon Lascar, Zelabdine, Cassim Mourmamade, Zamal Otemy, Issep Rafique, Madar Sakir, Moutoussaim Sortomoutou, Chavraya Malaga und all die anderen, deren Name nur aus einem Vornamen besteht, die Bediensteten, Köchinnen, Näherinnen, Wäscherinnen, Ammen und Gärtner, die gekauft und wiederverkauft wurden, und deren einzige Spuren, die sie in den Archiven hinterlassen haben, ihr Geburtstag und ihr Todestag im Sklavenregister sind, ein Eintrag mit krakeliger Feder des Sklavenregisterschreibers, eines gewissen T. Bradshaw, esquire, Marie Josèphe, notgetauft am [10]2. Prairial VI, Justine, gestorben am 12. Dezember 1786, Rafa, 8. Mai 1787, Robin, 2. Mai 1825, oder Mary Careesey, deren kurzes Leben ich erträumt habe, und die 1860 mit sechzehn Jahren, schon als Mutter eines Kindes, an Bord des Schiffes Daphné, befehligt von Kapitän Sullivan, kommend aus Teemoto in der Region Galla (an der Küste von Mosambik) in Port Louis eingetroffen und einen Monat später an Pocken gestorben ist und ohne Zeremonie in einem in der Erde ausgehobenen Loch, bedeckt mit ungelöschtem Kalk, verscharrt worden ist.
Die Namen tauchen auf, verschwinden wieder und bilden über mir ein schallendes Gewölbe, sie sagen mir etwas, sie rufen mich, und ich möchte sie wiedererkennen, einen nach dem anderen, aber nur eine Handvoll dringt an mein Ohr, ein paar lächerliche Silben, alten Büchern oder Grabplatten entrissen. Sie sind der kosmische Staub, der meine Haut bedeckt, mein Haar überpudert, kein Windstoß kann mich davon befreien. Von all diesen Namen, all diesen Leben, sind für mich vor allem die Vergessenen von Belang, jene Männer und Frauen, die die Schiffe der anderen Seite des Ozeans entrissen haben, um sie auf Strände zu werfen oder auf glitschigen Stufen von Hafenkais im Stich zu lassen und sie dann in sengender Sonne Peitschenhieben auszusetzen. Ich bin nicht in diesem Land geboren, nicht dort aufgewachsen, kenne fast nichts von seinen Sitten und Gebräuchen, und dennoch spüre ich in mir die Last seiner Geschichte, die Kraft seines Lebens, eine Bürde, die ich auf meinem Rücken trage, wohin auch immer ich gehe. Mein Name ist Jérémie Felsen. Schon bevor ich auch nur daran dachte, hatte ich die Reise angetreten.
Inhaltsverzeichnis
Mein Name ist Dodo
Dodo. Such a dodo. Haha, ich höre sie schon! Das sagen sie immer. Papa, Mama, warum sagt ihr nichts? Ihr sagt nie was. Euch ist das völlig egal. Ihn nicht beachten, übersehen. Sie sind gemein, eifersüchtig. Wenn du sie beschimpfst, fällt das auf dich zurück. Lass sie nur, beachte sie nicht. Lass sie verschwinden. Das ist ganz einfach, mach nur die Augen zu, mach den Mund zu, dann verschwinden sie im Dunkel. Wie Flecken, brauchst keine Seife, keine Bürste, dann verschwinden sie, brauchst kein Wasser. Nur die Lider schließen, sie gut verschlossen halten, press die Fäuste auf die Lider, drück ganz fest, bis die Kuller fast versinken, dann siehst du Funken sprühen. Das mag ich gern. Artémisia, die alte Amme, ist fast blind, sie sieht Funken. Das hat sie mir gesagt. Was siehst du, Amme? Was siehst du mit deinen blauen Augen in deinem schwarzen Gesicht? Funken, mein pikni. Ich sehe Funken, nix anders. Artémisia, die mir ihre Milch gegeben hat. Inzwischen sind ihre Brüste schlaff, hängen über ihrem dicken Bauch wie ein graues Hemd. Aber ihr Gesicht ist schwarz und glatt, ich streiche gern mit den Fingern über ihre Wangen. »Mo piti noi’, mo pikni«, mein kleiner Schwarzer, mein Kind. Das sagt sie leise, ganz leise, und ich schließe die Augen, um das zu sehen, was sie sieht, nur Schwarz, ein bisschen Rot an den Seiten, die Schatten der Blätter, die sich in der Sonne bewegen. Sie hat nur mich. Ihre Tochter Honorine, ihre Nichten und Neffen besuchen sie nicht. Sie schämen sich für sie, weil sie die Amme der Laros und der Fe’sens gewesen ist, eine Sklavin, sagen sie, und weil sie schwarz-schwarz ist wie Teer, aber ich liebe sie, die Haut ihrer Hände ist sanft und hart, verbraucht, rosa, ohne Falten, sie hat nie eine Lebenslinie oder eine Herzlinie gehabt, all diese Linien, wie sie kleine Mädchen in den Händen haben. Mama Laros ist tot, aber Artémisia ist immer noch da. Sag, Artémisia, du stirbst doch nicht, hm? Alle sterben irgendwann, Dodo. Aber du doch nicht, Artémisia, du kannst nicht sterben. Ich mag es gern, wenn sie lacht, sie hat ganz weiße Zähne, weil sie immer auf Süßholz kaut, auch wenn sie schlecht riechende Zigaretten raucht. Sie ist dick, hat Mühe, sich zu rühren, ihre Beine sind geschwollen, ihre Füße haben kleine Schnittwunden, die nicht heilen und die Fliegen anziehen. Ich streiche gern über ihre alten Brüste, die mir Milch geben, als ich kurz davor bin zu sterben, weil Mama kein Milch hat, ich berühre ihre Brüste und sage: »Vent’ contre vent’ ti bout’ dans labouce, bébé tète sa maman«, Bauch an Bauch, die kleine Spitze im Mund, saugt das Baby seine Mama. Oder den Satz, der mich immer zum Lachen bringt: »ki li pli piti ki li ki li poupou«, was ist kleiner als der Hintern einer Laus? Und die Antwort: »Dard so mâle«, der Stachel ihres Männchens. Deshalb besucht ihre Tochter Honorine sie nur selten. Honorine ist Anhängerin der Pfingstbewegung. Sie hasst alle Fe’sens, würde sie am liebsten in der Hölle schmoren sehen. Doch sie sind inzwischen alle tot, Mama Laros, Papa und die alte Artémisia. Nur ich bin noch da. Aber ich bin kein Fe’sen, kein Coup de ros. Ich bin Dodo. Das ist alles. Deshalb nimmt Honorine mich ab und zu bei sich auf, erlaubt mir, auf einer Matratze neben der Tür zu schlafen, wie ein Vagabund, der kein Zuhause hat.
Ich laufe jeden Tag. Den ganzen Tag lang. Ich laufe so viel, dass meine Schuhe durchlöchert sind. Wenn die Löcher zu groß sind und ich sie nicht mehr mit Pappe verstopfen kann, mache ich mich auf die Suche nach anderen Schuhen. Ich weiß, wo ich welche finden kann. Ich gehe hinauf in die Nähe des Trou aux Cerfs, des Botanischen Gartens und der Kirche der Swedenborgianer. Da kann ich andere Schuhe finden. Ich brauche nicht mal in Mülltonnen zu wühlen. Ich bitte die Kindermädchen vor den Haustüren darum, und sie fragen ihre Hausherrin und kommen dann mit einem in eine Zeitung gewickelten Paar Schuhe wieder. Die Zeitung behalte ich auch. Ich lese gern die Meldungen, auch wenn sie nicht taufrisch sind, aber die Schuhe sind auch nicht nagelneu. Ich setze mich im Schatten eines hohen Baums an den Straßenrand, aber ich lese nur mit Mühe, weil die Zeilen miteinander verschmelzen, und daher lese ich nur die Eigennamen, denn die lese ich gern. Ich präge sie mir in alphabetischer Reihenfolge ein, wie diese:
Chang Wing Sing Marie-Louise
Chawla Chahek
Cheeroh Zaynah
Chelember Madhvi
Cheong Youne Alison
Chojchoo Bibi Shazea
Trilok Manu Rohan
Yee Tong Wah Jérémie
Die Kindermädchen geben mir die Schuhe mit ein paar freundlichen Worten, sie nennen mich beim Namen, Dodo, und nie Fe’sen Coup de ros, manchmal scherzen sie mit mir, geben sich ein bisschen verliebt, tun so, als sei ich ihr Liebster, lachen mit strahlend weißen Zähnen und geben mir die Schuhe. Dann kann ich wieder laufen, bis in die Ferne, zu den Bergen, bis in den Wald, mit großen Schritten am Straßenrand entlang, die Autos hupen, die Busse und die Lastwagen mit quietschenden Bremsen, manche Fahrer rufen mir zu: »He, Dodo!« Ich laufe weiter, und wenn ich müde bin, setze ich mich auf eine Böschung. Ich betrachte die Berge, die Regenwolken, und manchmal sehe ich in der Ferne das Meer, und in der Nähe des Rempart die auf den Wellen glitzernde Sonne.
Irgendwann komme ich immer nach Alma. Ich gehe durch all die neuen Stadtviertel voller junger Leute, Studenten und Bankangestellten, hier kennt mich niemand, das ist eine neue Welt. Ich gehe über die Brücke des Cascade-Flusses oder nehme den alten Zuckerrohrweg durch Minissy, laufe oben am Rand der Böschung den Fluss entlang, dort wo die Sonne in den Augen brennt. Ich komme nach Valetta, gehe unter der Brücke her und dann am See entlang bis zur stillgelegten Bahnlinie. Ich komme gern her, hier ist fast nie jemand. Höchstens eine alte Frau auf der Suche nach Feuerholz oder ein Landarbeiter mit einer Flasche Arak. In der Nähe des Sees bellen Hunde. Ich nehme mich vor ihnen in Acht, kleine hellbraune Hunde, die beißen. Dort bleibe ich. Morgens ist es am Wasser mild, ich halte Ausschau nach Libellen. Ich sammele Kieselsteine und warte. Ich suche nach geschnittenem Zuckerrohr und lutsche den Zucker, ich habe schlechte Schneidezähne, aber kräftige Backenzähne, mit denen ich die Fasern zerquetschen kann, um den Zucker auszulutschen, den herben, bitteren Saft, Papa erhitzt ihn in einem Kupferkessel, bis das zu einer schlammigen Masse wird, er sagt, das ist gut für die Gesundheit, es ist so, als trinkt man Erde.
Alma. Ich kann diesen Namen aussprechen, seit ich ganz klein bin: Ich sage Mama, Alma. Mama ist Artémisia. An meine richtige Mama erinnere ich mich nicht mehr so genau. Sie stirbt, als ich sechs bin. Sie ist groß und blass. Anscheinend ist sie ganz langsam gestorben, schuld daran war das Blut oder die Knochen. Sie ist eine große Sängerin, das sagen alle, deshalb liebt mein Papa sie, trotz der bösen Leute, die wollen, dass sie verschwindet, weil sie eine Kreolin ist von der Insel Réunion, mit dichtem, krausem Haar. Ganz mager und kerzengerade. Ich erinnere mich an sie vor ihrem Tod, sie steht vor der Küchentür, sie ist weiß, trägt ein weißes Nachthemd. Harekrishna, der Gärtner, sagt, dass sie aussieht wie ein Gespenst. Wo ist Artémisia? Ich will Artémisia. Ich schreie dem Gespenst zu, dich rufe ich nicht, ich will Mama Artémisia, meine Amme. Dich will ich nicht.
Und dann kehre ich zum Friedhof Saint-Jean zurück. Ich komme gern hierher. Das ist ein bisschen mein Zuhause, da ich kein eigenes Zuhause habe. Das sage ich den Friedhofswärtern, und das bringt sie zum Lachen: »Dodo vinn lacaze?«, Dodo, gehst du nach Haus? Sie machen sich über mich lustig, aber sie respektieren mich, weil ich ein Fe’sen bin, der Letzte dieses Namens. Die Fe’sens sind hier überall unter den Toten: Abteilung O, Abteilung J, Abteilung M. Ich kenne sie nicht alle. Aber ich weiß, wo sie wohnen. Achab Felsen mit meiner Großmutter Jeannie Beth in der Nähe des großen Ebenholzbaums. Eugène Felsen mit Marie Zacharie in der Nähe des Standbilds des Engels Gabriel. Der ehrwürdige Vater »enn mon père« Robert Felsen am Ende der Allee, neben den Fitoussis. Auf der Marmorplatte ist sein Porträt, aber es ist schon halb verblasst. Und am anderen Ende des Friedhofs neben der alten Mauer, weil niemand sie anderswo haben will, Papa und Mama Laros unter einer grauen Granitplatte. Früher war die Platte von einer Kette umgeben, aber jemand hat die Kette gestohlen und so bleiben nur noch die vier durchlöcherten Zementpfähle, in deren Löchern man noch den Rost der Kette erkennen kann. Ich komme mit einem Stück Kreide und zeichne die verblassten Buchstaben nach: Antoine Felsen, 1902–1970, und Hélène Rani Laroche, 1913–1940. Ich liebe diese Namen. Sie sind sehr sanft. Sie stecken tief in mir, wie ein Raunen. Ich sage sie ganz leise und dann ziehe ich mit meinem Stück Kreide die Namen und die Zahlen nach. »Dodo ki li fer là?«, Dodo, was machst du da? Das fragt mich der Wärter, er ist sehr groß, pechschwarz und hat immer einen Strohhut auf dem Kopf. Er trägt einen verschlissenen, fleckigen schwarzen Anzug. Er heißt Jean. Missié Zan. Er sagt: »Das kann verwiss’t we’de, mein Lieber. Muss Fa’be nehme. Ich gib di’ Fa’be.« Aber ich will seine Fa’be nicht. Denn dann streichst du einmal, und danach vergisst du die Sache. Und dann bleibst du ein ganzes Jahr weg! Nein, nein, die alten Leute wollen Kreide. Das haben sie mir im Traum ins Ohr geflüstert.
Es regnet ein bisschen. Wie immer, wenn ich den Friedhof Saint-Jean besuche. Von den Zuckerrohrfeldern ausgehend, nehme ich nur kleine Wege, die Erde ist rot und rissig, ich spüre, wie die Sonne auf Gesicht und Händen brennt, und wenn ich die Straßen in der Nähe von Ebène überquere, häufen sich die Wolken über dem Gebirge, große weiße und schwarze Wolken treffen aufeinander, und ich spüre den kühlen Wind, der den Regen ankündigt. Unter Schirme gebeugte Menschen beschleunigen den Schritt, die Schülerinnen der Oberschulen klammern sich an die Busse, schreien lachend »ah!« und »oh!«, wobei die weißen Zähne in den Gesichtern aufblitzen. Sie sehen mich an und lachen noch lauter. Ich kenne sie nicht. Sie sind erst vor wenigen Jahren geboren. Ich sehe sie nie, außer Ayeesha, die Tochter von Zine Madame, sie ist noch Schülerin, aber alle sagen, dass sie schon mit Jungen geht, Ayeesha hat schwarze Locken und grüne Augen. Wenn sie mich sieht, ruft sie meinen Namen: »He-ho! Dodo-bird! Kot to été?«, Wo warst du denn? Zur Antwort gebe ich ihr ein kleines Zeichen mit der Hand, weil ich Ayeesha gern mag, sie ist sehr hübsch, und dann setze ich meinen Weg fort, dem Regen entgegen, der auf mich niedergeht, mir über die Wangen rinnt, mein Hemd durchnässt und an meinen Beinen hinabläuft. Ich mag den Regen auf dem Friedhof Saint-Jean. Papa und Mama, ihr mögt doch auch den Regen gern, denn wenn man tot ist, mag man den Regen, weil er den Tränen ähnelt. Als ich noch klein bin, sage ich nie »es regnet«, sondern »der Himmel weint«.
Papa ist groß und sehr mager. Er trägt nur schwarze Kleidung, vielleicht, weil seine Frau tot ist. Alle achten ihn. Er war früher Richter, und viele Menschen haben wohl noch Angst vor ihm. Dabei ist er sehr sanft, wird nie wütend und schreit nie. Jeden Morgen geht er in die Stadt, um seiner Beschäftigung nachzugehen, doch er drückt mir nie einen Kuss auf die Wange und gibt mir auch nicht die Hand. Er beugt sich ein wenig hinab, während er mich ansieht, denn er ist groß und ich bin klein, und sagt dann nur: »Behave.« Er redet gern Englisch mit mir. Er sagt nie etwas Belangloses wie alle die anderen, die schwatzen, sich streiten oder Lügenmärchen erzählen. Wenn er mit mir spricht, sagt er nur ein paar knappe Worte auf Englisch: »So long.« Oder: »What’s up?« Und wenn er abends zurückkommt, setzt er sich in seinen Ledersessel, faltet die Zeitung auseinander, und dann schläft er jedes Mal ein. Er raucht auch englische Zigaretten, die er zwischen Daumen und Zeigefinger hält wie einen Bleistift. Seine Fingerspitzen und seine Zähne sind gelb. Als Mama noch lebt, wagt er nicht, im Haus zu rauchen, weil sie den Geruch von kaltem Rauch hasst. Das sagt Artémisia. Und als Mama tot ist, fängt er wieder an zu rauchen. Davon bekommt er Hustenanfälle. Nachts höre ich ihn husten, dann kann er gar nicht aufhören. Schuld daran ist sein Asthma, Asthmatiker sollen nicht rauchen. Das sagt Dr. Harusingh zu ihm, sagt, dass jede seiner Zigaretten ihm Jahre seines Lebens wegnimmt. Aber Papa hört nicht auf ihn. Er sagt nur: »Und wenn ich Lust habe, mein Leben abzukürzen?« Und genau das passiert. Er hustet den ganzen Tag und die ganze Nacht, und eines Morgens platzt ein Blutgefäß in seinem Herzen oder in seinem Kopf, und Papa ist tot. Ich höre, wie er stirbt. Das macht großen Lärm, weil er auf den Boden fällt, und ich kann mich nicht rühren, weil ich Angst habe. Anschließend gluckst das Wasser in seiner Kehle, er röchelt und erstickt. Artémisia findet ihn gegen Mittag, wie er auf den Fliesen liegt, und hebt ihn ohne Hilfe ins Bett. Wenn ich schreie oder ganz schnell renne, um den Arzt zu holen, ist Papa vielleicht noch am Leben.
Anfangs mache ich ihm auf dem Friedhof Saint-Jean Vorwürfe. Ich setze mich auf die Grabplatte aus grauem Stein, in der sein Name und der von Mama Laros eingraviert sind, und sage: »Du musst auf Dr. Harusingh hören, wenn du auf ihn hörst, kannst du noch bei mir sein.« Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist er zufrieden, dass er nicht auf ihn gehört und all diese Zigaretten geraucht hat, die das Leben abkürzen, denn jetzt ist er mit seiner Frau zusammen. Ich mache ihm keine Vorwürfe mehr. Ich glaube, dass auch ich anfangen muss, Zigaretten zu rauchen, um möglichst schnell wieder bei Papa und Mama zu sein. Aber gleichzeitig läuft es mir kalt den Rücken hinunter, wenn ich mir vorstelle, dass ich unter dieser grauen Steinplatte liege. Und wer soll die Namen und die Daten mit Kreide nachziehen, wenn ich da unten liege? Bestimmt nicht Missié Zan. Er macht sich nicht mal die Mühe, ein paar Pinselstriche mit seiner Fa’be zu machen, sondern begnügt sich damit, Rum zu trinken und in seiner Hütte am oberen Ende des Friedhofs zu schlafen, in der Hoffnung, dass jemand kommt, der ihm eine kleine Münze gibt, damit er die Blumen begießt oder die Fugen des Grabmals mit seiner alten Zahnbürste und seinem Glas Salzwasser reinigt. Das Gute am Friedhof Saint-Jean ist auch, dass es hier Gräber von Chinesen gibt. Sie heißen Zhang Fo oder Zhang Ho. Es sind keine großen Gräber, aber sie sind sehr schön. Dort sind immer Blumen oder Grünpflanzen. Und auch Gefäße mit erloschenen Räucherstäbchen. Es ist gut für alte Leute, Chinesen als Nachbarn zu haben, nachdem sie sich immer beklagt haben, von Eltern, Freunden und überhaupt allen schlecht behandelt worden zu sein. Sie sagen immer: »Vipernrasse« oder »Gehenna«, was heißen soll, dass die Insel für sie die Hölle war. Und jetzt ruhen sie neben den Chinesen, die so sauber und ordentlich sind.
Früher, als Papa noch lebt, komme ich ein- oder zweimal im Jahr mit ihm her. Er ist immer schwarz gekleidet mit einem kleinen Hut und Lackschuhen. Aber er bringt nie Blumen mit, er sagt, das hasst er. Deshalb bringe auch ich nie welche mit. Missié Zan kritisiert mich: »Na, Missié Fe’sen, hast du keine’ kleine’ Strauß?« Er glaubt, dass ich ein Geizk’agen bin. Er verachtet mich, weil ich mit nackten Füßen in den Schuhen herumlaufe. In Schuhen, die ich bestimmt in einer Mülltonne gefunden habe. Herumlaufen in den Schuhen eines Toten. In der Haut eines toten grand dimoune herumlaufen. Alle Schuhe sind tote Haut. Aber weil Papa Richter ist, hält Missié Zan immer den nötigen Abstand. Wenn ich früher mit Papa herkomme, belästigt uns niemand, pöbelt uns niemand an. Ich bin sicher, dass Missié Zan auch damals schon da ist, in einem Versteck mit den anderen, wie die Kakerlaken in ihren Löchern. Sie kommen erst hervor, wenn wir weg sind, umschnüffeln das Grab, um zu sehen, ob sie etwas mitgehen lassen können. Zu der Zeit ist die Kette um das Grab noch da. Als ich klein bin, setze ich mich auf die Kette, um hin- und herzuschaukeln. Zu der Zeit ist Mamas Name noch ganz frisch, in schwarzen Lettern, eingraviert in die graue Steinplatte, ich sehe noch jeden Buchstaben, jede Zahl, wie in meine Augen eingeritzt. Ich will sie gern schwarz nachzeichnen, aber ich finde kein Stück Kohle. Ich versuche es mit einem Bleistift, aber das verwischt sofort. Und daher mach ich es jetzt in Weiß, mit Kreide. Aber ich will nix wissen von seiner blöden Fa’be. Um mir zu zeigen, wie das geht, pinselt Missié Zan das Nachbargrab an, nicht das der Chinesen, sondern das Grab einer alten Frau aus Lalmatie, die ich nicht kenne, aus der Familie Amampour, vielleicht tut er es absichtlich, um mir zu drohen, beim nächsten Mal seid ihr dran, die Fe’sens, die ich anpinsele. Doch ich sehe ihn an und sage nix, aber das soll heißen, wenn du unser Grab anrührst, bring ich dich um. Ich bin nicht so groß wie Papa, bin dünn und sehnig, aber mein Gesicht flößt allen Angst ein, weil ich keine Nase, keine Augenlider und Wangen voller Löcher habe. Nicht etwa, weil ich alt bin, nein, aber so bin ich, seit ich erwachsen bin, daran ist die Krankheit schuld. Niemand verliert ein Wort über die Krankheit, aber ihr verdanke ich es, dass ich keine Nase und Löcher in den Wangen und rings um den Mund habe. Die Krankheit hat mich zerfressen. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Eines Tages, als Papa noch in Alma ist, wühle ich in seinen Papieren auf seinem Arbeitstisch und finde einen verschnürten Aktenordner, und auf dem Ordner lese ich meinen Namen, Dominique. Und in dem Ordner sind alle möglichen Papiere, meine Geburtsurkunde, ausgestellt in der Town Hall von Moka, Zeugnisse aus der Schule Le Bourhis und auch ein auf Englisch geschriebener Brief eines Arztes mit Worten, die ich nicht verstehe, und ganz oben auf dem Brief in roter Schrift ein seltsames Zeichen. Damit ich es nicht vergesse, male ich es in ein Heft ab, um eines Tages zu wissen, was es heißt, denn mir ist klar, dass dieser Buchstabe der Name der Krankheit ist, die mein Gesicht zerfrisst: ∑.
Inhaltsverzeichnis
Zobeide
Ich frage eines Tages, was bedeutet dieser Buchstabe? Tante Milou gibt mir die Antwort. Zobeide schreibt sich mit einem Z, nicht mit diesem Buchstaben. Diesen Buchstaben kenne ich nicht. Niemand kennt ihn. Aber meine Tante Milou nennt mir seinen Namen. Das große Sigma. Das habe ich nie vergessen. Alle haben das vergessen, selbst Papa. Bis auf meine Tante Milou. Meine Tante Milou sagt immer die Wahrheit. Das liegt daran, dass sie allein lebt, sie hat nie heiraten wollen, ihre Familie verlassen. Sie hat ihr ganzes Leben lang in Alma gewohnt, im großen Haus. Doch anschließend hat sie Alma verlassen müssen, wegen des Kriegs mit den Armandos, den Söhnen von Jules, Henri, Léon und Barnard, der seinem Papa ähnelt, weshalb man ihn Dilo Kanal nennt, all die Bösewichter, die uns Fe’sens bekämpfen. Mama Laros ist auf dem Friedhof Saint-Jean gelandet und Papa ist natürlich auch deswegen gestorben, er hat einen Gehirnschlag bekommen, ist röchelnd und mit einem Geräusch von fließend Wasser in seinem Schlafzimmer zu Boden gestürzt. Es hat mehrere Tage gedauert, ehe er uns verlassen hat, er hat kreidebleich auf seinem Bett gelegen, und sein Bart ist jeden Tag gewachsen. Tante Milou hat ihn nicht alleingelassen. Sie ist die ganze Zeit an seiner Seite geblieben, sie wohnt bei uns in unserm Haus, sie nennt es die Bambushütte, weil es ein ganz kleines, sehr schmutziges Haus ist, unten in der Talsohle von Alma, auf der anderen Seite der Bambussträucher. Sie schläft im kleinen Zimmer, das Papas Arbeitszimmer war, sie hat ein Klappbett ins Zimmer gestellt, denn Papa braucht kein Arbeitszimmer mehr, er kann nicht mal mehr schreiben. Und da nennt sie mir den Namen des großen Zeichens und erzählt mir von der Frau, die mich mit dieser Krankheit ansteckt, aber ich sage nix dazu, weil das nur zwei oder drei Mal der Fall ist. Wenn ich Zobeide nur zwei- oder dreimal sehe, wie kann sie mich dann mit dem großen ∑ anstecken? Und wie kann das meine Nase und meine Wangen zerfressen und meine Augen in zwei Löcher ohne Lider verwandeln? Aber ich höre meiner Tante zu, weil sie immer die Wahrheit sagt. Und dann geht mir wieder alles durch den Kopf, was sich im Viertel Ward Four in Port Louis ereignet hat. Das ist schon lange her, denn damals leben wir noch im großen Haus in Alma, und Papa arbeitet noch als Richter in seinem Büro in der Nähe der Barracks, und ich gehe noch in die Schule, und niemand nennt mich Dodo oder Coup de ros, weil ich stärker bin als alle anderen und sie mit einem Knüppel aus Zuckerrohr verprügeln kann. Ich gehe oft aufs Champ de Mars, um mir ein Pferderennen anzusehen, das gefällt mir. Ich sehe gern zu, wie sie über die Rennbahn galoppieren, das mag ich auch heute noch, aber ich kann das Eintrittsgeld nicht mehr bezahlen, und mit meinen alten Klamotten und meinen Schuhen aus toter Haut lässt man mich nicht mehr rein, vor allem da ich Löcher in den Wangen und keine Nase mehr habe.
Zobeide wohnt in der Rue Moreno, nicht weit vom städtischen Krankenhaus und auch nicht weit von einem chinesischen Laden und der Moschee Al-Husseini, ich besuche sie am Sonntagnachmittag, ich erinnere mich, dass es immer sonntags ist, weil Papa und Tante Milou zur Messe in die Kathedrale gehen. Im Januar ist es sehr heiß im Ward-Four-Viertel, die Pferderennen beginnen wegen der Hitze später, erst gegen vier, und ich weiß nicht, wie ich die Zeit totschlagen soll, da sagt mein Freund Mohandas zu mir, komm, wir gehen zu Zobeide, und begleitet mich bis zum Ward Four, aber er will das Haus nicht betreten und lässt mich draußen vor der Tür.
Bei Zobeide ist es sehr schön. Alles ist rot, die Wände, die Vorhänge, die Bettdecken, sogar die chinesischen Möbel sind rot und schwarz, und Zobeide ist ganz in Rot, hat ein langes Kleid an, das ihr bis auf die Füße fällt, und kleine rote Pantoffeln wie in einem Märchen, und ich bin ganz eingeschüchtert, weil es das erste Mal ist, dass ich bei einer Frau bin, und weiß nicht, was ich sagen soll. Sie sagt: »Komm rein, mein Junge, ich beiße nicht!« Ich erinnere mich noch genau an jedes Wort, das sie zu mir sagt, und dann haben wir uns in ihr großes Bett gelegt, und sie zieht mich aus und macht sich über mich lustig: »Du bist ganz nackt und unbehaart, aber da unten, da wächst was!« Sie streichelt mir mit dem Handrücken die Wangen, lacht ein bisschen und sagt: »Enn zenfant!«, ein Kind. Und dann: »Du bist aber ein komischer Vogel!« Es ist sehr heiß bei Zobeide, und obwohl ich nix mehr anhabe, ist meine Haut nass vor Schweiß, aber Zobeides Haut ist trocken, sie glänzt im Tageslicht, hat die Farbe von roter Erde wegen der Vorhänge, und ihre Brustwarzen sind ganz hart. Sie zeigt mir den Weg in ihren Unterleib, da ist es weich und warm, ich fühle mich richtig wohl, aber ich schreie, als die Flüssigkeit aus mir herausspritzt, und Zobeide antwortet mit einem: »Aah!« Und dann sagt sie: »Mein kleiner Vogel, du bist mir aber ein schöner Schlingel, das hast du also noch nie zuvor gemacht, das kann ich kaum glauben, du bist ein großer Schwindler, dir brauche ich aber nichts mehr beizubringen, Zozo Mayo!« Es gefällt mir sehr, dass sie das sagt, denn ich habe es noch nie zuvor gemacht, bis auf wenige Male mit der Hand in meinem Bett, ehe ich aufstehe, aber eines Tages sagt Papa wütend zu mir: »Das ist nicht gut, ein Junge darf nicht morgens lang ausgestreckt in seinem Bett liegen bleiben«, und dann schickt er mich unter die Dusche, die Dusche in Alma besteht aus einer Kanne mit kaltem Wasser, das man sich in einer Zinkwanne über den Rücken gießt, und dann scheuert man sich mit Kalebassenstroh ab. Ich habe Papa nie was von Zobeide und dem Rest erzählt, aber meine Tante Milou weiß alles, wer es ihr gesagt hat, weiß ich nicht, vielleicht Mohandas oder Kadour, der kommt oft nach Alma und hat eine scharfe Zunge, sein Spitzname ist Skorpionfisch. Und Kadour geht oft nach Ward Four, in die Moschee Al-Husseini, sein Onkel hat einen Tuchladen in der Rue Moreno, und so wird diese Geschichte überall weitererzählt, vor allem da ich oft nach Ward Four gehe, um Zobeide zu sehen, sie mag mich gern, sie nennt mich Zozo Mayo oder manchmal auch Zako, sie sagt, dass ich mit meiner Hautfarbe und meinem krausen Haar den Makaken von Grand Bassin gleiche. Aber sie nennt mich nicht mehr »Zenfant«, Kind, weil ich jetzt meine Unschuld verloren habe und mich mit allem auskenne, ich kann auf sie steigen und ihr Lust verschaffen, und während ich mich auf ihr abrackere, packt sie mich an den Haaren und gibt schnurrende Laute von sich wie ein dicker Kater, raa, raa, roo, roo.
Aber dann bin ich schwer krank geworden. Und seitdem will Zobeide nicht mehr, dass ich zu ihr komme. Sie hat mich lange vor dem Doktor untersucht. Dazu muss ich mich vors Fenster stellen, ins Sonnenlicht, und sie setzt eine Brille auf die Nase und nimmt alle Teile unter die Lupe, meinen Schwanz, die Eier, alles, und dann sagt sie: »Zozo Mayo, du musst ins Krankenhaus.« Das sagt sie mit fester Stimme, damit ich begreife, dass es ernst ist. Und dann sagt sie: »Zako, ab jetzt kannst du nicht mehr zu mir kommen, und wenn man dir Fragen stellt, dann sagst du nichts von mir, niemals, verstehst du?« Sie gibt mir Geld für die Medikamente, das ist witzig, denn normalerweise mache ich ihr kleine Geschenke, gebe ihr etwas cash, ein paar Rupies, die ich mir vom Geld für die Kantine in der Schule abspare, oder ein paar Geldscheine, die ich mir durchs Grasschneiden im Garten von Alma verdiene. Doch diesmal gibt sie mir cash, aber ich habe noch nicht begriffen, dass sie das tut, um mich rauszuwerfen, um mir Adieu zu sagen. Ich bin nicht ins Krankenhaus gegangen, weil ich mich für diese Krankheit schäme, ich hoffe, dass es von selbst vorbeigeht, habe Salbe darauf getan, aber es geht nicht vorbei.
Ich gehe mehrmals in die Rue Moreno, ins Ward-Four-Viertel, streiche vor ihrer Haustür herum, aber eines Tages kommt ein Typ heraus, keine Ahnung, wer das ist, ein großer, kräftiger Kerl mit kohlschwarzer Haut, und der gibt mir eine Ohrfeige und schubst mich in den Bach. »Qui rôde là? Wer strolcht da herum? Hast du nicht verstanden, du kleiner Schwuli? Bugger off!« Er verscheucht mich bis ans Ende der Straße, und danach gehe ich nie wieder zu Zobeide. Und dann verschlimmert sich meine Krankheit. Es tut weh, furchtbar weh, und ich habe immer öfter Schweißausbrüche. Papa lässt Dr. Harusingh kommen, und der untersucht mich, aber er sagt nix. Ich bleibe in meinem Zimmer im Bett, mit zugezogenen Vorhängen, weil mir die Augen wehtun. Und dann habe ich einen Fiebertraum und sehe Teufel, die sich mit bösen Augen und verzerrtem Gesicht meinem Bett nähern und die Hände ausstrecken, um mich an den Haaren zu zerren, und da fange ich an zu schreien. Und seit dieser Zeit sehe ich Teufel im Spiegel, überall, wohin ich gehe, verdecke ich die Spiegel mit Papier oder verhänge sie mit Kleidungsstücken. Anschließend wohne ich nicht mehr im Haus, wegen der Krankheit, sondern in der Bambushütte ganz hinten im Hof, ich habe überall Krusten auf der Haut, in meinem Mund blutet es, und meine Zunge ist schwarz. Ich kann nicht mehr essen und nicht mehr schlafen und habe starke Kopfschmerzen, Artémisia bringt mir feuchte Tücher und wickelt meinen Kopf damit ein. So habe ich meine Nase und meine Augenbrauen verloren, meine Lider und meine Haare, und bin zu einem Monster geworden. Niemand erkennt mich mehr, die Würmer haben meinen Schädel zerfressen. Und ich gewöhne mich daran, Dämonen zu sehen.
Inhaltsverzeichnis
Der Stein aus dem Muskelmagen
Ich bin wieder da. Das ist ein seltsames Gefühl, denn ich war noch nie auf Mauritius. Wie kann man etwas für ein Land empfinden, das man gar nicht kennt? Mein Vater hat mit siebzehn Jahren die Insel verlassen und ist nie dorthin zurückgekehrt. Meine Großmutter stammt nicht von hier, sie ist im Elsass geboren. Meine Mutter heißt Alison O’Connor, sie war Krankenschwester in England, mein Vater hat sie nach dem Krieg kennengelernt und sie haben geheiratet. Mein Vater war Emigrant, heute spricht man von der »Diaspora« – das ist ein Wort, das ich ihn nie habe aussprechen hören, genauso wenig wie das Wort »Exil«. Er sprach nicht darüber, auch wenn er von großem Heimweh nach seinem Heimatland erfüllt war. Seine Sehnsüchte drückte er nicht in Worten aus. Er äußerte sie in Gesten, in seinen Manien, seinen Fetischen. In meiner Kindheit habe ich überall diese Gegenstände gesehen, die ihn mit seiner Insel verbanden: Muscheln (die er am Strand aufgesammelt hatte, er hätte sich nie darauf eingelassen, sie auf einem Trödelmarkt zu kaufen), Lavabrocken, Korallen, ein getrockneter Fisch, ein blau gefleckter Kofferfisch mit geschrumpften Augen, winzigen, zerbrechlichen Flossen und einem After, der mich zum Lachen brachte, schwarz und zerknittert wie ein Greisenmund. Und auch Samenkörner, Kaffeekörner, Tamarindenschoten, rotbraune Hülsenfrüchte, schwarze Stücke aus Kokosholz und jenes große Samenkorn mit abgeblättertem Lack, dessen Namen ich schon sehr früh erfahren habe, weil er keinem anderen glich und in keinem Wörterbuch stand, die Frucht des Calvariabaums, oder mit den Worten meines Vaters, des tambalacoque trees. Vielleicht hat er mir die Legende des großen Vogels ohne Flügel erzählt, der sich von diesen Früchten ernährte, und der, indem er die abgeschliffenen Körner in seinen Exkrementen wieder ausschied, einem auf der Welt einzigartigen Baum das Leben schenkte, dem Sideroxylon grandiflorum, auch großblättriger Eisenbaum genannt, von dem ich mir vorstellen konnte, dass er noch aus der Zeit der Sintflut stammte. Aber bei genauerer Überlegung glaube ich, dass er nichts erzählt hat. Diese Gegenstände waren da, auf seinem Arbeitstisch, am Rand seiner Bücherregale oder auf seinem Nachttisch, ohne Grund, ohne Worte. Sie waren einfach da.
Und die Landkarten. Überall waren welche, an den Wänden, bedeckt von einer dünnen Staubschicht, oder eingerollt oben auf den Schränken, in Stapeln neben den englischen Wörterbüchern, als könnten sie ihm eines Tages dienen. Alles Karten der Insel Mauritius, in verschiedenen Maßstäben, und Stadtpläne von Port Louis mit geänderten Straßennamen, handschriftlichen, mit Bleistift geschriebenen Hinweisen, den Namen der Händler, Ali, Soliman, Amoorasingh, Woong Chong Li, Pak Soo, Tsuridar, und den Namen von Firmen in der Rue de la Mosquée und der Rue Edith Cavell (vormals Rue du Rempart), Lonrho, Sugar Island, Commercial Bank, Consolidated Oriental, und denen von Hotels, nicht die der protzigen großen Hotels von heute, sondern die der bescheidenen Pensionen für kleine englische Beamte, National, Pearl, MacArthur, Montaigu, und die Namen von Restaurants, la Flore, le Barachois, le Capitaine, l’Espérance, le Cari Sec. Ich glaube nicht, dass mein Vater je seine Karten betrachtete. Sie waren da, mit den Muscheln und den Samenkörnern, Bestandteile der Ausstattung, mit den Geburtstagsfotos oder den Reisefotos, er sah sie nicht mehr, aber falls jemand sie zufällig an eine andere Stelle legte, bemerkte er es sofort: »Wer hat den Stadtplan von Port Louis angerührt?« Und dann fügte er hinzu: »Den von 1923«, als sei das besonders wichtig. Als hätte sich irgendjemand, abgesehen von meiner Mutter und mir, für ihn interessieren oder ihn sogar entwenden können.
Aber was mich von all diesen Dingen am meisten angezogen, ja fasziniert hat, und zwar in solchem Maße, dass es, wie ich glaube, mein späteres Leben bestimmt hat, war ein runder, abgenutzter Stein von weißlicher Farbe, der neben den Muscheln und Samenkörnern auf einem Bücherregal lag, als sei er dort nach einer Sturmflut liegen geblieben, und den ich in die Hand genommen habe, sobald ich das obere Regal erreichen konnte, auf dem er ausgestellt war. Ich erinnere mich nicht, gefragt zu haben, was das sei. Ein Kiesel, ein einfacher Kieselstein von der Größe eines Tennisballs, oder ein wenig kleiner, aber völlig rund, nur mit einer leicht gepunkteten Oberfläche, der Spur von winzigen Schlägen, die man nur sah, wenn man den Stein ins Sonnenlicht hielt. Ich habe nie geglaubt, dass es ein Spielzeug sein könne. Ich habe ihn oft genommen und in der Hand gehalten, bis er warm wurde. Ich habe sein Gewicht gespürt, seine Struktur untersucht, ihn an die Lippen gesetzt, um seinen Geschmack zu erraten und seine Härte einschätzen zu können. Und dann habe ich ihn jedes Mal wieder genau an seinen Platz gelegt, auf dem oberen Regal, zwischen dem Samenkorn des Calvariabaums und den Kaurimuscheln.
Viele Jahre später habe ich es eines Tages gewagt, meinen Vater zu fragen: »Was hat dieser runde Stein eigentlich für eine Bedeutung?« Zu meiner großen Überraschung hat mich mein Vater, der kaum noch ein Wort sagte und erst recht nicht über seine Vergangenheit sprach, plötzlich ins Vertrauen gezogen: »Errätst du das nicht? Dann sage ich dir, was das ist. Als ich etwa zehn Jahre alt war, habe ich diesen Stein inmitten der Zuckerrohrfelder gefunden, in der Nähe von Mahébourg, im Süden. Das Zuckerrohr war gerade geschnitten worden, ich ging aufs Geratewohl über die Felder, während mein Vater jemanden in der Zuckerfabrik von Mon Désert besuchte, und plötzlich habe ich diesen weißen Kieselstein gesehen, der zwischen den Stummeln auf der roten Erde glitzerte. Ich habe ihn mitgenommen, um ihn meinem Vater zu zeigen, und in der Fabrik hat sich ein Ingenieur den Stein angesehen und zu mir gesagt: »Du hast einen ganz seltenen Fund gemacht, das ist der Stein aus dem Muskelmagen eines Dodos. Sieh dir an, wie groß und schwer er ist, dann kannst du dir eine Vorstellung von der Größe des Vogels machen, der diesen Stein in seinem Schlund getragen hat.«
Von diesem Augenblick an wusste ich, dass dieser runde Stein einen Platz in meinem Leben einnehmen würde, und als mein Vater starb, war das der einzige Gegenstand, den ich behalten habe. Meine Mutter hat sich entschlossen, ins Kloster Saint-Charles in den Hügeln von Nizza zu gehen, und alles ist verkauft, in alle Winde zerstreut worden. Die antiken Möbel meiner Großmutter O’Connor – sie hatte ihre Louis-Seize-Sessel mit Lackfarbe gestrichen –, die Nippsachen, die Küchengeräte, das angeschlagene Geschirr, die Truhen mit Spitze und die Schatullen mit Schmuck und Firlefanz, alles ist an Trödler verkauft worden. Ein Antiquariat hat den Posten Bücher, die alten Zeitungen, die Landkarten und Almanache gekauft. Ich habe nur die alte Landkarte von Mauritius aus dem Jahre 1875 im Maßstab 1:25000 aus der Druckerei Descures behalten, die auf einer vergilbten Leinwand um einen Bambusstock gerollt war. Darauf kann man alle Parzellen mit den Namen ihrer Besitzer und die ehemaligen Zuckerfabriken erkennen. Selbstverständlich habe ich Alma und den Namen Felsen gesehen, aber das ist nicht der Grund, warum ich die Karte behalten wollte. Nicht aus Nostalgie, sondern weil die präzise Abgrenzung und die Schraffierung des Reliefs mich bei meiner Suche nach dem ausgestorbenen Vogel leiten konnte und weil manche dieser Namen und manche dieser Orte die einzigen Zeugen dieser Geschichte waren. Ich habe darauf die Spuren der Gehölze, der kleinen Schluchten, der Teiche gefunden und konnte aufgrund dieser Karte mir den großen Vogel ohne Flügel vorstellen, wie er durch das Unterholz rannte, und konnte sogar seinen Schrei hören, seinen verzweifelten Klageruf in seiner von erbarmungslosen Räubern heimgesuchten Einsamkeit. Ich habe die Karte in meinem Zimmer im Studentenheim an die Wand gehängt und den Stein des Muskelmagens in der Hosentasche mit mir herumgetragen, während ich die Seminare im Naturhistorischen Museum besuchte. Das waren meine Fetische. Ich habe den Stein eines Tages meiner Freundin Clara gezeigt, sie hat ihn in ihren kleinen braunen Händen gehalten und der Stein funkelte voll jugendlichem Glanz. Ich glaube, Clara ist die Einzige, die den Stein seit dem Tod meines Vaters berührt hat. Als ich Clara sagte, dass ich nach Mauritius gehen wolle, um eine Abhandlung über diesen Stein des Muskelmagens zu schreiben, hat sie laut gelacht, als hätte ich ihr einen Witz erzählt! Sie hat sogar hinzugefügt: »Du Glückspilz, dann kannst du ja dein Leben an den Stränden der Inseln genießen!« Zu jener Zeit glaubten noch viele Menschen, Mauritius bestände aus mehreren Inseln. Ich habe ihr nicht vorgeschlagen mitzukommen und brauchte mich nicht einmal zu rechtfertigen. Ich hätte ihr nur ungern von dem Wald, den kleinen Schluchten der Rivière Noire, den Schlammtümpeln auf den Anhöhen und den dunstumwobenen Gebirgen erzählt. Ich habe mir die Papiere und das nötige Geld besorgt und meine Reisetasche gepackt, ohne ein paar Längen Tüll für ein Moskitonetz und Ozonpillen für das Wasser der Gebirgsbäche zu vergessen. Ich habe die Karte in ein Papprohr eingerollt und den weißen Stein in meine Mappe gesteckt und bin abgereist.
Inhaltsverzeichnis
Die Mare aux Songes
Ich habe mit dem Anfang angefangen. Ich wusste nicht mehr als das, was ich in den Büchern darüber gelesen hatte. Ich hatte nicht versucht, mir eine Vorstellung davon zu machen. Zunächst laufe ich mit dem Stein des Muskelmagens, wie mit dem Stein der Weisen in der Hand, mitten durchs Zuckerrohr in Richtung Savinia, La Baraque, Le Chaland. Ich setze meine Füße in die Fußstapfen meines Vaters. Ich bemühe mich, seine Kindheitserfahrungen nachzuempfinden, wie er in praller Sonne allein über die geschnittenen Zuckerrohrfelder läuft und plötzlich mitten im Stroh diese weiße Form sieht, wie ein Ei. Selbstverständlich suche ich nichts. Man findet nicht zweimal etwas von solcher Bedeutung. Die Erde ist rot und trocken, sie bildet kleine Haufen, die die Sohlen meiner Turnschuhe nur mit Mühe zertreten. Es ist nicht die gleiche Jahreszeit wie damals: Das Zuckerrohr ist noch nicht geschnitten, die Halme überragen mich, sind hart und schneidend, der Seewind bewegt ihre Blätter mit metallischem Geräusch. Ich gehe nach vorn gebeugt mit vor den Bauch gedrückter Tasche, um mich zu schützen, und tief in die Stirn gezogener Schirmmütze. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Zuckerrohr, so weit das Auge reicht, ein Meer aus Grün, der Himmel ist stahlblau, fast violett. Ab und zu mache ich halt, um einen Schluck lauwarmes Wasser aus einer Plastikflasche zu trinken. Die Sonne steht schon hoch, das Licht ist äußerst grell. Der Geruch des Zuckerrohrs ist fast erstickend, das Stroh gärt am Fuß der Halme, ein Geruch nach Urin und Zucker und auch mein Geruch, der Schweiß rinnt mir über die Augen, über den Hals, ich spüre, wie mir der Stoff meines Hemds an der Haut klebt. Wo bin ich? War das vielleicht hier oder noch ein Stück weiter? Wo hat mein Vater den Stein gefunden? Er hat mir nie den Namen der Stelle genannt, in der Nähe von Mon Désert, auf der Straße nach Le Chaland. Das ist schon lange her, aber hier hat sich nichts verändert. Das Taxi hat mich an der Straße zur Fabrik abgesetzt, und ich habe sogleich einen gewundenen, schmalen Weg durchs Zuckerrohr genommen, der nach kurzer Zeit mitten in der Plantage endete. Ich gehe aufs Geratewohl durch einen Ozean aus Graugrün.
Hier, inmitten des Zuckerrohrs, existiert die Zeit nicht mehr. Ich sehe diesen Ort genauso wie er vor dreihundertzehn Jahren war, zur Zeit der letzten Tage der Dodos. Anstelle des Zuckerrohrs waren hier bestimmt ein niedriger Wald, Ebenholzbäume, Dornenbüsche, vielleicht auch Schilfrohr oder Becken mit hohem Gras, in dem die großen Vögel mit gerecktem Hals herumrannten. Aber es herrschte die gleiche Hitze, die gleichen Böen von feuchtem Wind, die den Meeresgeruch herbeitragen, und hin und wieder Nebelbänke mit kalten Tröpfchen, die vom unsichtbaren Himmel fallen und auf meinem Gesicht prickeln. Die kleinen Tropfen dürften an ihrem lockeren Gefieder hängen geblieben sein, ihren Schnabel benetzt und auf der Erde in den Spuren ihrer Füße mit den drei Zehen geleuchtet haben. Sie dürften ab und zu stehen geblieben sein, reglos und starr wie ein Reptil, und dann ohne Grund wieder losgerannt sein. Ich bewege mich jetzt mit demselben Gang vorwärts, nach vorn gebeugt, den Hals ein wenig gereckt, dem Wind entgegen, die Augen halb geschlossen und die Hände in den Taschen, um mich nicht an den schmalen, scharfen Blättern des Zuckerrohrs zu verletzen. Ich gehe, ohne zu wissen, wohin, in Richtung Osten, ich weiß, dass am Ende das Meer ist, bleibe hin und wieder stehen, um das Rauschen der Wellen zu hören, höre aber nichts anderes als das Säuseln des Winds in den Blättern. Ich suche nichts. Ich blicke nicht mehr vor meinen Füßen auf die Erde. Die Jahrhunderte haben die Erde ausgewaschen, abgeschliffen, bearbeitet, es kann keine Spuren mehr geben. Nichts hat den Wirbelstürmen widerstanden, der Regen ist in Sturzbächen von den hohen Bergen mit der Heftigkeit eines Hochwasser führenden Flusses hinabgeströmt. Irgendwann bin ich so erschöpft von der Sonne und dem Wind, dass ich mich im Zuckerrohr im dürftigen Schatten der Blätter hinsetze. Ich habe den runden Stein noch immer in der rechten Hand. Ich denke: »Wo bist du, Dodo?« Ich rufe sogar seinen Namen, da dieser, wie es scheint, dem Klang seines Schreis nahekommt, ein tiefes, knarrendes Gurren, wie das Geräusch von Steinen, die in eine Schlucht rollen, oder vielleicht wie das Blubbern des weißen Steins in seiner Kehle: DODODOdododo! … Ich warte, in mich zusammengesunken, mit der Stirn auf den Knien. Ich weiß nicht, worauf ich warte, ich warte schon sehr lange auf diesen Augenblick, seit meiner Kindheit, als ich den weißen Stein an meine Wange gepresst und die Augen geschlossen habe. Irgendetwas aus sehr alter Zeit dringt durch die Gesichtshaut, die geschlossenen Lider in mich, irgendetwas, das mich nährt und in meinem Blut zirkuliert, mir meinen Namen sagt, meinen Geburtsort, meine Vergangenheit, eine Wahrheit … Der Wind schüttelt die schmalen Blätter des Zuckerrohrs, stößt sie mit dem Geräusch eines Räderwerks gegeneinander, der Seewind, der sich auf der dürren, brüchigen Erde erwärmt hat, wie kommt es, dass ich diesen Geruch wiedererkenne? Er war schon immer in mir, kommt von meinem Vater, meinem Großvater Alexis, von allen Felsens, die nacheinander auf dieser Insel gelebt haben, seit Axel und seine Frau Alma sich hier ansiedelten, der Geruch ihres Fleisches und ihrer Haut in meinem Fleisch und meiner Haut. In diesem Moment wird der Himmel von einem Brummen erfüllt, das die Erde erzittern lässt, und ich ziehe den Kopf ein wie ein verängstigter Vogel, der das Brummen eines unbekannten Raubtiers hört, das Dröhnen einer Kanone auf dem Meer. Ein Schatten mit ausgebreiteten Flügeln gleitet langsam über das Zuckerrohr, auf seinem Rumpf spiegelt sich das Licht, ein Jumbojet mit seiner Ladung von Touristen ist gerade gestartet, ich habe den Eindruck, das knisternde Geräusch von Blitzlichtern in der Kabine zu hören, er fliegt schwerfällig über mich her, gewinnt mühevoll an Höhe über Plaisance, ehe er in einer Kurve über dem Ozean verschwindet.
Vor Einbruch der Dunkelheit gelange ich in die Nähe der Mare aux Songes, des Teichs der Träume. Trotz der Karte hatte ich Mühe, ihn zu finden. Ich musste eine Schlucht voller Gestrüpp hinauflaufen und einen Hain aus Ebenholz und Tamarinden durchqueren. Auf einem schmalen Feldweg mit tiefen Traktorspuren. Ich hielt Ausschau nach der Farbe von Wasser. Aber statt eines Teichs fand ich nur eine runde, von Wald umgebene Senke aus Gras und Schilf. Hier hat 1865 ein gewisser Roy, Vorarbeiter auf dem Gut von Gaston de Bissy, zufällig ein Gerippe entdeckt, als er den Teich auf der Suche nach Schlammschollen sondieren ließ, die er für neue Anpflanzungen entnehmen wollte. Würfel aus schwarzer, tonhaltiger, mit verwesenden Pflanzen vermischter Erde. Die indischen Arbeiter hatten sich einen Schal vor den Mund gebunden, um nicht die übel riechenden Dünste einzuatmen. Zu jener Zeit war noch Wasser im Teich, die Arbeiter waren barfuß und hatten sich nur ein langouti um die Hüften geschlungen, ihre schwarze Haut war schweißgetränkt. Die ersten Überreste sind sogleich aufgetaucht, einer der Arbeiter hat Alarm geschlagen: »Missié, da sind Knochen, Missié Roy.« Er hat ihm einen Klumpen aus schwarzer Erde gezeigt, in dem weiße Knochen zu sehen waren. Roy hat sich die Überreste genau angesehen und darin Teile des Skeletts eines unglaublich großen Vogels erkannt, einen Brustbeinkamm, Rippen und Rückenwirbel. Anschließend sind die Knochen der Beine ans Tageslicht gekommen, sie waren derart dick und lang, dass sie unmöglich einem Seevogel gehören konnten, wie beispielsweise einem Albatros, der sich im Sturm verirrt hat. Nachdem die Knochen mit Süßwasser gereinigt worden waren, das die Arbeiter in einem Kanister zum Trinken mitgebracht hatten, stellte sich heraus, dass die Knochen von seltsam blau geäderter schwarzer Farbe waren, im Gegensatz zum Weiß der Rippen, die Farbe eines Tiers aus alten Zeiten, das seit Jahrhunderten ausgestorben war. Ausgebreitet im Gras am Rand des Teichs schimmerte das Skelett in einem geheimnisvollen, fast bedrohenden Glanz. Die Arbeiter umringten es und betrachteten es ratlos. Von Roy benachrichtigt, traf Schulmeister Clarke, der die Küste von Mahébourg erforschte, eine knappe Stunde später mit einem Pferdewagen dort ein. Die Blöcke aus Löss und Torf rings um den Teich waren inzwischen trocken und sahen aus wie Grabsteinplatten. Im Schutz einer Segeltuchplane, die im Wind knatterte, saßen Roy, Gaston de Bissy und ein paar Arbeiter. Die Männer warteten auf den Befehl, sich wieder an die Arbeit zu machen und Schlammklumpen herauszuholen, aber es lag auf der Hand, dass das Auftauchen dieses seltsamen Vogels aus den Tiefen des Teichs jegliche profane Tätigkeit unterbrochen hatte. »Was du da ausgegraben hast, mein Lieber«, verkündete Clarke, »ist ganz einfach ein Raphus cucullatus, der Urahn dieser Insel, die berühmte Dronte, oder anders gesagt, ein Dodo.« Er hatte sich niedergekniet wie vor einem Ossuarium und nahm vorsichtig die langen Knochen, um sie anderswo, in einer anderen Anordnung, wieder hinzulegen, bis das Skelett des riesigen Vogels als solches zu erkennen war, lang auf dem Boden ausgestreckt, als verfiele es in ewigen Schlaf. »Schade, dass ihm ein Teil des Kopfes und der Unterkiefer fehlt, sonst stände er in nichts den Exemplaren in Amsterdam oder Oxford nach.«
Nachdem er sich erkundigt hatte, an welcher Stelle genau der Arbeiter die Knochen ausgegraben hatte, stieg Clarke ohne Rücksicht auf seine weiße Baumwollhose in den Teich und begann den Boden mit einer Schaufel zu sondieren. Wenige Minuten später hob er die Schaufel mit einem Klumpen Schlamm, der die Form einer abgeflachten Kugel hatte, aus dem Wasser, die sich, nachdem man sie abgespült, gereinigt und getrocknet hatte, als ein Schädeldach herausstellte, das in einem riesigen, schweren Schnabel endete, der in der gleichen blauschwarzen Farbe der Tiefen schimmerte. Sichtlich gerührt legte Clarke den Kopf ans obere Ende der Wirbellinie, und so wurde zum ersten Mal im grellen Licht der Mittagssonne ein Ebenbild dieses ungeheuerlichen und zugleich vertrauten Vogels auf perfekte Weise sichtbar, wie er auf seinen Füßen hockt, die in drei langen, mit Krallen bewaffneten Zehen enden – tot und zugleich wieder zum Leben erweckt – vermutlich hatte er schon immer auf diesen Augenblick gewartet.
»Wenn ich daran denke, dass ich mein ganzes Leben lang in den Bergen nach ihm gesucht habe, und dabei war er hier, nur ein paar Schritte von Meer entfernt.«
In den darauffolgenden Tagen wurde die Mare aux Songes zum Schauplatz einer kollektiven Raserei. Die indischen Arbeiter, die Plantagenverwalter, die Neugierigen aus der Nachbarschaft gingen manchmal bis zu den Hüften ins Wasser, und zwar barfuß, um die Unebenheiten der im Schlamm des Teichs verborgenen Knochen zu spüren.