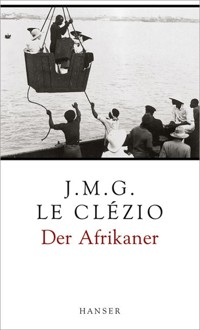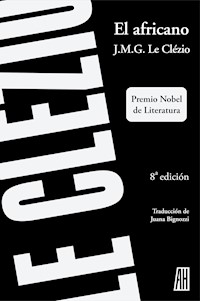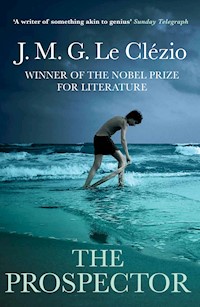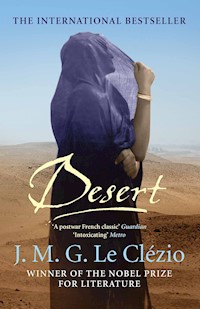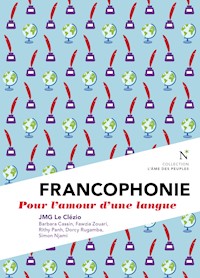16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Nobelpreisträger J.M.G. Le Clézio – der Meister des Subtilen Die beiden Novellen in J.M.G. Le Clézios neuem Buch sind wie die zwei Seiten einer Medaille. Mit viel Einfühlungsvermögen und Gespür für Details erzählt er von Menschen, die fernab der Schauplätze der Geschichte – auf einer japanischen Insel, in Afrika, in der Pariser Banlieue – nach schweren Schicksalsschlägen die Kraft für einen Neuanfang finden. So wie in der Titelgeschichte der Journalist Philip Kyo, der auf der japanischen Insel Udo einer verlorenen Liebe nachspürt und der schwer an einer Verfehlung in seiner Vergangenheit trägt. Zwischen ihm und der 13-jährigen, vaterlosen June, Tochter einer Muscheltaucherin, entspinnt sich eine besondere Beziehung, die für beide zum Auslöser wird, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Anders die Geschichte von Rachel aus der zweiten Novelle. Als ihre Familie zerbricht und sie ihr geliebtes Afrika verlassen muss, um nach Frankreich zu ziehen, ist sie gezwungen, sich nicht nur nach außen, sondern auch im Verhältnis zu ihrer Familie völlig neu zu orientieren. Ein schmerzhafter und langwieriger Prozess, bei dem nur die Liebe zu ihrer Schwester sie vor einer Katastrophe bewahrt und ihr am Ende hilft, eine wegweisende Entscheidung zu treffen. Licht und Schatten, Tod und Neuanfang, Wissen und Nicht-Wissen, zwischen diesen Polen siedelt Le Clézio seine Geschichten an. Den Blick gleichermaßen nach innen und nach außen gerichtet. Meisterhaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Ähnliche
J. M. G. Le Clézio
Sturm
Zwei Novellen
Aus dem Französischen von Uli Wittmann
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über J. M. G. Le Clézio
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Sturm
Für die Haenyo,
die Seefrauen der Insel Udo
Die Nacht bricht auf der Insel an.
Die Nacht füllt nach und nach die Senken, dringt zwischen die Felder, eine Schattenflut, die bald alles bedeckt. Im gleichen Moment verlassen die Touristen die Insel. Jeden Morgen treffen sie mit der Acht-Uhr-Fähre ein, ergießen sich wie ein Strom über die leeren Flächen, bevölkern die Strände und rinnen wie Schmutzwasser über Straßen und Sandwege. Wenn es Nacht wird, leeren sie die Tümpel wieder, fließen zurück, verschwinden. Die Schiffe schaffen sie fort. Und dann ist die Nacht da.
Ich war vor dreißig Jahren zum ersten Mal auf dieser Insel. Die Zeit hat alles verändert. Ich erkenne die Landschaft, die Hügel, die Strände und die Form des eingefallenen Kraters im Osten kaum wieder.
Warum bin ich hierher zurückgekehrt? Gibt es für einen Schriftsteller keinen anderen Ort, an dem er schreiben kann? Keine andere Zufluchtsstätte – fernab vom Lärm der Welt, mit weniger Geschrei, weniger Arroganz –, an der er sich vor einer Wand an seinen Arbeitstisch setzen kann, um seine Zeilen auf der Schreibmaschine zu tippen? Ich wollte diese Insel wiedersehen, dieses Fleckchen Erde ohne Geschichte und ohne Erinnerung, dieses vom Ozean umbrandete und von Touristen überlaufene Felsenreich.
Dreißig Jahre, die Lebensdauer einer Kuh. Ich war gekommen wegen des Windes, des Meeres, der umherirrenden halbwilden Pferde, die ihre Leine hinter sich herziehen, wegen der Kühe nachts mitten auf den Wegen, ihres tragischen Muhens wie ein Nebelhorn und des Kläffens der angeketteten Hunde.
Vor dreißig Jahren gab es keine Hotels auf der Insel, nur Gästezimmer in der Nähe des Anlegers, die jeweils für eine Woche zu vermieten waren, und Esslokale in Holzbaracken am Strand. Wir hatten ein kleines Holzhaus ohne Komfort auf einer Anhöhe gemietet, es war ideal, auch wenn es feucht und kühl war. Mary Song war zwölf Jahre älter als ich, hatte schönes dunkles, fast schwarzblaues Haar, und Augen in der Farbe von Herbstblättern, sie hatte in Bangkok in einem Hotel für wohlhabende Touristen als Bluessängerin gearbeitet. Warum hatte sie darauf bestanden, mich auf diese abgelegene Insel zu begleiten? Es war nicht meine Idee gewesen, sie hatte mich auf den Gedanken gebracht, glaube ich. Oder sie hatte gehört, wie jemand von einer abgelegenen Felseninsel erzählt hatte, die bei Sturm vom Rest der Welt abgeschnitten war. »Ich brauche Stille.« Oder es war meine Idee gewesen, ich hatte an die Stille gedacht. Um zu schreiben, um nach den verlorenen Jahren wieder anzufangen zu schreiben. Die Stille, die Entfernung. Die Stille, umgeben von Wind und Meer. Die kalten Nächte, die Anhäufung von Sternen.
Jetzt ist all das nur noch eine Erinnerung. Das Gedenken ist unwichtig, folgenlos. Nur die Gegenwart zählt. Diese Erkenntnis habe ich teuer bezahlt. Der Wind ist mein Gefährte. Er bläst ununterbrochen auf diese Felsen, er kommt vom Horizont im Osten, prallt auf die zerklüftete Vulkanwand, weht über die Hügel, schlängelt sich durch die kleinen Mauern aus Lavablöcken und gleitet über den Korallensand und die zermalmten Muscheln. Nachts pfeift der Wind im Zimmer meines Hotels (Happy Day – wie ist dieser Name bloß hierhergekommen, ein unvollständiger Name auf einer gestrandeten Holzkiste?) durch die Ritzen neben Fenstern und Tür, weht durch den leeren Raum, in dem das verrostete Eisenbett ebenfalls wie Strandgut wirkt. Es gibt keinen anderen Grund für mein Exil, für meine Einsamkeit, nur das Grau des Himmels und des Meeres und die durchdringenden Rufe der Taucherinnen, die Seeohren fischen, ihre Schreie, ihre Pfeiftöne, so etwas wie eine unbekannte, archaische Sprache, die Sprache der Meerestiere, die die Welt lange vor der Existenz des Menschen bevölkert haben … Ahuah, iya, ahi, ahi! … Die Taucherinnen waren schon da, als Mary mich auf diese Insel mitgenommen hat. Damals war alles anders. Die Muscheltaucherinnen waren zwanzig, schwammen unbekleidet, die Taille mit Steinen beschwert, und trugen Taucherbrillen, die sie den Leichen japanischer Soldaten entwendet hatten. Sie hatten weder Schuhe noch Handschuhe. Heute sind sie weitaus älter, tragen schwarze Taucheranzüge aus Gummi, Handschuhe aus Neopren und bunte Füßlinge aus Plastik. Wenn sie ihr Tagewerk verrichtet haben, schieben sie in Kinderwagen ihre Ernte die Küstenstraße entlang. Manchmal haben sie einen Elektroroller oder ein Dreirad mit Benzinmotor. An ihrem Gürtel hängt ein Messer aus rostfreiem Metall. Sie ziehen ihre Taucheranzüge neben einer Hütte aus Hohlblocksteinen aus, die inmitten der Felsen für sie errichtet worden ist, spritzen sich mit einem Schlauch im Freien ab und humpeln dann, von Rheuma gebeugt, nach Hause zurück. Der Wind hat ihre Jahre fortgeweht, und meine auch. Der Himmel ist grau, hat die Farbe der Reue. Das Meer ist unruhig, stürmisch, es brandet gegen die Riffe, auf die Lavaklippen, es strudelt und plätschert in den großen Lachen der schmalen Buchten. Ohne diese Frauen, die jeden Tag fischen, würde das Meer feindlich, unzugänglich wirken. Ich lausche jeden Morgen den Schreien der Seefrauen, ihrem keuchenden Atem, wenn sie auftauchen, ahuiii, iya, dann denke ich an die vergangene Zeit zurück, an Mary, die verschollen ist, höre ihre Stimme wieder, wie sie einen Blues singt, denke an ihre Jugend, an meine Jugend. Der Krieg hat alles zunichtegemacht, der Krieg hat alles zerstört. Der Krieg erschien mir zu jener Zeit schön, ich wollte über ihn schreiben, ihn erleben und dann über ihn schreiben. Der Krieg war wie eine schöne junge Frau mit traumhafter Figur, langem schwarzem Haar, hellen Augen und bezaubernder Stimme, doch sie hat sich in ein struppiges, boshaftes altes Weib verwandelt, in eine rachsüchtige, unbarmherzige Xanthippe voller Grausamkeit. Die Bilder kommen mir wieder vor Augen, tauchen aus der Tiefe auf. Verrenkte Leichen und abgeschlagene Köpfe, die schmutzige Straßen übersäen, Benzinlachen, Blutlachen. Ein bitterer Geschmack im Mund, übler Schweiß. In einem fensterlosen kleinen Raum, der von einer einzigen nackten Glühbirne erhellt wird, halten vier Männer eine Frau fest. Zwei von ihnen sitzen auf ihren Beinen, einer hat ihre Handgelenke mit einem Gurt festgebunden, der vierte ist damit beschäftigt, sie unendlich lange zu vergewaltigen. Kein Geräusch ist zu hören, wie in einem Traum. Nur das heisere Keuchen des Vergewaltigers und das schnelle, vor Angst halb erstickte Hecheln der Frau, sie hat anfangs womöglich geschrien, denn auf ihrer Unterlippe ist die Spur eines Schlags zu sehen, sie ist geplatzt, und das herabgeronnene Blut hat auf ihrem Kinn einen Stern hinterlassen. Das Keuchen des Vergewaltigers beschleunigt sich, verwandelt sich in ein tiefes, beklemmtes Röcheln, wie das abgehackte, dröhnende Rasseln einer Maschine, ein Geräusch, das immer schneller wird und nie aufhören zu wollen scheint.
Die Geschichte mit Mary, die mehr trank als zuträglich ist und die vom Meer verschlungen worden ist, hat sich erst viel später ereignet. »Das könnte ich auch«, hatte sie gesagt, als wir die Meerenge überquerten, die die Insel vom Kontinent trennt. Sie ist bei Sonnenuntergang ins Wasser gegangen. Die Ebbe hatte die Wellen geglättet, die weinfarbenen Kreise breiteten sich nur langsam aus. Jene, die sie ins Wasser haben gehen sehen, haben gesagt, sie sei ruhig gewesen und habe gelächelt. Sie trug ihren ärmellosen, halblangen blauen Schwimmanzug und ließ sich zwischen die schwarzen Klippen gleiten, dann begann sie zu schwimmen, bis die Wellen oder die Spiegelung der untergehenden Sonne sie den Blicken der Zuschauer entzogen.
Ich habe nichts davon gewusst, nichts gesehen, nichts geahnt. Im Schlafzimmer unserer Holzhütte lagen ihre Kleider sorgsam gefaltet und gestapelt, als wolle sie verreisen. Die Reisschnapsflaschen waren leer, die Zigarettenschachteln offen. Eine Reisetasche enthielt ein paar vertraute Gegenstände, Kamm und Haarbürste, Pinzette, Spiegel, Schminke, Lippenstift, Taschentuch, Schlüssel, etwas amerikanisches und japanisches Geld, all das, als würde sie in zwei Stunden zurückkommen. Der einzige Polizeibeamte dieser Insel – ein junger Mann mit jugendlichem Aussehen, das Haar mit einer Bürstenfrisur – hat die Bestandsaufnahme gemacht. Aber er hat mir alles überlassen, als sei ich ein Angehöriger oder ein Freund. Und ich bin beauftragt worden, über ihre sterblichen Reste zu verfügen, sie einzuäschern oder sie ins Meer zu werfen, falls man etwas finden sollte. Aber es hat nie etwas anderes gegeben als diese unbedeutenden Habseligkeiten. Die Vermieterin hat sich ein paar Dinge aus der Garderobe ausgesucht, hat die hübschen blauen Schuhe behalten, den Strohhut, die Seidenstrümpfe, die Sonnenbrillen und die Handtasche. Ich habe die Papiere im Hof verbrannt. Die Schlüssel und die persönlichen Gegenstände habe ich vom Deck des Schiffes, das mich zum Kontinent zurückgebracht hat, ins Meer geworfen. Im Wasser funkelte irgendetwas mit goldenem Glanz, ich habe mir gesagt, dass ein gefräßiger Fisch, ein Barsch oder eine Meeräsche sie wohl verschlungen hatte.
Ihre Leiche ist nie gefunden worden. Mary mit der zarten, bernsteinfarbenen Haut, den muskulösen Beinen einer Tänzerin, einer Schwimmerin, und dem langen schwarzen Haar. »Aber warum?«, hat der Polizeibeamte gefragt. Mehr hat er nicht gesagt. Als würde ich eines Tages eine Antwort darauf erhalten. Als besäße ich die Lösung des Rätsels.
Wenn Sturm aufkommt und der Wind ununterbrochen aus dem Osten weht, kommt Mary wieder. Ich habe nicht etwa Halluzinationen und auch keine Tendenz zum Wahn (selbst wenn der Gefängnisarzt in seinem Bericht den unheilvollen Buchstaben Ψ in die Kopfzeile meiner Akte geschrieben hat), ganz im Gegenteil, alle meine Sinne sind hellwach, alarmbereit und ganz auf die Außenwelt gerichtet, um das zu empfangen, was Meer und Wind mir bringen. Nichts genau Definierbares, aber dennoch das Gefühl von etwas Lebendigem, nichts Totem, das meine Haut mit einem Nimbus umgibt, und das weckt die Erinnerung an die Liebesspiele von Mary und mir, die langen Liebkosungen von unten bis oben, im Halbdunkel unseres Schlafzimmers, der Atem, der Geschmack der Lippen, die tiefen Küsse, die mich erschauern ließen, bis zur langsamen Welle der Liebe, wenn unsere beiden Körper vereint waren, Bauch an Bauch, all das, was mir seit Langem verboten ist, was ich mir selbst verboten habe, denn ich bin für den Rest meines Lebens in einem Gefängnis.
Bei Sturm höre ich ihre Stimme, spüre ich ihr Herz, spüre ich ihren Atem. Der Wind pfeift durch die Zwischenräume in der Fensterwand, dringt durch die verrosteten Schmalseiten herein, strömt durch den Raum und lässt die Tür schlagen. Dann kommt alles auf der Insel zum Stillstand. Die Fähren überqueren nicht mehr den Meeresarm, die Motorroller und die Autos stellen ihren Reigen ein, der Tag ähnelt einer dunklen, von Blitzen durchzuckten Nacht ohne Donner. Mary ist an einem windstillen Abend im spiegelglatten Meer davongegangen. Bei Sturm kehrt sie wieder, wird Atom für Atom aus den Tiefen ausgestoßen. Anfangs wollte ich es nicht glauben. Ich war entsetzt, presste die Hände gegen die Schläfen, um diese Bilder zu verscheuchen. Ich erinnere mich an einen Ertrunkenen. Keine Frau, sondern ein siebenjähriges Kind, das eines Abends verschwunden ist, Mary und ich haben es gemeinsam mit den Insulanern die halbe Nacht gesucht. Wir gingen mit einer Taschenlampe in der Hand am Meer entlang und riefen das Kind, aber wir kannten seinen Namen nicht, Mary schrie: »Ohe, mein Schatz!« Sie war zutiefst bewegt, Tränen rannen ihr über die Wangen. An jenem Tag hatten wir ebensolchen Wind, ebensolche hohen Wellen und diesen verwünschten Tiefseegeruch. Im Morgengrauen verbreitete sich die Nachricht, die Leiche des Kindes sei gefunden worden. Wir sind zwischen den Felsen zu einem Sandstrand gegangen, von einem Klagelaut geleitet, den wir für die Stimme des Windes gehalten hatten, aber es war die der Mutter des Kindes. Sie saß im schwarzen Sand mit dem Kind auf ihrem Schoß. Das Kind war nackt, es war vom Meer entkleidet worden, bis auf ein schmutziges T-Shirt, das seinen Oberkörper wie eine verdrehte Kordel umgab. Sein Gesicht war kreideweiß, aber ich habe sofort gesehen, dass Fische und Krebse seinen Körper schon angeknabbert, die Nasenspitze und den Penis gefressen hatten. Mary hatte sich dem Kind nicht nähern wollen, sie zitterte vor Angst und Kälte, und ich habe sie an mich gedrückt, und dann haben wir uns ins Bett gelegt und uns eng aneinandergeschmiegt, ohne uns zu streicheln, und Mund an Mund geatmet.
Dieses Bild verfolgt mich, der Körper dieser mit ausgebreiteten Armen und Beinen auf dem Boden liegenden Frau, während die Soldaten sie hernehmen, und das zu einem schwarzen Stern verkrustete Blut unter ihrem verletzten Mund. Und ihre Augen, die mich anblicken, während ich im Hintergrund in der Nähe der Tür stehe, ihre Augen, die durch mich hindurch den Tod sehen. Ich habe nie mit Mary darüber gesprochen, und dennoch ist sie wegen dieser schrecklichen Szene ins Meer gegangen, um nie wiederzukommen. Das Meer wäscht den Tod rein, das Meer zernagt, zerfrisst und gibt nichts zurück, oder höchstens die angefressene Leiche eines Kindes. Anfangs habe ich geglaubt, ich kehrte auf diese Insel zurück, um hier zu sterben, wie Mary. Um ihre Spur wiederzufinden und eines Abends ins Meer zu gehen und zu verschwinden.
Bei Sturm kommt sie zu mir ins Schlafzimmer. Es ist ein Wachtraum. Ich werde vom Geruch ihres Körpers geweckt, der sich mit dem der Tiefen vermischt hat. Ein scharfer, kräftiger Geruch, herb, beißend, finster und tosend. Ich rieche den Algenduft ihres Haars. Ich spüre ihre zarte, durch die Reibung der Wellen geglättete, vom Salz schimmernde Haut. Ihr Körper treibt im Licht der Dämmerung, gleitet unter die Bettdecke, und mein steifes Glied dringt in sie, bis ich erschauere, sie umschließt mich mit ihrem eisigen Fieber, ihr Körper gleitet gegen meinen, ihre Lippen pressen sich um mein Glied, ich bin ganz in ihr, und sie ist ganz in mir, bis zum Orgasmus. Mary, die seit dreißig Jahren tot ist und deren Leiche man nie gefunden hat. Mary, die aus den Tiefen des Ozeans zurückgekehrt ist und mir mit ihrer leicht heiseren Stimme ins Ohr flüstert, die gekommen ist, um für mich vergessene Melodien zu singen, Sternenlieder, die sie für mich in der Bar des Hotels Oriental gesungen hat, als ich ihr zum ersten Mal begegnet bin. Eigentlich keine Bar für Soldaten, und auch sie war eigentlich keine Barsängerin. Als ich sie damals sah, wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, wer sie war: von einem GI gezeugt und von einer Familie von rednecks in Arkansas aufgenommen, Frucht einer Vergewaltigung, im Stich gelassen und schließlich hierher zurückgekehrt, um ihren Erzfeind zu besiegen, sich zu rächen oder nur wegen jenes Atavismus, der die Menschen unweigerlich in ihre ursprüngliche Bahn zurückwirft. Aber ich war kein Soldat, das hatte sie begriffen, vermutlich war ihre Wahl deshalb auf mich gefallen, einen Typen im Kampfanzug, mit kurz geschorenem Haar, der mit einem Fotoapparat in der Hand den Truppen folgte, um eine Chronik aller Kriege zu erstellen. Ich erinnere mich an das erste Mal, an dem wir miteinander gesprochen haben, nach ihrer Blues-Session, spätabends oder frühmorgens auf einer Hochterrasse am Ufer des Chao Phraya, sie hat sich hinabgebeugt, um etwas am Boden zu betrachten, einen schwarzen Nachtfalter, der mit flatternden Flügeln im Todeskampf lag, und durch den Ausschnitt ihres roten Kleides habe ich ihre nackten Brüste gesehen, sehr zart und anziehend. Sie wusste nichts über mich und ich nichts über sie. Doch schon damals ließ mir die brennende Wunde des Verbrechens keine Ruhe, ich glaubte, das würde vorübergehen. Ich hatte die Vergangenheit vergessen, den Strafantrag gegen die vier Soldaten, die eine Frau in Hué vergewaltigt hatten. Gegen den, der ihre nach hinten gedrehten Arme festgehalten und ihr einen Schlag auf die Lippen versetzt hatte, um sie zum Schweigen zu bringen, und gegen den, der sie ohne die geringste Hemmung vergewaltigt und dabei nicht einmal die Hose heruntergelassen hatte, und gegen mich, der wortlos zugesehen und so gut wie nicht reagiert oder höchstens eine leichte Erektion bekommen hatte, aber zusehen und schweigen heißt handeln.
Ich hätte alles darum gegeben, nicht dabei gewesen, nicht Zeuge dieser Szene geworden zu sein. Ich habe mich vor Gericht nicht verteidigt. Die junge Frau war da, in der ersten Reihe. Ich habe einen flüchtigen Blick auf sie geworfen und sie nicht wiedererkannt. Sie wirkte jünger, fast wie ein Kind. Sie saß regungslos auf der Bank, das Gesicht im Licht einer Neonleuchte. Ihr kleiner Mund war geschlossen, ihre Gesichtshaut wirkte aufgrund ihres zu einem Knoten gebundenen schwarzen Haars sehr straff. Irgendjemand las ihre Zeugenaussage auf Englisch vor, doch auch dabei rührte sie sich nicht. Die vier Soldaten saßen auf einer anderen Bank, ein paar Meter von ihr entfernt, und auch sie rührten sich nicht. Sie sahen niemanden an, starrten nur auf die gegenüberliegende Wand und das Podest, auf dem der Richter saß. Sie dagegen kamen mir gealtert vor, waren fettleibig und hatten die fahle Gesichtsfarbe von Strafgefangenen.
Das habe ich Mary nie erzählt. Als ich sie im Hotel Oriental kennenlernte, fragte sie mich, was ich gemacht hätte, nachdem ich die Armee verlassen hatte. Ich habe ihr geantwortet: »Nichts … Ich bin viel gereist, das ist alles.« Sie hat mir keine Fragen gestellt, im Übrigen hätte ich nie den Mut gehabt, ihr die Wahrheit zu sagen: »Ich bin zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil ich Zeuge eines Verbrechens geworden bin und nichts unternommen habe, um es zu verhindern.«
Ich wollte mit Mary leben, mit ihr verreisen, ihr zuhören, wenn sie sang, das Leben und das Bett mit ihr teilen. Wenn ich ihr all das gesagt hätte, hätte sie mich vor die Tür gesetzt. Ich habe ein Jahr mit ihr zusammengelebt, bevor wir auf diese Insel kamen. Und eines Tages hat sie beschlossen, ins Meer zu gehen. Das habe ich nie verstanden. Wir lebten völlig zurückgezogen. Niemand kannte uns, niemand hat ihr die Sache erzählen können. Vielleicht war sie ganz einfach verrückt, und es gab keine Erklärung für ihr Handeln. Sie hat sich von den Wellen forttragen lassen. Sie war eine ausgezeichnete Schwimmerin. Mit sechzehn war sie in die Auswahlmannschaft der USA für die Olympischen Spiele in Melbourne aufgenommen worden. Sie hieß Farrell, Mary Song Farrell. Song, weil man sie unter diesem Namen ihren Adoptiveltern anvertraut hatte. Vermutlich hieß ihre Mutter Song. Oder sie war Sängerin, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich diese ganze Geschichte nachträglich erfunden.
Ich erfinde nichts für andere Leute, sie interessieren mich nicht. Ich bin es nicht gewohnt, in Bars aus meinem Leben zu plaudern. Ich kenne die Familie aus Arkansas nicht, diese Farrells. Landwirte. Bei ihnen hat Mary gelernt, Vieh zu versorgen, Motorräder zu reparieren und einen Traktor zu fahren. Und eines Tages, mit achtzehn, hat sie sich davongemacht, um anderswo zu leben, um zu singen. Dazu fühlte sie sich berufen. Sie hat ein anderes Leben geführt, ist nie auf den Bauernhof zurückgekehrt. Als sie im Meer verschwunden ist, habe ich versucht, die Eltern wiederzufinden, ich habe Briefe an die County-Verwaltung geschrieben, um ihre Adresse herauszufinden. Keiner meiner Briefe ist zurückgekommen.
Als ich Mary kennenlernte, war sie fast vierzig, aber sie wirkte viel jünger. Ich war achtundzwanzig und gerade aus dem Gefängnis entlassen worden.
Der Sturm leiht mir seine Wut. Ich brauche seine gellenden Schreie, sein Fauchen wie der Blasebalg einer Schmiede. Wegen des Sturms bin ich auf diese Insel zurückgekehrt. Dann wird alles geschlossen, die Menschen verschwinden in ihren Häusern, schließen die Fensterläden, verbarrikadieren die Türen, ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück, in ihren Panzer. Verschwunden sind auch die Touristen mit ihrer naiven, siegessicheren Miene, ihren Posen, ihrer Mimik und ihrem affektierten Gehabe. Die Mädchen in Minishorts auf ihren Fahrrädern, die Jungen auf einem Quad, mit Polaroid-Sonnenbrille, Fotoapparat und Rucksack sind in die Stadt zurückgekehrt, in ihre condominiums, in ihre Länder, in denen es niemals stürmt.
Die Insulaner haben sich vergraben. Sie sitzen in ihren Unterkünften mit beschlagenen Scheiben auf dem Boden und spielen Karten, trinken Bier. Das elektrische Licht flackert, bald wird es die große Panne geben. Dann lassen die Kühltruhen der Geschäfte pissgelbes Wasser aussickern, die Salzfische schmelzen, verlieren ihre Augen, und die Eislollis mit Schokoladenüberzug weichen in ihrer Verpackung auf. Wegen des Sturms bin ich hierher zurückgekehrt. Ich fühle mich wieder wie im Krieg, als ich aufs Geratewohl der wilden Flucht der Truppen folgte und auf Lautsprecher horchte, aus denen unverständliche Befehle dröhnten. Ich versetze mich in eine frühere Zeit zurück, baue mir ein neues Leben auf. Wünschte mir, noch einmal auf die Türschwelle des Hauses in Hué zurückkehren und einen Blick hineinwerfen zu können, einen Blick, der die Zeit anhalten, Verwirrung stiften und die Frau von ihren Henkern befreien kann. Aber nichts von dem, was ich weiß, lässt sich aus dem Gedächtnis streichen. Die Insel ist die Bestätigung für die Unmöglichkeit der Erlösung. Der Beweis für die Unfähigkeit. Die Insel ist der letzte Hafenkai, die letzte Zwischenstation vor dem Nichts. Deshalb bin ich wieder hergekommen. Nicht um die Vergangenheit wiederzufinden, nicht um eine Spur zu wittern wie ein Hund. Sondern, um sicherzugehen, dass ich nichts wiedererkenne. Damit der Sturm endgültig alles verwischt, da das Meer die einzige Wahrheit ist.
Mein Name ist June. Meine Mutter ist eine Seefrau. Ich habe keinen Vater. Meine Mutter heißt Julia, sie hat noch einen anderen Namen, der nicht christlichen Ursprungs ist, aber sie will nicht, dass ich ihn nenne. Als ich geboren wurde, hatte mein Vater meine Mutter bereits im Stich gelassen. Meine Mutter hat einen Vornamen für mich gesucht, ihr Großvater hieß Jun, ein chinesischer Name, weil er aus diesem Land stammte, und so hat sie mich June genannt, weil das auf Amerikanisch Juni heißt und weil ich in jenem Monat gezeugt worden bin. Ich bin groß, habe dunkle Haut, und die Familie meiner Mutter hat mich verwünscht, weil ich keinen Vater habe. Deshalb hat meine Mutter mich mitgenommen, und wir haben uns auf dieser Insel niedergelassen. Ich war vier, als wir hier gelandet sind, und ich erinnere mich nicht mehr an die Zeit davor und auch nicht an die Reise, nur daran, dass meine Mutter und ich mit einem Schiff hergekommen sind und dass es regnete, ich trug einen schweren Rucksack, in dem sie allen Schmuck und alle Wertsachen versteckt hatte, um sie nicht zu verlieren, denn sie hatte sich gesagt, dass niemand den Rucksack eines vierjährigen Mädchens stehlen würde. Anschließend hat sie fast allen Schmuck verkauft, bis auf ein Paar goldene Ohrringe und ein Halsband, das ebenfalls aus Gold ist oder zumindest aus vergoldetem Metall. Ich erinnere mich, dass es bei der Überfahrt geregnet hat. Vielleicht habe ich auch geweint. Oder der Regen hat mein Gesicht genässt und mir das Haar an den Mund geklebt. Lange habe ich geglaubt, dass der Himmel weine, wenn es regnet. Aber jetzt weine ich nie mehr.
Meine Mutter ist keine richtige Seefrau, ich meine wie die hiesigen Frauen, die diesen Beruf seit ihrer Kindheit ausüben und die großen schwarzen Walen ähneln, vor allem wenn sie aus dem Wasser kommen und auf ihren dürren, alten Beinen taumeln. Meine Mutter ist noch jung, sie ist sehr hübsch und schlank, hat schönes glattes Haar und ein fast faltenloses Gesicht, aber vom vielen Muschelablösen sind ihre Hände rot geworden und ihre Nägel abgebrochen. Meine Mutter stammt nicht von hier. Sie ist in der Hauptstadt geboren, sie war Studentin, als sie schwanger wurde und mich erwartete. Mein Vater hat sie sitzen lassen, weil er kein Kind haben wollte, und ist ans andere Ende der Welt gegangen, und da hat meine Mutter beschlossen, sich bis zu meiner Geburt zu verstecken, und um ihrer Familie keine Schande zu machen, hat sie die Hauptstadt verlassen und ist aufs Land gegangen, um dort zu leben. Um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, hat sie alle möglichen Jobs angenommen, sie hat auf einer Entenfarm gelebt, sie hat in einem Restaurant gearbeitet, das Geschirr gespült und die Latrinen gereinigt. Und dann ist sie mit mir als Säugling von Stadt zu Stadt gezogen, bis in den Süden, und eines Tages hat sie von dieser Insel gehört, hat das Schiff genommen und ist hier gelandet. Zunächst hat sie in Restaurants gearbeitet, dann hat sie sich eine Taucherbrille und einen Taucheranzug gekauft und hat begonnen nach Seeohren zu tauchen.
Die meisten Seefrauen sind alt. Wenn ich mit ihnen spreche, rede ich sie mit »Großmutter« an. Meine Mutter war noch jung, als sie hier ankam. Die Frauen haben zunächst zu ihr gesagt: »Was willst du hier? Geh zurück in die Stadt, aus der du kommst.« Aber sie hat durchgehalten, und die Frauen haben sie schließlich akzeptiert. Sie haben ihr gezeigt, wie man taucht, den Atem anhält und die Stellen findet, an denen sich Muscheln oder Meeresschnecken befinden. Das Gute daran war, dass sie meine Mutter akzeptiert haben, ohne ihr Fragen zu stellen, die sich auf ihren Mann oder mich bezogen. Sie sind meine Familie, die Familie, die ich nie gehabt habe. Sobald ich alt genug war, um allein das Haus zu verlassen, waren sie das Ziel meiner Streifzüge. Ich brachte ihnen etwas heiße Suppe, wenn sie aus dem Wasser kamen, oder ein bisschen Obst. Ich wohne mit meiner Mutter in einem Haus auf einer Anhöhe, unsere Vermieterin hat früher selbst nach Seeohren getaucht. Sie ist eine verschrumpelte alte Frau mit ganz dunkler Haut, ich nenne sie Großmutter, sie hat nach einem Unfall, bei dem sie zu lange unter Wasser geblieben ist, aufgehört zu tauchen und seitdem ist sie etwas langsam. Sie verbringt den ganzen Tag damit, auf ihrem Süßkartoffelacker die Erde aufzuhacken und Unkraut zu jäten, und ich helfe ihr dabei, sobald ich aus der Schule komme. Sie hat einen Hund, der Chubb heißt, weil er dick und kurzbeinig ist, aber er ist keineswegs dumm. Im vorigen Jahr hat sich ein Typ bei Mama eingenistet. Er behauptet, er heiße Brown, als sei er Engländer, aber ich mag ihn nicht. Wenn er mit meiner Mutter zusammen ist, sagt er nur honigsüße Worte, aber wenn er und ich allein sind, ist er frech und gemein zu mir und kommandiert mich herum, außerdem hat er einen komischen Akzent. Eines Tages hat er mich derart genervt, dass ich seinen Akzent nachgeahmt und zu ihm gesagt habe: »Mit mir musst du schon einen anderen Ton anschlagen, ich bin nicht deine Tochter.« Er hat mich angestarrt, als wolle er mich schlagen, aber seitdem nimmt er sich in Acht. Ich mag es nicht, wie er mich ansieht, ich habe den Eindruck, als versuche er durch meine Kleider hindurchzusehen. Wenn er mit Mama zusammen ist, spielt er den Verliebten, dann hasse ich ihn noch mehr.
In der Schule habe ich keine Freunde. Anfangs ging es ganz gut, aber in diesem Jahr hat sich alles geändert. Es gibt eine Gruppe von Mädchen, die sich einen Spaß daraus machen, mich zu provozieren. Ich habe mich mehrmals mit ihnen geprügelt, ich bin größer als sie und gewinne, aber manchmal tun sie sich zusammen, um mich zu verprügeln, und wenn ich auf der Straße nach Hause zurückgehe, werfen sie mit Erdklumpen oder kleinen Steinen nach mir und bellen wie ein Hund. Sie sagen, ich hätte keinen Papa, mein Vater sei ein Bettler und säße im Gefängnis, deshalb besuche er mich nie. Einmal habe ich gesagt: »Mein Vater ist nicht im Gefängnis, er ist im Krieg gefallen.« Sie haben höhnisch gelacht. »Das musst du uns beweisen«, haben sie geantwortet, doch ich kann es nicht beweisen. Ich habe meine Mutter gefragt: »Ist mein Vater lebendig oder ist er tot?« Aber sie hat nicht geantwortet, sondern nur den Kopf gesenkt und so getan, als hätte sie nichts gehört. Doch wenn ich darüber nachdenke, sage ich mir, dass sie recht haben, da meine Mutter mir schon Englisch beigebracht hat, seit ich klein bin, sie sagt, das sei für meine Zukunft, aber vielleicht hat sie es auch getan, damit ich die Sprache meines Vaters beherrsche.
Das bösartigste von allen Kindern unserer Schule ist ein Junge namens Jo. Er ist groß und schlank, er geht in die Klasse über mir. Er ist gemein. Er sagt, ich sei eine Schwarze. Er sagt, mein Vater sei ein schwarzer amerikanischer Soldat der Militärbasis, und meine Mutter sei eine Nutte. Das sagt er immer wieder, wenn ich allein die Straße entlanggehe und die Erwachsenen es nicht hören können. Er rennt hinter mir her, und wenn er an mir vorbeiläuft, sagt er leise: »Deine Mutter ist eine Nutte, dein Vater ist schwarz.« Er weiß, dass ich das nicht weitersage, weil ich mich dafür viel zu sehr schämen würde. Jo hat einen arglistigen Blick wie ein aasfressender Hund, eine lange Hakennase und gelbliche Augen mit schwarzen Punkten in der Mitte. Wenn ich allein die Straße entlanggehe, nähert er sich von hinten, packt mich an den Haaren, denn ich habe eine dichte krause Mähne, und seine Finger klammern sich darin fest und zerren, bis ich den Kopf zum Boden senke, dann steigen mir die Tränen in die Augen, aber diesen Triumph gönne ich ihm nicht. Er möchte, dass ich schreie: »Gleich ruf ich meine Mama, gleich ruf ich sie!« Aber ich sage nichts, versetze ihm Fußtritte, bis er meine Haare loslässt.
Ich liebe das Meer mehr als alles andere auf der Welt. Seit ich ganz klein bin, habe ich die meiste Zeit am Meer verbracht. In der ersten Zeit auf dieser Insel hat meine Mutter in den Fischrestaurants gearbeitet. Sie ging früh am Morgen dorthin und stellte mich in meinem Kinderwagen in eine Ecke, damit ich niemanden störte. Sie reinigte den Zementboden mit einer Scheuerbürste, spülte Bottiche und Töpfe, fegte den Hof, verbrannte den Müll, und anschließend arbeitete sie in der Küche, hackte Zwiebeln, wusch die Muscheln, bereitete das Suppengemüse zu und schnitt die Fische für Sushi-Gerichte klein. Ich blieb unterdessen in meinem Wagen, ohne ein Wort zu sagen, und sah ihr zu. Anscheinend war ich sehr artig. Ich wollte nicht draußen spielen. Die Inhaberin sagte: »Was hat die Kleine denn? Es sieht so aus, als habe sie Angst vor allem.« Dabei hatte ich überhaupt keine Angst, ich blieb nur da, um meine Mutter zu beschützen, um sicherzugehen, dass ihr nichts passierte. Und eines Tages hatte Mama genug davon, für diese Leute zu schuften. Sie hat sich mit den alten Frauen verständigt, die die Meeresschnecken brachten, und ist auch eine Seefrau geworden.
Von diesem Augenblick an bin ich jeden Tag ans Meer gegangen. Ich begleitete meine Mutter, trug ihre Tasche, ihre Schuhe, ihre Taucherbrille. Sie zog sich an einer windgeschützten Stelle zwischen den Felsen um. Ich betrachtete sie, wenn sie nackt war, bevor sie ihren Taucheranzug überstreifte. Meine Mutter ist nicht groß und dick wie ich, sie ist eher klein und mager, sie hat sehr helle Haut, außer im Gesicht, das sonnenverbrannt ist. Ich erinnere mich, dass ich ihre Rippen betrachtet habe, die unter der Haut hervorstanden, und ihre Brüste mit ganz schwarzen Brustwarzen, weil sie mich ganz lange gestillt hat, bis ich fünf oder sechs war. Die Haut auf ihrem Bauch und ihrem Rücken ist ganz weiß, und meine ist fast schwarz, selbst wenn ich mich nicht der Sonne aussetze, deshalb sagen die Kinder in der Schule, ich sei eine Schwarze. Eines Tages habe ich zu meiner Mutter gesagt: »Stimmt es, dass mein Vater ein amerikanischer Soldat war und dass er uns im Stich gelassen hat?« Meine Mutter hat mich angestarrt, als wolle sie mich ohrfeigen, und hat dann erwidert: »Sag das nie wieder. Du hast nicht das Recht, mir so etwas Gemeines zu sagen.« Und dann hat sie hinzugefügt: »Wenn du solche Gemeinheiten weitersagst, die man dir an den Kopf geworfen hat, dann ziehst du dich selbst durch den Dreck.« Deshalb habe ich nie mehr mit ihr darüber gesprochen. Aber trotzdem würde ich gern die Wahrheit erfahren, was meinen Vater angeht.
Als ich noch klein war, bin ich nicht in die Schule gegangen. Meine Mutter hatte Angst davor, dass mir etwas zustoßen könne, und ich glaube auch, dass sie sich schämte, weil ich keinen Vater hatte. Und so habe ich den ganzen Tag inmitten der Felsen verbracht. Ich passte auf die Sachen meiner Mutter auf, während sie nach Muscheln tauchte. Das habe ich sehr gern getan. Ich hatte mir mit Wollstoffen eine Art Nest gebaut, lehnte mich mit dem Rücken an die schwarzen Steine und betrachtete das Meer. Es gab dort auch ziemlich seltsame Tiere, halb Krebs, halb Käfer, die zaghaft aus den Spalten krochen und mich musterten. Sie verharrten reglos in der Sonne, doch sobald ich eine Bewegung machte, eilten sie in ihre Schlupfwinkel zurück. Dort waren auch Vögel, Möwen, Kormorane und graublaue Vögel, die immer nur auf einem Bein standen. Meine Mutter schlüpfte in ihren Taucheranzug aus Gummi, zupfte die Kopfhaube, die Handschuhe und die Füßlinge zurecht, ging ins Wasser und setzte dann die Taucherbrille auf. Ich sah zu, wie sie aufs offene Meer zuschwamm und dabei ihre schwarz-weiße Boje hinter sich herzog. Jede Seefrau hat eine andersfarbige Boje. Sobald sie weit genug fortgeschwommen war, von Wellen umgeben, tauchte sie, und ich sah ihre blauen Füßlinge, die in der Luft wedelten, und dann glitten ihre Beine in die Tiefe, und sie verschwand im Wasser. Ich hatte gelernt, die Sekunden zu zählen. Mama hatte mir gesagt: »Zähl bis hundert, wenn ich bis dahin nicht wieder aufgetaucht bin, musst du Hilfe holen.« Aber sie bleibt nie bis hundert unter Wasser. Höchstens dreißig oder vierzig Sekunden, ehe sie wieder auftaucht. Und dann stößt sie einen Schrei aus. Alle Seefrauen stoßen einen Schrei aus. Jede hat ihren eigenen Schrei. Das tun sie, um wieder Atem zu holen, und den Schrei meiner Mutter erkenne ich aus weiter Ferne wieder, sogar wenn ich sie nicht sehe. Sogar inmitten anderer Schreie, anderer Geräusche. Er ist wie der Schrei eines Vogels, erst ganz schrill und schließlich ganz leise, das hört sich etwa so an: Rira! huuhuu-rrra-urrra!