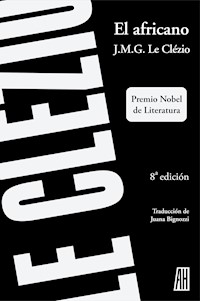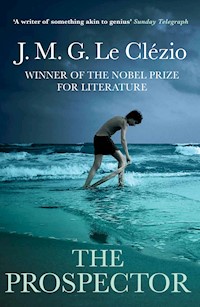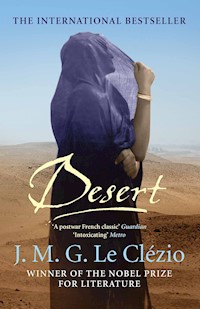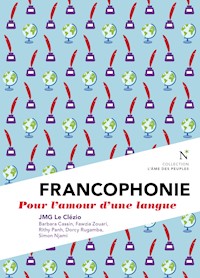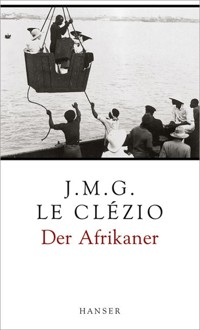
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Eine Afrikareise in der Kindheit wurde für Le Clézio, einem der bedeutendsten zeitgenössischen französischen Schriftsteller, zur Initiation. Hier lernte er eine Welt kennen, die ihn mit ihren fremden Lebensformen, den exotischen Gerüchen und Farben in ihren Bann schlug und nie wieder loslassen sollte. Und so erzählt er von der Reise, die ihn 1948 nach Afrika führte und wo er zum ersten Mal seinem Vater begegnete. Einem Tropenarzt, der in Nigeria Lepra und Sumpffieber kurierte, den Kolonialismus hasste, mit einer Piroge das Landesinnere erkundete und Landschaften und Menschen fotografierte. Und er erzählt die Liebesgeschichte seiner Eltern, die in Kamerun, vor seiner Geburt, spielt, als der Traum eines von Krankheit und Fremdherrschaft befreiten Afrika noch realisierbar schien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 116
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Eine Afrikareise in der Kindheit wurde für Le Clézio, einem der bedeutendsten zeitgenössischen französischen Schriftsteller, zur Initiation. Hier lernte er eine Welt kennen, die ihn mit ihren fremden Lebensformen, den exotischen Gerüchen und Farben in ihren Bann schlug und nie wieder loslassen sollte. Und so erzählt er von der Reise, die ihn 1948 nach Afrika führte und wo er zum ersten Mal seinem Vater begegnete. Einem Tropenarzt, der in Nigeria Lepra und Sumpffieber kurierte, den Kolonialismus hasste, mit einer Piroge das Landesinnere erkundete und Landschaften und Menschen fotografierte. Und er erzählt die Liebesgeschichte seiner Eltern, die in Kamerun, vor seiner Geburt, spielt, als der Traum eines von Krankheit und Fremdherrschaft befreiten Afrika noch realisierbar schien.
J. M. G. Le Clézio
Der Afrikaner
Aus dem Französischen von Uli Wittmann
Carl Hanser Verlag
Jeder Mensch hat einen biologischen Vater und eine biologische Mutter. Man muß sie nicht unbedingt lieben oder anerkennen, man kann ihnen mißtrauen. Aber sie existieren — mit ihrem Gesicht, ihrer Haltung, ihren Manieren und Manien, ihren Illusionen, ihren Hoffnungen, der Form ihrer Hände und Zehen, der Farbe ihrer Augen und ihres Haars, ihrer Art zu reden, ihren Gedanken und vermutlich dem Alter, in dem sie sterben, all das haben wir in uns aufgenommen.
Ich habe lange davon geträumt, meine Mutter sei eine Schwarze. Ich hatte eine Geschichte erfunden, mir eine Vergangenheit zurechtgelegt, um nach meiner Rückkehr aus Afrika nach Frankreich, in der Stadt, in der ich niemanden kannte und zu einem Fremden geworden war, der Wirklichkeit zu entfliehen. Und als mein Vater dann im Ruhestand wieder zu uns nach Frankreich zurückkehrte, entdeckte ich plötzlich, daß er der Afrikaner war. Es fiel mir nicht leicht, mich damit abzufinden. Ich mußte die Vergangenheit wieder aufrollen, von vorn beginnen und versuchen, all das zu verstehen. In Erinnerung daran habe ich dieses kleine Buch geschrieben.
Der Körper
Zu dem Gesicht, das ich bei meiner Geburt erhielt, muß ich ein paar Worte sagen. Als erstes, daß ich nicht umhin konnte, es zu akzeptieren. Damit will ich nicht behaupten, ich hätte es nicht gemocht, denn das hieße, ihm eine Bedeutung beizumessen, die es nicht hatte, als ich ein Kind war. Ich haßte es nicht, sondern nahm es nicht wahr, wich ihm aus. Ich betrachtete es nicht im Spiegel. Ich glaube, daß ich es jahrelang nicht gesehen habe. Auf den Fotos wandte ich den Blick ab, als sei jemand anders an meine Stelle getreten.
Im Alter von etwa acht Jahren habe ich in Westafrika gelebt, in Nigeria, in einer ziemlich abgelegenen Region, in der bis auf meinen Vater und meine Mutter keine anderen Europäer waren und die Menschheit für mich als Kind sich nur aus Ibo und Yoruba zusammensetzte. In der Hütte, in der wir lebten (das Wort Hütte hat etwas Kolonialistisches, das heute zwar schockieren mag, aber gut auf die Dienstwohnung zutrifft, wie sie die englische Regierung damals den Militärärzten zur Verfügung stellte: Eine Betonplatte als Fußboden, vier Wände aus unverputzten Zementsteinen, ein mit Palmwedeln bedecktes Wellblechdach, keinerlei Zierat, Hängematten, die an den Wänden befestigt waren und als Betten dienten, und als einziger Luxus eine Dusche, die durch Eisenrohre mit einem von der Sonne erhitzten Wasserbehälter auf dem Dach verbunden war), in dieser Hütte gab es also keine Spiegel, keine Bilder, nichts, was uns an die Welt erinnern konnte, in der wir bisher gelebt hatten. Und ein Kreuz, das mein Vater an die Wand gehängt hatte, jedoch ohne die Figur des Gekreuzigten. Dort habe ich gelernt zu vergessen. Ich habe den Eindruck, daß mein Gesicht und die Gesichter all derer, die mich umgaben, an dem Tag, als wir in diese Hütte in Ogoja zogen, zu verblassen begannen.
Von diesem Augenblick an tauchten, sozusagen als Folge davon, die Körper auf. Mein Körper, der Körper meiner Mutter, der Körper meines Bruders, die Körper der Jungen aus der Nachbarschaft, mit denen ich spielte, die Körper der afrikanischen Frauen auf den Wegen in der Nähe des Hauses oder auf dem Markt am Fluß. Ihre Statur, ihre schweren Brüste, die glänzende Haut ihres Rückens. Das Geschlechtsteil der Jungen, ihre beschnittene rosa Eichel. Vermutlich auch die Gesichter, aber wie verhärtete Ledermasken, mit Narben übersät, von rituellen Zeichen zerfurcht. Hervorstehende Bäuche mit einem Bauchnabel, der wie ein unter der Haut vernähter Kiesel wirkte. Und der Geruch der Körper, die Haut, die sich nicht rauh, sondern warm und weich anfühlte und mit Tausenden von Härchen übersät war. Ich hatte den Eindruck großer Nähe, zahlreicher Körper rings um mich herum, etwas, was ich vorher nicht gekannt hatte, was neu und zugleich vertraut war und keinerlei Angst einflößte.
Das natürliche, von keiner Scham getrübte Verhältnis zum Körper in Afrika war etwas sehr Schönes. Es erweiterte und vertiefte das Blickfeld, vervielfachte die Empfindungen, spannte ein menschliches Netz um mich herum. Es paßte gut zur Landschaft des Ibo-Gebiets, zum Flußlauf der Aiya, zu den Hütten des Dorfs, ihren rostfarbenen Dächern und ihren lehmfarbenen Mauern. Es vibrierte in den Namen, die in mich drangen und für mich viel mehr waren als bloße Ortsnamen: Ogoja, Abakaliki, Enugu, Obudu, Baterik, Ogrude, Obubra. Es verband sich mit dem Gürtel des Regenswalds, der uns von allen Seiten umgab.
Als Kind verfügt man über wenige Worte (und die Worte sind noch nicht abgenutzt). Adjektive und Substantive standen mir damals noch nicht zur Verfügung. Worte wie wunderbar, unermeßlich, machtvoll konnte ich noch nicht formulieren, nicht einmal denken. Aber ich war imstande, etwas Entsprechendes zu empfinden. Zu empfinden, wie hoch die Bäume mit ihrem kerzengeraden Stamm in den nächtlichen Himmel aufragten, der sich über mir wölbte, und wie sie die blutrote Bresche der Lateritpiste, die von Ogoja nach Obudu führte, gleichsam in einen Tunnel einschlossen, ich konnte die nackten, schweißglänzenden Körper auf den Lichtungen der Dörfer spüren, die massigen Silhouetten der Frauen, die auf dem Rücken festgeschnürten Kinder, all das bildete ein harmonisches Ganzes ohne falschen Schein.
Ich erinnere mich noch an den Ortseingang von Obudu: Die Straße kam aus dem Schatten des Waldes und führte in der prallen Sonne mitten ins Dorf. Mein Vater hielt mit dem Wagen an, er und meine Mutter mußten mit den Verwaltungsbeamten reden. Ich war allein inmitten der Menge, aber ich hatte keine Angst. Hände berührten mich, strichen mir über die Arme, über das Haar unterm Hutrand. Unter den Menschen, die sich um mich drängten, war auch eine alte Frau, aber ich wußte nicht, daß sie alt war. Ich nehme an, daß ich als erstes ihr Alter bemerkte, weil sie sich von den nackten Kindern und den mehr oder weniger nach westlicher Art gekleideten Männern und Frauen, denen ich in Ogoja begegnet war, unterschied. Als meine Mutter zurückkehrte (vielleicht, weil sie dieser Menschenauflauf etwas beunruhigte), zeigte ich ihr diese Frau: »Was hat sie? Ist sie krank?« Ich erinnere mich, daß ich meiner Mutter diese Frage gestellt habe. Der nackte Körper dieser Frau voller Falten und Runzeln, ihre Haut wie ein entleerter Wasserschlauch, ihre schlaffen, langen Brüste, die ihr bis auf den Bauch hingen, ihre rissige, matte, ein wenig graue Haut, all das kam mir seltsam und zugleich unverfälscht vor. Wie hätte ich ahnen sollen, daß diese Frau meine Großmutter hätte sein können? Ich war nicht etwa entsetzt oder voller Mitleid, im Gegenteil, ich empfand Liebe und Interesse, also jene Regungen, die der Anblick der Wahrheit, der erlebten Wirklichkeit hervorruft. Ich erinnere mich nur noch an die Frage: »Ist sie krank?« Sie brennt noch heute seltsam in mir, als sei die Zeit stehengeblieben. Und nicht an die — vermutlich beruhigende, vielleicht ein wenig verlegene — Antwort meiner Mutter: »Nein, sie ist nicht krank, sie ist alt, das ist alles.« Das Alter schockiert ein Kind beim Anblick eines Frauenkörpers vermutlich noch stärker, da die Frauen in Frankreich, in Europa, in den Ländern der Hüfthalter und Unterkleider, der Büstenhalter und Unterröcke, heute wie damals gewöhnlich von der Krankheit des Alterns verschont bleiben. Das Brennen auf meinen Wangen, das die naive Frage und die schroffe Reaktion meiner Mutter begleitete, spüre ich noch heute wie eine Ohrfeige. Diese Frage ist für mich ohne Antwort geblieben, denn sie lautete vermutlich nicht: »Warum ist diese Frau so geworden, derart verbraucht und vom Alter entstellt?« Sondern: »Warum hat man mich belogen? Warum hat man mir diese Wahrheit vorenthalten?«
Afrika war für mich eher der Körper als das Gesicht. Es war der Strudel der Empfindungen, das Aufbrausen der Begierden, der heftige Wechsel der Jahreszeiten. Die erste Erinnerung, die ich an diesen Kontinent habe, war ein durch extreme Hitze hervorgerufener Ausschlag, der meinen Körper mit kleinen Pickeln übersäte, eine gutartige Erkrankung, wie sie die Weißen in der Äquatorregion befallen kann und die den witzigen Namen »roter Hund« trägt — prickly heat, wie die Engländer sagen. Ich lag nackt in meiner Koje, während das Schiff langsam auf der Höhe von Conakry, Freetown, Monrovia an der Küste entlangfuhr und feuchte Luft durch das offene Bullauge hereindrang. Ich war von oben bis unten mit Talk eingepudert, es kam mir vor, als läge ich in einem unsichtbaren Sarkophag oder wäre wie ein Fisch in einem Netz gefangen worden und wartete mit Mehl bestreut darauf, in schwimmendem Öl gebraten zu werden. Afrika hatte mir schon das Gesicht genommen und bescherte mir nun einen schmerzhaften, fiebrigen Körper, jenen Körper, den Frankreich in der lähmenden, sinnesfeindlichen Behaglichkeit der Wohnung meiner Großmutter vor mir verborgen hatte.
Außerdem erhielt ich auf dem Schiff, das mich in diese andere Welt brachte, ein neues Gedächtnis. Die afrikanische Gegenwart ließ alles, was vorangegangen war, verblassen. Den Krieg, das Zusammenleben auf engem Raum in Nizza (wir wohnten zu fünft in einer Zweizimmerwohnung unter dem Dach oder sogar zu sechst, wenn man Maria mitzählt, das Hausmädchen, auf das meine Großmutter nicht hatte verzichten wollen), die Rationierung und die Flucht ins Gebirge, in dem sich meine Mutter aus Angst davor versteckte, von der Gestapo festgenommen zu werden — all das verblaßte, verschwand, wurde unwirklich. Von da an gab es für mich die Zeit vor und die Zeit nach Afrika.
Die Freiheit in Ogoja war die Vorherrschaft des Körpers. Der Blick hinab von der Zementplattform, auf der das Haus wie ein Floß auf einem Gräsermeer thronte, war unbegrenzt. Wenn ich mein Gedächtnis anstrenge, kann ich die ungefähren Grenzen dieses Geländes rekonstruieren. Jemand, der diesen Ort sozusagen fotografisch im Gedächtnis behalten hätte, würde sich fragen, was ein achtjähriges Kind darin sehen konnte. Vermutlich einen Garten. Aber keinen Ziergarten — gab es in diesem Land überhaupt etwas, was nur der Zierde diente? Eher einen Nutzgarten, in dem mein Vater Obstbäume angepflanzt hatte, Mango-, Guaven- und Papayabäume, und gleichsam als Hecke vor der Veranda Limetten und Apfelsinenbäume, deren Blätter zum großen Teil die Ameisen zusammengeklebt hatten, um darin ihre Nester zu bauen, weshalb aus ihnen ein watteähnlicher Flaum hervorschaute, in dem sich ihre Eier befanden. Irgendwo hinter dem Haus, mitten im Buschwerk, ein Hühnerstall mit Hühnern und Perlhühnern, dessen Existenz mir nur durch die Anwesenheit senkrecht darüber kreisender Geier angezeigt wurde, auf die mein Vater manchmal mit dem Karabiner schoß. Also gut, ein Garten, da einer der Hausangestellten den Titel garden boy trug. Am anderen Ende des Geländes hatten wohl die Dienstboten ihre Hütten: der boy, der small boy und vor allem der Koch, den meine Mutter gern mochte und mit dem sie das Essen gemeinsam zubereitete — aber keine französischen Gerichte, sondern Erdnußsuppe, gebackene Kartoffeln oder foufou, den Yamswurzelbrei, der das Grundnahrungsmittel darstellte. Ab und zu ließ sich meine Mutter mit ihm auf Experimente ein, Guavenmarmelade, kandierte Papayas oder Fruchteis, das sie mit der Hand anrührte. Im Hof waren vor allem viele Kinder, die jeden Morgen kamen, um mit uns zu spielen oder sich mit uns zu unterhalten und die sich erst bei Einbruch der Dunkelheit von uns trennten.
All das mag den Eindruck eines äußerst geregelten kolonialen, fast städtischen Lebens hervorrufen — oder zumindest den eines ländlichen Lebens, wie es vor dem industriellen Zeitalter in England oder in der Normandie ausgesehen haben mochte. Und dennoch war es die absolute Freiheit für Körper und Geist. Vor dem Haus, in entgegengesetzter Richtung des Krankenhauses, in dem mein Vater arbeitete, erstreckte sich, soweit das Auge reichte, eine leicht gewellte Ebene. Im Süden führte das Gelände zum dunstigen Tal der Aiya hinab, einem Nebenfluß des Cross River, und zu den Dörfern Ogoja, Ijama, Bawop. Im Norden und Osten konnte ich die mit Termitenhügeln übersäte, von Bächen und Sümpfen durchzogene fahlrote Ebene sowie den Saum des Waldes sehen, in dem gigantische Iroko- und Okumebäume wuchsen, und über alledem erhob sich ein riesiges Gewölbe, ein grellblauer Himmel mit sengender Sonne, der sich jeden Nachmittag mit Gewitterwolken bezog.
Ich erinnere mich an die Gewalt. Keine versteckte, heuchlerische, Panik hervorrufende Gewalt wie jene, die alle Kinder kennen, die während eines Krieges geboren werden — etwa, wenn ich mich heimlich nach draußen schlich und nach den Deutschen in grauen Soldatenmänteln ausspähte, die die Reifen des De Dion-Boutons meiner Großmutter stahlen, oder wenn mich die Geschichten, die ich über Schwarzhandel und Spionage gehört hatte, und die halbverschleierten Botschaften meines Vaters, die uns der amerikanische Konsul Mr. Ogilvy übermittelte, noch im Traum verfolgten, und vor allem der Hunger, der Mangel an allem, das Gerücht, daß sich die Cousinen meiner Großmutter von Gemüseabfällen ernährten. All das war keine direkt körperliche Gewalt. Sie blieb unterschwellig und wurde verheimlicht wie eine Krankheit. Sie zehrte an meinem Körper, verursachte nicht zu unterdrückende Hustenanfälle und eine derart schmerzhafte Migräne, daß ich mich unter der weiten Decke des runden Tisches versteckte und die Fäuste vor die Augen preßte.