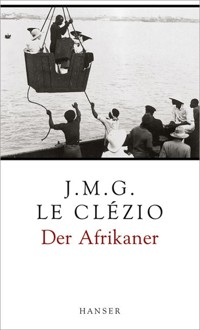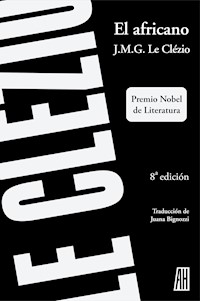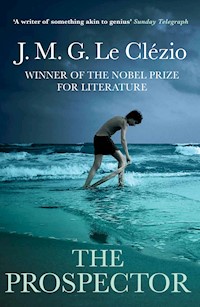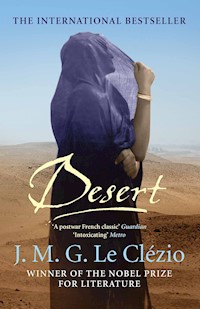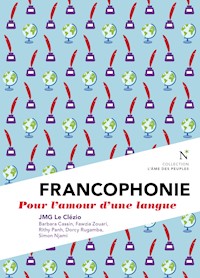18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein Lied der Erinnerung an eine Kindheit zwischen Meer und Krieg. Der französische Nobelpreisträger Jean-Marie Gustave Le Clézio erinnert sich in »Bretonisches Lied« an seine Kinder- und Jugendzeit. An die Urlaube mit der Familie in der Bretagne und in »Das Kind und der Krieg« an seine frühe Kindheit im besetzten Süden Frankreichs. Zwei eindrückliche autobiografische Erzählungen aus einem anderen Jahrhundert, die in Frankreich die Bestsellerlisten gestürmt haben. Nostalgisch, aber nie sentimental, so erinnert sich J.M.G. Le Clézio an die Bretagne seiner Kindheit und Jugend. Von 1948 bis 1954 hat er hier mit seiner Familie die Sommerferien verbracht. In einem von berückender Schönheit, aber auch von großer Armut geprägten Landstrich. In poetischen Bildern beschreibt Le Clézio diesen Kindheitsort, die Feste, die Natur, die Sprache, aber auch die Veränderungen, denen die Bretagne immer wieder unterworfen und deren Zeuge er zum Teil war. »Es ist das Land, das mir die meisten Emotionen und Erinnerungen gebracht hat«, sagt der Nobelpreisträger über die Bretagne, die es so, wie er sie erlebt hat, nicht mehr gibt. Doch Le Clézio begibt sich noch weiter auf seiner Reise in die eigene Vergangenheit. In »Das Kind und der Krieg« erzählt er von der Zeit zwischen 1940 und 1945, die er als kleines Kind erst in Nizza und später, als die Deutschen auch den Süden Frankreichs besetzt hatten, in einem Versteck im Hinterland erlebte. Hier vermischen sich die Eindrücke: Erlebtes, Geträumtes, Erzähltes. Alles wird miteinander verwoben zu einem berührenden, eindringlichen Porträt einer Kriegskindheit, deren Essenz leider auch heute noch gültig ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Ähnliche
J. M. G. Le Clézio
Bretonisches Lied
Zwei Erzählungen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über J. M. G. Le Clézio
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Bretonisches Lied
Abbildung Combrit – Le Cosquer
Sainte-Marine
Madame Le Dour
War an hent
Le Cosquer
Erntezeit
Durch die Nacht irren
Kartoffelkäfer
Der Krieg
Am Meer
Die Ebbe
La Torche
Religion
Die Vorgeschichte
Ein geheimnisumwittertes Land
Breizh atao!
Die Autonomie anstreben?
Ein bretonischer Held
Das Kind und der Krieg
Abbildung Roquebillière – Turm der Kirche des Templerordens
Inhaltsverzeichnis
für die eine und die andere Simone
Inhaltsverzeichnis
Bretonisches Lied
Combrit – Le Cosquer
Obwohl ich nicht in der Bretagne geboren bin und nie mehr als ein paar Sommermonate in jedem Jahr von 1948 bis 1954 dort verbracht habe, ist sie eine Gegend, die mein Gemüt und meine Erinnerung außerordentlich geprägt hat – Afrika war etwas ganz anderes, und als 1948 unser Aufenthalt dort zu Ende ging und mein Vater dann in den fünfziger Jahren nach Frankreich zurückgekehrt ist, habe ich diese Zeit vergessen, nicht abgelehnt, sondern aus dem Gedächtnis verbannt, als sei sie etwas Unmögliches, Irreales, zu Überwältigendes, ja womöglich Gefährliches gewesen.
Zur Bretagne dagegen habe ich eine vertraute, fast familiäre Beziehung. Denn ich bin in der Überzeugung aufgewachsen, dass wir (die wir den Namen meines Vaters und meiner Mutter tragen und gleicher Abstammung sind) gebürtige Bretonen sind und dass wir, soweit sich unsere Linie zurückverfolgen lässt, durch dieses unsichtbare Band fest mit dieser Gegend verbunden sind.
Ich werde nicht chronologisch vorgehen. Kindheitserinnerungen sind langweilig, und Kinder haben keinen Sinn für Chronologie. Für sie reiht sich ein Tag an den anderen, aber nicht, um sich zu einer Geschichte zu verbinden, sondern um sich zu vergrößern, Raum einzunehmen, sich zu vermehren, zu vervielfältigen und ein Echo auszulösen.
Sainte-Marine
Wenn ich heute nach Sainte-Marine zurückkehre, in das Dorf, in dem ich in meiner Kindheit jedes Jahr die Sommerferien verbracht habe, erkenne ich fast nichts wieder. Die lange Straße, die vom Ortseingang bis zur Spitze der Landzunge führt, der Pointe de Combrit, ist noch genauso da wie früher, weder verbreitert noch begradigt. Ich erkenne auch die Ablaufbahn im Hafen wieder, die alten Häuser, das Marinemuseum Abri du Marin und die reizende Kapelle. Alles ist noch am selben Platz, aber irgendetwas hat sich verändert. Selbstverständlich hat die Zeit ihr Werk verrichtet, sowohl an mir wie auch an den Häusern, hat sie altern lassen, ihnen neue Farben verliehen, den Maßstab verändert, die Landschaft modernisiert. Die Straße ist geteert und vor allem voller weißer Linien und Streifen, die Parklücken anzeigen, Zickzackdurchlässe bewirken oder als Stoppsignale dienen. Um den Fluss der Fahrzeuge zu kanalisieren, sind Verkehrskreisel geschaffen und Holzbarrieren aufgestellt worden, die die Durchfahrt von Wohnmobilen verhindern, und Schilder, die die erlaubten Parkzeiten anzeigen, sowie Metallpfosten und Gitter, die unerlaubtes Parken verhindern sollen. Zahlreiche Cafés sind aus dem Boden geschossen, Crêperien mit Terrasse und Sonnenschirmen, und nun gibt es Läden mit Ansichtskarten und Reiseandenken. All das hat den Glanz provinzialer Moderne, als sollte das Dorf für das Vergehen der Zeit unempfänglich gemacht oder wie mit Politur vor dem Zahn der Zeit geschützt werden, wie ein antikes Möbelstück. Heute fährt man mit dem Auto durch Sainte-Marine, macht dort aber nicht halt. Im Sommer ist der Besucherstrom so groß, dass man weiterfahren muss, bis zur Pointe de Combrit, vielleicht, um dort ein Foto zu machen, und kehrt dann wieder um. Man durchquert den Ort noch einmal und lässt ihn dann hinter sich. Ich dagegen habe mich damals jedes Jahr, jeden Sommer an all den Tagen, die ich in Sainte-Marine verbracht habe, nicht sattsehen können und meine Kindheit entdeckt.
Es ist schwer, eine Verbindung zwischen dem damaligen Dorf und dem herzustellen, was heute daraus geworden ist. Die Welt hat sich gewandelt, das versteht sich von selbst. Sainte-Marine macht da keine Ausnahme. Aber warum geht mir das so nah? Was für ein Bild muss ich in meinem Herzen wie ein kostbares Geheimnis bewahrt haben, dass mich dieses Zerrbild mehr als alle anderen stört und mir das Gefühl vermittelt, mir sei ein Schatz gestohlen worden?
Sainte-Marine, das war diese lange Dorfstraße, auf der meine Familie und ich nach einer endlosen Fahrt aus Südfrankreich in dem vorsintflutlichen Renault Monaquatre meiner Eltern jeden Sommer ankamen, um drei ideale Ferienmonate voller Freiheit und Abenteuer in einer ganz anderen Umgebung zu verbringen. Damals war die Dorfmitte von Sainte-Marine nicht so sehr die Kapelle, sondern die Fähre, diese erstaunliche eiserne Schwimmbrücke, die alle halbe Stunde an Ketten gleitend quietschend das tiefe Tal der Odet-Mündung überquerte. Der Bau der gigantischen (und vermutlich überflüssigen) Brücke mit dem hochtrabenden Namen Pont de Cornouaille oberhalb der Mündung war der Anlass und das weithin sichtbare Zeichen des Wandels. Als es noch die Fähre gab, überquerte man nur zögernd den Fluss. Die Überfahrt war langsam, geräuschvoll, es roch nach Schmieröl, und man beschmutzte sich die Schuhe. Und wozu eigentlich? Um auf die andere Seite des Flusses zu gelangen, nach Bénodet, wo nichts los war? Wo sich im Sommer die Leute in Scharen an den Stränden, auf den Caféterrassen oder den Campingplätzen tummelten? Auf der anderen Seite war die Moderne schon eingetroffen, und es reichte völlig, sich den Anblick von diesem Flussufer aus vorzustellen, und wenn man wirklich dorthin wollte, brauchte man nur mit den Lieferwagen und Fahrrädern auf die Fähre zu steigen, das kostete so gut wie nichts, brachte aber auch nicht viel. Wenn ich mich recht erinnere, ein paar Pfennige – zwei, drei Sou hätte meine Großmutter gesagt. Vielleicht noch weniger. Vielleicht war es für zehnjährige Kinder, die im letzten Moment an Bord sprangen, bevor die Fähre ablegte, sogar umsonst. Die Überfahrt dauerte zehn Minuten, aber bei Hochwasser oder Sturm wurde die Fähre quietschend an ihrer Kette abgetrieben und vom Auf und Ab des Meerwassers und den Strudeln des Flusses hin und her geschüttelt. Auf der anderen Seite erwartete einen eine andere Welt: Bénodet war damals die Stadt, der Treffpunkt der Sommerurlauber, der Campinggäste. Von Sainte-Marine nach Bénodet überzusetzen, hieß, eine Grenze zu überschreiten, welche die halb vergessene, traditionsreiche, ein wenig rückständige Bretagne von dem modernen Département mit all seinen Straßen, Hotels, Cafés, Kinos und vor allem seinen mit Sonnenschirmen übersäten Stränden voller Badegäste trennte. Ich weiß nicht, ob Kindern solche Dinge wichtig sind. Ich habe nicht das Gefühl, mich als Kind sonderlich für Modernität, Lärm und Menschenmassen interessiert zu haben. Aber die Erwachsenen haben das wohl anders gesehen, denn sie beschlossen eines Tages, dass die alte, rostige Fähre und der weite Umweg über die Uferstraßen von Quimper nicht mehr ausreiche und eine Brücke gebaut werden müsse, um die Autos und den Touristenstrom durchzulassen.
Der Pont de Cornouaille ist prachtvoll. Ich habe den Bau der Brücke nicht mitangesehen – in jenen Jahren hatten wir es schon aufgegeben, die Bretagne zu besuchen. Die Anfahrt von Nizza war zu lang für das alte Auto, und mein Vater hatte vermutlich Lust, etwas anderes zu sehen. Außerdem waren mein Bruder und ich inzwischen herangewachsen und zogen es vor, die Sommermonate in der schwülen Hitze Nizzas zu verbringen oder nach Südengland zu fahren, nach Hastings oder Brighton, um in milk bars zu gehen und Mädchen kennenzulernen.
Viele Jahre später bin ich in die Bretagne zurückgekehrt und über diese Brücke gefahren. Um dieses Bauprojekt zu verwirklichen, hat man ein ganzes Netz von drei- oder vierspurigen Straßen mit Verkehrskreiseln und Zufahrtsstraßen geschaffen. Die Brücke war zu jener Zeit in einer Richtung mautpflichtig, in der anderen kostenlos befahrbar (was ganz offenkundig im Widerspruch zu allen Gewohnheiten der Bretagne stand). Anders gesagt, es war ein unternehmerischer Akt. Die Banken hatten daran teilnehmen müssen. Die Fahrt über die Brücke ist wie ein Flug über das breite Mündungstal des Odet in gleicher Höhe wie die Möwen. Es hat mich überrascht, wie sehr die Höhe dieser Brücke die Landschaft hat schrumpfen lassen.
Wenn wir in einem kleinen flachen Holzboot mit einer Angelschnur im Schlepp auf dem Odet wriggten, kam er uns ebenso groß wie der Amazonasstrom vor, mit geheimnisvollen, im Nebel liegenden Ufern, strudelndem schwarzem Wasser und der Mündung ins offene Meer vor den Glénan-Inseln. Jetzt ist er im Schatten der Brücke zu einem ruhigen Wasserarm geworden: provinziell, jämmerlich klein, mit kleinen weißen Booten gesprenkelt, die an Muringbojen festgemacht sind. Innerhalb weniger Jahre hat sich die wildromantische Flussmündung in einen Ankerplatz für Motor- und Segeljachten verwandelt, eine von Häusern und Bäumen eingerahmte Esplanade aus grünem Wasser, eine Ria. Ich habe versucht, mir vorzustellen, was es für zwei halbwüchsige Jungen heißen würde, zwischen den Brückenpfeilern zu manövrieren, während ein Autostrom in fünfunddreißig Metern Höhe mit sechzig Stundenkilometern dröhnend die Odet-Mündung überquert. All das hat etwas Endgültiges, Urbanes angenommen, ist gewaltig und unverrückbar wie eine Talsperre. Ich bin nie wieder zu dieser Brücke zurückgekehrt.
Wenn ich versuche, mir das Dorf meiner Kindheit, Sainte-Marine, ins Gedächtnis zurückzurufen, taucht vor meinen Augen als Erstes die Straße auf, diese ganz lange Kiesstraße, die vom Ortseingang in der Nähe der Schule bis zur Spitze der Landzunge führt, der Pointe de Combrit, mit jeweils einer Reihe von Häusern auf der einen und der anderen Straßenseite. Das muss mir wohl normal vorgekommen sein, aber es war bereits eine gemischte, am liebsten würde ich sagen, hybride Siedlung. Zum einen die bretonischen, zumeist ärmlichen Häuser, zwar aus Granitstein erbaut, aber mit grauem Zement verputzt, mit rustikalen Fensterläden und niedrigen Türen, deren Sturz manchmal verziert war, moosbedeckten Schieferdächern mit sichtbar verzahnten Firstplatten und Schornsteinen aus Backstein. Manche waren so ärmlich und alt, dass sie noch ihre unverputzten Granitmauern, die schmalen Fenster und ein Strohdach behalten hatten. Hinter diesen Häusern lag ein geschütztes Gärtchen, in dem Knoblauch und Zwiebeln, Bohnen und Kartoffeln angepflanzt wurden. Und mitten zwischen diesen einfachen Häusern standen, arrogant und protzig, die Villen der »Pariser«, mit großen Parks bis ans Odet-Ufer, umgeben von hohen Steinmauern, hinter denen man Giebel und Türme erkennen konnte. Ein schweres, dunkelgrün gestrichenes schmiedeeisernes Portal diente als Zufahrt zu weißen, von blühenden Blumenbeeten, blauen Hortensienbüschen und Kameliensträuchern gesäumten Kieswegen.
Was Sainte-Marine zu einem besonderen Dorf machte, war die Tatsache, dass es dort keine Geschäfte gab, vermutlich war das eher ein Mangel und nicht etwa ein Zeichen von besonderem Luxus (was ist heute luxuriöser als eine Straße ohne Geschäfte?), denn in Wirklichkeit konnte man in jedem der bescheidenen Häuser etwas kaufen, je nachdem, einen Fisch, Garnelen, ein Krustentier oder auch nur leicht erdiges, dem Garten entrissenes Gemüse. Das einzige Geschäft, das diese Bezeichnung verdiente, war ein Gemischtwarenladen, der zum Hof Biger (in Poulopris) gehörte. Man betrat den Laden, indem man ganz einfach eine ebenerdige, mit einer scheppernden Glocke versehene Tür aufstieß und kaufte, was man dort fand: Konserven (Kondensmilch, Ölsardinen, Dosenerbsen), Wein in Literflaschen (algerischen Wein, der den seltsamen Namen Allah Allah trug, was damals niemanden schockierte), unverpackt verkaufte Hülsenfrüchte und so unentbehrliche Artikel wie Toilettenpapier, Streichhölzer (und Zigaretten) und vor allem etwas, was meine Bewunderung erregte: mit einem Schöpflöffel bemessenes Gelee, dessen Geschmack ich nicht vergessen habe, auch wenn ich nicht imstande bin zu sagen, ob es Apfel-, Weintrauben- oder Quittengelee war. Bei Biger konnte man auch Brot kaufen, unverkennbar industriell produzierte Brotlaibe aus Quimper, die immer derart hart und trocken waren, dass die Kinder, die den Auftrag hatten, sie nach Hause zu bringen, sie auf dem Heimweg als Hocker benutzten, um sich ab und zu auszuruhen. Meine Eltern kauften es nur selten, da sie ein für alle Mal beschlossen hatten, lieber Crêpes zu essen als dieses grässliche Weißbrot.
Einer der Treffpunkte in Sainte-Marine, unweit des Hauses Biger, war der Dorfbrunnen mit seiner Schwengelpumpe. Er hatte die offizielle Funktion, die Dorfbewohner mit Trinkwasser zu versorgen. Jedes Haus und jeder Bauernhof besaß einen eigenen Brunnen oder ein Regenwasserbecken auf offenem Gelände, aber die unmittelbare Nähe von Jauche- oder Klärgruben stellte eine Gefahr für das Trinkwasser dar. Das Regenwasser der Dachrinnen wurde ebenfalls in Becken aufgefangen, aber da die Dächer der feuchten Brise des Seewinds ausgesetzt waren, handelte es sich um Brackwasser, das höchstens zum Waschen oder Wäschewaschen benutzt werden konnte. Die umliegenden Felder wurden nach und nach immer stärker mit Chemikalien gespritzt, um die Invasion von Schädlingen zu bekämpfen, insbesondere die von Kartoffelkäfern, von denen später noch die Rede sein wird. Die Hühner- und Schweinemastbetriebe waren noch nicht so groß wie heute – in manchen Gegenden gibt es Geflügelfarmen mit zweihunderttausend Hühnern! –, aber schon damals hatte die Zunahme des Nitratpegels aufgrund der tierischen Ausscheidungen begonnen. Es hatte zwar noch nicht das Niveau der heutigen Umweltverschmutzung erreicht, kam ihm aber immer näher. Im Übrigen gab es damals in Sainte-Marine noch kein Mineralwasser zu kaufen – außer vielleicht für Säuglinge und jene andere empfindsame Sippschaft, die dort ihre Ferien verbrachte und das Auto mit einer ganzen Ladung Wasserflaschen vollgepackt hatte. An der Pumpe gab es weder ein Schild mit einer offiziellen Regelung noch irgendwelche Filter.
Die einzige Trinkwasserquelle war also diese Schwengelpumpe am Straßenrand, mit der man das Wasser aus einem relativ gut erhaltenen, tiefen Brunnen schöpfen konnte. Es war die Aufgabe von uns Kindern und aller Kinder aus dem Dorf, zweimal am Tag Wasser von der Pumpe zu holen. Als ich zehn Jahre später Sainte-Marine noch einmal besucht habe, musste ich feststellen, dass es die Pumpe zwar immer noch gab, aber sie war außer Betrieb, verrostet und apfelgrün gestrichen. Sie war zu einem Dekorationsgegenstand geworden, zu einer Art Fetisch vergangener Zeiten für nostalgische Menschen, genau wie die Kettenräder der Fähre oder die Kilometersteine. Mit Blumensträußen verziert, wie eine alte Schubkarre in einem Vorgarten.
Zur Zeit meiner Kindheit erfüllte die Wasserpumpe einen Zweck, und wie alles, was einen Zweck erfüllt, war sie farblos, oder genauer gesagt, hatte den dunkelgrauen Farbton von Gusseisen, an manchen Stellen Rostspuren und in der Nähe des Kolbens Fettflecken. Der Schwengel war von all den Händen, die ihn auf und ab bewegt hatten, blank poliert. Er quietschte, wenn man ihn betätigte, und nach einer Weile spritzte in regelmäßigen Abständen ein dünner Strahl kalten Wassers aus der Pumpe, der langsam die Kannen füllte. Wenn die Kanne randvoll war – es handelte sich um große Kannen aus Zink oder blau emailliertem Metall, die fünf oder sechs Liter fassten – musste man sie nach Hause tragen. Wir wechselten uns beim Tragen ab und gingen langsam mit angespannten Armmuskeln, damit das Wasser nicht überschwappte, und machten oft halt, bis der Schmerz im Handgelenk oder im Ellbogen nachließ. Die Entfernung zwischen dem Brunnen und Ker Huel (dem Ferienhaus, das Madame Hélias unseren Eltern vermietete) dürfte weniger als einen Kilometer betragen haben, aber selten ist mir ein Weg so lang vorgekommen wie dieser! Mein Vater kochte das kostbare Wasser auf dem Gaskocher in einem großen Emailletopf ab, der nur diesem einen Zweck diente, wobei immer ein Teil des Wassers verdunstete und wir schon bald wieder den Weg zum Brunnen antreten mussten. Man sagt oft, dass die Aufgabe, Wasser zu holen, eine angenehme Abwechslung im täglichen Leben der Dorfkinder darstelle und Wasserstellen vom Lachen der Mädchen und Geschrei der Jungen erfüllt seien. Ganz so habe ich das nicht in Erinnerung. Ich erinnere mich eher an den endlosen Weg in der Sonne zwischen zwei Häuserzeilen und an die lange Reihe von Kindern, die, um die Balance zu halten, mit leicht zur Seite gebeugten Körpern die Kannen schleppten, während ein Teil des kostbaren Wassers aus den Kannen plätscherte. Aber letztlich war es eine eher angenehme Aufgabe, weil sie den Kindern, wie ich vermute, das Gefühl vermittelte, sich nützlich zu machen. Inzwischen ist das alles natürlich viel einfacher, man braucht nur den Hahn in der Küche oder im Badezimmer aufzudrehen und zuzusehen, wie das Wasser herausfließt. Aber noch heute kann ich nicht umhin, darauf zu achten, dass die Wasserhähne fest zugedreht sind, um nicht einen einzigen Tropfen der kostbaren Flüssigkeit zu vergeuden.
Die Kinder von Sainte-Marine (zu denen wir uns zählen durften) waren zum großen Teil Söhne oder Töchter der Fischer, die das Dorf bevölkerten. Es gab zwar auch ein paar Auswärtige, die in den schicken Villen am Odet-Ufer wohnten, aber die sahen wir nur selten und meistens in der Kapelle, wenn dort eine Messe abgehalten wurde. Sie kamen uns seltsam vor, ich meine, ganz anders als die bretonischen Kinder. Wir belauerten die Auswärtigen manchmal durch eine Hecke hindurch oder auf Zehenspitzen vor einem Portal stehend: Gruppen von gut gekleideten Jungen und Mädchen, die Plumpsack oder Krocket spielten, Spiele, die uns kindisch vorkamen, bei denen sie sich aber gut zu amüsieren schienen. Ein Haus, das mich besonders anzog, war das Haus der Mädchen in Le Moguer, an der Straße zur Landzunge. Diese schöne, geräumige mehrstöckige Villa am Odet-Ufer war von einem großen Park mit majestätischen Bäumen umgeben, hatte ein spitzes Schieferdach mit Dachfenstern, Giebeln, Türmchen und vor allem ein schmiedeeisernes, mit schneckenförmigen Ornamenten verziertes Portal, auf das ich kletterte, um den Garten sehen zu können, nicht etwa ein Zwiebelfeld und Apfelbäume, sondern einen richtigen, großen Garten mit Kieswegen und Blumenbeeten, und hinter dem Haus schillerte durch ein Kiefernwäldchen hindurch der Fluss. Was mich anzog, war weniger der Garten – auch wenn er etwas Magisches, ja Grandioses hatte, das ihn von allen anderen dieses Dorfs unterschied – als vielmehr die Anwesenheit der Mädchen. Von fünf oder sechs Mädchen – damals habe ich erfahren, dass sie die Töchter eines der angesehensten Männer jener Zeit waren, des Leiters der französischen Pfadfinder Scouts de France – und um die Legende, das Geheimnis, vielleicht auch den Ärger noch zu verstärken, waren alle groß, schlank und blond, die Älteste dürfte etwa achtzehn gewesen sein und die Jüngste acht oder neun. Ich beobachtete sie durch die Schnörkel des Portals, sah zu, wie sie spielten oder durch den Park rannten, lauschte ihren wohlklingenden Stimmen, musterte eingehend ihre hellen Kleider, ihre Strohhüte, ihre Halstücher und ihre Sandalen, als seien sie einem Traum entflohen. Etwas Vergleichbares habe ich erst viel später im Kino wiedergesehen, in Ingmar Bergmans Wilde Erdbeeren – allerdings mit dem Unterschied, dass die durch die Lücken eines Torgitters gestohlenen Erinnerungen viel realer und dauerhafter sind als die Bilder eines Films.
Die Kinder aus dem Dorf, mit denen wir uns trafen, saßen meistens auf den kleinen Mauern neben der Anlegestelle der Fähre und sahen zu, wie sich Fußgänger und Lieferwagen jeweils mit einem Knall der schweren Metallplatte, die als Laderampe diente, an Bord der Fähre begaben. Oder wir gesellten uns vor den flachen Holzbooten, die am Hafenkai festgemacht waren, zu ihnen und sprangen von einem Boot ins andere. Dort war der Treffpunkt. Sie riefen sich etwas auf Bretonisch zu, machten Scherze. Wir waren ar Parizianer, die Pariser, über die man sich lustig machte, aber eher weniger, als wir es in Südfrankreich gewohnt waren, vielleicht weil wir ihnen trotz allem glichen und imstande waren, ihnen ein paar Brocken in ihrer Sprache an den Kopf zu werfen. Diese Generation war noch in der bretonischen Sprache aufgewachsen, und selbst wenn man ihnen in den staatlichen Schulen verbot, in ihrer »Mundart« zu sprechen – so bezeichnete man damals die bretonische Sprache –, waren der Freiheit der Sprache im Sommer keine Grenzen gesetzt. Es war eine Sprache, die man draußen benutzte, in der man schreien, fluchen und sich anbrüllen konnte. Die andere Sprache, die der Parizianer, konnten sie in drei langen Monaten vergessen und in irgendeinem Winkel zurücklassen, wie etwa in ihrem Ranzen zusammen mit den Schulbüchern und den vollgekritzelten Heften.
Sie sprachen alle bretonisch, wie ihre Eltern und ihre Großeltern. Später, wenn sie etwas älter waren, verloren sie den Gebrauch dieser Sprache, aber nicht etwa, weil sie diese vergessen hätten, sondern weil es die Sprache ihrer Kindheit war, die Sprache aus der Zeit davor, als sie sich noch nicht ihren Lebensunterhalt verdienen oder um eine erfolgreiche Ausbildung bemühen mussten. Ich erinnere mich noch an alle, Yanik, Mikel, Pierrik, Ifik, Paol, Erwan, Fanch, Soizik und die Koseformen ihrer Vornamen, an ihren Akzent, ihre Gebärden und Gesten, als wären sie die Letzten ihrer Geschlechterreihe, die in einer anderen Welt geboren worden waren und sich verändert hatten, zu Ärzten, Rechtsanwälten, Seeleuten der Handelsmarine, Hafenkommandanten oder Piloten geworden waren, und die Mädchen zu Müttern oder Großmüttern, und die alle zu einem gewissen Zeitpunkt ihres Lebens beschlossen hatten, sich nicht mehr in ihrer Muttersprache auszudrücken, um Franzosen zu werden.
Warum? Warum haben sie sich nicht dagegen gewehrt? Warum haben sie geglaubt, dass die bretonische Sprache sie in eine niedere Kategorie absinken lassen und sie zu Armut oder Unwissenheit verdammen würde? Die Männer und Frauen in meinem Alter (die Jungen und Mädchen, mit denen wir gespielt und uns auf Bretonisch angefahren haben) erinnern sich noch, dass sie in der Schule bestraft wurden, wenn sie sich in dieser Sprache ausdrückten, sogar in den Pausen. Das waren die Direktiven des französischen Erziehungsministeriums, die von Lehrern befolgt wurden, die selbst bretonisch sprachen. Französisch war die Sprache der Republik. Das hat sich nicht geändert, jüngste Erklärungen der Regierung haben dieselbe feindliche Gesinnung den anderen Regionalsprachen gegenüber erkennen lassen, dem Korsischen, Elsässischen, Okzitanischen (und die am weitesten verbreitete Regionalsprache, das Kreolisch, wird in der zukünftigen Charta nicht einmal erwähnt). Dieselben Direktiven haben den Klerus im westlichen Teil der Bretagne gezwungen, die bretonische Sprache bei der Predigt und im Gottesdienst aufzugeben. In den sechziger Jahren sind die alten »Pfarrer« – wie etwa der person, der in Sainte-Marine und in Combrit den Gottesdienst abhielt und dessen Messdiener mein Bruder und ich waren – aufgrund des Generationswechsels auf natürliche Weise durch jüngere Priester in grüner Soutane abgelöst worden, die die Messe auf Französisch zelebrierten. Und natürlich machten sie mehr her als der alte Priester, der an einem ständigen Schnupfen litt und seine Predigt regelmäßig unterbrechen musste, um sein Taschentuch aus dem Ärmel zu ziehen und sich laut zu schnäuzen.
Aber all das waren nur die Symptome des Wandels und nicht deren Ursachen. Der wahre Grund für die Aufgabe der bretonischen Sprache sind die Bretonen selbst, sie tragen die Verantwortung dafür. Es war, als sei zu jener Zeit ein heftiger Sturm über die Bretagne gefegt, der