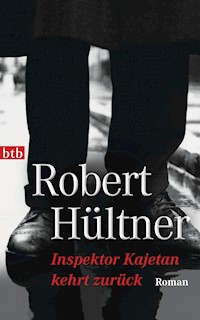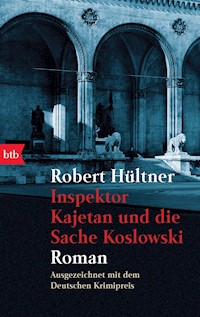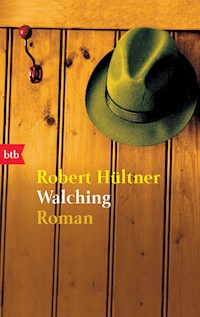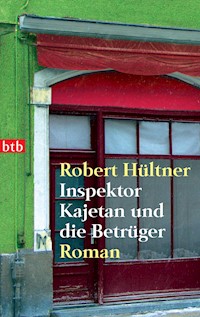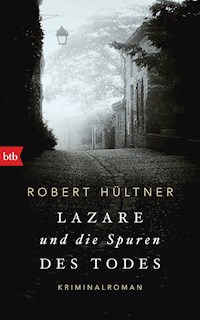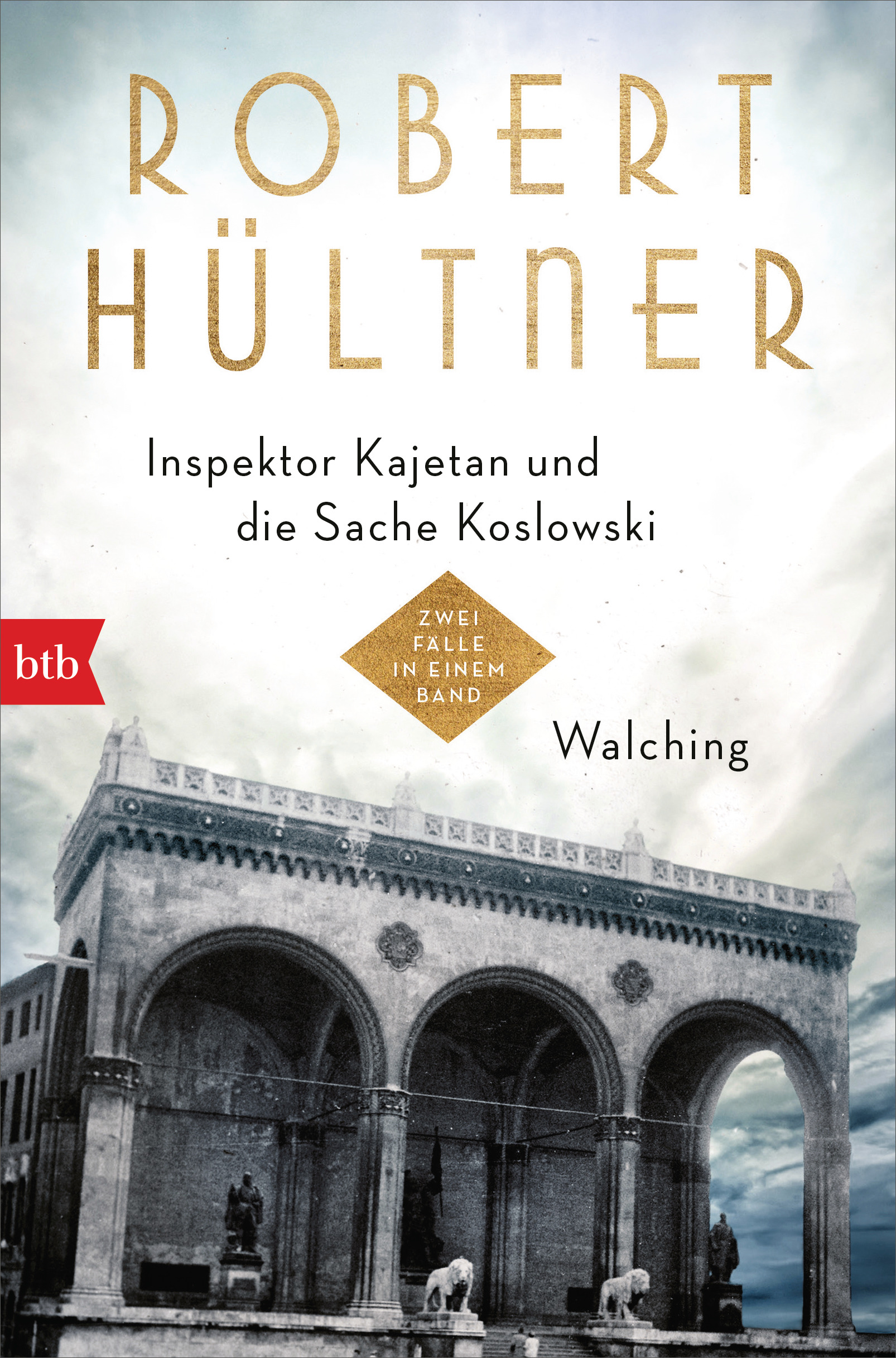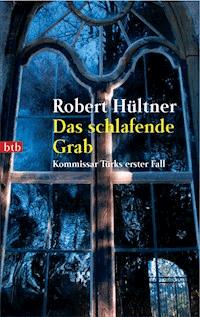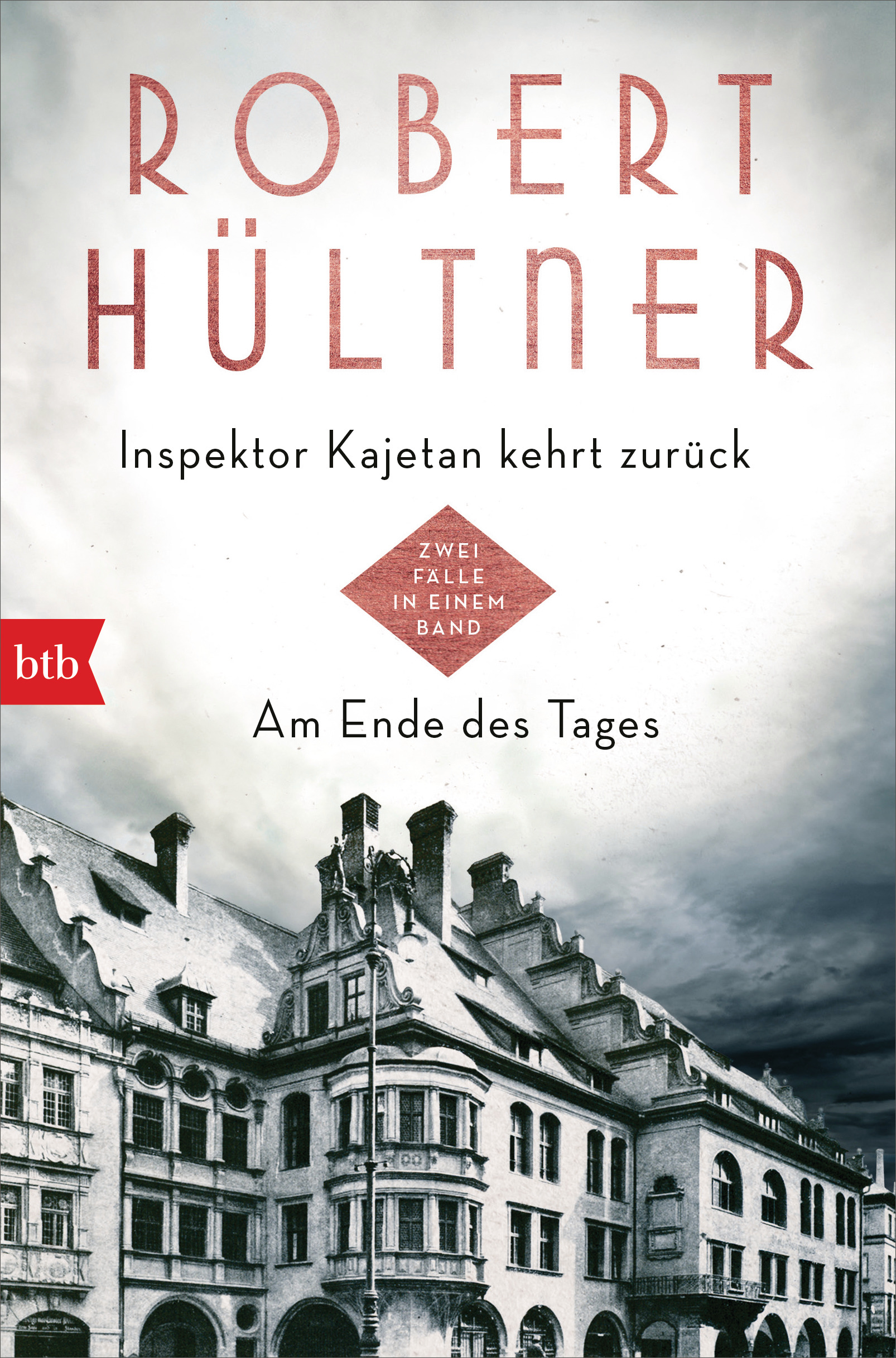
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Kajetan Doppelbände
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Dieser Doppelband enthält die Romane "Inspektor Kajetan kehrt zurück" & "Am Ende des Tages"
Inspektor Kajetan kehrt zurück:
München am Ende der turbulenten 1920er Jahre: Kajetan ist auf der Flucht, weil er den korrupten Machenschaften der Münchener Polizei auf die Spur gekommen war. Vom Grenzort Zellach aus versucht er über die Berge nach Österreich zu fliehen. Doch dann verirrt er sich in einem Schneesturm, den er überlebt, nur um sofort in die nächste Bredouille zu geraten: Man nimmt ihn als vermeintlichen Mörder des Zellacher Wirts Thannheiser fest. Als der örtliche Kommissar Kajetans wahre Identität entdeckt, verspricht er ihm, ihn nicht nach München auszuliefern – wenn Kajetan ihn im Gegenzug bei den festgefahrenen Ermittlungen im Thannheiser-Mord hilft …
Am Ende des Tages:
In den Chiemgauer Alpen stürzt ein Flugzeug ab. Ein Bauer, der gleich nach dem Unglück aufgestiegen ist, um Verletzte zu bergen, kommt bald danach mitsamt seiner Familie bei einem Brand seines Hofes um. Hat er etwas gesehen, was er nicht hätte sehen sollen? Kajetan, der in einem ganz anderen Fall ermittelt und dem Hoffnungen gemacht wurden, dass er wieder in den Polizeidienst zurückkönne, gerät bald mitten hinein in eine politische Verschwörung, in der es um mehr als nur um Flugzeugabstürze geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 739
Ähnliche
Zu den Büchern
Inspektor Kajetan kehrt zurück
München am Ende der turbulenten 1920er Jahre: Kajetan ist auf der Flucht, weil er den korrupten Machenschaften der Münchener Polizei auf die Spur gekommen war. Vom Grenzort Zellach aus versucht er über die Berge nach Österreich zu fliehen. Doch dann verirrt er sich in einem Schneesturm, den er überlebt, nur um sofort in die nächste Bredouille zu geraten: Man nimmt ihn als vermeintlichen Mörder des Zellacher Wirts Thannheiser fest. Als der örtliche Kommissar Kajetans wahre Identität entdeckt, verspricht er ihm, ihn nicht nach München auszuliefern – wenn Kajetan ihn im Gegenzug bei den festgefahrenen Ermittlungen im Thannheiser-Mord hilft …
Am Ende des Tages
In den Chiemgauer Alpen stürzt ein Flugzeug ab. Ein Bauer, der gleich nach dem Unglück aufgestiegen ist, um Verletzte zu bergen, kommt bald danach mitsamt seiner Familie bei einem Brand seines Hofes um. Hat er etwas gesehen, was er nicht hätte sehen sollen? Kajetan, der in einem ganz anderen Fall ermittelt und dem Hoffnungen gemacht wurden, dass er wieder in den Polizeidienst zurückkönne, gerät bald mitten hinein in eine politische Verschwörung, in der es um mehr als nur um Flugzeugabstürze geht.
Zum Autor
ROBERT HÜLTNER wurde 1950 in Inzell geboren. Er arbeitete unter anderem als Regieassistent, Dramaturg, Regisseur von Kurzfilmen und Dokumentationen, reiste mit einem Wanderkino durch kinolose Dörfer und restaurierte historische Filme für das Filmmuseum. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen gehören neben historischen Romanen und Krimis auch Drehbücher (u. a. für den Tatort), Theaterstücke und Hörspiele. Sein Roman »Der Sommer der Gaukler« wurde von Marcus H. Rosenmüller verfilmt. Für seine Inspektor-Kajetan-Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem dreimal mit dem Deutschen Krimipreis und mit dem renommierten Glauser-Preis.
Robert Hültner
Inspektor Kajetan kehrt zurück
Am Ende des Tages
Zwei Fälle in einem Band
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Sonderausgabe Juni 2020
by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Inspektor Kajetan kehrt zurück © 2009 by btb Verlag
Am Ende des Tages © 2012 by btb Verlag
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © Bridgeman Images / Look and Learn
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ts · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-27065-0V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Inspektor Kajetan kehrt zurück
Roman
Er war kein Held.Dazu hatte er zuviel Phantasie.
THEODORPLIVIER
München, Ende August 1928
Während des Tages war der graue Himmel wie ein verwaschenes Leintuch über der Stadt gehangen. Am späten Nachmittag sank die Wolkendecke tiefer, stäubend feiner Niederschlag brachte das Pflaster und das matte Blattwerk der Straßenbäume zum Glänzen. Als die Dämmerung hereinbrach, rissen die Wolken auf, es wurde wieder etwas milder, doch plötzlich färbte schwefelgelber Schein den Abendhimmel. Das Gezwitscher der Vögel verstummte. Jäh prasselte ein Wolkenbruch mit ohrenbetäubendem Getöse herab, scheuchte die Städter in ihre Häuser und brachte das geschäftige Treiben auf den Straßen und Gassen zum Erliegen. Eine endlos wirkende Zeit goss es wie aus Kübeln. Rasch schwollen Isar und die Bäche der südlichen Vorstadt an.
Allmählich klang das Unwetter ab und ging in ein lautloses Nieseln über. Als der mitternächtliche Glockenschlag der Giesinger Kirche wimmernd ausklang, erfüllte das Rauschen von Fluss und Bächen noch immer die Luft. Nebel wälzte sich durch die Gassen, dicht wie der Dampf in einer Waschküche.
Vom Haidhauser Hochufer kommend hastete Lipp Kerschbaumer durch den Lichthof einer milchig schimmernden Straßenlampe an der Ohlmüller-Straße, um sogleich vom Dunkel der schmalen Gassen wieder verschluckt zu werden.
Kurze Zeit später platschte er durch die Pfützen im lichtlosen Innenhof einer aufgelassenen Sägemühle und verschwand in der Tür eines heruntergekommenen Gebäudes. Er tastete sich das unbeleuchtete Stiegenhaus in den ersten Stock hinauf. Auf dem Absatz hielt er inne und lauschte in die Dunkelheit. Aus einem Schlitz unter einer Türe am Ende des Flurs schimmerte Licht. Leises Gemurmel war zu hören, ein Bodenbrett knarrte unter einem schweren Schritt.
Lipp Kerschbaumer atmete durch, um seinen hämmernden Puls wieder unter Kontrolle zu bekommen. Er hastete auf die Türe zu und stieß sie auf. Das Licht einer Kerze flackerte. Die beiden Männer in der kleinen Kammer fuhren alarmiert herum und starrten ihn an.
»Da ist er ja«, hörte er eine erleichterte Stimme.
Lipp holte röhrend Luft. »Wer ist es gewesen!?« Mit einem Hackentritt schlug er die Tür hinter sich zu. »Wer hat geschossen?«, rief er. Er presste seinen Rücken an das Türblatt, als könne er damit das Eindringen eines weiteren Unglücksboten verhindern. »Hölzl!?«
Der Angesprochene war ein untersetzter Mann mit fleischigem Gesicht und kleinen, dunklen Augen unter der wulstigen Stirn.
»Endlich bist da, Kerschbaumer«, beschwichtigte er den Ankömmling. »Wo bist denn so lang geblieben?«
»Ich hab euch was gefragt!«
»Plärr noch lauter! Scheinst wohl scharf drauf zu sein, dass uns die Grünen gleich erwischen, oder was?«
»Wers gewesen ist, möcht ich wissen«, keuchte Lipp. Sein Blick flog in die Ecke der Kammer, in der Jakl Dosch auf einer Wandbank gekrümmt kauerte und noch immer stoßend atmete. Wie sie es vereinbart hatten, war jeder von ihnen nach diesem unglückseligen Unternehmen auf unterschiedlichen Wegen zum aufgelassenen Holzlager in Untergiesing gerannt, um das weitere Vorgehen zu beraten.
»Jakl!« Lipp zog den Rotz hoch. »Bist dus gewesen?«
Der Angesprochene hob sein hohlwangiges Gesicht. »Was schaust ausgerechnet mich an?« Matte Empörung klang aus seiner Stimme. »Möchtst dus vielleicht mir anhängen?«
»Ich schau euch alle zwei an!«
»Weckts nur das ganze Viertel auf«, sagte Hölzl. Der Parteifunktionär griff sich einen Schemel, ließ sich darauffallen und streckte die Beine von sich. »So ists recht. Genauso gehört sichs für ein geheimes Parteikommando.« Er kramte in seiner Jackentasche und zog ein verbeultes Päckchen Zuban hervor. »Ganz genau so.«
»Wer es war, möcht ich wissen!«, schrie Lipp. Seine alte Narbe an der Stirn pochte.
Hölzl streifte ihn mit einem zornigen Blick, steckte sich eine Zigarette an der Kerze an und nahm einen tiefen Zug. »Hock dich hin, Lipp«, sagte er beherrscht. »Geschehn ist geschehn.« Er wischte sich mit dem Handrücken über die feuchte Stirn, drehte sich zum Fenster und sah in die tintige Nacht hinaus. Regen prasselte gegen die Scheiben. »Der Schöttl ist ein Lump gewesen. Er hats nicht anders verdient.« Sein Blick kehrte zu Lipp zurück. »Es ist egal, wers gewesen ist. Jeder von uns hat eine Pistole dabei gehabt, und zum Schluss ist es drunter und drüber gegangen. Aber deswegen brauchst jetzt nicht gleich die Nerven zu verlieren. Kein Mensch hat uns gesehen.«
Lipp Kerschbaumer trat einen Schritt vor. Seine Schuhe schmatzten beim Gehen, von den Säumen seiner durchnässten Kleidung tropfte noch immer Wasser und bildete kleine Pfützen zu seinen Füßen. Sein Gesicht glühte, die nassen Haare klebten ihm in Strähnen über Stirn und Schläfen. Das Licht der Lampe, die von der Decke der niedrigen Kammer baumelte, ließ seine noch jungen Züge ausgemergelt erscheinen.
»Du warst es, Hölzl«, sagte er leise.
»Reiß dich zusammen! Noch bin ich der Kommandant.«
»Drauf scheiß ich ab jetzt! Gibs endlich zu.«
»Auf was ein Genosse wann scheißen darf, ist noch nicht ausgemacht, Kerschbaumer«, sagte Hölzl ungerührt. »Und wie kommst überhaupt drauf, dass ich es gewesen bin? Hast dus vielleicht gesehen?«
Lipp schien die Frage nicht gehört zu haben. »Warum hast du geschossen? Es war anders ausgemacht. Er hätt einen Denkzettel kriegen sollen. Ein paar Watschen, sonst nichts!«
Hölzl paffte und sah an ihm vorbei. »Ob dus gesehen hast, hab ich dich gefragt.«
Lipp spürte, wie sein Herzschlag vor ohnmächtiger Wut zu poltern begann. Eine Übelkeit kroch heran.
»Der Lipp hat recht. Von Schießen ist nie die Red gewesen«, warf Jakl verdrossen ein. Er hielt seine Arme um seinen Oberkörper geschlungen, als friere ihn.
Wieder unterdrückte Hölzl einen zornigen Impuls. »Jetzt hörts einmal zu, Genossen«, begann er. »Wir spielen hier nicht Räuber und Schandi, kapiert? Die Partei ist von oben bis unten von Spitzeln verseucht. Fangen wir einen, schleicht sich von der anderen Seite wieder ein neuer rein.« Er hob seine Stimme: »Kerschbaumer! Dosch! Muss ich euch erzählen, wie viele von uns schon eingefahren sind, weil bei der Verhandlung auf einmal einer von diesen Drecksäuen als Zeuge aufgetaucht ist? Die besten Kameraden waren drunter! Ist euch das auf einmal egal?«
»Da drum gehts doch gar nicht«, sagte Jakl. »Aber wenn ich gewusst hätt, dass –«, Hölzl schnitt ihm mit einer gereizten Handbewegung das Wort ab und fuhr beschwörend fort: »Wir haben vom Genossen Grabow persönlich den Auftrag, diese Drecksäu unschädlich zu machen. Wenn ihr gemeint habt, es langt, denen ein bissl mit dem Finger zu drohen, dann habt ihr in einem Geheimen Parteikommando nichts verloren, verstanden?«
»Dieser Grabow … keiner in der Partei kennt ihn, bloß du.«
Hölzl verdrehte die Augen zur Zimmerdecke. »Darf ich nicht drüber reden, Dosch. Wie oft soll ichs dir noch erklären.«
»Was hat uns eigentlich ein Russ zu befehlen? Wir sind die bayerische Partei.«
»Und von der Komintern hast auch noch nie was gehört, stimmts?«
»Doch …«, sagte Jakl müde.
»Na, wenigstens etwas«, seufzte Hölzl.
»Du kapierst nicht!«, setzte Jakl wieder an. »Hätt ich gewusst, dass einer bei der Sach draufgehen kann, hätt sich die Partei einen anderen suchen müssen.« Er hob sein schmales Gesicht zu Hölzl. »Und ich wars nicht, der geschossen hat.« Er drehte sich zu Lipp. »Hab doch nicht einmal entsichert gehabt.« Seine letzten Worte waren in ein Flüstern übergegangen.
Hölzl strich sich in gespielter Verzweiflung mit der Hand über seinen Schädel. »Kapiert ihr denn allweil noch nicht, ihr Anfänger? Es ist komplett egal, wem von uns ein Schuss abgegangen ist. Ist wie bei den Weibern. Ist nicht vorgesehen gewesen, richtig, kann aber vorkommen! Je nervöser einer ist, desto eher!«
Lipp lachte grimmig auf. »Genauso werdens die Richter auch sehn.«
Hölzl ging nicht darauf ein. »Genossen!«, setzte er wieder mit eindringlicher Stimme an. »Ich sags noch mal: Keine Sau hat uns gesehen. Es gibt also bloß eins, das uns gefährlich werden könnt. Nämlich, wenn einer von uns jetzt die Nerven verliert!« Drohend ergänzte er: »Das aber wird die Partei nicht zulassen, da könnts Gift drauf nehmen.« Er fixierte Jakl, dessen Schädel zwischen seine Schultern zu schrumpfen schien. Hölzl registrierte befriedigt sein erschöpftes Nicken, warf seine Zigarette zu Boden und sagte lauernd: »Du auch, Kerschbaumer? Haben wir uns verstanden?«
Lipp war noch immer fassungslos. Er klappte den Mund ein paarmal auf und zu, bevor er hervorstieß: »Habt ihr überhaupt eine Ahnung, was jetzt losgeht? Wenn ers nicht überlebt –«
»Dann hat ers nicht anders verdient!«, fiel ihm Hölzl heftig ins Wort.
»Aber wir … wir werden als Mörder gesucht!« Dass er spürte, wie seine Augenwinkel feucht wurden, machte Lipp nur noch zorniger. »Was ist mit den Genossen im Ruhrgebiet droben wegen einer gleichen Sach passiert, vor zwei Jahren? An die Wand gestellt sinds worden!«
»Klassenjustiz ist das gewesen«, sagte Hölzl. »Sogar die Bürgerlichen habens zugeben müssen.«
»Und damit, dass die Bürgerlichen hinterher was zugeben, könnens jetzt die Würmer füttern, oder was?!« Lipps Stimme überschlug sich. »Hölzl … bist dus gewesen? Red, sonst –!«
»Es muss endlich durchgegriffen werden! Gründlich!«
»Ob du geschossen hast?! – Du warst es!«
»Zum letzten Mal«, sagte Hölzl beherrscht. »Hast dus gesehen?«
»Nein! Bin doch schon wieder im Hausgang gewesen, wies gekracht hat!«
»Also nichts hast gesehen«, stellte Hölzl fest. »Ich sag dirs noch mal, Lipp. Reiß dich ja zusammen. Die Geduld der Partei hat Grenzen.«
»Ich … ich trau dir nicht, Hölzl …« Lipps Stimme klang jetzt heiser. »Ich hab dir noch nie getraut …«
Der Mund des Funktionärs zuckte. Verächtlich maß er sein Gegenüber. »Kann auf Gegenseitigkeit beruhen, Kerschbaumer. Ich frag mich auch langsam, auf was für einer Seiten du eigentlich stehst.« Er bemerkte, dass ihn Dosch ungläubig anstarrte. Seine Stimme wurde wieder drängend: »Herrgott! Ihr seids doch keine Weiber! Ihr müsst es endlich kapieren! Es ist Krieg, Genossen!« Wie zur Bekräftigung schlug er seine Hände auf seine Oberschenkel. »Und jetzt ist Schluss mit der Winslerei! Hab ichs denn mit Kommunionbuben zu tun, oder was?« Er stand auf und ging zum Fenster. Der Regen hatte nachgelassen. Hölzl schob den Saum des verschlissenen Vorhangstoffes zurück und sah prüfend in die Nacht hinaus. Er zog den Vorhang wieder zu und kehrte zu seinem Schemel zurück. »Und jetzt reden wir darüber, was wir den Kriminalern sagen, wenn sie uns …«
»Ich trau ihm nicht, Jakl«, setzte Lipp wieder an. »Der ist nicht sauber –« Sein Magen krampfte sich. Er tat einen ungelenken Schritt zurück und tastete nach der Türklinke.
»Wohin gehst?«, sagte Hölzl scharf.
»Aufs Scheißhaus …«, würgte Lipp hervor. »Ich muss … speiben. Oder wärs dir … lieber, ich täts da herin?«
Er wartete Hölzls Entgegnung nicht mehr ab, ging hinaus und zog die Türe hinter sich zu. Seine Kehle wurde eng, Säuregeschmack füllte seinen Gaumen. Er rang nach Luft, wankte einige Meter vorwärts, bis er die Türfassung des Aborts mit seinen Fingern ertastet hatte, drückte die Türe auf und griff nach dem Abortdeckel.
In diesem Moment hörte er mehrere Schläge, die an die Haustüre unter ihm donnerten, nur wenige Augenblicke danach das Splittern und Bersten des nachgebenden Holzes, dann das Poltern der Stiefel und den hechelnden Atem mehrerer Männer auf der Stiege.
Lipp zog die Türe hinter sich zu und hielt den Atem an. Durch den Schlitz unter der Türe huschte der Schein flackernder Lampen vorüber. Sekunden später dröhnten nur wenige Meter entfernt wieder Schläge.
»Polizei!!«, hörte er eine laute Stimme. »Waffen weg! Einzeln und mit erhobenen Händen herauskommen!«
Lipp stieg auf das Abortbrett, suchte nach dem Fensterhaken, drehte ihn, öffnete das schmale Fenster und wand sich hinaus. Noch immer fiel Regen. Unter ihm gurgelte der schwarze Stadtbach. Der Geruch abgestandener Lauge und Fäkalien drang an seine Nase. Er stieß sich ab. Als er im Wasser landete, spürte er einen Schlag. Ein reißender Schmerz schoss durch seine Wade. Er tauchte unter.
Südostbayern, Bezirk Dornstein, Anfang September 1928
Der gelbe DAAG der »Alpenkraftpost« bremste kurz hinter der Stauffenbrücke abrupt ab. Er war kaum am Straßenrand zu stehen gekommen, als ein Dutzend Gendarmen, die Waffen schussbereit gehoben, den Wagen umstellte.
Kajetan atmete flach. Er sah zu den Ausgängen. Vor jedem hatten sich Polizisten postiert. Er saß in der Falle.
Einer der beiden Beamten, die Uniform wies sie als Sergeanten der Grenzpolizei aus, hatte sich bereits in der Nähe des Ausstiegs an der Seite des Kondukteurs postiert, während der andere damit begann, den Mittelgang langsam abzuschreiten und jeden der Reisenden zu mustern.
War während der Fahrt noch munteres Stimmengewirr zu hören gewesen, so war dies beim Auftreten der beiden Sergeanten – jeder den Daumen der Rechten in den Gürtel gehakt, in Griffnähe zur Pistolentasche – in beunruhigtes Gemurmel und schließlich in lähmendes Schweigen übergegangen. Als hätte das Auftreten der Staatsmacht die zwei Dutzend Passagiere in ein Häuflein kleinlauter Sünder verwandelt, von denen jeder in diesem Moment in seinem Gedächtnis gekramt und auch prompt darin etwas gefunden hatte, das ihn ein Strafgericht befürchten ließ, duckten sich die Passagiere unter dem durchdringenden Blick des Sergeanten weg.
Kajetan knetete den Hutrand auf seinem Schoß; seine Handflächen waren heiß und schweißfeucht. Ein verkrampftes Hüsteln drang an sein Ohr. Aus den Augenwinkeln fischte er den misstrauischen Blick seines Nebenmannes auf.
Der Grenzpolizist kam näher. Seine Miene ließ keine Regung erkennen, nur seine Augen lebten. Er bewegte sich leicht vornübergebeugt, war angespannt, auf überraschende, gefahrvolle Situationen vorbereitet.
Kajetan wagte einen verstohlenen Blick. Er bemerkte, dass der Grenzer die Alten, die Frauen und Kinder nur mit einem kurzen Blick streifte und niemand nach Papieren fragte.
Sie suchten einen Mann. Einen, der als gefährlich eingeschätzt wurde, vielleicht sogar bewaffnet war. Einen, auf dessen Papiere sie nichts gaben, weil anzunehmen war, dass sie gefälscht waren. Von dem sie jedoch eine Personenbeschreibung hatten, welche eine vermutlich nicht veränderbare, unverwechselbare Äußerlichkeit aufwies.
Kajetan betrachtete sich in der Spiegelung des Fensters. Noch immer kam er sich fremd vor: Er hatte seinen Bart bis auf eine kleine Bürste über der Oberlippe abrasiert, sein Kopfhaar beinahe militärisch gestutzt und seinen Scheitel verlegt, was sein Gesicht breiter wirken ließ. Aber würde er die Beamten damit täuschen können?
Dabei war bisher alles nach Plan gelaufen. Noch vor Sonnenaufgang hatte die Witwe Süssmayr, seine Nachbarin in der Hildegardstraße, an die Tür des Verschlags hinter ihrem Bücherlager geklopft. In diesem hatte sich Kajetan bereits seit mehreren Wochen verborgen gehalten, nachdem nicht mehr daran zu zweifeln war, dass es ein Mordkommando auf ihn abgesehen hatte. Dabei hatte er keinen Schimmer, wer es überhaupt darauf anlegte, ihn aus dem Weg zu schaffen. Und warum? Er ahnte, dass es etwas mit seinem letzten Fall zu tun haben musste, in dessen Verlauf er mit der erst kürzlich gegründeten Politischen Polizei in einen Konflikt geraten war, der ihm beinahe das Leben gekostet hatte. Ein Fall, bei dem nicht ausgeschlossen war, dass auch die Nazi-Partei in ihn verwickelt war. Waren es die Nazen, die Jagd auf ihn machten? Arbeitete die Polizei mit ihnen zusammen? Aber wie kämen auf die Republik vereidigte Polizeibeamte dazu, mit Feinden des Staates gemeinsame Sache zu machen? Ein unglaublicher Skandal wäre das doch, hatte er Frau Süssmayr bestürmt. Worauf die alte Frau ihn nur ein wenig mitleidig gemustert, fast unmerklich den Kopf geschüttelt und geschwiegen hatte. Nur eines sei sicher, meinte sie: dass Kajetans Wohnung im Hinterhaus seit Tagen von wenig vertrauenerweckenden Gesellen observiert würde, denen man die schlechte Absicht schon am Gesicht ablesen könne. Denen in die Hände zu fallen würde sie ihm jedenfalls nicht wünschen.
Ein letztes Mal hatte ihm die alte Frau eingeschärft, wie er den Weg bis zur Grenze zurückzulegen, mit wem er, wenn er dort angekommen sei, Kontakt aufnehmen müsse. Er war nicht einmal mehr dazu gekommen, sie zu befragen, wie es eine biedere Ladnerin wie sie zustande gebracht hatte, innerhalb kürzester Zeit Kontakt zu jener geheimen Schleuserorganisation herzustellen, die ihn bald über die grüne Grenze bringen sollte. Zu mehr als einer Andeutung darüber, dass ihr verstorbener Ehemann eben ein alter Soze gewesen sei, der als junger Kerl noch die Verbotszeit miterlebt hatte, hatte sie sich nicht bewegen lassen.
Nachdem Kajetan die Anweisungen zu ihrer Zufriedenheit wiederholt hatte, steckte sie ihm wortlos den neuen Ausweis und ein Bündel Scheine zu. Beinahe schroff wehrte sie seinen Dank ab. Sonst sei er gesund? Was fasele er da? Habe er ihr nicht vor Kurzem in einer verzweifelten Lage geholfen? Na also!
Sie drängte ihn zur Tür. Vor der Toreinfahrt stand ein Fuhrwerk, wie sie die Bauern des Umlandes zur Belieferung des Viktualienmarktes benutzten. Der behäbige Fuhrknecht und die Alte verständigten sich mit einem verschwörerischen Nicken. Nachdem sie sich mit flinken Blicken in alle Richtungen vergewissert hatte, dass noch niemand auf der morgendlichen Gasse zu sehen war, winkte die alte Frau in das Hausinnere. Kajetan schlüpfte hinter die Plane der Ladefläche und kroch unter die leeren Kartoffelsäcke.
Wenig später hörte er, wie das Gefährt das holprige Pflaster der Altstadtgassen verließ und in die Prinzregentenstraße einbog. Schnaubend quälte sich das Zugtier das Isarufer empor. Nach mehreren Stunden hielt das Fuhrwerk außer Sichtweite des Grafinger Bahnhofs, und kurz darauf befand sich Kajetan bereits auf dem Weg durch eine unwirkliche, von Nebel verhüllte Landschaft. Dampfige Wärme erfüllte die Luft seines Abteils, sie vermischte sich mit dem süßlichen Qualm, der aus der Pfeife eines älteren Mannes mit gefurchten Zügen emporstieg. Neben ihm fütterte eine stämmige Bäuerin ihren kleinen Jungen mit Brotstücken. Die anderen Fahrgäste – ein ungesund rotgesichtiger Bursche im Armeerock und ein älterer Mann in einem schäbigen dunklen Anzug und ölig über die Glatze geklebtem Haar – sinnierten schläfrig vor sich hin und lauschten dem gleichmäßigen Takt, den die Räder des Zugs auf den Gleisnähten schlugen.
Gegen die Mittagszeit riss der Himmel auf. Die gezahnte Silhouette des Gebirges glitzerte in der Ferne, als Kajetan den Zug eine Station vor dem Grenzbahnhof verließ und nach kurzem Warten in den Wagen der »Alpenkraftpost« umstieg.
Der Bus war bis auf wenige Plätze besetzt. Mehrere Passagiere waren an ihren gewalkten Jankern als Bewohner der Region auszumachen, bei anderen verrieten Kleidung und Ausrüstung, dass es sich bei ihnen um Touristen oder Bergsteiger handeln musste. Auch Kajetan trug wetterfeste Wandermontur und Rucksack. Niemand nahm Notiz von ihm, nicht mehr jedenfalls, als es die Höflichkeit erforderte, mit der sich die in enge Sitze gepferchten Reisenden untereinander zu arrangieren hatten. Die nervöse Wachsamkeit, die noch zu Beginn seiner Reise seinen Puls beinahe schmerzhaft angetrieben hatte, war allmählich von ihm abgefallen und dem Gefühl gewichen, er befände sich bereits in Sicherheit.
Er hatte sich zu früh gefreut.
Der Grenzpolizist war nur noch wenige Schritte von ihm entfernt. Er verharrte bei einem jüngeren Mann mit eingefallenen Wangen, der sich bemühte, der strengen Musterung des Beamten trotzig standzuhalten.
»Tuns den Hut runter!«, befahl der Fahnder. Der junge Mann gehorchte.
»In Ordnung!«, gab der Grenzer schließlich brummend von sich. Er drehte ab.
Ein Kleinkind auf den vorderen Plätzen hatte zu weinen begonnen, als sich neben Kajetan ein dunkler Schatten aufbaute. Kajetan hob das Gesicht, streifte für den Bruchteil einer Sekunde den ausdruckslosen Blick des Polizisten. Hinter dessen Stirn schien es zu arbeiten.
Kajetans Muskeln spannten sich unwillkürlich, sein Herz pochte an seine Rippen. Panik ergriff ihn. Flieh!, schrie jede Faser seines Körpers, doch im selben Augenblick erfüllte ihn das Gefühl einer lähmenden Resignation.
Er hatte verloren.
Und jetzt würde er sich nicht weiter lächerlich machen.
Er würde aufstehen, die Hände heben und sagen: Ersparen wir uns das Theater, Leute. Ihr habt mich.
Er öffnete den Mund. Seine Zunge fühlte sich pelzig an.
»Wohin gehts?«, hörte er. Es musste die Stimme des Sergeanten gewesen sein.
Vor Kajetans Augen flirrte es.
»Nach …«, er musste husten, »… ins Gebirg.«
»In Ordnung.«
Der Fahnder ging weiter. Als Kajetan die Augen wieder hob, hörte er die nölende Stimme seines Sitznachbarn wie aus weiter Ferne: »Um was gehts denn eigentlich, Herr Wachtmeister? Wen suchens denn?«
»Meinens, dass Ihnen des was angeht?«, raunzte der Sergeant über die Schulter.
»Entschuldigens, ich –«
»Ruhe!«
Kajetan saß wie betäubt. Erst nach einer geraumen Weile nahm er wahr, dass die Grenzpolizisten den Wagen wieder verlassen hatten und der Bus die Fahrt unter dem jetzt umso lebhafteren Geschnatter der Passagiere fortsetzte. Je mehr seine Benommenheit wich, desto deutlicher spürte er, dass es in seinem Magen zu rumoren begonnen hatte. Er würde den Kondukteur bei der nächsten Station bitten müssen, ihn für einige Minuten aus dem Wagen zu lassen.
Gemeinde Zellach, Bezirk Dornstein (Oberbayern)
Schon berührte die sinkende Sonne die Zinnen des Gebirges im Westen, doch noch immer spannte sich ein makellos tiefblauer Himmel über das Zellacher Tal. Über den ostwärts gerichteten Hängen herrschte bereits Dämmerung, als der staubgelbe Bus die letzte Steigung vor dem Ort emporschnaubte, wenig später auf den Dorfplatz einbog und neben der Kirchhofsmauer zu stehen kam.
Die letzten Fahrgäste verabschiedeten sich voneinander unter gelassenem Geplauder. Der Kondukteur sprang federnd vom Trittbrett, hantierte am Verschluss einer Seitenklappe, öffnete sie, entnahm ihr einen schlaffen Postsack und steuerte die Poststation am Ende des Platzes an.
Kajetan hatte sich an der Haltestange neben der Einstiegstüre festhalten müssen. Einige Atemzüge lang hatte er das Gefühl, der Boden schwanke unter seinen Füßen – die letzten Kilometer auf der schmalen Gebirgsstraße waren eine Tortur gewesen, Kurve hatte sich an Kurve gereiht, polternd, schaukelnd und spotzend hatte sich der Wagen auf der von Schlaglöchern übersäten Straße das Hochtal hinaufgekämpft.
Kajetan atmete tief durch. Klamme Kälte füllte seinen Gaumen, biss in seine Schleimhäute wie winzige Nadelstiche, er musste heftig niesen. Ein älterer Wanderer, der schweren Schrittes die Hauptstraße hinaufstapfte, sah zu ihm herüber, wandte sich aber, als sich ihre Blicke kreuzten, sogleich wieder ab.
Ein eisiger Windhauch fegte über den Dorfplatz, versetzt mit dem süßfaulen Geruch dampfenden Dungs. Eine gelassene Ruhe lag über dem Ort; nur noch wenige Menschen waren unterwegs. Über einigen der Dorfhäuser, die sich auf mehreren Hangstufen um die kalkgelb verputzte Pfarrkirche scharten, stand die dünne Rauchsäule eines Herdfeuers. Die Felder des engen Talgrundes waren abgeerntet, einige der schmalen Ackerstreifen bereits schwarz aufgebrochen. Das plumpe Geläut einer Weideglocke drang an Kajetans Ohr, von einer Mühle im tiefer liegenden Ortsteil flog das Kreischen einer Holzsäge heran, irgendwo sprachen Leute miteinander; alle Geräusche vermischten sich mit dem steten Rauschen des milchgrünen Baches, dessen Wasser um glatt geschliffene Kalksteinblöcke tänzelte.
Er hob den Kopf. Im Westen und Osten flutete der Nadelwald wie ein schwarzes, lanzenbewehrtes Heer die steilen Hänge empor, an deren Ende er in herbstlich flammenden Laub- und Föhrenwald überging, um schließlich in von Felsblöcken übersäten Geröllhängen auszubranden. Darüber erhoben sich, fast senkrecht in schwindelerregende Höhen aufragend, die nackten Zinnen des Hochgebirges. Hoch über der Talsohle im Süden war ein baumloser Bergsattel zu erkennen, auf den sich das graue Band einer Straße zuschlängelte. An ihrem höchsten Punkt fing ein hell verputztes Gebäude das letzte Licht der untergehenden Sonne. Die Grenzstation.
Kajetan griff nach seinem Rucksack und machte einige unentschlossene Schritte zur Mitte des Platzes, als ihn ein energisches Klingeln hinter seinem Rücken zusammenfahren ließ. Ein kleines Mädchen mit wippenden Zöpfen, das Gesicht vor Eifer und Anstrengung gerötet und energisch in die Pedale ihres klapperigen Fahrrades tretend, bog vor ihm auf den Vorplatz der Gemischtwarenhandlung ein, sprang vom Rad und verschwand unter dem dünnem Patschen ihrer nackten Sohlen im Laden, den im selben Moment zwei Frauen mit gefüllten Einkaufskörben verließen, die, nachdem sie Kajetan einen flüchtigen Blick zugeworfen hatten, gemächlich über den Platz davonschlenderten.
Kajetan drückte sein Kreuz durch. Er bemerkte, dass sich die Luft binnen weniger Minuten abgekühlt hatte. Fröstelnd schulterte er seinen Rucksack und knöpfte seine Jacke bis unter das Kinn zu.
Bis jetzt hatte er den Zettel noch nicht zu Hilfe nehmen müssen, den man ihm in München in die Hand gedrückt hatte. Jetzt brauchte er ihn. Ein handgeschriebener Brief mit belanglos privatem Inhalt war es, der mit einem einfachen Zahlencode zu dechiffrieren war. Kajetan buchstabierte:
Peterbauerhof. Hinter Kirchplatz ueber Bruecke, erste Zweigung bergwaerts hoch …
Kajetan verstaute das Papier, fixierte die beschriebene Brücke und machte sich auf den Weg.
Die von Rillen der Fuhrwerke gefurchte Schotterpiste wand sich im Zickzack über strohbraune Hangstufen empor. Nach etwa einer Stunde flachte sich der Weg ab, um sich zu einer kleinen Rodung zu öffnen. An ihrem Ende stand der Peterbauerhof, breit und gedrungen, mit wettergrauen Holzschindeln gedeckt, von Obstbäumen in Herbstlaub umgeben.
Das Haus musste uralt sein. Über dem massigen Erdgeschoss – ein von wenigen Fensteröffnungen durchbrochenes Mauerwerk – hob sich das balkengezimmerte, von einer Altane umgürtete Obergeschoss. Der über der Stallung mit Brettern verschlagene Wirtschaftstrakt lehnte sich an die Rückseite des Hofgebäudes.
Ein Hund schlug empört an, als sich Kajetan dem Haus näherte. Wie überall in den Bergen war die Haustüre nicht verschlossen. Auf sein Rufen antwortete eine Frauenstimme aus einem Raum am Ende des dunklen Hausflurs. Kajetan folgte ihr.
Die junge Frau unterbrach ihre Arbeit nicht. Sie stand vor dem Herd und rührte in einer Pfanne. In einem Topf perlte kochendes Wasser. Dampf umnebelte sie und rötete ihr Gesicht. Sie war klein und stämmig, hatte das volle, dunkelbraune Haar unter ein Kopftuch verstaut, trug eine Schürze über einer ausgewaschenen Bluse und knöchellangem Kittel. Sie streifte ihn mit einem prüfenden Blick, bevor sie seinen Gruß erwiderte.
»Um was gehts?«
Den Peterbauern müsse er sprechen, sagte Kajetan. Er sei doch hier richtig?
Sie bestätigte es, ihm ihr Profil zuwendend. Der Bauer sei noch beim Viehgatter, müsse aber bald zurück sein. Sie wischte sich mit dem Handrücken über die glänzende Stirn und wies zur Stubentür. »Wenns Ihnen derweil hinhocken möchten, Herr?«
Kajetan nickte dankend, trat unter den niedrigen Türsturz hindurch und ließ sich am Tisch nieder. Eine Weile hörte er nichts als das leise Scheppern des Küchengeschirrs nebenan, dann ein angestrengtes Stöhnen. Er sprang auf und sah, dass sich die junge Frau in der Küche abmühte, ein Schaff an den Ausguss zu wuchten.
Er packte wortlos an. Sie streifte ihn mit einem dankbaren Blick.
»Was hat Er da verloren?«, schnauzte eine Stimme hinter ihm. Ein untersetzter Mann stand auf der Türschwelle, das Gesicht dunkel vor Wut. Er machte einen drohenden Schritt auf Kajetan zu.
»Er will zu dir«, sagte die junge Frau schnell.
»Was hat er dann in der Kuchl herumzuschlieffen?!«
»Karl. Spinn dich aus. Er hat mir bloß geholfen.«
Kajetan fasste sich. »Ich muss mit Ihnen reden, Peterbauer«, sagte er. »Ich hab gehört, dass Sie ein zuverlässiger Bergführer sein sollen.«
Der Bauer sah ihn scheel an. »Wer sagt dir so was?«
»Ein Herr Knecht in München, von dem ich Sie lieb grüßen soll.«
Lieb. Knecht. Die Parole. Die Züge des Bauern entspannten sich, zeigten aber noch immer Skepsis. Kajetan streckte die Hand aus. Der Bauer ergriff und drückte sie. Er nickte kaum merklich, als er dabei den abgewinkelten Mittelfinger seines Besuchers erspürte.
»Der Gruß geht retour«, sagte er.
»Gehts rüber«, sagte die junge Frau. »Ihr stehts mir im Weg umeinand.«
Der Peterbauer brummte etwas zur Antwort und ging voraus. In der Stube angekommen, zog er die Türe hinter sich zu.
»Nicht, dass die Schwester und ich ein Geheimnis voreinander hätten«, erklärte er. »Es ist bloß: Was die Lies nicht weiß, kann sie auch keinem erzählen.« Der Bauer deutete auf die Bank. Kajetan setzte sich.
»Und nimm mirs nicht krumm, dass ich dich …« Der Peterbauer unterbrach sich und rieb sich verlegen die stoppelige Wange. »Hab dich für einen anderen gehalten.«
Kajetan winkte verständnisvoll ab. Der Bauer hängte seine Schürze an den Wandhaken und nahm am anderen Ende des Tisches Platz. »Es ist nämlich schon länger keiner mehr da gewesen. Hab mir schon fast gedacht, dass die Zeiten besser werden und es den ganzen Krampf nimmer braucht.« Resigniert fügte er hinzu: »Hab ich mich wohl täuscht.«
»Bleibt er zum Essen, Karl?«, rief Lies durch die Tür.
»Nein.« Der Peterbauer sah Kajetan an. »Pass auf: Ich brauch ein paar Tag, um den Genossen drüben Bescheid zu sagen. Die sinds, die dich über die Muntenwand bringen. Die ist nämlich schon auf der österreichischen Seiten.«
»Es sind nicht Sie, der mich –?«
Der Bauer schüttelte den Kopf.
»Wo denkst hin? Ich kann nicht so lang von der Arbeit fort. Von mir kriegst bloß die Stell gesagt, wo sie dich abholen und durch die Wand bringen.«
Die Wand? Es hörte sich nicht nach einem bequemen Weg an. Der Bauer bestätigte es.
»Der Muntensteig ist kein kommoder Spazierweg. Wirst dich anseilen müssen.« Der Bauer grinste spärlich. »Bequemere Wege gäbs freilich. Aber da riskierst du, dass du einer Streifen der Grenzpolizei oder einem Revierjäger in die Quer kommst.«
»Wird denn oft kontrolliert da oben?«
»Sie sind seit einiger Zeit wieder schärfer geworden.« Der Peterbauer kratzte sich am Handrücken. »Frag mich nicht, wieso. Geschmuggelt wird bei Weitem nimmer so viel wie noch vor ein paar Jahr, das kanns nicht sein. Das Lästigste aber ist, dass es sich früher sofort rumgesprochen hat, wenn wieder eine Patrouille ansteht. Heut aber kriegst es fast nimmer raus.« Er hob das Gesicht und lächelte. »Aber in die Muntenwand hat sich noch keiner von denen reingetraut.«
»Wie lang wirds dauern, bis Sie –«
»Bis ich die Genossen von der Gilde drüben erwischt hab? Ein, zwei Tag tät ich sagen. Eher gehts nicht.«
»Kann ich derweil bei Euch unterkommen?«
Der Bauer schüttelte den Kopf. »Auf gar keinen Fall. Dafür kennen mich ein paar Leut im Dorf zu gut.« Er machte eine Kopfbewegung in Richtung der Küchentüre. »Und der Lies möcht ich auch nicht alles auf die Nasen binden.« Er verzog den Mund zu einem leichten Grinsen, das aber sofort wieder erlosch. »Du hast auch keinem gesagt, dass du zu mir gehst? Oder nach dem Weg zu mir gefragt?«
Kajetan verneinte. Er habe es genauso gemacht, wie man ihm gesagt hatte.
»Gut. Das Gescheiteste ist, dass du dir für ein paar Tag beim ›Taffern‹-Wirt drüben ein Zimmer nimmst und den Sommerfrischler markierst. Genug Geld dafür hast?« Das Nicken Kajetans registrierend fuhr er fort: »Du gehst am besten auf der Stell los, bevors finster wird.« Er sah aus dem Fenster. Die Dämmerung hatte sich ausgebreitet. Langsam verglühte auch der rötliche Schimmer der Felswände im Osten. »Und wenn dich unterwegs jemand fragt, was du in der Näh vom Peterbauer zu suchen hast, dann lass dir was einfallen. Du hättest dich vergangen, oder so. Kapiert?«
»Wie krieg ich mit, wenns so weit ist?«
»Wirst dann schon merken«, sagte der Peterbauer. Wieder verkniff er den Mund zu einem schmalen Lächeln. »Du solltest es dir jedenfalls nicht mit den Kellnerinnen vom ›Taffern‹ verscherzen.«
»Mit denen soll sichs einer eh nie verscherzen«, gab Kajetan zurück.
Der Peterbauer lachte leise. »Das ist gescheit.«
Das Gasthaus »Taffern« lag an der Grenzstraße, einige Gehminuten oberhalb des Kirchdorfs, von dem es eine in das Tal ragende, bewaldete Felszunge trennte. Es war ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, wenn nicht älter, behäbig, dreistöckig, bis an die Giebel aus Stein gebaut. Die der Straße zugewandte Fassade mit ihren meterdicken Wänden, tiefen Fensterlaibungen, runden Türöffnungen und holzschindelgedecktem Walmdach atmete Behaglichkeit und den unaufdringlichen Stolz seiner Erbauer. Eine verblasste, über dem Portal auf den kalkgelben Putz gemalte Fuhrleute-Szene erzählte davon, welche Gäste hier die Jahrhunderte hindurch Rast gemacht hatten.
Kajetan bat eine durch den geräumigen Hausflur huschende Bedienstete, nach den Wirtsleuten zu rufen.
Kurze Zeit später öffnete sich die Türe zum Gastraum. Eine Frau erschien, umkränzt von ausfallendem Licht und behäbigem Gemurmel. Mit kurzem Augenaufschlag taxierte sie ihn, bevor sie die Türe hinter sich zuzog, mit geschäftsmäßiger Freundlichkeit grüßte und sich hinter einem schmalen Pult postierte. Kajetan schätzte sie auf höchstens Mitte dreißig. Sie war kräftig gebaut, das volle, bäuerlich schöne Gesicht mit dichten, dunklen Brauen war von kastanienbraunen, zum Gretl-Kranz geflochtenen Haaren gerahmt. Sie stand aufrecht, den stattlichen Busen gereckt, die Linke auf die Hüfte gestemmt. Es musste die Wirtin sein.
»Der Herr wollen über die Nacht bleiben?«
Sie ließ eine Reihe ebenmäßiger Zähne sehen und sah ihn erwartungsvoll an. Kajetan, vom schnell zurückgelegten Fußmarsch noch immer außer Atem, bestätigte mit einem Nicken.
»Sind der Herr allein unterwegs?«
»Ja.«
»Ein Einzelzimmer also.« Sie zog das Belegbuch heran und schlug es mit einer resoluten Bewegung auf. Sie nickte zufrieden, als bestätige sich ihr das, was sie bereits wusste. »Habens Glück, Herr. Die Nummer sechs ist frei.« Sie bedachte ihn mit einem freundlichen Lächeln. »Wissens«, erklärte sie, »in der Nachsaison haben wir zwar nimmer viel Gäste, aber allerweil zu wenig Einzelzimmer.«
»Eines tät mir schon reichen«, gab Kajetan launig zurück.
Sie gab ein kontrolliertes Lachen von sich und erkundigte sich nach der Dauer seines Aufenthalts. Zwei, vielleicht drei Nächte, antwortete Kajetan. Er würde am Tag seiner Abreise rechtzeitig Bescheid sagen.
»Wie der Herr möchten.« Sie nahm seinen Pass in Empfang, griff sich einen Stift, beugte sich über das Belegbuch und trug seinen Namen ein. Dann schlug sie das Buch zu, schob es zur Seite und gab ihm den Schlüssel.
»Erster Stock, Zimmer sechs. Ich lass Ihnen Bescheid geben, wenns zum Essen ist.« Wieder blitzten ihre Zähne. »Einen schönen Aufenthalt wünsch ich Ihnen bei uns, Herr Paul.«
»Den werd ich haben, Frau Wirtin«, sagte Kajetan.
Sie hatte sich bereits abgewandt. »Ich bin nicht die Wirtin«, korrigierte sie über die Schulter. Kajetan schien es, als hätte sich kurz ein Schatten über ihr Lächeln gelegt. »Ich kümmer mich bloß um die Wirtschaft.« Sie rief mit befehlsgewohnter Stimme in die Tiefe des weiten Hausflurs: »Mariedl?« Ihre Stimme war im Gewölbe noch nicht ausgehallt, als am Ende des Ganges eine Türe klappte und sich ein junges Mädchen näherte.
»Mariedl, du zeigst dem Herrn gleich die Sechs, hast mich verstanden?«
»Ist recht«, sagte das Mädchen mit gesenktem Kopf.
Die Kammer roch nach altem Mobiliar, war aber blitzsauber. Den gewachsten Bohlenboden bedeckte ein Flickenteppich, aus der gestärkten Bettwäsche strömte der Duft eines herben Waschmittels.
Kajetan öffnete das Fenster und beugte sich hinaus. In der Ferne glühten die Lampen der Grenzstation durch die Finsternis. Sein Blick wanderte höher. Der Mond war noch nicht aufgegangen, nur ein einsamer Stern flimmerte in der scharfen Luft. Vor dem Nachthimmel zeichneten sich die pechschwarzen Umrisse des Hochgebirges ab.
Ein plötzlicher Schauder durchlief Kajetan. Dort oben musste sich der illegale Grenzübergang befinden. Die Barriere schien ihm mit einem Mal unüberwindlich, etwas Feindseliges ging von ihrer lauernden Unbewegtheit aus.
Er schloss das Fenster, hockte sich auf die Bettkante und vergrub sein Gesicht in seine Hände. Bleierne Müdigkeit ergriff ihn.
Er wusste, wie gefährlich diese Momente für ihn waren, in denen er ins Grübeln geriet, in denen die Zuversicht mehr und mehr aus ihm wich, wie die Luft aus einem angestochenen Ballon.
Prompt brach sich wieder eine Verzagtheit Bahn, die ihn in den letzten Wochen schon mehrmals heimgesucht hatte. Sie hatte ihn das erste Mal überfallen, als er sich in diesem lichtlosen Bretterverschlag in München verkriechen hatte müssen. Er hatte sich wie ein gefangenes Tier gefühlt, zu lähmender Untätigkeit verdammt; es zerfraß seinen Stolz, wie ein Kleinkind auf die Hilfe und die Entscheidungen seiner alten Nachbarin angewiesen zu sein.
Er stemmte sich gegen dieses Gefühl. Es gelang nicht mehr. Seine Gedanken gerieten sofort wieder in einen fiebrigen Wirbel, stolperten übereinander, verkeilten sich.
Wie sollte es überhaupt weitergehen, nachdem man ihn über die Grenze geschleust haben würde? Er überschlug im Geiste seine Barschaft. Mit dem, was er bei sich hatte, waren, wenn er sparsam war, vielleicht drei Monate zu überstehen. Doch nach dieser Zeit würde er sich nur noch in die Schlangen irgendwelcher Wohlfahrtsspeisungen in Innsbruck oder Wien schmuggeln können, würde obskuren Hilfsorganisationen etwas vorjammern müssen, um eine warme Speise oder ein paar Münzen in die Hand gedrückt zu bekommen. Und wie lange sollte das gehen?
Nein, er musste versuchen, drüben so schnell wie möglich auf die Beine zu kommen. Als Saisonhelfer in einem abgelegenen Gehöft vielleicht, für Kost und Logis? Als Waldarbeiter? Oder gar – ha! – frech und offen, wieder als Detektiv? Aber ginge das überhaupt, ohne Land und Leute zu kennen, ohne Verbindungen zu haben, die er in seinem Beruf dringend brauchte?
Jede der Lösungen, die im Gewirr seiner Gedanken auftauchten und die er zu greifen versuchte, entglitt ihm wie glitschige Fische, sie bespöttelten einander als Schnapsidee, und sofort stürmte auch wieder eine andere Sorge heran: Wo würde er überhaupt bleiben können? In Österreich, wo, wie man gelesen und gehört hatte, die Rechten und die Hitlerischen ebenfalls damit begonnen hatten, die Republik zu unterwühlen? Oder sollte er nach Italien gehen, wo aber auch Mussolini und seine schwarzen Kolonnen bereits an der Macht waren? Vielleicht in die Schweiz hinüber, wo man ausländische Habenichtse erst recht nicht mit offenen Armen empfing? Während er noch über diese Fragen brütete, schlugen seine überreizten Gedanken erneut einen Haken: War es überhaupt richtig gewesen zu fliehen? Hatte er sich von seinen Feinden zu früh die Schneid abkaufen lassen? Hätte er nicht doch ausharren, losbrüllen, die Fäuste schwingen, dreindreschen sollen in die dreisten und siegesgewissen Visagen seiner Gegner? Er hatte sich diese Frage immer wieder gestellt, und jedes Mal schmerzte sie ihn mehr. War er ein Waschlappen, ein Feigling, der nicht Manns genug war, sich zu wehren?
Kläglich verteidigte sich eine innere Stimme, dass seine Entscheidung richtig gewesen war, weil er diesem Kampf niemals gewachsen gewesen wäre. Einer wie er konnte nicht gegen einen Feind gewinnen, der sein Netz wie eine Spinne über die Stadt gesponnen hatte, überall und nirgends lauerte und dessen Beweggründe ihm fremd waren. Keine Vernunft war mehr darin zu erkennen; was er davon wahrnahm, war nichts als Dummheit. Und grenzenlose Brutalität.
Gleichzeitig fühlte er zu seinem Erstaunen – denn sonderlich sentimental war er nie gewesen –, wie sehr er doch an seiner Heimatstadt hing.
Denn mochte München manchmal noch so unwirtlich sein, in der kalten Jahreszeit nach dem bitteren Ausstoß der Biersiedereien, nach Schwefel und Kohlerauch stinken, mochten die Leute dort einmal freundlich und voller Güte, ein anderes Mal wieder entsetzlich dumm, vom Grant und von Bosheit zerfressen sein – er hatte einfach alles gekannt. Er hatte die Sprache der Menschen seiner Umgebung verstanden, ihre groben wie ihre feinen Gesten begriffen und daher immer zu wissen geglaubt, was zu tun war, wenn er wieder einmal in eine verzwickte Situation geraten war. Und hin und wieder war es ihm sogar gelungen, das Richtige zu tun.
Lackenkaser, ca. 1500 M. ü. d. M.
Lipp Kerschbaumer schob die verwitterte Türe des Kasers hinter sich zu und schlurfte zur Pritsche. Er hielt die Luft an, biss die Zähne zusammen. Jeden Muskel angespannt, ließ er sich vorsichtig auf die Schlafbank sinken. Als seine Schulterblätter das Brett berührten, presste er den gestauten Atem durch die Zähne. Der pochende Schmerz in seinem Bein klang langsam aus und ging in ein dünnes, heißes Pochen über.
Wieder war alle Mühe umsonst gewesen. Er hatte sich den steilen Pfad zum Engpass emporgeschleppt, doch die Höhlung unter dem Felsblock war leer gewesen wie an den Tagen zuvor. Seine Helferin hatte es wieder nicht geschafft, das Versteck mit einem Laib Brot, etwas geräuchertem Fleisch und sauberem Verbandszeug aufzufüllen. War ihr etwas zugestoßen, hatte sie jemand beobachtet und abgefangen? Hatte man sie gezwungen, sein Versteck preiszugeben? Waren seine Verfolger längst unterwegs, bezogen sie bereits Posten im Wald um die Blockhütte, um ihn festzunehmen?
Nein. Sie würde ihn nie verraten. Allein schon damit, wie sie ihn, von den Dorfleuten unbemerkt, in diesen von der Welt vergessenen Kaser hinaufgelotst hatte, hatte sie ihm ihre Umsicht bewiesen. In dieses Hochtal begab sich kein Bauer und Jäger mehr, seit der Talweg von einem Felssturz in die Schlucht gerissen worden war. Denn dadurch war auch der Pfad verödet, der einst vom höhergelegenen Engpass am Lackenkaser vorbei ins Tal führte. Kein Hirte würde diese beschwerliche Sackgasse ohne Not betreten. Die Grenzpatrouillen mieden ihn erst recht. Auch sie wussten: Kein Schmuggler oder Illegaler käme je auf die Idee, auf diesem Pfad die Grenze zu überqueren.
Auf der Herdstelle knisterte letzte Glut. Lipp starrte mit weiten Augen zum rauchgeschwärzten Dachstuhl. Zwischen den Sparren flatterten staubsatte Spinnweben in der Zugluft. Aus dem gleichmäßigen Rauschen vor dem Kaser hob sich ein hoher Ton, näherte sich wispernd, rüttelte sacht an den gesprungenen Scheiben des winzigen Fensters und segelte wieder in die Nacht zurück.
Als er ein Junge war, hatte Lipp die Nächte auf den einsamen Hochalmen geliebt, und noch bis vor wenigen Wochen war er mit seinem Schicksal auch leidlich zufrieden gewesen. Jetzt aber hatte es ihn mit einem brutalen Tritt aus allem gestoßen, was zuvor sein Leben ausgemacht hatte. Noch immer verstand er nicht, wie er in diese hoffnungslose Lage hatte geraten können. Hatte er sich nicht immer bemüht, jeden seiner Schritte mit Bedacht zu tun? Er war nie ein gedankenloser Luftikus wie viele seiner Altersgenossen gewesen, hatte seine Entscheidungen meist quälend lange abgewägt. Etwas in seinem Inneren hatte ihm immer zugeraunt, dass das Leben einem wie ihm nicht allzu viele Fehler erlauben würde.
Wo hatte er seine Vorsicht über Bord geworfen, wo versäumt, auf sein inneres Alarmsignal zu hören? Und warum?
War der Dosch-Jakl an allem schuld? Weil er ihn in etwas hineingezogen hatte, was nie wirklich das Seine gewesen ist?
Ihre Freundschaft hatte bei einem Sommerfest des Kanu-Vereins ihren Anfang genommen. Eine laue Nacht war es gewesen, farbige Lampions hingen zwischen den Bäumen, Musik spielte zum Tanz auf. Lipp hatte es auf ein Mädchen abgesehen und sich – da er sich bewusst war, nicht gerade ein Meister der geschmeidigen Annäherung zu sein, ihm die Angst vor einer Abfuhr jedes Mal die Kehle zuschnürte und er sich zum Affen machte – ein wenig Mut angetrunken. Prompt kam er einem anderen ins Gehege, der sich ebenfalls sicher war, dass der kokette Augenaufschlag der hübschen Haidhauserin nur ihm gegolten haben konnte.
Es musste der Alkohol gewesen sein, der Lipp damals dazu verleitet hatte, sein schmächtig wirkendes Gegenüber zu unterschätzen. Jakl war nämlich durchaus in der Lage, seine körperliche Unterlegenheit mit überraschender Wendigkeit auszugleichen. Flink tauchte er unter Lipps klobigen Angriffen weg, hielt den wutentbrannt auf ihn einstürmenden Gegner mit schmerzhaften Faustschlägen auf Brust und Bauch auf Distanz und setzte nach, als diesem langsam zu dämmern begann, dass er dieses Mal womöglich kein leichtes Spiel haben würde. Irgendwann floss etwas Klebriges in Lipps linkes Auge, und er ahnte, dass es sein Blut sein könnte. Spätestens jetzt fanden die anderen Festgäste, dass die Sache kein Spaß mehr war. Energisch trennte man die beiden Kampfhähne.
Im Morgengrauen krochen Lipp und Jakl aus einem Gebüsch hinter dem Vereinsheim hervor. Noch immer halb bewusstlos, kotzten sie sich die Seele aus dem von Bier und Schnaps vergifteten Leib und teilten ihre Wut auf die Weiber, was ihr ramponiertes Selbstbewusstsein wieder halbwegs aufmöbelte. Derart einig geworden, beschlossen sie zögernd, sich auch sonst gar nicht so übel zu finden. Sie verziehen sich schließlich, dass Lipp neben einem mächtig geschwollenen Auge eine verschorfte Wunde am Haaransatz, Jakl einen abgebrochenen Eckzahn als Andenken an ihre misslungene Brautschau behalten würde.
Ihr Ansehen in der Ruderabteilung stieg wieder, als sie in den nächsten Monaten ordentlich loslegten. Zweimal heimsten sie bei der Landesmeisterschaft gegen die starken Nordbayern gute Plätze ein, einmal verpassten sie sogar knapp den Sieg.
So unähnlich sich die beiden äußerlich waren – Jakl war klein und schmalschultrig, wogegen Lipp eher die Solidität eines bäuerlichen Kraftkerls ausstrahlte –, so ähnelten sie sich darin, mit Worten nicht groß um sich zu werfen.
Was bei Lipp schließlich dazu führte, dass er sich eines Tages in der Schlange der Stempelgeld-Empfänger vor dem Arbeitsamt wiederfand. Er hatte seinem Meister bei Krauss-Maffei wortlos eine gescheuert, nachdem dieser ihn zu Unrecht beschuldigt hatte, ein Werkteil verhunzt zu haben. Obwohl die Kollegen und die Abteilungsräte gegen Lipps Rauswurf Sturm liefen, wurden deren Eingaben niedergebügelt. Monate vergingen, ohne dass er eine Arbeit fand. Immer häufiger griff er zum Bierkrug.
Bis Jakl ihn sich eines Abends vorknöpfte. Er solle endlich mit seiner Winselei aufhören, es sei ja nicht mehr zum Anhören. Was glaube er denn, warum er bei seiner Arbeitssuche auf so gar keinen grünen Zweig mehr käm? Ausgerechnet er, der eine Kraft habe wie ein Ochs, zupacken könne wie drei?
Lipp hatte ihn angeglotzt und ratlos die Schultern gezuckt.
Weil es eine schwarze Liste gibt, du Depp! Und weil darin dein Name steht, mit dem Zusatz: Gefährlicher Aufwiegler. Vermutlich Kommunist.
Lipp hatte sich empört. Diese Drecksäue! Er und Kommunist! Lüge!
Jakl hatte ihn von der Seite angesehen. Nach einer Weile erkundigte er sich in beiläufigem Ton, ob es nicht langsam Zeit dafür wäre.
Lipp, zunächst unschlüssig, war schließlich einer Einladung Jakls zu einer Veranstaltung der Giesinger Sektion gefolgt. Prompt musste er miterleben, wie diese von einer SA-Horde überfallen wurde. Wie immer hatte sich Lipp die Geschichte erst einmal ruhig angeschaut. Als jedoch abzusehen war, dass die Angreifer Erfolg zu haben drohten, schwollen seine Schläfenadern an – er war schließlich gekommen, um sich einen Vortrag über genossenschaftliches Bauen anzuhören, und was er bis zum Auftritt der Störer zu hören bekommen hatte, hatte interessant geklungen. Niemand hatte das Recht, ihn daran zu hindern, auch noch den Rest des Vortrages zu hören. Er stürzte sich in das Gewühl, versetzte dem Großmaul an der Spitze des Trupps mehrere krachende Ohrfeigen, packte ihn am Braunhemd, machte eine Drehung und schleuderte ihn den Angreifern entgegen. Der Anführer schlitterte über mehrere Tischplatten, bevor er seinen Kameraden vor die Füße plumpste. Überstürzt traten diese daraufhin den Rückzug an.
Bescheiden hatte Lipp das Lob der Anwesenden abgewehrt. Der Vortrag wurde wie geplant fortgesetzt. Die Versammlung endete in feuchtfröhlicher Geselligkeit, und noch am selben Abend unterzeichnete Lipp den Aufnahmeantrag in die bayerische Kommunistische Partei.
Nur wenige Monate später sah es danach aus, als müsse er diesen Schritt schon wieder bereuen. Die Nazen putschten, ihr Marsch wurde jedoch nach wenigen Kilometern von einer kleinen Abteilung der Landespolizei an der Feldherrnhalle gestoppt. Aber nicht nur Hitlers Partei wurde verboten, sondern auch die, der sich Lipp angeschlossen hatte.
Es war purer Trotz, dass er es sich nicht nehmen ließ, weiter zu deren geheimen Versammlungen zu gehen. Es war unter seiner Würde, seine Meinung verbergen müssen. Er war schließlich kein Verbrecher.
Die Polizei teilte seine Ansicht nicht. Lipp wurde geschnappt, eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz verdächtigt und in eine Zelle im Keller der Polizeidirektion gesperrt. Obwohl er nach wenigen Tagen wieder freikam, war die Festnahme ein Schock für ihn gewesen. Wie ein wildes Tier war er in der Zelle herumgetigert, seine Brust drohte zu zerspringen, und er hatte Angst, verrückt zu werden.
Zermürbende Monate vergingen, bis die Partei ihre Schlupfwinkel endlich verlassen konnte. Mit unverminderter Energie wurde die Propagandaarbeit wieder aufgenommen.
Lipps Sache war es jedoch nie gewesen, sich bei Straßenaktionen und Demonstrationen vor die Leute zu stellen, Parolen zu brüllen oder gar Reden zu halten. Sollte doch jeder tun und denken, was er für richtig hielt. Wenn er nur den anderen in Frieden ließ.
Dafür konnten die Genossen stets auf Jakl und ihn zählen, wenn kräftige Burschen für den Saalschutz gesucht wurden. Als sie wieder einmal einem Trupp der Braunen heimleuchten hatten müssen, die frech in eine Versammlung in der »Haidhauser Bierhalle« geplatzt waren, hockte man anschließend noch in kleiner Runde zusammen.
Der Genosse Reinhard Hölzl, der Lipp bis dahin nicht aufgefallen war, von den anderen jedoch mit vertraulichem, zugleich respektvollem Unterton als »Harti« angesprochen wurde, gesellte sich zu ihnen, entschuldigte sein Zuspätkommen mit einer wichtigen Sitzung, die länger als geplant gedauert habe. Er nickte anerkennend, nachdem ihm vom Geschehenen berichtet worden war. Ja, Leute wie Lipp und Jakl brauche die Partei. Duckmäuser, Maulhelden und windelweiche Herz-Jesu-Sozen, die sofort den Schwanz einzögen, wenn es gefährlich wurde, gäbe es schließlich genug.
Jakl, Lipp und Hölzl hatten ein Stück des Weges gemeinsam, als sie nach Mitternacht durch das schlafende Franzosenviertel gingen. Dabei war der Funktionär damit herausgerückt, dass man sich in der Parteispitze Sorgen um das um sich greifende Spitzelwesen mache. Die Münchner Genossen seien leider viel zu gutgläubig, würden jedem neuen Mitglied zu schnell Vertrauen schenken. Und was sei das Ergebnis? Vom Sonnleitner Ignaz, der bei der Sacco-und-Vanzetti-Demonstration vor wenigen Monaten wegen Widerstands verhaftet worden war, hätten Jakl und Lipp gehört? In letzter Minute habe eine dieser Ratten gegen ihn ausgesagt und dafür gesorgt, dass der Sonnleitner fast ein ganzes Jahr in Stadelheim eingebuchtet wurde.
Jakl und Lipp erinnerten sich. Eine gute, gemütliche und verlässliche Haut war der Sonnleitner-Naz gewesen, wie sie Aktiver in der Ruderabteilung der »Naturfreunde«. Sein Schicksal hatte jeden im Verein erschüttert. Naz’ junge Ehefrau, zuvor schon feinnervig und vom Alltag überfordert, hatte wenige Tage nach der Urteilsverkündung den Gashahn aufgedreht. In letzter Sekunde waren sie und ihre zwei kleinen Kinder gerettet worden, doch seither dämmerte sie in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie vor sich hin. Bei ihren Kindern hatte gerade noch verhindert werden können, dass sie in ein Heim gesteckt wurden. Entfernt wohnende Verwandtschaft hatte sie aufgenommen, dem Ansehen nach nicht übertrieben erfreut.
Drecksäue, hatte Jakl geschimpft, und Lipp hatte zustimmend genickt. Allerdings, hatte Jakl mit Bestimmtheit hinzugefügt, für die Haidhauser, die Auer und die Giesinger Sektion könne er, was Spitzel beträfe, jederzeit die Hand ins Feuer legen. Hölzl hatte ihn schief angesehen und eine Weile beredt geschwiegen. Schön wärs, meinte er dann. Schließlich rückte er damit heraus, dass der geheime Abwehrdienst der Partei …
»Was? So was gibts?«, unterbrachen ihn seine beiden Zuhörer fast gleichzeitig. Unsere Partei hat doch eine Tscheka?
Freilich hat sie so was, hatte Hölzl geantwortet. Was seien die Zwei bloß für Träumer? Auch die Nazen hätten schließlich ihre geheimen Kommandos, von der Politischen Polizei würde er erst gar nicht anfangen. Da sei es doch mehr als logisch, dass die Partei ebenfalls so was brauche, oder?
Hölzl war kurz stehen geblieben und hatte die beiden am Ärmel gepackt: Dass das alles natürlich unter ihnen bleiben müsse, sei ja wohl klar, oder? Wehe, auch nur ein Wort davon dringe an die Öffentlichkeit! Er spreche nur deshalb offen zu ihnen, weil er die Überzeugung gewonnen habe, ihnen beiden könne die Partei vertrauen.
Lipp und Jakl waren einige Minuten schweigend neben ihm her getrottet, bevor Hölzl andeutete, selbst bereits seit Längerem in einem der Tscheka-Kommandos aktiv zu sein.
Was er da so zu tun habe, hatte Jakl wissen wollen.
Nun – Hölzl zögerte wieder, rückte aber dann doch mit der Antwort heraus –, nun, wie er ihnen schon erklärt habe, sei der derzeit absolut dringlichste Auftrag, die Spitzel in der Partei zu enttarnen.
Lipp war noch skeptisch. Seien es wirklich so viele?
Hölzl hatte geseufzt. Leider mehr, als er selbst für möglich gehalten habe. Jedenfalls habe er kürzlich den Schöttl Franz von der Sektion Haidhausen unter die Lupe nehmen müssen.
»Den?!«, riefen Lipp und Jakl fast gleichzeitig.
»Ja, der!«, hatte Hölzl ärgerlich gezischt. Hielten sie ihn etwa für einen Schwätzer? Wollten sie außerdem unbedingt gleich das halbe Franzosenviertel aufwecken mit ihrem Geplärre?! Und bevor sie ihn jetzt noch weiter mit offenem Maul anstieren und dann sagen würden, dass sie sich das überhaupt nicht vorstellen könnten, weil der Frisör Franz Schöttl doch so ein patentes Mannsbild sei, bei allen wegen seiner Geselligkeit beliebt, bejubelter Solist beim »Volkschor« außerdem –
… du spinnst, hatte Jakl gejapst. Der Franzl doch nicht!
Hölzl wirkte, als habe er selbst noch gegen seine Erschütterung angesichts dieser Entdeckung anzukämpfen. Aber leider gebe es mittlerweile überhaupt keinen Zweifel mehr. Die Sache sei so traurig wie einfach: Könnten sie sich noch dran erinnern, wie der flotte Schöttl-Franz im letzten Jahr gut ins Schwitzen gekommen ist, weil ihm so ein Weibsbild – er war ja umschwärmt wie noch was, fast neidisch hätt eins werden können – hat anhängen wollen, er hätt sie dazu gezwungen, zur Engelmacherin zu gehen?
Jakl hielt dagegen: Aber der Franz ist doch freigesprochen worden! Diese Flitschn hat doch zum Schluss zugeben müssen, dass alles erstunken und erlogen gewesen ist!
Eben, hatte Hölzl sarkastisch genickt. Und genau damit haben sie ihn sich wahrscheinlich eingekauft. Lieber Herr Schöttl, näselte er, einen schmierigen Ermittler nachahmend, wir lassen die Anklag gegen Sie fallen, und dieses hysterische Weib bringen wir auch dazu, dass sie die Goschen hält – wenn Sie uns Ihrerseits entgegenkommen …
»Schmarren!«, war Jakl herausgeplatzt. »Ich kenn den Franzl doch!«
Hölzl wurde ungehalten. Die Partei gehe überhaupt nicht leichtfertig mit so was um! Es gebe eindeutige Beweise! Er wiederhole es: Ein!-deutige! Er selbst habe den Frisör einige Wochen beschattet, nachdem ein erster Verdacht aufgetaucht sei. Das Ergebnis habe sogar ihn umgehauen: Der Frisör hatte seit einiger Zeit eine neue Kundschaft, die sich meist nach Geschäftsschluss – seine Angestellte hat er dabei jeweils gnädig schon nach Haus geschickt – noch rasieren ließ.
Lipp hätte fast laut aufgelacht. Das sei doch ein Witz! Das sei der Beweis?
Das allein natürlich noch nicht, räumte Hölzl ein. Aber zwei dieser Kunden habe er eindeutig identifizieren können. Sie gingen in der Polizeidirektion ein und aus, seien dort offensichtlich derart daheim, dass sie an der Pforte nicht einmal mehr ihren Ausweis zeigen müssten.
»Wirklich kein Zweifel?«, hatte Jakl sich vergewissert, noch immer fassungslos.
Wenn er es ihnen doch sage, gab Hölzl zurück. Weder daran, dass der Schöttl-Franz ein Spitzel sei, noch daran, dass es nur seine Aussage gewesen sein konnte, die den armen Sonnleitner-Ignaz und seine Familie ins Unglück gerissen hatte.
Mit kummervollem Seufzen hatte Hölzl hinzugefügt: »Tja, Genossen. Die Welt ist halt leider nicht so schön, wie wir sie gern hätten. Und wie weit wir mit unserer Gutmütigkeit kommen, haben wir ja im Neunzehner Jahr gemerkt, oder? Schon wieder vergessen, wie unsere Leut damals wie die Hasen zusammengeschossen worden sind?«
Keiner der drei Männer hatte mehr ein Wort gesprochen, als sie sich am Isartorplatz voneinander verabschiedeten.
Damit hatte alles begonnen. Nein, Jakl trug keine Schuld. (Wie mochte es ihm jetzt überhaupt gehen? Fliehen hatte er in dieser Nacht im Holzlager an der Entenbachstraße wohl nicht mehr können. Oder doch?)
Er, Lipp, war allein für die missliche Lage verantwortlich, in die er geraten war. Weil er nicht mehr auf seine warnende innere Stimme gehört hatte, sondern sich von der Empörung über diese Spitzel-Schweinereien hatte übermannen lassen. Und weil es ihm geschmeichelt hatte, als ihm Hölzl mitteilte, dass man ihn zum Mitglied eines geheimen Parteikommandos erkoren hatte – ausgerechnet ihn, den noch immer ein wenig unbeholfen auftretenden Buben vom Land, den arbeitslosen Stempelgeld-Ansteher und Gelegenheits-Hilfsarbeiter.
Jetzt aber war er dahin, dieser kurze, mickrige Glanz in seinem Leben, diese kindische Freude am Abenteuer, jetzt moderte er auf dem halb verfallenen Lackenkaser vor sich hin, konnte nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Von Tag zu Tag schwand seine Hoffnung, sein lädiertes Bein würde noch rechtzeitig verheilen. Was war es überhaupt, das ihm beim Auftreten immer häufiger höllische Schmerzen bereitete? Hatte er sich, als er in den Mühlbach sprang und wahrscheinlich auf ein Abflussrohr geprallt war, einen Fußknochen angebrochen? Was auch immer es sein mochte – mit dieser Verwundung würde er es nie schaffen, über die Muntenwand ins Österreichische zu gelangen.
Und bald würde Schnee fallen, er sah die Zeichen, konnte ihn riechen. Dann würde es auch seiner Helferin endgültig unmöglich werden, ihn noch zu unterstützen.
Lipp fühlte, dass seine Kräfte zur Neige gingen. Bald würde er eine Entscheidung fällen müssen. Viele Möglichkeiten hatte er jedoch nicht mehr zur Auswahl. Eigentlich waren es nur noch zwei.
Er würde sich stellen müssen. Oder mit allem Schluss machen.
Im Kaser herrschte jetzt eine Stille wie in einer Gruft. Der Wind hatte sich gelegt, der Mond war noch nicht aufgegangen.
München, Polizeidirektion Ettstraße, Abt. VI
Kommissar Leopold Amrainer versuchte, sich seine Verbitterung nicht anmerken zu lassen. Kaum tauchten irgendwelche Schwierigkeiten auf, hatte Polizeirat Dr. Trattner nichts Besseres zu tun, als sich ihn als Sündenbock auszusuchen. Konnte dieser blasierte Idiot nicht endlich wenigstens in Erwägung ziehen, dass es seine immer fragwürdiger werdenden Operationen selbst sein könnten, die Ursache für die Häufung der Pannen in der Politischen Abteilung der Münchner Polizeidirektion waren? Ein Kerl mit Rückgrat würde außerdem nicht zögern, als Abteilungsleiter die Verantwortung auf sich zu nehmen. Nicht so Trattner. Er war eitel, selbstgefällig, hielt sich für ein Genie der Polizeiarbeit. Fehler machten immer nur die anderen.
Amrainers Nackenhaare stellten sich wieder auf, als er das sägende Organ des Polizeirats in seinem Rücken vernahm.
»Ich frage mich noch immer, wie Ihnen das passieren konnte, Herr Kommissar«, nölte Dr. Trattner. »Ich hatte Sie doch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass uns keiner der Täter entwischen darf! Und was ist? Wir stehen da wie die Idioten! Die Zeitungen mokieren sich bereits über uns. Die Politische Abteilung sei unfähig, dem roten Terror Herr zu werden! Und wem habe ich das wieder einmal zu verdanken?«
Ruhig bleiben, Amrainer. Dieser Idiot ist es nicht wert, dass du dir seinetwegen ein Magengeschwür zulegst. Irgendwann wird sich der Oberschlaumeier im Gestrüpp seiner famosen Geheimoperationen verfangen und auf der Schnauze landen, dass es nur so kracht.
»Habs Ihnen doch schon erklärt«, verteidigte er sich lahm. »Der Philipp Kerschbaumer ist grad auf dem Abort gewesen, wie unsere Leut ins Haus sind. So was ist halt nicht vorauszusehen.«
»Ein dummer Zufall also wieder einmal, was?«
Der Polizeirat war näher gekommen. Ein Hauch Kölnisch Wasser drang an die Nase des Kommissars. Er hielt angewidert die Luft an.
»Ja«, sagte er heiser.
Der Polizeirat beendete seinen Rundgang und nahm wieder hinter seinem Schreibtisch Platz.
»Aber leider wieder einer, der nicht hätte passieren dürfen, Herr Kommissar Amrainer«, stellte Trattner eisig fest. »Ich meine mich weiterhin entfernt daran erinnern zu können, dass professionelle Polizeiarbeit beinhalten würde, bei einer derartigen Aktion das entsprechende Gebäude in einer Weise zu umstellen und zu sichern, dass keiner der Hausinsassen durch einen rückwärtigen Ausgang entkommen kann. Ich würde sogar zu behaupten wagen, dass es sich dabei um das einfache Einmaleins der Polizeiarbeit handelt.«
Amrainer fühlte sich unbehaglich. Was die verunglückte Aktion im Holzlager an der Entenbachstraße betraf, war es schwer, seinem Vorgesetzten zu widersprechen. Tatsache war, dass er dem Einsatzleiter der Schutzpolizei zu sehr vertraut hatte. Dieser hatte ihm versichert, dass sich auf der Rückseite der verlassenen Sägemühle keine Tür oder ein Fenster befände, das verwinkelte Gebäude außerdem an den Bach grenze. Das winzige, von einem meterhoch wuchernden Holunder kaschierte Abortfenster mussten seine Leute übersehen haben. Dass er den Trottel von Einsatzleiter in einem Tobsuchtsanfall zusammengestaucht hatte, nutzte ihm jetzt auch nichts mehr. Philipp Kerschbaumer, der dritte Täter im Mordfall Schöttl, hatte fliehen können.
»Wenn Ihnen dazu nichts einfällt, mein lieber Herr Kommissar Amrainer, dann sage ich Ihnen, was ich vermute: Sie haben sich aus purer Bequemlichkeit zu sehr auf die Kollegen von der Schupo verlassen, obwohl ich Ihnen eingeschärft habe, jeden der Schritte dieser zuweilen äußerst unsicheren Kantonisten penibelst zu überwachen.«
»Es … es ist eben eine ziemlich komplizierte Aktion gewesen«, wehrte sich Amrainer schwächlich.