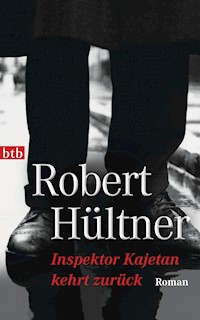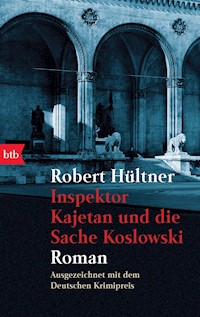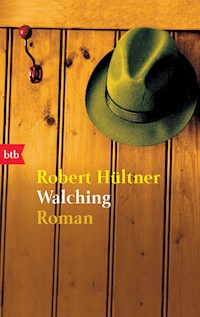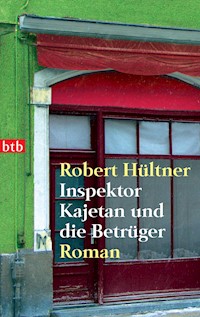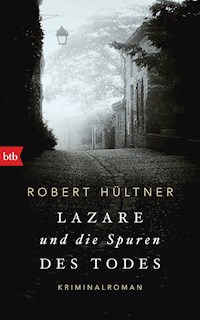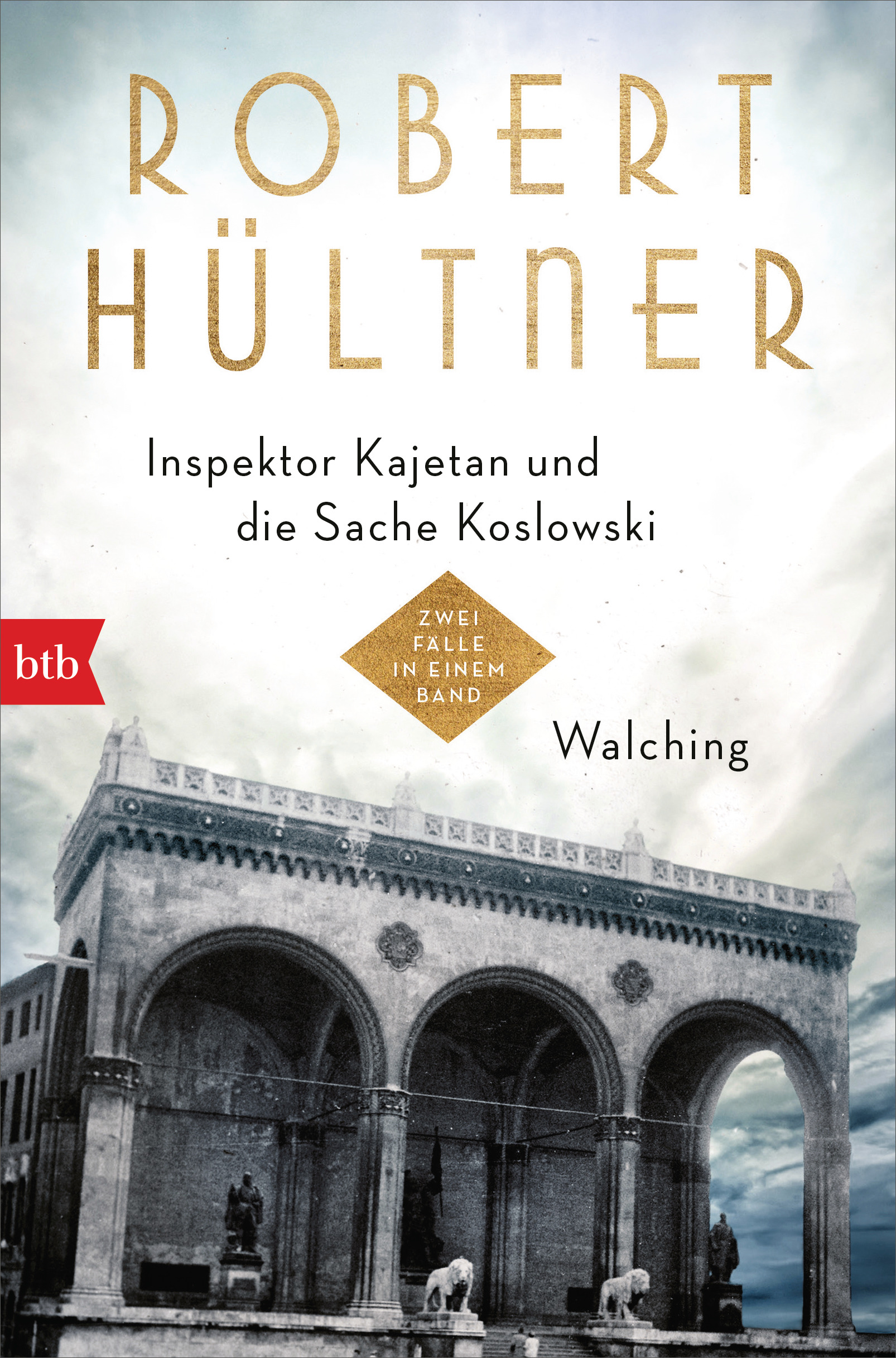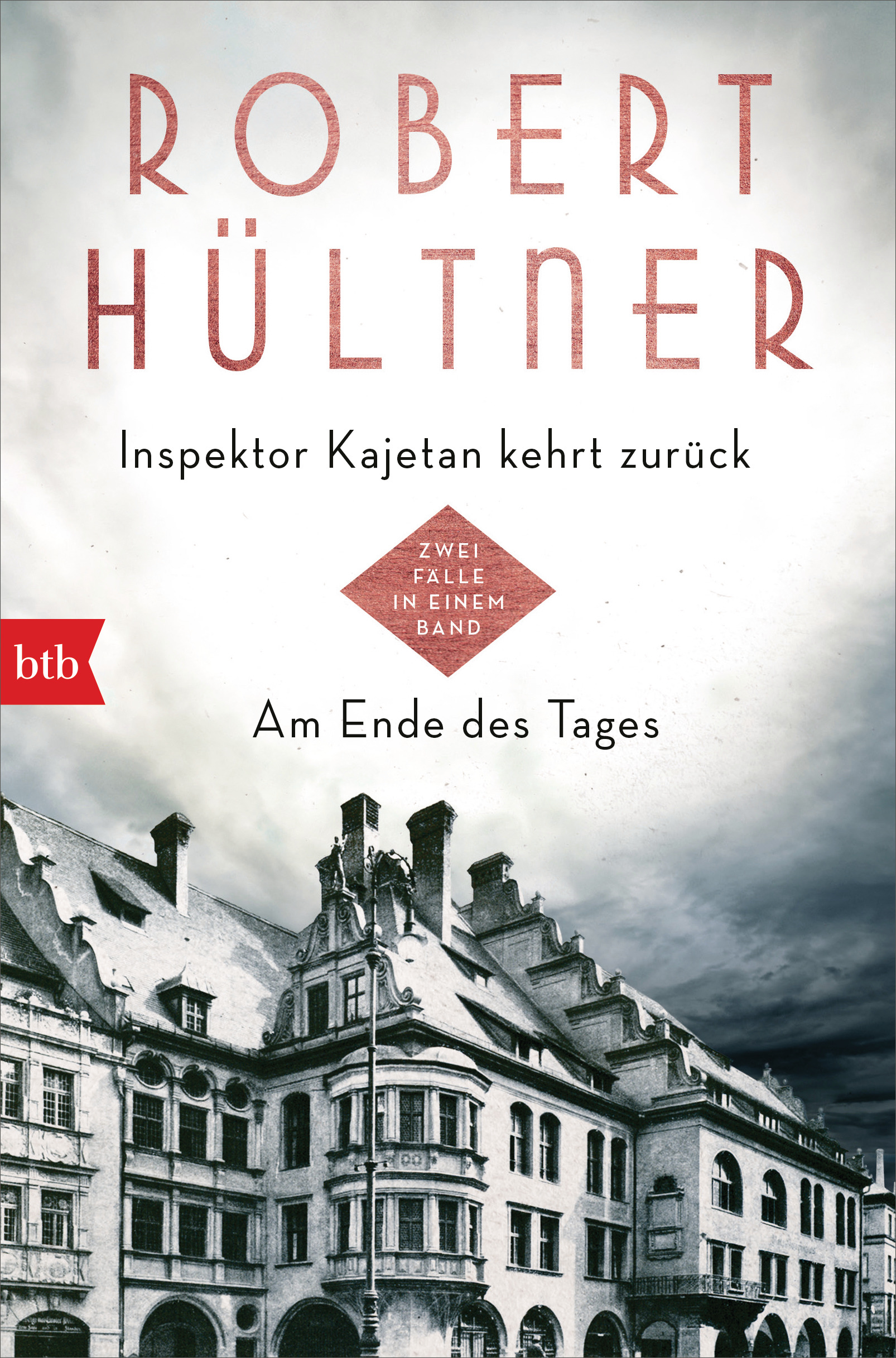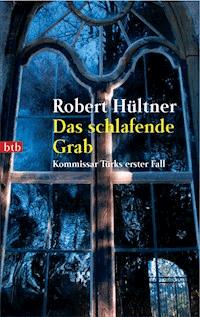8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Lazare
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein Toter am Strand: tragisch, aber im malerischen Sète, dem Venedig Südfrankreichs, kein seltener Unglücksfall. Wahrscheinlich hat es doch nur wieder etwas mit den internen Streitereien der Gitans zu tun, die hier schon seit Jahren am Stadtrand siedeln. Seltsam also, dass extra ein Kommissar aus Montpellier angefordert wird für diesen Fall. Die Behörden vor Ort sind konsterniert und empfangen Kommissar Lazare entsprechend. Sie ahnen nicht, dass Lazare angetreten ist, ein riesiges – und wenn es sein muss, mörderisches – Komplott aus Mauschelei, Korruption und Betrug aufzudecken, das die ganze Region im Würgegriff hat. Was andererseits Lazare nicht ahnt: dass zudem eine offene Rechnung aus Frankreichs jüngerer Vergangenheit darauf wartet, beglichen zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Ähnliche
Zum Buch
Ein Toter im Kanal: tragisch, aber im malerischen Sète, dem Venedig Südfrankreichs, kein seltener Unglücksfall. Wahrscheinlich hat es doch nur wieder etwas mit den internen Streitereien der Gitans zu tun, die hier schon seit Jahren am Stadtrand siedeln. Seltsam also, dass extra ein Kommissar aus Montpellier angefordert wird für diesen Fall. Die Behörden vor Ort sind konsterniert und empfangen Kommissar Lazare entsprechend. Sie ahnen nicht, dass Lazare angetreten ist, ein riesiges – und wenn es sein muss, mörderisches – Komplott aus Mauschelei, Korruption und Betrug aufzudecken, das die ganze Region im Würgegriff hat. Was andererseits Lazare nicht ahnt: dass zudem eine offene Rechnung aus Frankreichs jüngerer Vergangenheit darauf wartet, beglichen zu werden.
Zum Autor
ROBERT HÜLTNER wurde 1950 in Inzell geboren. Er arbeitete unter anderem als Regieassistent, Dramaturg, Regisseur von Kurzfilmen und Dokumentationen, reiste mit einem Wanderkino durch kinolose Dörfer und restaurierte historische Filme für das Filmmuseum. Für seine Inspektor-Kajetan-Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem dreimal mit dem Deutschen Krimipreis und mit dem renommierten Glauser-Preis. Robert Hültner lebt in München und in einem Bergdorf in den südfranzösischen Cevennen.
Robert Hültner
Lazare und der tote Mann am Strand
Kriminalroman
1.
»Na gut, wie fang ich an …«, sagte der Bäcker.
Brigadier Georges Jeanjean legte seinen Stift beiseite. Er sah auf, mäßig interessiert.
»Von vorne, schlage ich vor.«
»Kann ja auch unwichtig sein, verstehst du?«
»Gut möglich, Maurice«, sagte Jeanjean. »Aber jetzt wirst du langsam zum Punkt kommen, nehme ich an.«
Der dicke Bäcker holte rasselnd Luft. Er habe auf seiner wöchentlichen Versorgungstour eine beunruhigende Beobachtung gemacht. Als er geendet hatte, nahm der Brigadier seine Brille ab und massierte sich die Nasenwurzel.
»Dann fasse ich mal zusammen«, sagte er, die Brille wieder aufsetzend. »Gegen vier Uhr nachmittags hast du an der Straße nach St. Esprit –«
»Dort, wo die Piste nach Lo Barta abzweigt, genau.«
»Da hast du eine Kühlbox gesehen, die –«
»Die Box, die mir Monsieur Papin, also Jules –«
Der Brigadier schaute den Bäcker entnervt an. »Wie wär’s, wenn ich einen Satz zu Ende bringen könnte?«
Der Bäcker fuchtelte beschwichtigend. »Ist ja gut.«
»Es war also die Box, in die du deine wöchentliche Lieferung für Jules hineingibst.«
Maurice öffnete den Mund, beließ es aber bei einem zustimmenden Nicken.
»Machst du das eigentlich immer so? Wieso bringst du dem alten Mann die Sachen nicht ins Haus?«
»Weil ich nichts dagegen hätte, wenn meine Stoßdämpfer noch eine Weile halten würden, ja? Die Piste zu Jules’ Hof ist steil, noch dazu ausgewaschen. Wie dir außerdem vielleicht schon zu Ohren gekommen sein dürfte, bin ich Geschäftsmann. Wenn man von mir neuerdings erwartet, dass ich auch noch den Seniorenbetreuer spiele, dann soll man es mir sagen. Und mich gefälligst dafür bezahlen.«
»Schon gut«, versuchte Jeanjean zu begütigen, doch Maurice war in Fahrt geraten: »Und zum Thema Service, ja? Der gute Jules mag ein treuer Kunde sein, das stimmt, aber die Handvoll Cents, die ich bei Leuten wie ihm einstreiche, gehen schon fast fürs Benzin drauf. Früher, ja, als auf Lo Barta noch Leben war, kam jede Woche noch ordentlich was in die Kasse. Aber heute?«
»Ist gut, sagte ich. Du hast –«
»Ich bring’s bloß nicht übers Herz, ihn hängen zu lassen, verstehst du? Außerdem sind er und mein Alter zusammen auf die Jagd gegangen.«
Der Brigadier machte eine ungeduldige Handbewegung. »Du hast die Box also geöffnet und darin einen Laib Roggenbrot, einige Scheiben Schinken sowie je ein Paket Zucker und Salz gefunden, richtig?«
»Das Brot hart wie Brennholz, der gute Schinken angeschimmelt, der Rest feucht und verklumpt«, sagte der Bäcker. Er war immer noch erbost. »Außerdem fehlte die Liste mit der Bestellung für die nächste Woche.«
»Schön.« Jeanjean lehnte sich zurück und verschränkte seine Arme vor seinem breiten Brustkorb. »Und weshalb sollte die Gendarmerie française nun interessieren, dass einer deiner Kunden nichts von deiner Ware wissen will?«
»Weil der Alte in den letzten Jahren ein wenig nachlässig geworden sein mag, es aber eins nie bei ihm gegeben hat, nämlich dass er gute Lebensmittel vergammeln lassen würde.«
Maurice wischte seine Handflächen an seinem speckigen Overall ab, trat einen Schritt vor, stützte sich mit den Fäusten auf der Schreibtischplatte ab und sagte ernst: »Und jetzt sollten wir uns vielleicht nicht dümmer stellen, als wir sind, Georges. Jules ist über achtzig.« Er richtete sich wieder auf. »Gut, die Leute auf Lo Barta waren schon immer eine zähe Rasse. Und als ich ihn das letzte Mal sah, war er jedenfalls fitter als manch Fünfziger. Aber –«
»Du willst sagen, man sollte sich Sorgen um den Alten machen.«
Der Bäcker nickte. »Ich bin jedenfalls nicht gekommen, weil ich mich nach einem trauten Schwätzchen mit dir sehne.« Er verzog den Mund. »Da gäbe es erfreulichere Adressen, das darfst du mir glauben.«
Brigadier Jeanjean verspürte keine Lust, das Grinsen zu erwidern.
»Und wieso siehst du dann nicht gleich selber nach?«
»Bei allem Respekt, ja?«, brauste der Bäcker auf. »Muss ich mir jetzt auch noch Vorwürfe machen lassen?« Er ignorierte die beschwichtigende Handbewegung des Brigadiers. »Ich hab dir eben erklärt, dass ich mit meinem Lieferwagen da nicht hochkomme, ja? Und zu Fuß bräuchte ich mindestens eineinhalb Stunden hin und zurück. So lang kann ich meine anderen Kunden nicht warten lassen.« Maurice schickte ein bekräftigendes Nicken nach. »Was übrigens noch immer gilt. Ich hab’s euch gemeldet, und jetzt muss ich weiter.«
Er wandte sich zum Ausgang, drehte sich aber noch einmal um. »Und übrigens, falls du jetzt überlegen solltest, was du mir noch sagen wolltest –«
Der Brigadier runzelte fragend die Stirn.
»Danke, dass du gelegentlich die Augen für uns offen hältst, wolltest du sagen, stimmt’s?«
»Hau schon ab«, brummte Jeanjean versöhnlich.
»Müsste ich nämlich nicht. Hab genug eigene Sorgen.«
»Ich glaub’s dir, Maurice, ich glaub’s dir.«
Maurices Frau Bernadette war eine üppige und redselige Normannin, zupackend geschäftstüchtig, strahlend blond wie das Stroh auf den Feldern ihrer Heimat. Aber leider ebenso dumm, denn sie hatte sich vor einiger Zeit von einem schmierigen Grossisten dazu beschwatzen lassen, sich bei den Departementswahlen als Kandidatin aufstellen zu lassen. Für den Front National. Was in einem von bockbeinigen Hugenotten-Abkömmlingen bewohnten Landstrich, in dem seit Generationen stur links gewählt wird, eine eher unglückliche Idee ist. Deswegen war daraus natürlich auch nichts geworden, sie landete weit abgeschlagen, und auch Maurice, sonst eher gutmütig, hatte zuletzt ein Machtwort gesprochen. Aber seither knirschte es in der Gemeinde.
Maurice hatte bereits den Türknauf in der Hand.
»Also, ihr kümmert euch darum, ja?«
»Mach dir keine Sorgen, Maurice. Wird sich alles aufklären.«
»Der Alte ist nämlich in Ordnung. Außerdem ist er ja nicht irgendwer.«
Die Glastür, die in den Vorraum der Station führte, fiel hinter ihm ins Schloss. Der Brigadier sah ihm mit zusammengekniffenen Augen nach. Er stieß sich seufzend aus der Lehne, griff nach dem Mikrophon des Headsets und wählte die Nummer eines der Streifenwagen.
Gendarm Mathieu Belmont meldete sich. Jeanjean wies ihn an, unverzüglich zum Hof Lo Barta in der Gemeinde St. Esprit zu fahren und, falls der Alte nicht in den Wohnräumen oder einem der Hofgebäude anzutreffen sein sollte, Haus und nähere Umgebung zu inspizieren.
»Was Ernstes?«, drang Belmonts Stimme krächzend aus dem Lautsprecher. »Hörst dich so an.«
»Tut, was ich euch sage«, blaffte Jeanjean. »Und beeilt euch gefälligst, Ende.« Er unterbrach die Verbindung und starrte eine Weile ins Nichts. Die Klimaanlage surrte. Eine unbestimmte Trauer, vermengt mit dem Gefühl von Hilflosigkeit, züngelte heran. Mit einem ärgerlichen Knurren schüttelte er sie ab.
Was redest du da für einen Stuss, schalt er sich. Wieso sollen sie sich jetzt noch beeilen?
2.
Der Anruf aus der Kripo-Zentrale in Montpellier hatte Lazare zu unverschämt früher Stunde aus dem Schlaf gerissen. Aber er war nicht verärgert. Ganz und gar nicht. Endlich kam Bewegung in die Sache! Außerdem hatte er jetzt einen guten Grund, seinen Aufenthalt in den Bergen vorzeitig abzubrechen.
Fast zwei Wochen hatte Narciso Lazare – wenige Kollegen und nahe Freunde durften ihn ›Siso‹ rufen – auf La Farette ausgeharrt. Der abgelegene Hof gehörte zum Gemeindegebiet von Tormes, einem verschlafenen Flecken im nördlichsten Zipfel des Departements. Das Dorf erreichte man über eine Straße, die auf den Karten als difficile et dangereux markiert war. Die letzte Volkszählung hatte 99 Einwohner ermittelt. Es gab seit Jahrzehnten keinen Laden mehr, kein Restaurant, nicht einmal eine kleine Bar, geschweige denn ein Kino oder Theater. Nur in den Sommermonaten einen mickrigen Markt, auf dem zottelbärtige Hippies fade Gemüsekreationen zu umso gepfefferteren Preisen anboten. Als empfänden sie sogar die leblose Stille dieses Nests als störend, war die Mehrheit der Dörfler seit Generationen untereinander so zerstritten, dass sie kein Wort mehr miteinander wechselten. Lazare hatte es noch nie verstanden. Und hierher kamen Menschen, die von göttlicher Ruhe und erholsamer Abgeschiedenheit schwärmten, sich baufällige Einödhöfe zulegten und sich ein glücklicheres Leben erhofften? Es konnte sich nur um Spinner handeln, um Eigenbrötler, Sektierer.
Er würde nie hier leben wollen, so malerisch schön die Landschaft auch sein mochte, so unberührt ihre Berge, Täler und Wälder, so wildromantisch und pittoresk die Schluchten, die Gemäuer der alten Dörfer, Höfe und Burgruinen. Er war ein Montpellierain durch und durch. Er brauchte das lebhafte Treiben auf den Straßen, die aufgeräumten Schwätzchen mit Freunden und Nachbarn, den Geruch und die Geräusche der Stadt. Hier auf dem Land hatte jedes Mal, wenn er einen seiner Besuche zu absolvieren hatte, schon nach kurzer Zeit eine grenzenlose Langeweile von ihm Besitz ergriffen. Hinzu kam dieses Mal, dass kaum ein Tag vergangen war, an dem er nicht von Regenschauern durchnässt und von einem arktisch kalten Tramontane bis auf die Knochen ausgekühlt worden wäre.
Aber nun war er erst einmal erlöst. Lazare zog die Türe seiner Behausung hinter sich zu, schloss ab und verstaute den Schlüssel in einem Mauerschlitz über dem Türsturz. Bevor er sich abwandte, warf er noch einen Blick auf den ehemaligen Stall. In den vergangenen Monaten hatte er ihn leidlich bewohnbar gemacht. Ein baufälliger, bis zum First von Efeu überwucherter, von Spinnweben verhangener und nach Ziegenmist müffelnder, flohverseuchter Schuppen war es gewesen. Gewiss, es war noch eine Menge zu tun. Aber mit dem, was er bisher geschafft hatte, konnte er zufrieden sein. Eigentlich hatte er sich so viel handwerkliches Geschick gar nicht zugetraut.
Die Schultern fröstelnd hochgezogen, die Pfützen des unbefestigten, noch taufeuchten Wegs schlaftrunken umtänzelnd, trottete Lazare zum Hauptgebäude hinab. Er kniff die Augen zusammen, sah nach oben. Der Morgen versprach einen herrlichen Tag. Der Himmel war wolkenlos, letzte Sterne verblassten, über dem bewaldeten Gebirgskamm im Osten fingerten erste Strahlen der aufgehenden Sonne. Von Nordwest strich sachte ein würziger Tramontane heran. Aus dem noch verschatteten Flusstal quoll Nebel. Irgendwo in der Tiefe röhrte eine Motorsäge, krähte ein Hahn.
Als das Haupthaus des Anwesens in seinem Gesichtsfeld auftauchte, verschlechterte sich Lazares Laune schlagartig. Der Anblick erinnerte ihn daran, dass er wieder einmal nicht auf der Hut gewesen war, sich wieder einmal hatte überrumpeln lassen. Durch seine verfluchte Trägheit, seine mangelnde Geistesgegenwart. Damals vor zwei Jahren, als es darum ging, das Erbe der verstorbenen Mutter aufzuteilen, hatte er seiner Schwester Mireille nachgegeben und eingewilligt, dieses heruntergekommene Anwesen am Ende der Welt zu übernehmen.
Und sich um seinen einzigen Bewohner zu kümmern. Den verwitweten Siset, der immerhin, wenn auch nur über mehrere, nicht mehr vollständig überschaubare Ecken, zur Familie gehörte.
Seine Schwester hatte seine Bedenken zerstreut und eingeräumt, dass dem jahrhundertealten Gehöft die eine oder andere Reparatur guttäte. Aber mit mehr als zwei Dutzend Hektar Terrain, der Großteil davon uralter Wald, vor allem mit seiner unverbaubaren Alleinlage würden sich Käufer aus dem Ausland später einmal darum reißen. »Und, nicht dass man mich falsch versteht«, hatte Mireille gesagt und dabei versucht, Pietät in ihre Stimme zu legen. »Aber wir müssen realistisch sein. Onkel Siset hat neulich seinen Achtundachtzigsten gefeiert.«
Stimmt ja, hatte Lazare gedacht. Aber dieses Fest war bis fünf Uhr morgens gegangen. Und der Alte war der Letzte gewesen, der ins Bett gefallen war.
Seither hatte er dieses verfallende Anwesen am Hals. Und einen immer schrulliger werdenden fernen Verwandten. In letzter Zeit häuften sich die Alarmanrufe besorgter Nachbarn: Der Alte sei vom Baum gefallen, habe im Dorf eine Schlägerei provoziert, fasele wirres Zeug. Erst vor wenigen Wochen hatte ihn die Nachricht aufgeschreckt, der Alte habe seit Tagen gesoffen, verschanze sich jetzt in seinem Zimmer, habe angekündigt, das Haus abzufackeln und sich umzubringen.
Einmal mehr hatte Lazare alles liegen und stehen lassen und war in die Berge gebrettert. Tatsächlich hatte er Siset in einem erbarmungswürdigen Zustand vorgefunden. Apathisch in seinem Bett versunken, hatte der Alte Lazare herangewunken und ihm zugeflüstert: »Ich krieg keinen mehr hoch, mein Junge … die Mädchen wollen nichts mehr von mir wissen, ich mach mich bloß noch lächerlich … was soll ich noch auf dieser beschissenen Welt?«
Lazare war fassungslos gewesen. Um sich dieses würdelose Gewimmer anzuhören, hatte er seine Arbeit liegen und stehen lassen? Es war wieder einer dieser Momente gewesen, wo ihm danach war, dem Ganzen ein Ende zu machen, ein Altersheim für Siset zu suchen, die Bruchbude zu verkaufen. Doch kaum war sein Ärger verraucht, schämte er sich für diese Gedanken.
Denn Onkel Siset war der Held seiner Kindheit gewesen. Er hatte ihn gelehrt, Bachkrebse zu fangen, hatte ihm Pfeil und Bogen gebastelt, ihn auf den Markt von Tormes mitgenommen, hatte nächtens von atemberaubenden Abenteuern in Katalonien, der Heimat seiner Eltern, erzählt. Wie er Botengänge für die Genossen machte, die im Untergrund gegen den Diktator Franco kämpften. Wie er der guardia civil nur um Haaresbreite entwischt war und sich in letzter Sekunde über die Pyrenäen retten konnte. Gelegentlich, und in letzter Zeit gehäuft, regte sich Zweifel bei seinen Heldengeschichten – so lag etwa Salvador Puig Antich schon im Grab, garottiert von Francos Henkern, als ihm Onkel Siset die Hand geschüttelt und ihm gute Ratschläge gegeben haben wollte.
Dennoch staunte Lazare erst vor kurzem wieder, wie der Alte einmal haarsträubend senilen Unsinn von sich gibt, dann aber plötzlich wieder völlig klarsichtig ist und Weisheiten vom Stapel lässt, für die ein akademischer Denker unzählige Buchseiten benötigen würde.
Dieses Mal war es jedoch keine von Sisets Tollheiten gewesen, die Lazares Kommen erzwungen hatte. Zwei Wochen zuvor hatte der Himmel über dem Gebirge über mehrere Tage sämtliche Schleusen geöffnet. Der Kanton war zum Katastrophengebiet erklärt worden, der tosende Talfluss hatte Brücken und Uferdämme weggerissen, Straßen, Siedlungen und Äcker überflutet. Die Schäden an Sisets Haus waren beträchtlich. Von einer morschen Kastanie war ein mächtiger Ast auf das Scheunendach gestürzt, eine Schlammlawine hatte die Zisterne überflutet und einen Teil der Küche unter Wasser gesetzt. Zehn Tage Arbeit hatte Lazare veranschlagt, doch das Abdichten des Daches, das Zersägen und Beseitigen des Bruchholzes und die Reinigung des Hausinneren dauerten länger als erwartet. Die dringlichsten Arbeiten waren getan, doch noch war längst nicht alles von dem erledigt, was er sich vorgenommen hatte. Aber jetzt hatte er für seine vorzeitige Abreise eine Begründung. Eine, gegen die niemand etwas einwenden konnte.
Die Pflicht rief. Unweit des Stadtkanals von Sète hatten heimkehrende Fischer im Morgengrauen eine männliche Leiche entdeckt. Die Streifenbeamten vor Ort sahen sich außerstande zu beurteilen, ob ein Unfall oder Mord vorlag. Und als Commandant de Police und Ermittler in der Zentrale der regionalen Kriminalpolizei in Montpellier war es seine Aufgabe, hier Klarheit zu schaffen, e’ basta!
Die Erde unter Lazares Sohlen schmatzte, als er mit raschen Schritten über den noch im aschgrauen Frühlicht liegenden Innenhof auf das Haupthaus zusteuerte. Neben der Eingangstür lehnte das ältliche Damenfahrrad von Mathilda Bouffier, einer Witwe aus einem benachbarten Weiler. Die Türangeln kreischten, als Lazare den niedrigen Raum betrat, der Wohnzimmer und Küche zugleich war. Kaffeeduft drang an seine Nase. Er kniff die Lider zusammen, bis sich seine Augen an das dämmerige Dunkel der Wohnhöhle gewöhnt hatten. Am Tisch saß Onkel Siset, die Schultern hängend, noch schlaftrunken, der Kragen verkrumpelt, der schüttere Schopf ungekämmt. Der Hofhund zu seinen Füßen öffnete ein Auge wie ein schläfriges Krokodil im Schlick, ließ es wieder zuklappen und döste weiter. Ein Lächeln huschte über das zerknitterte Gesicht des Alten, als er Lazares Gruß mit heiserer Stimme erwiderte.
Im Hintergrund stand Mathilda am Herd. Ein grauer Kater strich um ihre bestrumpften Waden. Sie begrüßte Lazare mit einem freundlichen Nicken über die Schulter, nahm den Milchtopf von der Herdplatte und ging mit steifen Bewegungen an ihm vorbei zum Tisch. Nachdem sie dem Alten die Milch eingeschenkt hatte, bemerkte sie, dass Lazare seine Reisetasche geschultert hatte und zur Abreise gekleidet war.
Er hob bedauernd die Schultern und erklärte ihr in knappen Worten den Grund. Ein Anruf des Staatsanwalts, der ihn zu Ermittlungen in einem Mordfall an der Küste befohlen hatte.
»Für einen Schluck Kaffee ist aber noch Zeit?«
Für einen von ihr gemachten unbedingt, meinte Lazare. Er setzte sich mit einem gespielten Ächzen neben Siset und tätschelte ihm den Arm. Er würde die restlichen Arbeiten erledigen, sobald es möglich sei.
»Schon gut, mein Junge.« Schlürfend nahm der Alte einen Schluck. »Wird was Wichtiges sein, wenn sie dich rufen, hm?«
Lazare nickte vage. »Man wird sehen.«
Mathilda stellte eine dampfende Tasse vor ihn auf den Tisch und kehrte wieder an den Herd zurück. »Schade. Ich hätte so gerne noch ein bisschen mit Ihnen geredet. Über das alles hier. So geht’s nicht mehr lang weiter, Monsieur Lazare.« Sie machte eine Kopfbewegung zu Siset und seufzte bekümmert. »Er rührt ja kaum noch einen Finger. Dauernd geht was kaputt. Irgendwann fällt uns das Dach auf den Kopf. Sie sind nur alle paar Wochen für ein, zwei Tage da, Ihre Schwester lässt sich gleich gar nicht mehr sehen. Und das nennt sich eine Familie?«
Siset ließ ein ärgerliches Grunzen hören.
»Und dann geht auch das Brennholz langsam zu Ende. Womit soll man da kochen?«
Lazare sah auf seine Uhr, stand auf, trank die Tasse leer und stellte sie ins Spülbecken.
»Klar geht’s zu Ende!«, meckerte Siset von hinten. »Hast ja von Sparsamkeit auch noch nie was gehört. Mein gutes Brennholz!«
Mathilda zog hörbar Luft durch die Nase. Ärgerlich drehte sie sich zu ihm. »Erlebe ich noch einmal einen Morgen, an dem du nichts zu nörgeln hast? Ich heize, um den Moder aus dem Haus zu kriegen, klar? Oder willst du verschimmeln?«
»Reine Verschwendung!«, stichelte der Alte weiter. »Und der Kaffee schmeckt auch, als hätt einer seine verschwitzten Socken als Filter genommen.«
Mathilda schnappte empört nach Luft.
Oh-oh!, dachte Lazare. »Onkel Siset –!«, setzte er tadelnd an. Zu spät.
»So!«, fauchte Mathilda, ging mit stampfenden Schritten zum Tisch, wand dem verdutzten Alten mit einer entschlossenen Bewegung die Tasse aus der Hand und leerte sie ins Spülbecken. »Da will man es diesem Holzkopf gemütlich machen, und dann – ach!«
Die Fensterscheiben klirrten, als sie die schwere Eingangstüre hinter sich zuwarf.
Lazare sah den Alten ärgerlich an. Siset duckte sich schuldbewusst unter seinem Blick.
»Dass die Weiber immer gleich so empfindlich sein müssen«, brummte er.
»Das war doch wohl jetzt unnötig, oder?«
Der Alte sah trotzig auf: »Ich seh schon, mein Junge, du hast wieder mal von nichts eine Ahnung.«
»Von was, Onkel Siset!«
»Von was, fragt der Dummkopf. Sie ist scharf auf mich, merkst du das nicht? Aber daraus wird nichts. Sie ist mir viel zu jung. Über was soll man sich mit so einer unterhalten, he? Hat doch noch keine Ahnung von nichts.«
Lazare glotzte ihn ungläubig an. Die gute Mathilda war achtundsiebzig.
Der Alte brabbelte weiter: »Gut, ich sag nichts. Was sie kocht, kann man essen. Aber trotzdem. Das ist nichts für mich. Glaub mir, das hinterlistige Weib hat was im Sinn.«
»Sei nicht kindisch, Onkel Siset.«
»Ich sag ja: von nichts ’ne Ahnung, der Kerl.«
»Wie du meinst. Aber sie hält den Laden hier zusammen. Also sei gefälligst ein bisschen netter zu ihr. Und entschuldige dich bei ihr, ja?«
Eine Katastrophe, wenn Mathilda abspringt, dachte Lazare. Woher soll ich so schnell Ersatz bekommen? Wer tut sich diesen Griesgram an?
»Ich bieg das schon wieder zurecht, keine Sorge.« Der Alte winkte ihn näher. Lazare spürte den Druck gichtig verhärteter Finger auf seinem Unterarm. »Mein Junge, du musst eines wissen.« Ein weicher, schwärmerischer Glanz glomm in seinen kleinen schwarzen Augen auf. »Die Mädchen sind das Schönste, was uns der da oben, oder wer auch immer da in den Wolken herumfurzt, geschenkt hat.« Er senkte verschwörerisch die Stimme. »Das Problem ist nur, dass sie uns über sind. Und wenn sie das merken, sind wir verloren – verstehst du?« Wie zur Bestätigung schickte er seinen Worten ein listiges Nicken nach.
So viel zum Thema ›Weisheit des Alters‹, dachte Lazare. Er zog seinen Arm zurück, stand auf und knöpfte seine Jacke zu. »Ich muss gehen«, sagte er. »Ich erledige die restlichen Arbeiten, wenn ich wieder da bin, in Ordnung?«
Der Alte winkte mit einer welken Geste ab. »Ich komm schon zurecht. Mach dir keine Sorgen.«
»Und du passt auf deine Gesundheit auf, ja?«
»Keine Bange, mein Junge. Muss mich ja hier um alles kümmern. Da hab ich zum Sterben noch keine Zeit.«
Wider Willen musste Lazare schmunzeln. Der Alte war einfach eine Marke.
Mathilda stand neben der Eingangstür an die Wand gelehnt. Ihre Brust hob und senkte sich, ihre Finger kneteten ein Taschentuch.
»Es tut ihm leid.« Lazare suchte nach Worten. »Er ist eben nicht mehr der Jüngste. Man … man wird wohl ein bisschen schrullig, wenn man in dieses Alter kommt, hm?«
Sie sah an ihm vorbei und lächelte resigniert. »Lassen Sie’s gut sein, Monsieur. Hier in Tormes hat doch jeder seinen Vogel.«
Lazare widersprach mit gespielter Entrüstung. Mathilda überhörte es. Sie verstaute das Taschentuch in ihrem Schürzenaufnäher. »Aber es hat auch sein Gutes, nicht? Da fällt der, den man selber hat, nicht so auf.«
Er erwiderte ihr Lächeln.
»Trotzdem. Er mag Sie, Madame Bouffier.«
Ihre Lider flatterten unmerklich, als sie Lazare mit einem unergründlichen Blick streifte.
»Das will ich auch hoffen«, murmelte sie trotzig.
»Ich weiß es«, bekräftigte Lazare.
»Das ist nicht das Problem«, sagte sie leise.
»Sondern?«
Sie schniefte. Lazare durchforschte fragend ihr Gesicht. Ihre Miene sagte ihm, dass sie nicht in Stimmung war, sich weiter zu erklären.
»Alles gut, Monsieur. Lassen Sie sich nicht aufhalten.«
Lazare berührte ihren Arm mit einer unbeholfenen Geste und wandte sich zum Gehen, als er hinter seinem Rücken hörte: »Das Problem ist, dass ich ihn mag.«
Er drehte sich erstaunt zu ihr, doch sie schien ihre Worte bereits zu bereuen.
»Sie kommen noch zu spät«, sagte sie schnell.
Nanu?, dachte Lazare. Als ich dich damals fragte, ob du ein- oder zweimal die Woche bei Onkel Siset vorbeisehen könntest, hast du dich doch geziert wie ein alter Maurer?
Er setzte sich in seinen alten Renault 4 und drehte den Zündschlüssel. Der Motor orgelte eine Weile, die Feuchtigkeit der vergangenen Tage und Nächte hatte der Batterie wieder einmal zugesetzt, dann sprang er an. Lazare wischte mit dem Ärmel über die bedampfte Windschutzscheibe und setzte die Scheibenwischer in Gang, um die Schmiere aus Staub und Morgentau zu beseitigen. Während er die Piste ins Tal hinabpolterte, ließ er sich noch einmal das Telefonat mit dem noch schlaftrunkenen und mürrischen Untersuchungsrichter Simoneau durch den Kopf gehen.
»Na schön, versuchen Sie Ihr Glück«, hatte der geendet und mit halb launigem, halb drohendem Unterton hinzugefügt: »Ich bin zwar mehr als skeptisch, ob Ihr Plan gelingt. Vor allem muss Ihnen eins klar sein, Commandant: Wenn Sie die Chose vermasseln, kostet es Sie Ihren Kopf.«
3.
Das morgendliche Übergabegespräch in der Kriminalabteilung des Kommissariats von Sète verlief wie immer wenig förmlich. Nachdem er sich einen Becher Kaffee besorgt hatte, nahm Kommissar Raymond Danard am Besprechungstisch Platz. Er sah in die Runde seiner Untergebenen. »Ich habe die schönen Neuigkeiten schon auf der Herfahrt gehört. Jemand hat in der Nacht ein Bad im Kanal genommen und vergessen, wieder aufzutauchen, hm? Wer hat die Sache aufgenommen?«
Brigadier-Major Vincent Juliani warf seinem Streifenkollegen Jaques Cordy einen fragenden Blick zu, bevor er mit matter Bewegung die Hand hob. »Wir. Jaques und ich.«
»Näheres?«, drängte Danard.
»Es war kurz vor Sonnenaufgang. Wir kamen von der Route de Cayenne und wollten gerade auf den Kai einfädeln, als die Meldung reinkam. Bei dem Mann, der die Leiche gemeldet hatte, handelt es sich um einen Fischer aus Pointe-courte namens –« Juliani sah auf seinen Notizblock. »Angolo, Pierre. Er und sein Schwiegersohn kamen gerade von einer Fangtour zurück. Die beiden waren vor Ort, als wir ankamen. Der Mann dümpelte im Wasser, zwischen zwei Booten, Gesicht nach unten. Nachdem schnell klar war, dass wir uns Wiederbelebungsversuche sparen konnten –« Der Brigadier stockte bei der Erinnerung an diesen Anblick. Cordy bemerkte es und übernahm: »Wir zogen ihn ans Ufer, sicherten die Umgebung und gaben den Lagebericht durch. Die Zentrale schickte uns einen weiteren Wagen, mit Manda und Capucine. Kollegen von der Police municipale halfen bei der Absperrung, die Kollegen von der Spurensicherung und der Doktor stießen fast gleichzeitig dazu.«
»Ein Unglücksfall? Besoffen oder bekifft, gestolpert, in den Kanal gefallen?«
»Möglich.« Juliani zuckte die Schultern. »Zu sehen war lediglich eine offene Wunde auf der Stirn, knapp unter dem Haaransatz.«
»Ginge es präziser? Eine Schlagverletzung, eine Schusswunde, oder was?«, hakte Danard nach. »Sagt, muss man euch eigentlich alles aus der Nase ziehen?«
Cordy schüttelte den Kopf. »Eine Platzwunde oder Abschürfung an der Stirn, nicht sehr tief, soweit wir es beurteilen konnten. Mit der Todesursache sei sie eher nicht in Verbindung zu bringen, meinte der Arzt.«
Brigadier Becker hatte bisher schweigend an seinem Kaffee genippt. »Gibt’s Hinweise zur Identität?«, schaltete er sich ein.
»Noch nicht«, erwiderte Cordy. »Der Bursche war eher jung, wir schätzen ihn auf zwischen fünfundzwanzig bis höchstens dreißig.« Er sah zu Juliani. Dieser nickte bestätigend. »Auf den ersten Blick ein maghrebinischer Typ. Oder einer von den Gitans«, ergänzte er. »Ansonsten keine Papiere, kein Handy. Angezogen war er wie die meisten Kerle in seinem Alter. Nicht zu billige Jeans, desgleichen die Schuhe, noch ziemlich neue Sneakers, ein hellblaues T-Shirt …«
»Also schon mal kein Badeunfall«, warf Brigadier Becker ein.
Darauf wär ich nie gekommen, du Westentaschen-Maigret, dachte Danard.
»Wir haben ihn nicht ausgiebig gefilzt«, schloss Brigadier Cordy. »Die Einsatzzentrale hatte uns nämlich angekündigt, dass sie uns jemand aus Montpellier schicken würde. Dem wollten wir nicht vorgreifen.«
»Hinterher gibt’s wieder Gestänker«, brummte Juliani. »Darauf können wir verzichten.«
Danard starrte ihn ungläubig an.
»Wie, jemand aus Montpellier ermittelt? Nicht wir?«
Cordy zuckte mit den Schultern. »Entscheidung des Chefs der Division, hieß es.«
»Sind die Kollegen dort unterbeschäftigt?«, polterte Danard. »Oder hält man uns hier für Idioten, die so was nicht allein auf die Reihe kriegen?«
Was ist da schon wieder am Dampfen, dachte Danard. Ein Toter ist eine ernste Sache, keine Frage. Aber leider keine ungewöhnliche. Immer wieder waren Ertrunkene an den Badestränden an Meer und Lagune zu beklagen. Er konnte sich aber nicht daran erinnern, dass sich die Kripo des Departements in solchen Fällen jemals eingemischt hätte.
Danard gab ein ärgerliches Grunzen von sich. Er sah auf seine Armbanduhr. »Wir haben jetzt neun Uhr zwanzig«, sagte er. »Die Meldung ging kurz vor sieben bei der Zentrale ein. Wie ist der Stand jetzt?«
»Nachdem der Kollege aus Montpellier eingetroffen war, haben wir an Manda und Capucine übergeben und sind ins Kommissariat zurück«, erklärte Juliani.
»Im Augenblick dürften die Befragungen der Anlieger laufen«, ergänzte sein Kollege. »Mehr wissen wir nicht.«
Der Gruppenleiter nickte missmutig. »Na gut. Der Kollege wird sich melden, wenn er was von uns braucht. Dann wird er sich hoffentlich auch dazu herablassen, uns zu informieren.« Er sah auf. »Wen haben sie uns übrigens diesmal geschickt?«
Brigadier Juliani verzog den Mund. »Natürlich nur ihren Besten.«
»Aber nicht Commandant Lazare? Tut mir das nicht an!«
»Doch.« Der Brigadier nickte. »Höchstpersönlich.«
»Putain!«, entfuhr es Danard. »Verdammt. Der Tag hätte so schön werden können.«
Brigadier Juliani wechselte verstohlen einen wissenden Blick mit seinen Kollegen und sah nach draußen. Regen peitschte gegen die Scheiben.
»Na schön«, murrte der Gruppenleiter. »War das schon alles?«
»Schön wär’s«, seufzte Brigadier Becker. »Nein, wir hatten ordentlich zu tun, Chef.«
4.
Seit Lazare am Einsatzort, einer mit Fels- und Betonblöcken befestigten Ufergeraden am nordwestlichen Ende von Sète, eingetroffen war und die Ermittlung an sich gezogen hatte, schnurrte die Maschinerie. Alle Beteiligten wussten, was zu tun war, die Beamten des Kommissariats von Sète hatten vor seiner Ankunft bereits mit der Spurensicherung begonnen, der Notarzt präsentierte ihm den Totenschein, auf dem ein nicht natürlicher Tod vermerkt war. Als Todeszeitpunkt hatte der Mediziner den Zeitraum von ein bis drei Uhr der vergangenen Nacht geschätzt.
Den beiden Beamten, die das Kommissariat Sète für ihn abgeordnet hatte – Lieutenant de Police Manda Solinas und Élève-officierCapucine Lenoir –, hatte Lazare den Auftrag erteilt, die Bewohner der Wohnhäuser entlang des Ufers zu befragen und nach Zeugen zu suchen.
Nachdem Lazare den Abtransport der Leiche in das gerichtsmedizinische Institut in Montpellier veranlasst hatte, ließ er sich die erste Einschätzung des Leiters der Spurensicherung vortragen.
Weder am Fundort noch im größeren Umkreis bis zur Uferstraße hatte das Team Hinweise darauf entdeckt, wie der Unbekannte zu Tode gekommen sein könnte. Keine Blutspuren auf dem Kies oder auf dem porösen Beton des Kais, keine Gegenstände, durch die auf die Identität des Opfers oder auf Fremdeinwirkung hätte geschlossen werden können.
»Wenn es überhaupt einen Täter gab«, endete der Lieutenant. »Mir scheint eher, als wäre da einer bis obenhin voll gewesen und hätte einfach verdammtes Pech gehabt.«
»Wir werden sehen«, erwiderte Lazare kurz angebunden.
»Ich meine, Unfälle wie diesen haben wir öfters.«
»Ist bekannt.«
»Ich wollte nur sagen, dass ich mich natürlich freue, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Commandant.«
»Danke«, sagte Lazare. Aber –?, dachte er.
»Aber ist der Aufwand in dieser Sache nicht ein wenig zu übertrieben?«
»Was bezweckt diese Frage, Lieutenant? Wollen Sie damit andeuten, ich bewege mich außerhalb des vorgeschriebenen Vorgehens?«
»Nicht doch, Commandant. Ich meine nur, dass ein Fall wie dieser für unsere Kriminaler doch kaum mehr als Routine ist. Und dafür holt man Sie eigens aus Montpellier? Sie ermitteln doch üblicherweise in Fällen ganz anderen Kalibers? Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht ganz.«
Musst du auch nicht, dachte Lazare.
»Wann ist mit der Auswertung der Fingerabdrücke zu rechnen?«, fragte er.
»Ist in Arbeit.« Aus dem Gesicht des Lieutenants war das Lächeln gewichen. »Wir trödeln nicht, Commandant.«
»Wagt das jemand zu bezweifeln?«, sagte Lazare versöhnlich.
5.
Der Brigadier kam allmählich zum Ende. »Samstagabend noch zwei Wohnungseinbrüche, einmal in einem Haus in der Rue Cassin, kurz danach in einem Bungalow auf dem Mont St. Clair. Der Handschrift und den Fingerabdrücken nach ist es derselbe Täter, der seit ein paar Wochen unterwegs ist, aber noch haben wir keinen Treffer in der Datei. Der Kerl scheint neu im Geschäft zu sein. Sieht langsam nach einer Serie aus, wenn man mich fragt.«
»Möglich«, sagte der Gruppenleiter. »War's das?«
»Ansonsten nur noch ein gestohlenes Smartphone, Samstagabend beim Brassens-Fest im Theatre de la Mer.«
Becker kicherte.
»Was ist daran so lustig, ihr Komiker?«
Das Grinsen auf dem rundlichen Gesicht des Brigadiers wurde breiter. »Weil der Typ richtig Spaß gemacht hat. Wir hatten die Nummer, schickten ihm eine SMS, dass wir uns für die Lieferung von er-wisse-schon-Bescheid bedanken würden und dass er die vereinbarte Asche jetzt abholen könne. Treffpunkt der Übergabe bei der Grotte im Jardin du Chateau.«
Der Kommandant runzelte die Stirn.
»Die Antwort kam natürlich postwendend«, fuhr Juliani fort. »Er würde einen Boten schicken, meinte der Schlauberger. Dass Bote und Langfinger ein und dieselbe Person waren, brauche ich wohl nicht zu erwähnen.«
»Ihr Ganoven.« Danard rang sich ein wohlwollendes Schmunzeln ab. »Vermutlich ein alter Bekannter, richtig?«
Becker verneinte. »Er ist aus Paris. Ich will die Intelligenz unserer Kundschaft ja nicht überbewerten. Aber wer sich so blöd anstellt, kann schwerlich von hier sein.«
»Na, dann wünsch ich dir, dass du dir deinen Lokalpatriotismus bewahrst«, warf Cordy ein. »Meiner jedenfalls hat schon einige Kratzer abbekommen.«
»Was jeden hier brennend interessiert.« Danard straffte sich und sah in die Runde. »War’s das?«
Es klopfte. Sylvette, die Sekretärin des Leiterbüros, trat ein und legte zwei Blätter Papier auf den Tisch vor Danard. »Eben per Fax gekommen«, sagte sie. »Interessiert Sie vielleicht. Commandant Lazare ist bereits informiert.« Sie bedachte die Runde mit einem freundlichen Nicken und zog die Tür wieder hinter sich zu.
Danard überflog das erste Blatt. Sein Herz machte einen Ruck. Er räusperte in seine Faust und schaute Juliani und Cordy an. »Eure Wasserleiche ist identifiziert. Die Fingerabdrücke gehören zu einem Pablo Fernandez, siebenundzwanzig. Franzose, in Perpignan geboren, dort auch gemeldet. Scheint laut Register ein eher kleineres Kaliber zu sein.« Sein Blick umfasste die Runde. Er versuchte, seiner Stimme einen unbeteiligten Ton zu geben. »Ist zwar erstmal nicht unsere Angelegenheit, aber sagt der Name einem von euch etwas? Fernandez, Pablo?«
Cordy schüttelte den Kopf. »Mir nicht.« Er sah seinen Kollegen fragend an.
Juliani zuckte mit den Schultern. »Auch nicht.«
Das will ich auch schwer hoffen, dass es das nicht tut, dachte Danard. Sein Puls ging noch immer schnell, doch er hatte sich wieder im Griff. Er senkte einen Blick auf die zweite Nachricht. »Ach ja. Und dann noch die Interpol-Chose …«
»Es geht um diesen Deutschen, den wir neulich bei der Schlägerei kassiert haben, oder?«, erkundigte sich Becker.
»Wen sonst«, brummte der Gruppenleiter. »Die deutschen Kollegen kommen jetzt doch am Flughafen Montpellier an, nur der Rückflug ist ab Marseille gebucht.« Danard sah Brigadier Becker an. »Jean, du holst die beiden von dort ab und fährst sie anschließend nach Marseille, ja? Soweit ich informiert bin, sprechen sie nur Englisch. Als Elsässer bist du schließlich unsere Geheimwaffe, was Mondänität angeht.«
Der Angesprochene grinste Zustimmung heischend in die Runde. »Nicht bloß deswegen, Chef.«
»Stimmt, hab ich vergessen«, knarzte Danard. »Als Witzbold bist du ebenfalls unschlagbar.«
6.
Was der Bäcker von St. Pierre d’Elze befürchtet hatte, war eingetroffen.
Dr. Alban richtete sich auf und verstaute das Tuch, das er sich gegen den Verwesungsgestank vor Mund und Nase gepresst hatte, in seiner Tasche. »Dass da nichts mehr auszurichten ist, hätten Sie auch selbst feststellen können.« Er trat einige Schritte zurück. »Sie nerven manchmal, Ihre Vorschriften. Wirklich, mein Wartezimmer ist voll, und ich vergeude hier meine Zeit.«
Brigadier Jeanjean überhörte es. Er sah wieder auf Jules Papins Leiche. Der Alte lag in einer geräumigen Kuhle, etwa eineinhalb Meter neben einem elektrischen Viehzaun, mit dem Rücken an den jäh ansteigenden, mit Brombeergestrüpp und Farn überwucherten Hang gelehnt. Durch die halb geöffneten Lider schimmerte das stumpfe, geschrumpfte Perlmutt seiner Augen. Maden krochen aus seinem Mund, seine Haut hatte sich dunkelbraun verfärbt, wirkte wie rissiger Kitt. Von einem Schwarm bläulicher Schmeißfliegen umtost, hatte sich schmatzendes, gefräßiges Gewürm erbarmungslos über ihn hergemacht, seinen Körper in eine Anhäufung organischen, dampfend in Fäulnis übergehenden, unerträglich stinkenden Materials verwandelt. Ein Schauder durchlief Jeanjean. Er hatte die Empfindung einer ungeheuren Niederlage, einer maßlosen Demütigung.
Jeanjean spürte wieder, wie sich seine Kehle verengte. Nein – was er sah, war nicht mehr Jules Papin, der auch im hohen Alter noch eine Autorität über die Grenzen des Kantons hinaus gewesen war, dessen Urteil jedermann schätzte, um dessen Jugend in der Résistance sich Legenden rankten. Der jahrzehntelang im Gemeinderat und in der Bauerngenossenschaft aktiv war. Mit dem man sich besser nicht anlegte, dessen scharf durchdachte Gegenreden Widersacher und Schwätzer fürchten mussten. Bei dem man trotzdem immer fühlte, dass sich hinter seinem bärbeißigen Auftreten Humor und Herzensgüte verbargen. Und den das Schicksal nicht geschont hatte. Sein erster Sohn war bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Noch keine dreißig Jahre alt, war er mit seinem Bagger auf eine bei einem sintflutartigen Unwetter unterspülte Straße geraten und in eine Schlucht gestürzt. Papins Frau war daraufhin in schwärzeste Schwermut verfallen, sie marterte sich mit Selbstvorwürfen, verfiel in religiösen Wahn. Jules kannte den Grund. Er wusste damit auch, dass er und auch kein anderer Mensch je imstande sein würde, sie daraus zu erretten: Ihr Sohn hatte am Vorabend seines Todestages ausgiebig gefeiert und sich am Morgen unwohl und kraftlos gefühlt. Von einer unbestimmten Vorahnung geplagt, wollte er an diesem Tag nicht zur Arbeit gehen, doch die stets um Rechtschaffenheit bemühte Mutter hatte ihm Vorhaltungen gemacht. Ihm ins Gewissen geredet, er könne seine Kollegen doch nicht im Stich lassen. Woraufhin er sich doch noch aufgerafft hatte. Jules pflegte die vor sich hin Dämmernde aufopfernd, bis er sie ein Dutzend Jahre später tot in einem Wasserloch entdecken musste. Sein zweiter Sohn war nicht aus seinem Holz geschnitzt. Er war mutlos, faul und auf weinerliche Art verschlagen. Er zeigte keinerlei Interesse für die Landwirtschaft, schloss ein Jurastudium ab und stieg in einem Energiekonzern auf. Nach und nach hatte Jules seine Landwirtschaft reduziert und vor einigen Jahren ganz aufgegeben.
Als Belmont und Morin gestern nach ihm Ausschau hielten, hatten sie ihn nirgendwo entdecken können. Sie hatten ein paarmal eine falsche Abzweigung genommen, und als sie auf dem entlegenen Gehöft endlich eintrafen, war die Dämmerung bereits fortgeschritten. Sie hatten Haus und Wirtschaftsgebäude durchsucht, danach die nähere Umgebung, bis die zunehmende Dunkelheit und aufkommender Nebel sie zum Aufgeben zwangen. Jeanjean hatte sie zurückbeordert, für den nächsten Morgen aber bereits mit dem Leiter der Brigadegemeinschaft und der Ortsfeuerwehr vereinbart, eine Suchaktion zu starten. Kurz nach Sonnenaufgang waren die Männer aufgebrochen, die Feuerwehren von St. Esprit, Tormes und St. Pierre d’Elze waren nahezu vollständig angetreten. Jules war selbst Mitglied gewesen, jeder von ihnen hatte ihn gekannt, erst vor vier Jahren hatte ihm der Vizepräfekt die Ehrenmedaille der Pompiers angeheftet. Es war noch keine halbe Stunde vergangen, da hatte einer der Trupps Meldung erstattet.
»Auch recht«, hörte der Brigadier die Stimme des Arztes.
Jeanjean sah ihn verblüfft an. »Was meinen Sie?«
Der Arzt wischte bedächtig das Schweißband seiner Mütze mit einem Taschentuch ab. »Dass man mich ausnahmsweise einmal nicht damit löchert, wie lange er schon tot ist.«
»Sagen Sie schon«, brummte Jeanjean.
Dr. Alban setzte seine Schirmmütze auf seinen kahlen Schädel. »Ich würde sagen, seit mindestens einer Woche. Das sieht man schon daran, was sich bereits an ihm zu schaffen gemacht hat.« Der Arzt wedelte mit angewiderter Miene Fliegen von sich. »Aber legen Sie einen einfachen Wald- und Wiesenarzt nicht fest.« Er drückte seinen Rücken durch, bückte sich und griff nach seinem Koffer.
»Was tragen Sie als Todesursache ein? Sieht nach einem natürlichen Tod aus, nicht wahr?«
»Ich trage nichts ein. Da ich keine äußeren Verletzungen feststellen kann, ist das Ihre Angelegenheit. Dafür haben Sie ja schließlich Ihre Koryphäen, nicht wahr?«
»Aber … das hier?« Jeanjean winkte dem Arzt und deutete auf die Wange des Toten, an der die Haut aufgeplatzt war. »Könnte das nicht eine Verletzung sein?«
Dr. Alban war ihm widerstrebend gefolgt. »Sieht mir eher nach dem Biss eines Fuchses aus. Oder einer Ratte.«
»Es könnte ihm aber auch ein Mensch beigebracht haben, oder?«
»Ich möchte nicht unhöflich sein, Monsieur Jeanjean. Aber wenn Sie weiter versuchen, mir eine Aussage zu entlocken, mache ich Ihnen gerne das Angebot, einmal Ihre Hörfähigkeit einem Test zu unterziehen. Messieurs?«
Er deutete einen militärischen Gruß an und stapfte davon.
»Witzbold«, knurrte ihm Jeanjean hinterher.
Es war früher Vormittag, doch die Sonne brannte bereits sengend herab. Das Unterholz dampfte, der Leichengeruch nahm wieder zu. Jeanjean wich zurück und gesellte sich zu den beiden Brigadiers, die sich in einigem Abstand unter dem Schatten einer ausladenden Kastanie postiert hatten. Von tief unter ihnen, auf der baumlosen, mit Sträuchern und hohen Gräsern bewachsenen Weide drang wieder das heisere Blöken mehrerer Schafe. Der Brigadier fingerte ein Tuch aus seiner Tasche und wischte sich über Nacken und Stirn.
»Wird heiß werden«, sagte Morin. »Der Regen gestern war bestimmt gut für Pilze.«
Brigadier Belmont schlug sich klatschend gegen die Wange.
»Mir wär nach einer Zigarette«, maulte er. »Verdammte Fliegen. Ist außerdem nicht gerade mein bevorzugtes Parfüm, was so ’ne Leiche ausgast.«
»Untersteh dich.« Jeanjean warf ihm einen zornigen Blick zu. »Dass hier alles strohtrocken ist, siehst du schon, oder?«
»War ’n Scherz, Chef.« Belmont wies mit einer Kopfbewegung nach unten. »Ist so ’n Reflex von mir, manchmal.«
Die Männer schwiegen eine Weile.
Morin sah auf seine Uhr. »Der Leichenwagen müsste doch schon lange hier sein«, sagte er. »Ist schon über eine Stunde her, dass du der Zentrale Bescheid gegeben hast, oder?«
7.
Das Unwetter zog nach Südosten ab, auf das offene Meer zu. Noch flackerten Blitze durch das aschgraue Gewölk über Sète, gefolgt von mattem Donner, doch der Regen war bereits in feines Nieseln übergegangen. Über dem nördlichen Ufer der Lagune hatte der Tramontane den Himmel aufgerissen, seine Böen peitschten schaumgekrönte Wellen gegen die Ufermauer und versetzten die Fischerboote in behäbiges Schaukeln. Der Sturm fächelte über den leicht brackigen und fauligen Geruch hinweg, der von Zeit zu Zeit aus den Sümpfen im Osten über die östlich gelegenen Stadtteile herüberwehte.
Élève-officier Capucine Lenoir und Lieutenant de PoliceManda Solinas verließen das letzte der niedrigen Fischerhäuser entlang der Kais. Die Kunde vom Fund einer Leiche hatte unter den Bewohnern des Viertels La pointe courte schon die Runde gemacht. Meist hatte man ihnen bereitwillig Auskunft gegeben. Doch keiner der Befragten hatte in der vergangenen Nacht am gegenüberliegenden Ufer etwas bemerkt. Manda und Capucine hatten nichts anderes erwartet. In der Nacht hatte dichter Nebel Lagune und Küste bedeckt, und der Westwind, der seit Tagen über das Land brauste, musste jedes Geräusch übertönt haben.
Die beiden Beamten gingen noch einige Schritte auf der Uferpromenade entlang. Sie endete in einer schmalen Landzunge, die in die Lagune ragte. Manda blieb stehen. Er angelte eine Schachtel Zigaretten aus seiner Hosentasche, steckte sich eine an und nahm einen tiefen Zug.
Sein Blick strich über die milchigen Umrisse des gegenüberliegenden Ufers. Der Abstand zwischen Ufer und Häusern war hier noch größer, und die Sicht auf die Anlegestelle, an der man den Toten entdeckt hatte, war durch einen niedrigen Erdwall behindert. Sie würden auch dort keinen Erfolg haben.
Die Kommissars-Anwärterin lockerte ihr Regencape unter ihrem Kinn und strich sich eine feuchte Strähne aus der Stirn.
»Weißt du, was mir die ganze Zeit nicht aus dem Kopf gehen will?«
Mit der gönnerhaften Miene des alten Hasen sah Manda auf sie herab. Capucine hatte erst vor acht Wochen ihren Dienst im Kommissariat von Sète angetreten. Schon ein paar Mal hatte er sich dabei ertappt, dass er sie gerne ansah. Sie war zwei Köpfe kleiner als er, ein wenig pummelig, die kesse Igelfrisur passte zu ihr.
»Du wirst es mir sagen, hm?«
»Wieso kommt eigens einer von der Kripo aus Montpellier hierher? Für so einen läppischen Fall? Sicher, Mord kann noch nicht ausgeschlossen werden, aber einen Hinweis darauf gibt’s doch genauso wenig.«
»Vielleicht will er wieder mal Meerluft schnuppern?«
Eine ärgerliche Entgegnung lag ihr auf der Zunge. Noch immer ließ man sie gelegentlich spüren, dass sie noch in Ausbildung war. Ein Grünschnabel, der von nichts eine Ahnung hatte. Weder von professioneller Ermittlungsarbeit noch davon, was in Sète vor sich ging. Doch sie begnügte sich mit einem ergebenen Schmunzeln. Diese Sticheleien verletzten sie nicht wirklich. Manda war nicht der Hellste, aber eigentlich ganz in Ordnung.
»Kennst du ihn eigentlich?«
»Commandant Lazare? Nicht wirklich, dafür ist er zu selten in Sète. Soviel ich weiß, stammt er aus der Region. Er soll ein Lehrling vom alten Castro gewesen ist. Es heißt, dass die zwei wie Vater und Sohn waren.«
»Castro?«, sagte Capucine. »Jetzt musst du mir helfen.«
Cuba, oder was?, dachte sie. Wo bin ich denn hier gelandet?
»Jean Castro. Sowas wie eine Legende in Sète. War von irgendwann in den Achtzigern an bis Ende der Neunziger der Chef des Kommissariats. Die alten Kollegen sprechen noch oft von ihm. Er muss den Laden wie kein Zweiter im Griff gehabt haben, war sehr angesehen, bei den Kollegen ebenso wie bei den Leuten in der Stadt. Soll aber auch knallhart gewesen sein, wenn einer nicht gespurt hat. Wenn er hinter irgendwelche Mauscheleien gekommen ist, dann war der schon draußen. Und wenn’s nur war, dass einer seiner Leute sich bei einem Zigarettenschmuggler ein halbes Päckchen abgezweigt hat.«
»Er lebt noch?«
»Aber sehr zurückgezogen. Man erzählt sich, dass er in einer baufälligen Villa auf dem Mont St. Clair den Diogenes gibt.« Manda grinste. »Du weißt schon. Tonne und so. Ich beneide ihn.«
Er nahm einen letzten Zug, warf die Kippe ins Wasser und bedeutete ihr, wieder zurückzugehen. »Was Commandant Lazare angeht, so soll er in der Vergangenheit tatsächlich einige Ermittlungen ganz ordentlich hinbekommen haben.« Er verzog den Mund. »Aber vielleicht versteht er es auch bloß, sich bei seinen Vorgesetzten einzuschleimen. Danard jedenfalls hält ihn für einen Blender.«
Capucine wich einer Pfütze aus.
»Womit wir aber immer noch keine Erklärung dafür haben, warum man ihn zu uns geschickt hat.«
Manda nickte. Er spürte, wie sich eine leichte Gereiztheit in ihm ausbreitete. Er hatte tatsächlich keinen Schimmer. »Haben wir nicht, stimmt«, gab er zu. »Die Zentrale in Montpellier scheint offenbar fest davon überzeugt zu sein, dass es sich um ein Verbrechen handelt.«
»Aber hast du irgendwelche Kampfspuren gesehen? Dass der Mann beim Baden ertrunken ist, ist genauso unwahrscheinlich. An dieser Stelle badet niemand, schon gar nicht um diese Zeit und bei diesem Wetter.«
»Hm.« Ziemlich neunmalklug, die Kleine, dachte Manda.
»Und wenn er beim Fischen aus dem Boot gefallen ist und ihm die Schiffsschraube eins übergezogen hat? Was meinst du?« Sie blieb stehen und griff nach seinem Arm. »Rede ich Quatsch? Warum sagst du nichts?«
»Weil eine Schiffsschraube andere Wunden macht«, tat Manda klug. »Und jetzt überleg mal. Die Kleidung, die er anhatte – geht man so zur Arbeit?« Er befreite sich aus ihrem Griff und ging weiter. Sie folgte ihm.
»Du hast Recht. So geht man in die Bar. Oder zum Tanzen.«
Natürlich habe ich Recht, dachte er. Was macht sie eigentlich so nach Dienstschluss? Können wir nicht endlich das Thema wechseln?
»Was aber dann doch wieder hieße, dass die Zentrale mit ihrem Verdacht richtigliegen könnte.«
»Blödsinn«, sagte Manda heftig. Verdammt, ja, dachte er. Natürlich war ein Verbrechen nicht ausgeschlossen. Die Banden, die in der Stadt mit Drogen dealten, kämpften um ihre Reviere. Die Rechten hassten Gitans, Araber und Linke. Und um den Irrsinn komplett zu machen, gingen strenggläubige Muslims auf die Moderaten los, waren sich Sozialisten und Kommunisten nicht grün, gifteten alteingesessene Gitans gegen die aus Osteuropa zugewanderten Sinti, Roma und Jenischen. Und umgekehrt.
»Ich meinte ja nur«, sagte Capucine.
»Dann denk mal nach: Woran muss ein Mörder normalerweise größtes Interesse haben? Ich sag’s dir: Er muss zusehen, dass die Leiche so spät wie möglich, am besten nie gefunden wird.« Er grinste herablassend. »Methode Chicago, Füße in einen Eimer mit Mörtel, schön ziehen lassen, und ab damit auf den Grund.«
»Na gut«, murmelte sie. »War ja alles auch nur so eine Überlegung von mir.«
»Schon in Ordnung«, winkte Manda ab. Er steckte sich eine neue Zigarette an. Wieso bin ich plötzlich so genervt, dachte er.
8.
Kurz nach neun Uhr gab Lazare den Leichenfundort frei. Die Beamten der Stadtpolizei, die den Ort zuvor abgesperrt und Neugierige zurückgedrängt hatten, entfernten die Sperrbänder und kehrten zu ihrer Station zurück.
Ein letztes Mal ließ der Ermittler seinen Blick über den Leichenfundort und die Lagune kreisen. Ihr Abfluss mündete in den Canal royal, der die historische Altstadt durchzog und den Binnensee mit dem Mittelmeer verband. Die Strömung wälzte sich behäbig in Richtung der Mitte des Kanals. Wäre der Mann in größerer Entfernung oder weit vom Ufer entfernt ins Wasser gestürzt – oder gestoßen worden –, hätte die Strömung verhindert, dass er an dieser Anlegestelle angeschwemmt wurde. Nein – was immer dem Opfer widerfahren war, es musste etwas weiter nordwestlich geschehen sein.
Lazare sah auf die Uhr. Untersuchungsrichter Simoneau hatte sein Eintreffen im Kommissariat erst für zehn Uhr angekündigt, er hatte also noch Zeit.
Er schritt entschlossen aus. Die Uferlinie war an einigen Stellen durch bis ans Wasser reichende Grundstücksmauern verbaut. Dahinter öffnete sich eine freie Fläche, die nur von einigen Pinien, verwahrlostem Gebüsch und verdorrtem Gras bestanden war. Hinter einem mannshohen Drahtzaun waren der Flachbau und die Terrasse eines Uferrestaurants zu erkennen. Nichts bewegte sich.
Der Zaun war an einigen Stellen beschädigt. Er lief ins flache Wasser der Lagune aus, die hier eine kleine Bucht bildete. Ziegelschutt, ausgebleichte Reste von Plastikflaschen, Fetzen toten Mooses und abgestorbene Algen dümpelten zwischen scharfkantigen, schwarz überkrusteten Steinbrocken.
Wieder sah Lazare prüfend auf die Wasseroberfläche. Er bückte sich nach einem Stück Trockenholz und warf es in die Strömung. Der Stock bewegte sich eine Weile im Kreis, dann entfernte er sich gemächlich nach Osten.
Lazare nickte sich zufrieden zu. Was immer auch geschehen sein mochte, es musste hier geschehen sein.
Er kehrte zu seinem Wagen zurück. Er hatte gerade den Regenschirm ausgeschüttelt und die Tür des Renault entriegelt, als er hörte, wie sich ein Motorroller mit knatterndem Auspuff in rascher Fahrt näherte. Er drehte sich um. Der Fahrer, ein schmächtiger junger Mann, bremste scharf ab und kam auf der Bankette zu stehen. Er rannte mit weiten Schritten auf die Lände zu.
Lazare drückte die Wagentüre geräuschlos zu und setzte sich in Bewegung.
Der junge Mann war an der Bootsanlegestelle stehen geblieben und blickte suchend umher. Er zuckte zusammen, als er Schritte hinter sich hörte.
»Guten Tag, mein Sohn«, sagte Lazare. »Suchst du etwas?«
Der Angesprochene funkelte ihn feindselig an. »Geht Sie nichts an.«
»Das sehe ich anders«, gab der Kommissar zurück. »Lazare. Kriminalpolizei. Ich habe gefragt, was du hier suchst.«
Der junge Mann zwinkerte. »Warum?«
Der Kommissar wies mit einer Kopfbewegung in Richtung der Stadt. »Du darfst mich auch ins Kommissariat begleiten, wenn dir das lieber ist. – Also?«
»Es ist nur … man ist eben neugierig, nich’? … Ich … man erzählt sich, dass hier jemand ertrunken sein soll. Stimmt das?«
Lazare nickte.
»Und wer?«
»Ich will deinen Ausweis sehen«, sagte Lazare.
Der junge Mann nestelte ein Mäppchen aus seiner Gesäßtasche, entnahm ihm seinen Ausweis und hielt ihn dem Kommissar entgegen. Henri Rey, las Lazare. Geboren 1997 in Perpignan. Der Kommissar drehte den Ausweis um.
»Du wohnst drüben in Agde?«
Der Junge bemühte sich, Lazares Blick standzuhalten. »Ich bin für einige Tage für einen Job hier. Ich wohne bei Bekannten.«
»Deren Namen und Anschrift lauten wie?«
Der junge Mann zögerte mit einer Antwort. »Fernandez«, sagte er schließlich.
Lazare ließ sich nichts anmerken. Danards Sekretärin hatte ihm den Namen vor einer halben Stunde mitgeteilt.
»Weiter?«
Der Junge wies mit dem Kinn nach Nordosten. »Sie wohnen auf dem Gelände hinter dem Bahnhof.«
Die Wagensiedlung, dachte Lazare. Das Bidonville der Stadt, das Blechdachquartier. Nie genehmigt, seit Urzeiten geduldet. In dieser kargen Uferregion zwischen Sète und Balaruc befanden sich früher Bootswerkstätten, seit Jahrzehnten war das Gelände verlassen, die Gebäude waren niedergelegt oder zu Ruinen verkommen, aus dem Schotter der von Schlaglöchern übersäten Straßen spross das Unkraut. Hier waren die Fahrenden weg vom Schuss, störten nicht das für die Touristen aufgehübschte Stadtbild.
»Es sind Bekannte von dir, sagst du?«
Henri Rey schüttelte den Kopf. »Eine meiner Tanten ist mit ’nem Fernandez verheiratet.«
Warum nicht gleich?, dachte Lazare. »Na gut«, sagte er streng. »Aber ich habe noch immer keine Erklärung dafür, was du hier verloren hast.«
Der junge Mann sah sich hilfesuchend um. Dann sagte er: »Die Tante hat mich gebeten. Pablo ist letzte Nacht nich’ nach Hause gekommen.«
»Pablo?«
»Pablo Fernandez, ja. Und als das Gerücht die Runde machte, dass hier jemand ertrunken ist …« Er sah Lazare flehend an. »Ist er es? Der … der gefunden worden ist?«
»Wie kommt ihr darauf, dass er es sein könnte?«
»Weil er heute früh … Onkel Sebastién helfen wollte, ein paar … ein paar Sachen zu transportieren.« Er fühlte Lazares bohrenden Blick. »Onkel Sebastién handelt mit Alteisen.«
Lazare schürzte nachdenklich die Lippen.
»Jetzt sagen Sie endlich, ob es Pablo ist!«, rief der junge Mann.
»Ich stelle die Fragen«, blaffte Lazare. Versöhnlicher fuhr er fort: »Aber vielleicht sagst du mir, woran wir erkennen könnten, dass er es ist? Wie sieht er aus?«
»Bisschen größer als ich, ungefähr 1,75, schwarze Haare …«
»Kurz? Lang?«
»Nich’ ganz kurz.« Seine Finger führten eine fahrige Beschreibung aus. »An den Schläfen rasiert, und oben länger.«
Lazare zuckte mit den Schultern. »So sehen viele von euch aus.« Scheint Mode geworden zu sein, dass sich jedes noch so mickrige Bürschchen ausstaffiert wie ein knüppelharter Fallschirmjäger in der Hölle von Diên Biên Phu, dachte er. »Sonst gibt’s kein besonderes Merkmal? War – ich meine, ist er dick oder schlank? Hat er auffallende Narben? Ist er tätowiert?«
»Ein Tattoo auf den Unterarmen. Und auf dem Rücken, glaube ich. Von Narben weiß ich nichts. Dick ist Pablo nich’, er ist gut trainiert.«
»Und wieso kommst du darauf, dass ihm etwas passiert sein könnte? Kann er nicht irgendwo versumpft sein? Bei irgendeiner Freundin?«
Der Junge schüttelte den Kopf. »Pablo … er hat Respekt vor Onkel Sebastién. Er hätte sich wenigstens gemeldet.«
Lazare musterte den Jungen skeptisch. »Unfälle gibt es immer wieder, mal am Kanal, mal am Hafen. Wieso suchst du gerade an dieser Stelle nach ihm?«
»Weil ich gehört habe, dass man hier jemand gefunden hat. Bloß deswegen. Manchmal nämlich, da ist Pablo nach der Arbeit noch baden gegangen, bevor er sich schlafen gelegt hat. Das Ufer da liegt auf seinem Heimweg.«
»Wo arbeitet er?«
»Im Le Caraïbe.«
Lazare runzelte fragend die Stirn.
»Ist ’ne neue Discothek.« Der Junge wies mit einer unbestimmten Kopfbewegung hinter sich. »Er steht da an der Tür.«
»Hat er gekifft? Gesoffen?«
»Pablo war jedenfalls kein Junkie, wenn Sie das meinen.«
»Hatte er Feinde?«
»Weiß ich doch nich’!«, platzte der Junge heraus. »Jetzt sagen Sie mir endlich, ob er es ist! Alle machen sich Sorgen! Scheiße nochmal! Lassen Sie mich ihn sehen!«
»Wie stellst du dir das vor? Er ist bereits in der Gerichtsmedizin.« Versöhnlicher fuhr Lazare fort: »Wir geben euch Bescheid, wenn wir Gewissheit haben, okay?« Er griff in seine Brusttasche und zog eine Visitenkarte hervor. »Mach so lange niemand verrückt, hast du verstanden? Und halte dich in nächster Zeit zu unserer Verfügung.«
Der junge Mann steckte die Visitenkarte ein und hastete zu seinem Roller zurück. Lazare sah ihm nach.
Der Tote gehörte also zu den Gitans. Die auf einem Gelände leben, auf das private Investoren neuerdings ein begehrliches Auge geworfen hatten. Und die nicht daran dachten, sich vertreiben zu lassen.
Lieutenant Manda meldete sich. Er und seine Kollegin hatten nun auch die Bewohner der Häuser auf La pointe longueabgegrast. Bis jetzt Fehlanzeige.
»Entweder verarscht man uns gewaltig, oder die Anwohner hatten einfach einen zu guten Schlaf. Bei mehreren Häusern in direkter Nähe der Fundstelle der Leiche waren die Leute außerdem bereits aus dem Haus.«
»War auch nicht anders zu erwarten«, entgegnete Lazare. »Kommt erstmal her. Ich brauche euch.«
9.