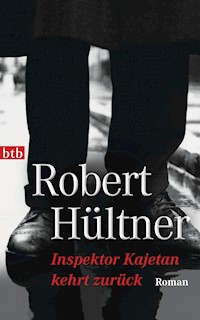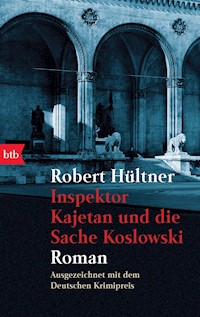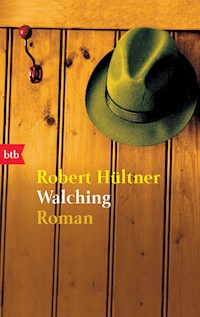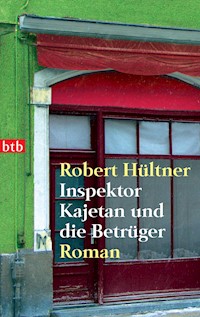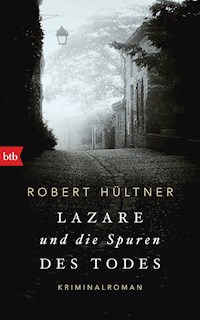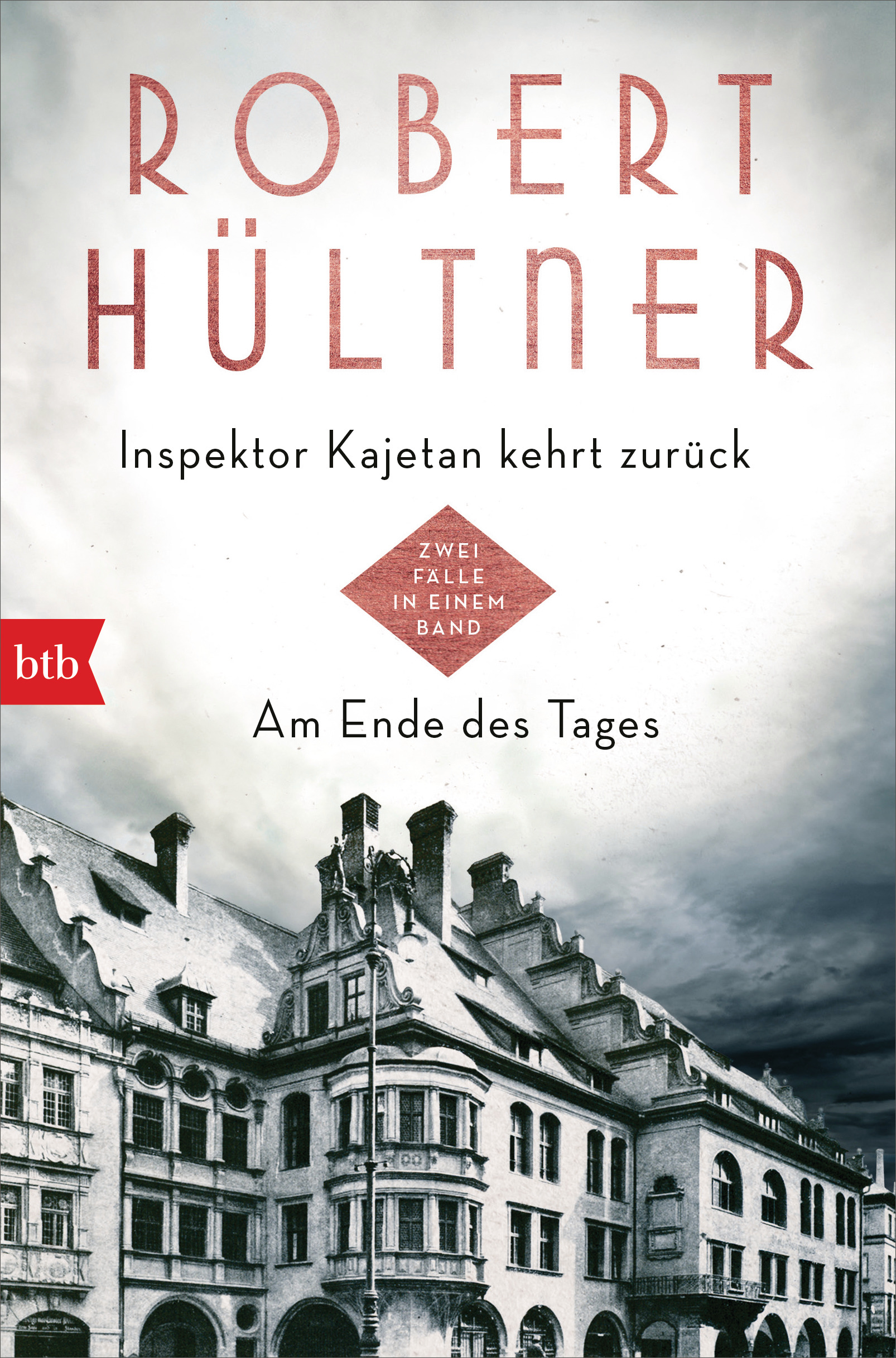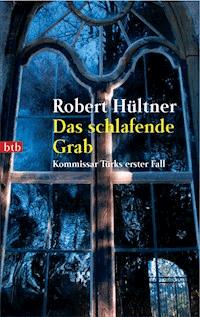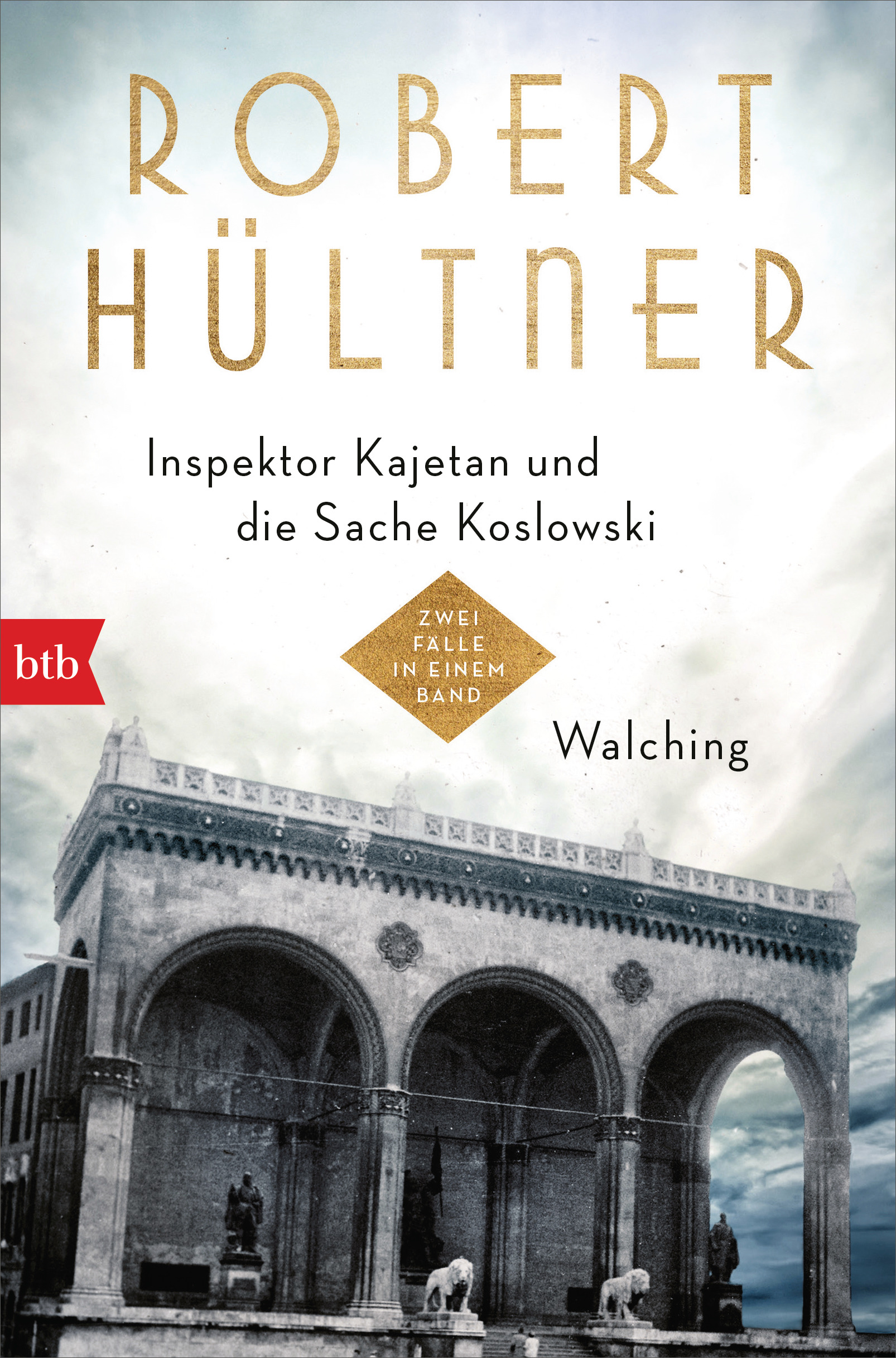
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Kajetan Doppelbände
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Dieser Doppelband enthält die Romane "Inspektor Kajetan und die Sache Koslowski" & "Walching"
Inspektor Kajetan und die Sache Koslowski:
In den Wirren der Räterepublik verschwindet in München der Journalist Meiniger. Nachdem sein Leiche gefunden wird, beginnt Inspektor Kajetan mit höchst gefährlichen Recherchen. Offenbar war Meiniger dabei, die Hintergründe des Attentats auf Kurt Eisner aufzudecken.
Walching:
Winter 1922: Im kleinen Alpendorf Walching wird ein junges Mädchen ermordet aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass drei Vagabunden die Täter sind, doch als Kommissar Kajetan mit seinen Ermittlungen beginnt, gibt es genug Anlass, misstrauisch zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Ähnliche
Zu den Büchern
Inspektor Kajetan und die Sache Koslowski
München, zur Zeit der Räterepublik. In der Stadt regiert das Chaos, politische Gruppen streiten um die Vorherrschaft, die Machtverhältnisse ändern sich schneller, als die Zeitungen darüber berichten können. Mitten in den Wirren dieser Tage verschwindet der junge Journalist Meininger und wird bald darauf tot aufgefunden. Inspektor Kajetan, der bei Dienstantritt nie sicher sein kann, ob die bayerische Polizei nicht über Nacht aufgelöst wurde, findet Hinweise, dass Meininger einer brandheißen Geschichte auf der Spur war: Er recherchierte die Hintergründe des Attentats auf Kurt Eisner …
Walching
Winter 1922. Ein junges Mädchen wird tot in einem Gehöft nahe des Dorfes Walching gefunden. Die vermeintlichen Mörder sind rasch gefunden: drei Vagabunden, die beim Betteln durch diese Gegend gekommen waren. So wird Kommissar Kajetan eher der Form halber in das Dorf geschickt, doch widersprüchliche Zeugenaussagen lassen ihn bald an der Schuld der Festgenommenen zweifeln.
Zum Autor
ROBERT HÜLTNER wurde 1950 in Inzell geboren. Er arbeitete unter anderem als Regieassistent, Dramaturg, Regisseur von Kurzfilmen und Dokumentationen, reiste mit einem Wanderkino durch kinolose Dörfer und restaurierte historische Filme für das Filmmuseum. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen gehören neben historischen Romanen und Krimis auch Drehbücher (u. a. für den Tatort), Theaterstücke und Hörspiele. Sein Roman »Der Sommer der Gaukler« wurde von Marcus H. Rosenmüller verfilmt. Für seine Inspektor-Kajetan-Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem dreimal mit dem Deutschen Krimipreis und mit dem renommierten Glauser-Preis.
Robert Hültner
Inspektor Kajetan und die Sache Koslowski
Walching
Zwei Fälle in einem Band
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Sonderausgabe Juni 2020
by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Inspektor Kajetan und die Sache Koslowski © 1995 by Robert HültnerWalching © 1993 by Robert HültnerUmschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © mauritius images / Kohl-Illustration / Alamy
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ts · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-27063-6V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Inspektor Kajetan und die Sache Koslowski
Roman
1
Der Gewehrlauf zielte auf das Pflaster. Er wippte gemächlich auf und ab, als der Soldat sich in Bewegung setzte und, ohne die Hände aus den Taschen zu nehmen, auf den jungen Mann im abgetragenen dunklen Mantel zuging.
»Was suchst denn da? Da ist heut gesperrt!«
Der Angesprochene fingerte ein Blatt Papier aus einer Tasche, entfaltete es und hielt es sich vor die Brust. Seine Hände zitterten unmerklich.
Der Soldat warf einen Blick darauf, nahm die Zigarette aus dem Mundwinkel und spuckte einen Tabakkrümel aus. Seine Miene verdunkelte sich.
»Von der Zeitung?«
Auf seine Worte hin wandten sich einige Männer des kleinen Trupps republikanischer Soldaten, die den Zugang zum Promenadeplatz bewachten, um.
»Was für einen Dreck wird er denn diesmal wieder zusammenschmieren?«, höhnte einer. Die Brust des aufgeregten jungen Mannes hob und senkte sich. Er wurde rot.
»Von mir habts ihr noch keinen Dreck nicht gelesen!«, rief er verletzt.
Der erste Soldat winkte ungeduldig ab, trat einen Schritt zur Seite und ließ den Journalisten passieren. »Aber deinen sauberen Kollegen sagst«, rief er ihm drohend hinterher, »dass bald ein anderer Wind weht! Hast gehört?«
Der junge Mann, der sich nun schon in der Mitte der Maffeistraße befand, antwortete nicht mehr. Er war in Eile. In wenigen Minuten sollte die Sitzung des neuen Landtags beginnen. Die Wahlen vor einigen Wochen hatten der Partei des Präsidenten eine verheerende Niederlage zugefügt, und alle Welt fragte sich, wie dieser darauf reagieren würde.
Doch so neugierig der junge Journalist darauf war, sowenig war das in Wirklichkeit der Grund, warum er der Sitzung des Parlaments beiwohnen wollte. Er hoffte vielmehr, dabei etwas zu erfahren, was für sein eigentliches Vorhaben nützlich wäre. Was es genau sein würde, wusste er nicht. Noch war er dabei, einige widersprüchliche Informationen zu ordnen, und noch war er längst nicht in der Lage, die vermuteten Zusammenhänge zu beweisen. Das konnte jedoch nicht mehr lange dauern. Der junge Journalist fühlte, wie sein Herz heftiger pochte.
Vor ihm öffnete sich der Promenadeplatz. Noch stand die Sonne schräg hinter den Dächern; über dem schwarzen, feuchten Pflaster dampften Nebelschleier. Im Westen fingen herrschaftliche Fassaden erste Sonnenstrahlen ein und blinkten durch den dünnen Dunst. Ein frühlingshafter Tag kündigte sich an. Kein Wind war zu spüren. Die Luft roch nach dem Rauch vieler Herdfeuer.
Der langgestreckte Platz war nahezu menschenleer. Gelegentliche Rufe der Soldaten, die das Regierungsviertel absperrten, durchbrachen die Stille. Schleppenden Schrittes gingen zwei ärmlich gekleidete Männer mit gesenkten Köpfen an den Wachen des Außenministeriums vorbei, und im Windfang des Eingangs eines Bankgebäudes hatte ein Mann, die Schultern fröstelnd hochgezogen und seine Hände in die Taschen seines Wintermantels vergraben, Zuflucht gefunden.
Eine Bewegung lenkte den Blick des Journalisten auf sich. Aus dem Portal des Montgelas-Palais, das noch im morgendlichen Schatten lag, hatte sich eine Gruppe gelöst: drei Zivil tragende Männer, die von zwei Bewaffneten begleitet wurden, von denen einer vor, der andere hinter der kleinen Gruppe ging.
Der Beobachter blieb stehen. Er fixierte den Mann in der Mitte. Das also war der Präsident? Der Journalist hatte ihn noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen; er kannte sein Äußeres nur von einigen Postkarten, auf denen er als vergeistigter Gelehrter, als eine Melange aus Doktor Faustus und einem leicht an der Welt verzweifelnden, etwas verschlampten Poeten abgebildet war.
Der Mann jedoch, der sich nun mit gemessenen, kräftigen Schritten auf ihn zubewegte, wirkte anders. Eine ruhige Würde, eine patriarchale Gelassenheit ging von ihm aus, und die Belastungen, denen er in den vergangenen Monaten und Tagen ausgesetzt gewesen sein musste, waren ihm nicht anzusehen. Anders als seine Begleiter, deren Blicke zu Boden gerichtet waren und dann wieder unruhig über die toten Fassaden des Regierungsviertels wanderten, drückte seine Miene eine eigentümliche, beinahe sarkastische Heiterkeit aus.
Ja, er würde heute vor den Abgeordneten seinen Rücktritt erklären. Diejenigen, die in den vergangenen Monaten gegen ihn zu Felde gezogen waren, würden nun beweisen müssen, dass sie mit den Problemen der jungen Republik besser fertigwürden – und sie würden scheitern, die biederen Mehrheitssozialisten ebenso wie die Radikalen. Der Misserfolg seiner Gegner würde ihm schließlich recht geben und den Weg ebnen für die Ideen, für die er sein ganzes Leben lang gekämpft hatte. Sein Rücktritt würde ihm Zeit zum Atemholen geben, zum Nachdenken. Der überraschende Erfolg des Umsturzes vor wenigen Monaten hatte es bisher kaum zugelassen. Und da waren schließlich auch seine Frau und seine kleine Tochter, die er liebte und die nicht nur darunter gelitten hatten, dass sich in den vergangenen Monaten Beleidigungen und Morddrohungen gehäuft hatten.
Wärme dehnte sich über den Platz. Aus einem Loch im Maschengitter huschte eine Ratte. Sie schnupperte erregt, verschwand dann aber, von den knallenden Tritten der nahenden Gruppe aufgescheucht, wieder im Keller des Bankgebäudes.
Nun bog der kleine Trupp in die Promenadestraße ein. Als wollte er zur Eile drängen, beschleunigte einer der beiden Bewaffneten seinen Schritt. Er überholte die Politiker und setzte sich an die Spitze der Gruppe.
Der Präsident sah auf. Die Sonne war gestiegen.
Er fühlte nichts als einen silbernen Schmerz im Nacken und hatte schon jedes Bewusstsein verloren, als er auf das Pflaster fiel.
2
Die Riemerischen waren bei den meisten Hallbergern bereits vergessen, als das letzte Familienmitglied in der Düsternis einer geschlossenen Anstalt verstorben war. Die Geschichte dieser Familie war schließlich auch keine besondere. Was diese so vernichtend getroffen hatte, geschah auch anderen und geschah zu oft in jenen Jahren, als dass die Tragödie Einzelner noch wahrgenommen werden konnte. Haushalten musste ein jeder mit seinem Mitleiden, nicht zu oft, nicht zu tief durfte man sich erschüttern lassen in diesen Zeiten nach dem großen Krieg.
In Vergessenheit geriet das Schicksal der Riemerischen aber auch deshalb, weil dabei vieles so eigenartig, so verstörend verlief und sich nicht mehr einfügen wollte in das, was bisher von den Dingen des Lebens bekannt war.
So wäre es nach all der Zeit auch schwer, den Ort zu finden, an dem einmal das Gehöft der Riemerischen stand. Nichts in diesem abgeschiedenen, wüst verbüschten Teil des Hallberger Hochlandes markiert mehr die Stelle, und wer sich, nach mühevollem Studium alter Kataster, danach auf die Suche machen würde, fände am bezeichneten Ort nur noch mürbes Unterholz, hohes Kraut über moosigem Grund, wenige kniehohe, von Immergrün und Unkraut überwucherte, von Wurzelwerk gesprengte Mauerreste und, weitab vom nervösen Lärm des Perthenzeller Tals, einen dunklen, toten Frieden.
Sind sie wieder so recht verloren in den rasch dahineilenden Zeiten, dann erdichten sich die Städter gern ein Bild des Bauern, der seit Jahrhunderten in angestammter Scholle verwurzelt sei. Obgleich es natürlich Höfe gab, die seit Jahrhunderten im Besitz einer Familie waren, so traf dies für die Riemerischen genauso wenig wie für die meisten der anderen Bauern des Hallberger Hochlandes zu. Viel häufiger geschah es, dass Gebäude und Ländereien wieder und wieder ihre Besitzer wechselten. Da genügte es, wenn ein tödliches Unglück den Bauern aus der Arbeit riss und sich die Witwe nicht sofort wieder verheiraten konnte. In jedem Winter passierten schreckliche Unfälle beim Holzschlag; unverständiges Hantieren mit dem erst um die Jahrhundertwende eingeführten elektrischen Strom raffte Männer wie Frauen dahin, und eine für die Bergregion absurd hohe Zahl der Bewohner fand den Tod durch Ertrinken.
Es genügte jedoch auch bereits, wenn der Hoferbe dem Alkohol ergeben war oder einfach nur schlecht wirtschaftete und sich zu hoch verschuldete. Konnte der heimatliche Hof vor einer Versteigerung bewahrt werden, so waren Verkauf und Abwanderung die letzte Möglichkeit, der völligen Verarmung zu entgehen. Nicht wenige waren in den vergangenen Jahrzehnten aufgebrochen, um jenseits des Ozeans ein neues Leben zu beginnen. Ihnen fiel der Abschied nicht sonderlich schwer. Entschlossen schnürten sie den Packwagen und schlugen zornig auf das Zugtier ein. Dann weinten und lachten sie und sahen nicht mehr zurück.
Freilich finden sich die von der Arbeit in die Landschaft gravierten Spuren auch in den Seelen der Menschen, und natürlich gibt es sie, diese in Traum und Gemüt geflochtene Bindung an den Ort der Kindheit. Doch nichts Mythisches ist daran, nichts Geheimnisvolles, keine gleichsam in die Körper getränkte, ins Blut übergegangene Erdverwurzelung. Für das Entstehen dieser oft so leichtmütig abgeworfenen Bindung waren auch keineswegs Jahrhunderte nötig. Wenige Jahre, in denen die Menschen der Erde ihr Überleben abtrotzen mussten, genügten dafür. Und schließlich beginnen sie ihn auf seltsame Weise zu lieben, diesen schweigenden, mächtigen Widerpart, der in einem Jahreslauf reiche Ernten auf sonnenbeschienenen, fett aufbrechenden Äckern schenkt, im nächsten in gleicher Gelassenheit heulende Unwetter, zu Tal dröhnende Muren und alles erstickende Winter mit sich führt.
Zu den schlichten Werkzeugen, mit deren Hilfe dieser kraftzehrende Kampf bestanden werden kann, gehört auch ein mit allen Nachbarn geknüpftes haltbares Netz gegenseitigen Beistands. Nichts mit Moral, allein mit praktischer Vernunft hat dies zu tun, und bei allen Konflikten wird ein wärmendes Ritual daraus gewonnen, dessen gelegentlich ungeschlachte Deutlichkeit weit entfernt von allem ist, was in den Städten oft an leerer Höflichkeit zelebriert wird. Und auch wenn prunkvolle Kulte dem zu widersprechen scheinen, hatte dies nichts mit Religion zu tun. Die Riten der römischen Kirche wurden nur benutzt, war diese doch klug genug, althergebrachte Mythen zu bemänteln. Und sie wurden ebenso ignoriert, wenn sich ihre Lehren zu sehr gegen das Leben sperrten. So war es nicht nur bei den Hallberger Bauern der gute Brauch, dass die Männer beim sonntäglichen Kirchgang erst nach der Predigt in ihre Stühle traten, und so fiel es auch nur den Bigotten ein, eine junge Magd bloß deswegen schief anzuschauen, weil sie ein lediges Kind geboren hatte. Allseits wurde befunden, dass es schließlich Schlechteres gab, was einem ansonsten fleißigen jungen Mädchen nachgesagt werden konnte.
Längst vergessen ist auch, wie die Riemerischen ins Land kamen. Von den Hallberger Alten würde sich nur noch der Steinhauser-Vater bei einer sonntäglichen Schale Kaffee, seinen köstlich stinkenden Landtabak genießend, daran erinnern können, und auch er war damals erst ein Bub, wie in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein zweitgeborener Sohn aus der Weißbacher Gegend das abgelegene, bereits sehr heruntergekommene Riemerlehen mit etwas glücklichem Erbgeld, den wenigen Ersparnissen seiner Frau und wagemutig eingegangenen Verschuldungen erworben hatte. Kaum waren die Güsse des späten Frühjahrs vorüber, begann er mit der Instandsetzung des Hofgebäudes.
Der alte Steinhauser würde vielleicht auch noch davon sprechen, dass es dabei zu einer Begebenheit gekommen war, über welche die Riemerischen später nur noch nach eindringlicher Aufforderung reden wollten.
Als nämlich einer der vom Wurm bereits zerfressenen und von Feuchtigkeit angegriffenen Balken aus der Kaminmauer gelöst wurde, fiel eine senkrecht eingelassene Kalksteinplatte zu Boden. Sie gab den Blick auf eine schmale, handbreite Öffnung frei, welche in eine kleine Höhlung im Innern der Mauer führte. Der Bauer geriet sogleich in Aufregung, hatte man doch hier und dort von diesen geheimen Verstecken gehört, in denen die Leute in früheren Zeiten ihre bescheidenen Reichtümer gegen Diebe oder marodierende Soldaten sicherten. Doch in der Nische fand sich nichts als ein von Ungeziefer nahezu zerfressenes, an einigen Stellen von kalkigem Sickerwasser bereits mineralisiertes Buch.
Der Gemeindepfarrer, dem dieses in ehrfürchtiger Scheu überbracht wurde, verlor darüber augenblicklich seine väterliche Fasson. In hohem Bogen warf er das Buch in das Herdfeuer und kam am nächsten Tag gar zum Entsetzen der Riemerischen und im Gefolge zweier verständnislos dreinblickender Ministranten in vollem Ornat und mit in tiefste gefurchtem Gesicht, um Satan dem noch unfertigen Riemerlehen auszusegnen. Seiner undeutlichen, in viele lateinische Begriffe gekleideten Erklärung glaubten zwei der auswärtigen Zimmerer entnehmen zu können, dass es sich bei dem rätselhaften Fund um eine Bibel der Lutherischen gehandelt haben musste, die vor vielen Jahren aus dem Perthenzeller Land vertrieben worden waren.
Umso mehr würde der alte Steinhauser bestätigen können, dass die Zuzügler in der Gnotschaft, wie die Hallberger ihre Gemeinde nannten, bald gut gelitten waren. Ihr Fleiß, ihre rechtschaffene Art wurden anerkannt, ihre fröhliche Lebenszugewandtheit gerne genossen. Der Riemer, dieser Name wurde alsbald auf die neuen Bewohner des Lehens übertragen, spreizte sich nicht lange, wenn bescheidene Festivitäten das Arbeitsjahr unterbrachen, und auch die Riemerin lachte gern, tanzte gern und gut und in aller Ehr.
Nicht mit allen waren die Riemerischen Freund. Doch jedem Schandmaul, das Ungutes bei ihnen entdeckt haben wollte, wurde spätestens dann hart über die dumme Red gefahren, als jeder den Riemer nach dem Brand des Steinhauslehens gesehen hatte. Ohne viel Worte hatte der Bauer eine große Fuhre Bauholz, das für einen Anbau am Riemerlehen vorgesehen war, herangezogen. »Wann gehts auf?«, hatte er den Dank der noch ganz verzagten Nachbarn abgewehrt.
Kein Streit, den es auch bei den Riemerischen gelegentlich gab, dauerte lange. Bauer und Bäuerin gefielen sich schließlich immer wieder, wirtschafteten trotz aller Schuldenlast gut und gingen in bedächtiger Liebe miteinander um. Der erste Sohn wurde der Riemerin geboren, als das Haus gerade fertig war. Die Bäuerin hatte zuvor wie ein Mannsbild mitgewerkt, und so ließ ihr die Erschöpfung der vorangegangenen Monate die Geburt schwer werden. In den folgenden Jahren starben zwei weitere Kinder wenige Tage nach der Geburt, bis die Riemerin mehr als ein halbes Jahrzehnt, nachdem ihr erster Sohn das Licht der Welt erblickt hatte, Zwillingen das Leben schenkte. Die größte Not der ersten Jahre war zu jener Zeit bereits vorüber und ließ die beiden überleben, obwohl das Mädchen bereits bei der Geburt einen anfälligen Eindruck gemacht hatte. Im Gegensatz zu seinem Bruder, der zu einem kräftigen Buben heranwuchs, wurde es des Öfteren von schweren Erkrankungen heimgesucht. Die leichte, fast unauffällige körperliche Behinderung, die sich daraus entwickelte, wurde jedoch als eine Art göttlicher Beschluss hingenommen, und das Mädchen wurde mit gleicher Liebe und Fürsorge erzogen, wie sie auch den Söhnen zuteilwurde. So lächelte sie lieb und wollte nichts verstehen, als sie am ersten Schultag wegen ihres leichten Hinkens verspottet wurde, und hielt sich weiter an die heitere Wärme ihres Elternhauses.
Gegen Ende des Jahrhunderts wendete sich die Lage der Hallberger spürbar zum Besseren. Begüterte Sommerfrischler fanden sich ein und zeigten sich von der Schönheit des Perthenzeller Oberlandes begeistert. Mehr und mehr Bauern räumten in den Sommermonaten ihre Kammern, boten sie den Touristen als Unterkunft an und schufen sich damit ein gutes Zubrot. Die dramatische Schönheit des Götschenmassivs und des Totkönigs zogen wagemutige Alpinisten an, und der Ruhm bislang für unmöglich gehaltener Gipfelbesteigungen drang in die Städte vor. Ein Hallberger Gasthof, den eine tüchtige und weltläufige Frau aus dem Unterland erworben hatte, wurde zum Treffpunkt stadtmüder Künstler.
Diejenigen unter ihnen, die es sich leisten konnten, begannen damit, sich in der Umgebung Feriensitze zu errichten; Akademiker und Fabrikanten folgten ihrem Beispiel. Die Preise für Boden und Gebäude stiegen binnen weniger Jahre an, und schon bald war es für die Einheimischen schwer geworden, sich auf dem Hallberg niederzulassen.
Unter den gelegentlichen Besuchern war auch ein Baron von Bottendorf. Nachdem er von der Wirtin des Gasthofs erfahren hatte, dass die Villa eines sächsischen Fabrikanten zu einem passablen Preis zum Verkauf stand, hatte er sie erworben. Was sein Beruf war, konnten die Hallberger nicht in Erfahrung bringen. Als Ingenieur hatte er sich eintragen lassen; oft war er auf Reisen, dann wieder sah man ihn über Monate.
In der Gnotschaft wusste man nicht recht, wie mit ihm und den anderen Städtern umzugehen sei. »Fremde« wurden sie genannt, man behandelte sie mit distanzierter, scheuer Höflichkeit, was diese zu Unrecht als Zeichen des von ihnen beanspruchten Respekts deuteten. So mochten es die Dörfler nicht sonderlich, wenn, wie es gelegentlich geschah, der Baron von Bottendorf bei ihnen auftauchte, unaufgefordert auf der Hausbank Platz nahm und das Gespräch suchte. Er bemerkte nicht, dass er dabei die Leute von der Arbeit abhielt, dass man ihn eben reden ließ und ihm nur aus Höflichkeit zustimmte, wenn er mit blasiertem Eifer und ins Nichts gewandtem Gesicht seine Kenntnisse vortrug. Man glaubte ihm vor allem nicht, wenn er von seinem Respekt gegenüber dem, wie er es nannte, einfachen Volk redete. Herumgesprochen hatte sich nämlich längst, wie der noble Herr mit seinen Arbeitern und Zugehfrauen umsprang. Noch weniger verstanden wurde er, wenn er diese seltsame Hochachtung mit allerlei Redereien vom mystischen Urgrund des Landvolkes begründete. Nichts war diesem jedoch unwichtiger, als zu erfahren, ob man von Germanen, Romanen oder sonstigen in der Geschichte untergegangenen Völkern abstammte. Das Vergangene war düster, war schwer, und der Blick galt nur dem Morgen. Die Leute befanden auch, dass »Blut« und »Boden« nicht ein, sondern zwei durchaus zu unterscheidende Dinge sind. Hingegen stimmte man ihm zu, wenn der Herr Baron das Stadtleben als durch und durch entsittlicht bezeichnete. Die Städter, redete er sich dann in Eifer, seien von Gier verseucht und vom Wohlstand verweichlicht. Als er jedoch einmal von schmerzvoller, entbehrungsbereiter Erfahrung schwadronierte, welche allein das Volk kurieren könne, hatte sich der junge Angerer verächtlich vom Tisch erhoben, seine Krücke gepackt und sich wortlos entfernt. Die anderen dachten daran, wie gern der Baron wechselnden weiblichen Besuch in seiner Villa empfing und wie er erst kürzlich, nachdem er sich einen harmlosen Holzsplitter in den Handballen gezogen hatte, in hysterischer Angst vor einer Blutvergiftung nach dem Arzt rufen ließ.
Die Riemerischen, deren Gehöft etwas abseits vom Zentrum der Gnotschaft lag, kümmerten diese Debatten wenig. Nüchtern steuerte die Familie durch die Zeiten; die Welt und die Torheiten in den Tälern schienen weit. Die Kinder waren herangewachsen. Keine Frage war, dass der älteste Sohn Josef das Lehen einmal übernehmen würde. So hatten die Eltern auch nichts dagegen einzuwenden, als der zweitgeborene Sohn eine Anstellung bei der Eisenbahn im Tal fand. An der Tochter hatte eine wohlhabende Dame aus München Gefallen gefunden und sie als Hausgehilfin mit in die Stadt genommen. Die Bäuerin hatte sich anfangs hart dagegen gestemmt, bis sie sich schließlich überzeugen ließ. Ihre Tochter nicht mehr um sich zu haben, bekümmerte die Eltern mehr, als sie es zugeben wollten. Immer seltener kamen Briefe, über die der Bauer einmal feixte, dass die Riemerischen doch eine seltsame Rass seien, weil sie, je weiter sie weg seien, desto liebere Worte fänden.
Nach etwa einem Jahr schrieb das Mädchen, dass mit der noblen Madam kein gutes Schaffen sei und sie deswegen die Stelle gewechselt habe. Jetzt habe sie es besser, aber hie und da sei sie recht allein und habe eine Sehnsucht, wisse aber nicht wonach. Die Eltern tranken die Traurigkeit ihres Kindes wie bitteren Most.
3
Die Dummköpfe waren bereits betrunken, lärmten jauchzend und mit blöden Visagen durch die Gnotschaft, als der Riemer bedächtig den Brief öffnete, in dem sich die Einberufung seiner beiden Söhne befand. Unschlüssig hielt er das amtliche Schreiben in seiner Hand. Er wich dem bösen Blick seiner Frau aus. Sie wusste längst, was der Brief zu bedeuten hatte. »Der Kaiser ruft …«, sagte der Bauer, und es klang eher wie eine Frage. Sie schwieg.
Bereits wenige Monate nach Kriegsausbruch überbrachte ein Bote die Nachricht vom Tod des ältesten Sohnes. Die Riemerischen, würde der alte Steinhauser dazu sagen, haben allerweil eine Vorsicht geübt. Sie waren auf alles gefasst. Aber nicht darauf, nicht auf dieses Unglück.
Es war die Bäuerin, welche den Brief, von dem sie bereits beim Anblick des Überbringers wusste, was er enthielt, entgegengenommen hatte. Sie hetzte stumm durch alle Kammern, als suchte sie nach etwas Verlorenem. Der noch ahnungslose Bauer saß währenddessen in guter Laune am Dengelstein vor dem Tor zum Tenn und fragte, als er den seltsamen Rumor vernahm, was für ein Teufel sie denn wieder reiten würde.
Sie trat aus dem Haus, atmete heftig, wollte auf ihn zustürzen, doch blieb, etwa zehn Meter von ihm entfernt, plötzlich wie versteinert stehen.
Der Bauer verstand sofort. Er hörte auf zu atmen. Dann beugte sich sein Körper wie im Krampf. Schnappend riss er den Mund auf, als müsste er ersticken. Ein lautes, tierhaftes, tief ins Innere der Brust gezogenes Schluchzen röhrte aus seiner Kehle. Dann, endlich, kamen Tränen. Alle Stärke war aus dem Riemer gewichen. Verzweifelt wie ein Kind weinte er um seinen Sohn. Die Bäuerin wollte ihn umarmen, doch sie spürte nichts als einen entsetzlichen, fremden Zorn.
In diesen Jahren war jedem in der Gnotschaft mit untrüglicher, geheimnisvoller Gewissheit klar, wen es als Nächsten treffen würde. So war die Steinhauserin die Erste, die zögernd die Stube betrat und mit einem Blick wusste, dass ihr Gefühl sie nicht getäuscht hatte. Tröstend umfing sie die Bäuerin, drückte sie fest an sich und weinte mir ihr. Der Bauer stand weich und still in der Tür.
Nein, sagte die Riemerin leise, ich glaube dir nicht, dass es weitergeht, und bloß noch tot möcht ich sein, bloß noch tot.
Noch war Hans im Feld. Doch auch von ihm blieben im zweiten Kriegsjahr plötzlich die Briefe aus. Es war bereits später Frühling, als auf dem Kamm der niedrigen Anhöhe, welche die Senke des Riemerlehens vom Dorf Hallberg trennte, der Gemeindebote auftauchte. An der höchsten Stelle hielt er an, stieg vom Rad, wischte sich den Schweiß von der Stirn und stand für Sekunden als schwarzer Schnitt vor dem wolkenschweren Himmel.
Die Riemerin hatte ihn längst entdeckt. Zuerst hatte sie unmäßige Kälte verspürt. Anschließend dröhnte ein betäubendes Pochen hinter ihrer Stirn, das von lauten hämmernden Herzschlägen durchbrochen wurde und zuletzt einer kühlen Betäubung gewichen war. Die Bäuerin richtete sich auf und schüttelte ungläubig den Kopf.
Dann löste sie entschlossen die Schleife ihrer Schürze und stapfte dem Ankömmling entgegen. Tränen quollen aus ihren Augen, je näher sie dem Grund der Senke kam, auf den sich nun auch der Bote zubewegte. Schließlich raffte sie den Rock und begann zu laufen.
Der Riemer hatte sich währenddessen in der Stube aufgehalten. Als er einen unterdrückten Ruf und polternde Flucht gehört hatte, war er ahnungsvoll vor das Haus getreten. Der Weg müsste längst wieder aufgeschottert werden, schoss es ihm durch sein benommenes Gehirn, als er den Boten im Senkengrund schlingernd anhalten und vom Rad steigen sah. Nun, so wusste er, würde der Bote, wie er es immer tat, das Fahrrad an seine Hüfte lehnen, sich zu seiner Tasche wenden und ihr einen Brief entnehmen. Die Bäuerin würde ihm das Kuvert aus den Händen reißen, es öffnen und überfliegen. Der Bote würde dabei zu Boden sehen und ihr dann die Hand reichen, um ihr sein Beileid zu bekunden. Der Riemer wollte fliehen. Er hob seine Hände und bedeckte seine Augen.
Dann stand die Bäuerin vor ihm. Mit leichtem Druck schob sie die starren Finger vom Gesicht des Riemers. Sie umarmte ihn. Was sie in jungen Jahren manchmal getan hatte, wenn am frühen Sonntag eine gelbe Morgensonne wieder einen herrlichen Sommertag versprach, tat sie jetzt. Sie nahm zärtlich sein Gesicht in ihre Hände und flüsterte, dass sie mit ihm tanzen wolle. Der Bub lebe.
Doch die Knie des Bauern gaben nach. Er schniefte und kniff seine Augen zusammen. Sie umfasste seine Hüften und lächelte.
»Geh, du Hirsch«, sagte sie weich, und ihr alt gewordenes Gesicht glänzte voller Frieden, »muss ich dich epper halten?«
Dann verließ sie ihn.
Noch stand der Riemer wie benommen vor der Tür, als er das dumpfe Poltern vernahm. Er kannte alle Geräusche, die das Haus und die darin lebenden Menschen und Tiere machten. Dieses kannte er nicht. Als er in die Stube trat, fand er seine Frau am Boden liegend. Sie atmete bereits nicht mehr.
Das sei nun einmal so bei den Eckerischen, meinten ihre Verwandten bei der Beerdigung, das wisse man schon, dass ein starkes Herz keiner von denen hat.
Den Riemer hatte zunächst eine unwirkliche Ruhe davor bewahrt, das Geschehene zu begreifen. Als er seine Frau voll Bedacht auf die Liegebank bettete, fiel der Brief aus ihrer Hand. Er hob ihn auf.
Hans hatte geschrieben. Verwundet sei er worden, zum Glück nicht schlimm, alle Glieder seien noch heil, er müsse halt noch einige Wochen im Lazarett zubringen und könne dann für immer heimkehren. Seine Schrift jedoch war hässlich, und er hatte Worte von entsetzlicher Zärtlichkeit, die er zuvor nie ausgesprochen hatte, hinzugefügt. Das hatte die Riemerin gelesen und sogleich gewusst, dass ihrem Sohn schreckliche Dinge widerfahren sein mussten, und das hatte ihr das Herz endgültig gebrochen.
Bei der Beerdigung, an der fast die gesamte Gnotschaft teilnahm, sahen die Hallberger erschüttert, dass den Riemer jeder Lebensmut verlassen hatte. Mit seiner Tochter, die aus München gekommen war, stand er verstört am Friedhofstor, als die Trauergemeinde an beiden vorbeischritt und ihnen ihr Beileid aussprach. Während die zu Tränen bewegten Steinhauserischen seine Hände ergriffen und wieder und wieder stammelten, wie schad, wie unendlich schad es um die Bäuerin sei, sah der Riemer wie abwesend an ihnen vorbei. Auch den Blick der Tochter fand niemand. Schön sei sie geworden, stellte man fest. Mit bleichem Gesicht und steinern aufgerichtet, schien sich ihr schmaler Körper wie im Zorn gegen die Erde zu stemmen, in die man ihre Mutter soeben gebettet hatte. Den Leichenschmaus verließen beide bald.
Sie blieb einige Wochen bei ihrem Vater, überlegte gar, ob sie nicht wieder nach Hallberg ziehen sollte. Doch das Haus ihrer Kindheit gab es nicht mehr; alles hatte sich verfärbt, war dunkel, klamm, stinkend und stumm geworden. Sie wurde unglücklich. Der Vater bemerkte es mit Bitterkeit. Er wurde mürrisch, suchte durch Streit ihre Nähe, nannte sie ungeschickt, rief ein ums andre Mal aus, dass alles gut werden würde, wenn nur endlich Hans wieder anpacken würde, und gab ihr schließlich zu verstehen, dass sie ihn allein lassen solle. Sie ahnte, dass er log, und beschloss, noch die Ankunft des Bruders abzuwarten, um dann in die Stadt zurückzukehren. Doch Hans kam nicht. Seine Genesung, schrieb er, verzögere sich, und er verstehe es nicht. Alle Glieder seien doch heil geblieben, weshalb entlasse man ihn nicht?
4
Der Sommer hatte endlich auch das Oberland erreicht, als Hans plötzlich vor dem Riemerlehen auftauchte. Er war mager geworden, lachte eine Spur zu laut und zu blechern und fuchtelte glücklich mit den Armen. Man hatte ihm nicht vom Tod der Mutter schreiben wollen, und nun, je länger Vater und Schwester schwiegen und hinter ihnen nicht die Mutter durch die Tür trat, stürzte das Glück aus seinem Gesicht.
Der Vater war zu dieser Zeit bereits von einer verzehrenden Krankheit gezeichnet, von der er nicht mehr genesen sollte. Sein Abschied war kein müder, friedlicher, wie es einem braven Menschen wie dem Riemer zu gönnen gewesen wäre. Ein rasch wachsender Krebs zerfraß ihn schließlich binnen weniger Wochen, und schreiend vor Schmerz trieb er dem Tod entgegen.
Noch einmal kam die Schwester aus der Stadt. Wieder bot sie ehrlich Hilfe an, doch Hans wies diese zurück. Er werde es schon schaffen, schließlich seien seine Glieder alle heil geblieben, hatte er trotzig lächelnd versichert. Doch sie kannte ihn zu gut und wusste deshalb, dass er in seinem tiefsten Inneren daran zweifelte. Sie hatte in den vergangenen Tagen entdeckt, dass der Krieg zwar nicht seinen Körper, dafür aber etwas anderes in ihm zerstört hatte. Er war ein anderer geworden. Er, der früher gern unter Leuten war, hatte sich verschlossen und ging nur noch aus dem Haus, wenn es unbedingt erforderlich war. Seltsam sei er geworden, raunten die Hallberger, schad drum, so schad.
5
Der junge Riemer hatte das Angebot seiner Schwester auch deshalb abgelehnt, weil er fühlte, dass München längst zu ihrer neuen Heimat geworden war. Obwohl das Leben dort in den vergangenen Monaten schwer war, spürte auch sie, als sie auf dem Münchner Bahnhof den Zug verließ, dass sie nie mehr in Hallberg würde leben wollen.
Nicht sonderlich interessiert, aber mit einer gewissen Aufmerksamkeit verfolgte sie die Veränderungen in der Stadt, sah die großen Demonstrationen, die ein Ende des Kriegs forderten, und las eines Tages in der Zeitung, dass Bayern nun Republik sei. Der alte König, stellte sie mit gemischten Gefühlen fest, hatte sich nach der Revolution ausgerechnet in Perthenzell niedergelassen, bevor er schließlich nach Österreich ins Exil floh.
Dann verbreitete sich eines Tages wie ein Lauffeuer in der Stadt, dass der Präsident auf offener Straße erschossen worden sei. Seine Nachfolger konnten sich jedoch nicht einigen; die Regierung spaltete sich. Die bei Wahlen zu Beginn des Jahres 1919 siegreichen Mehrheitssozialisten zogen sich nach Bamberg zurück; in München hingegen versuchte ein Kongress von Betriebs- und Soldatenräten, den Kampf um die Macht für sich zu entscheiden.
Entgegen anderen Erzählungen, wie sie außerhalb der Stadt zu hören waren, hatte die Arbeit der Münchner Stadtpolizei in diesen Tagen nicht wesentlich zugenommen. Bei den Diebstählen konnte man das nicht behaupten – doch wen hätte dies in diesen armseligen Zeiten gewundert? Viel mehr litten die Beamten darunter, dass ihnen die Bevölkerung immer häufiger mit einem anderen, einem – wie sie es empfanden – frechen Selbstbewusstsein gegenüberzutreten schien.
Auch Kriminalinspektor Paul Kajetan von der Münchner Polizeidirektion musste immer häufiger feststellen, dass ihm keinesfalls mehr derselbe Respekt entgegengebracht wurde, den er zu den Zeiten von König und Kaiser erwarten konnte. Auch wenn Polizei und Justiz während der Revolutionstage so arbeiteten, als hätte es nie einen Umsturz gegeben, wurden – so empfand es zumindest der Inspektor – Ermittlungen gelegentlich dadurch erschwert.
Dass sich nun jedoch die Aufklärung eines bestimmten, einigermaßen mysteriösen Todesfalles als schwierig erwies, hatte nichts damit zu tun. Der Tote war nämlich Beamter der Münchner Staatsanwaltschaft; sein Körper wurde im Rechen eines Wehres im Norden der Stadt gefunden.
Zwar hatten ihn Zeugen am Abend seines Todes im Ceylon-Teehaus am Bavaria-Park gesehen, doch niemand schien beobachtet zu haben, wie der Beamte in den Fluss gestürzt war. Der Gerichtsmediziner verneinte die Möglichkeit, der Mann könnte im Rausch in den Fluss gefallen sein, und keiner seiner Bekannten konnte sich vorstellen, dass er Selbstmord begangen hatte. Seine Lunge war mit Wasser gefüllt, als sein Leichnam geborgen wurde. Gleichzeitig wurde ein Bluterguss an seinem Hinterkopf entdeckt. Gewiss sei nur, meinte der untersuchende Mediziner, dass das Opfer noch nicht tot war, als es in die Isar fiel – oder gestoßen wurde.
Auch seine Kollegen in der Staatsanwaltschaft mochten nicht an einen Selbstmord glauben, räumten aber ein, dass gelegentlich Anfälle einer gewissen Melancholie festzustellen waren und dass er davon gesprochen hatte, seinen Beruf wechseln zu wollen. Dem Racheakt eines Verbrechers konnte er ebenfalls nicht zum Opfer gefallen sein – er hatte mit der Aburteilung nichts zu tun, war lediglich ein unbedeutender Archivar. Nachdem ihm auch sein neuer Kollege, der im Zuge einer überraschenden Umstrukturierung der Polizeidirektion in sein Büro versetzt wurde, nicht helfen konnte, musste Kajetan die Unterlagen schließlich zu den Akten legen. Sein Ehrgeiz ertrug keinen Misserfolg. Schlechtgelaunt und widerwillig begann er sich um die Anzeige zu kümmern, die vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Der Fall schien einfach.
In einer Druckerei war eingebrochen worden. Die Angelegenheit sei sicherlich schnell geklärt, hatte der Betriebsinhaber am Telefon gesagt – er habe da nämlich bereits einen dringenden Verdacht.
Der Inspektor hatte vor, am Nachmittag in die Druckerei zu gehen. Am Abend jedoch wollte er sich mit Irmi, die er vor einigen Monaten vor dem Glaspalast kennengelernt hatte, treffen.
Als er nun an sie dachte, lief ein wohliger Schauer über seinen Rücken. Er musste die Augen schließen.
6
Der junge Riemer stand lauschend da. Nein, er würde dem Unbekannten, der an die Eingangstür geschlagen und seinen Namen gerufen hatte, nicht antworten. Er wollte keinen Menschen sehen. Es bereitete ihm seit geraumer Zeit sogar Mühe, mit seinen Nachbarn zu sprechen. Vom Misstrauen, ihre besorgten Nachfragen wären nichts als hämische Neugierde, nahm er nur den alten Steinhauser aus. Dieser jedoch würde nicht klopfen – wie es überhaupt in den Bergen nicht üblich ist, vor dem Eintreten an die Tür zu pochen. Geschah es dennoch, so konnte es sich nur um einen Auswärtigen oder um unangenehm Amtliches handeln. Jedoch nicht einmal die Beamten der Gendarmerie in Perthenzell würden es tun, wenn sie einen Bauern des Oberlandes aufzusuchen hätten.
Nun war nichts mehr zu hören. Der Unbekannte schien sich wieder entfernt zu haben.
Der Bauer sah nach oben. Das Dach, auf dem der Schnee noch einen halben Meter dick lastete, machte ihm seit einiger Zeit Sorgen; schon längst hätten die Schindel gewendet werden müssen, um Schalung und Gebälk vor der Fäulnis zu schützen. So war die hölzerne Dachhaut bereits mit modernder Flugerde durchsetzt, die bei heftigem Regen Rinnsale über den fichtenen Balkenverbund und in die darunterliegenden Kammern führte. Kein Luftzug, der durch die Zwischenräume des Schindelwerks singen und dadurch das Gebälk nach den langen Wintern und den Regengüssen in Herbst und Frühling wieder trocknen würde, drang mehr ins Innere des Hauses.
Es stimmte, was man sich im Dorf erzählte: Das Riemerlehen verkam immer mehr. Den jungen Bauern plagte eine quälende Unentschlossenheit; er konnte sich nicht entscheiden, mit welchen der immer dringender werdenden Arbeiten er anfangen sollte. Genauso wenig wusste er, womit er die Arbeiten bezahlen sollte. Bei der Hypothekenbank, bei der er um Baugeld nachgefragt und das Riemerlehen als Sicherheit benannt hatte, gab ihm ein blasierter junger Kerl zu verstehen, dass man mit den Hungerleidern vom oberen Hallberg nur ungern Geschäfte mache.
Natürlich warf das Lehen kaum mehr etwas ab. Was er für die Milch seiner noch verbliebenen vier Kühe erhielt, reichte gerade, um sich damit beim Gemeindekramer mit dem Nötigsten einzudecken. Dass täglich nicht viel mehr als ein einfaches Mus oder eine Milchsuppe auf dem Tisch stand, war jedoch kaum anders als bei vielen Nachbarn.
Die Lehenshöfe des Perthenzeller Landes maßen selten mehr als zehn Hektar. Hinzu kam, dass in diesen Höhen an Getreideanbau nicht mehr zu denken war. Der Winter schickte erste Fröste schon im frühen Herbst über das Hochland, und wenn nach schwarzen, eisigen Monaten in den Tälern längst die Obstbäume in Blüte standen, lagen die Hallberger Fluren noch unter einer Schneedecke verborgen.
Gewiss, ein paar Mark Kriegsversehrtenrente hätten die Not verringert, doch das Dornsteiner Versorgungsamt weigerte sich. Er könne nichts feststellen, hatte der Arzt erklärt und dem Riemer zu verstehen gegeben, dass er ihn für einen Simulanten halte. Da sei aber was, hatte der Bauer nur immer wieder sagen können und dagegen ankämpfen müssen, dass, als er es genauer beschreiben sollte, ein Würgen in seiner Kehle hochstieg. Er könne nicht davon sprechen, hatte er verzweifelt geflüstert, es gehe nicht.
Als er daran dachte, fing der Riemer an zu zittern. Sein Herz hatte schmerzhaft an die Rippen zu schlagen begonnen und verfiel in rasenden Galopp. Der Bauer rang nach Atem und versuchte sich an der Heinzelbank festzuhalten. Seine zu Krallen gebogenen Finger griffen ins Leere. Dann stürzte er zu Boden.
Wieder flog ein Dröhnen heran. Wieder sah er, wie sich in atemraubender Langsamkeit eine mächtige Erdwand vor ihm auftürmte und donnernd über seinen Unterstand zu Boden prasselte. Danach umgab ihn Finsternis. Er konnte sich nicht mehr bewegen; die Erdmassen hatten seinen Körper in eine grässliche Verrenkung gepresst, die seiner Brust nur wenige Millimeter ließ, um nach Luft zu ringen. Eine gnädige Ohnmacht wollte nicht kommen, und so litt er, bewegungsunfähig und stets am Rande des Erstickungstodes, für Stunden in seinem entsetzlichen Grab, bis ihn Kameraden in einer Feuerpause bergen konnten. Keiner von ihnen erkannte ihn wieder. Als die Bilder endlich versanken, fand sich der Bauer auf dem Boden liegend. Er sah, dass er sich erbrochen hatte, wischte sich die Schleimreste vom Mund und richtete sich stöhnend auf.
Wieder schlug der Unbekannte an die Tür. Der Riemer bewegte sich nicht. Zornig lauschte er. Der Wind rauschte in der Ferne. Nach einer Weile atmete der Bauer auf und wollte sich gerade vorsichtig erheben, als er hörte, wie sich auf harschigem Schnee Schritte der nicht verschlossenen Hintertür näherten.
»Riemer! Wo sinds denn? Warum antwortens denn nicht?«
Der Bauer wusste nun, wer mit ihm sprechen wollte. Und er wusste auch, worüber.
7
Ächzend hatte sich die Hintertür geöffnet. Ein breiter Streifen des Tageslichts, vom massigen Schatten eines großgewachsenen Mannes gebrochen, fiel herein. Im Gegenlicht des grellen Wintertages war das Gesicht des Besuchers nicht zu erkennen; aus seinem Mund dampfte in Stößen nebliger Atem.
»Da sinds ja! Was antwortens denn nicht, wenn Ihnen einer ruft?«, fragte Gassner, der Verwalter der Villa des Barons von Bottendorf, missgelaunt und trat ein.
Der Bauer sah zornig auf. Sein Vater hatte ihm kurz vor seinem Tod erzählt, dass der Herr Baron schon seit einiger Zeit gute Geschäfte mit reichen Städtern mache, die sich auf dem Hallberg ein Feriendomizil kaufen wollten. Auch den Riemer hatte er deshalb vor einiger Zeit aufgesucht und ihn gefragt, ob dieser nicht an Verkauf dächte. Obwohl das Angebot ganz passabel war, hatte der Alte ihn, wie auch die beiden Interessenten, die der Baron als die Doktores Eckert und Wolf aus München vorstellte, barsch des Hofes verwiesen.
»Habe die Ehre, Riemer.« Gassner streckte die Hand aus. Der Bauer machte jedoch keine Anstalten, sie ihm zu schütteln.
»Warum ich nicht antwort?«, sagte er ungehalten und wandte sich zur Tür, die zum Wohnraum führte. »Weil ich nicht wüsst, was du da heroben zu suchen hast. Deswegen.«
Der Verwalter schien dies zu überhören und folgte dem Bauern. Er rieb sich die Hände.
»Bei Ihnen ists ja saukalt!« Seine Stimme triefte vor falscher Besorgnis. »Langts zum Einheizen nicht mehr?«
»Das tu ich, damit mir keiner zu lang bleibt.«
»Gehns! So harsch müssens auch nicht gleich sein.«
»Ist meine Sach, mit wem ich harsch bin!«, gab der Bauer böse zurück und betrat die Stube. Gassner, der sich nicht abweisen ließ, setzte sich auf die Bank. Der Riemer sah es mit Unwillen.
»Brauchst dich nicht hinzusetzen, Gassner. Ich weiß, weswegen du zu mir raufkommst. Und du kannst auch gleich wieder abhauen. Da wird nämlich nichts draus.«
Der Verwalter hob zweifelnd die Brauen. »So? Da hat sich nichts geändert?«
»Was soll sich geändert haben?«
»Nun, ich mein, jetzt ist Ihnen der Vater gestorben, und Sie sind ganz allein auf dem Lehen. Packen Sies denn ohne jemanden? In der Nachbarschaft gibts da Zweifel …«
Des Riemers Unmut war gewachsen. »Bin noch nicht verhungert, Gassner!«, fiel er ihm scharf ins Wort.
Der Verwalter wiegte seinen Kopf, als müsste er überlegen, ob den Worten des Bauern zu glauben sei. In einem wieder jovialeren Tonfall sagte er schließlich: »Der Herr Baron möchts halt noch mal im Guten mit Ihnen angehen, Riemer. Die beiden Herrschaften sind immer noch interessiert und täten beim Preis sogar noch was drauflegen, weils gar so vernarrt sind in das Riemerlehen. Wovon es natürlich auch nicht schöner wird, das muss man schon sagen, gell?« Sein Blick wanderte vielsagend durch die Stube.
Der Riemer glaubte, seinen Ohren nicht trauen zu dürfen. »Im Guten?!«, fauchte er zornig und trat einen Schritt auf Gassner zu. »Meint der epper, einen Schulbuben vor sich zu haben?«
Der Verwalter wehrte ab. »Gewiss nicht, Riemer, gewiss nicht«, sagte er unschuldig, »das verstehens jetzt aber ganz falsch! Doch meinens denn wirklich, dass Sie noch lange so durchhalten können? Gelernt haben Sie es ja schließlich auch nicht. Sie waren doch seinerzeit bei der Eisenbahn in Arbeit? Hats Ihnen dort nicht besser gefallen?«
Der Riemer ließ sich nicht mehr besänftigen. Seine Stimme wurde lauter.
»Wie lang ich durchhalt, lasst gefälligst meine Sorg sein! Ich verkauf nicht! Da kann er zahlen, so viel er will! Und jetzt sag ichs zum letzten Mal: Schleich dich!«
Gassner machte keine Anstalten, aufzustehen. Wieder hob er beschwichtigend die Hände. »Sie sind mit der Heimat verbunden, Riemer. Keiner versteht das so gut wie der Herr Baron. Aber meinens nicht …«
»Krampf!«, fuhr der Bauer grob dazwischen. »Glaubst, ich verkauf deswegen nicht, weil ich da heroben groß geworden bin? Dass ich an dem Haufen angefressener Balken, was das Riemerlehen jetzt ist, häng? Gib mir ein Platzerl mitsamt einem Auskommen, Gassner, dann pfeif ich auf die Heimat und zieh hin, und wenns auf Amerika sein müsst.«
»Aber da ließ sich doch was finden, Riemer!«
»Als Hausknecht und Schnallenchauffeur epper, wie du einer bist?«
»Verwalter, bitte schön – Verwalter.« Aus Gassners Zügen war die Freundlichkeit gewichen.
»Ha!«, lachte der Riemer bitter.
Der Verwalter stand langsam auf und drückte sein Kreuz durch. Er war einen Kopf größer als der Bauer.
»Nun«, begann er kalt, »dann lässt der Herr Baron ausrichten, er könnt auch noch andere Saiten aufziehen.«
»Schleich dich, Gassner! Auf der Stell!«
Der Verwalter grinste und schien sich zum Gehen zu wenden. Doch plötzlich blieb er stehen, hob die Hand und runzelte die Stirn.
»Still!«, flüsterte er.
»Spinnst du?«
»Still! Hören Sies nicht?«
»Was?«
»In der Wand drinnen, Riemer … die Totenuhr tickt schon in der Wand drinnen!«
Der Bauer schüttelte den Kopf. »Ich hör nichts. Und jetzt …«
Gassner unterbrach ihn. »Das tut sie nur«, sagte er, »wenn ein Haus sterben will. Wenn kein Leben mehr drin ist.«
Der Riemer starrte ihn ungläubig an.
»Was meinens denn«, fuhr der Verwalter ungerührt fort, »dass etwa zu Ihnen noch einmal eine Hauserin heraufzieht?« Er lachte boshaft und trat einen Schritt auf den Bauern zu. »Reden wir deutsch miteinander, Riemer. Sie sind ein Krüppel, jeder weiß es, auch wenns Ihnen keiner ansieht. Aber die Weiber, die wollen was Gesundes. Was Frisches, eins, woran eins seine Freud hat unter der Bettdeck. Wann haben wir denn zuletzt eine gestopft? Lasst Ihnen überhaupt noch eine drüber? Und von Ihrem Schwesterl …«
»Gassner!«, schrie der Bauer außer sich und taumelte auf den Verwalter zu.
»… von Ihrem Schwesterl in der Stadt«, fügte dieser schneidend hinzu, »da hört eins ja auch ganz spaßige Sachen. Da sollen die Mädl ja überhaupt recht leicht hergehen, in der Stadt drin …«
Der Riemer schlug zu. Es war Gassner ein leichtes, den Schlag abzufangen und den Bauern mit einem harten Tritt ans Knie zu Fall zu bringen.
»… eine Schnallen solls geworden sein, heißt es. Nur damit du es weißt, du Krüppel!«
Der Riemer schluchzte in ohnmächtiger Wut. Bebend fingerte er nach seinem Messer. Der Verwalter hatte sich bereits zur Tür gewandt und sie geöffnet. Er drehte sich noch einmal um.
»Ah so?!«, sagte er nur, stürzte sich mit einer schnellen Bewegung auf den Bauern und entriss ihm den Hirschfänger. Dann schlug er ohne Rücksicht zu. Der Riemer verlor die Besinnung.
Schwer atmend richtete sich Gassner auf.
»Jetzt hast du keine Ruhe mehr vor mir, Krüppel«, flüsterte er, »da verlass dich drauf.«
8
Der Baron hatte kaum den Vorraum der Bamberger Harmoniesäle betreten und seinen Namen genannt, als man ihn sofort in das Büro des Kriegsministers bat. Schon einmal war er mit seinem Ansinnen vorstellig geworden. Die bayerische Regierung habe es nicht nötig, hatte man ihn damals kühl zurückgewiesen, auf die Hilfe des Reichs, gar auf die privater Söldner zurückzugreifen, um die Macht in München wiederzuerlangen. Dieses Mal jedoch begann der Kriegsminister das Gespräch mit einer Entschuldigung und bewilligte ohne Umschweife die geforderte Summe.
»Ich bin überzeugt, Herr Baron, dass Ihre Bewegung dazu beiträgt, wieder ordentliche Verhältnisse in unserem Land herzustellen.«
Als würde es ihn verletzen, dass der Minister je daran gezweifelt hatte, erhob sich Baron von Bottendorf mit ernster Miene. Der Herr Minister könne sich in der Tat darauf verlassen, antwortete er.
»Und ich hoffe außerdem«, sagte der Minister und versuchte zu lächeln, »dass damit auch das Gerede in bestimmten Kreisen ein Ende hat, wonach die Sozis alle vaterlandslose Gesellen seien.«
»Ich werde mich bemühen, Herr Minister. Gewisse Vorurteile sitzen allerdings tief.«
Der Minister schien betroffen.
Der Baron beschwichtigte lächelnd.
»Was wir nun jedoch mit Sicherheit sagen können, ist, dass es unter ihnen solche und solche gibt, nicht wahr?«
9
Die schmalen Straßen des Viertels am Auer Mühlbach lagen längst in tiefer Ruhe. Die Uhr der Kirche am Mariahilfplatz hatte einmal geschlagen; der Ton war von den Türmen der Münchner Altstadt weitergetragen worden. Ein heftiger feuchtkalter Nachtwind trieb Wolken vor die schmale Sichel des Mondes. In den Abendstunden war ein schwerer Aprilregen auf die Dächer der Stadt niedergeprasselt und hatte den Mühlbach anschwellen lassen. Sein Rauschen verschluckte die eiligen Schritte zweier Gestalten, die, von der Hochstraße kommend, den Lichtkegel einer einsamen Straßenlaterne durchquerten und wieder im dunklen Gewirr der Gassen verschwanden.
Aus einer der niedrigen Herbergen am Mühlbach drang noch Licht. Nun öffnete sich die Tür; als die nächtlichen Besucher in das Haus traten, fiel ein matter Schein auf die mit grobem Schotter bedeckte, von Schlamm glänzende Gasse.
»Was habts, Baumgartnerin?«
Die Gemeindeschwester sah sich in der schwach beleuchteten Kammer um. Eine magere Frau, sie mochte etwa dreißig Jahre alt sein, saß wie gelähmt auf einem Schemel und starrte ins Nichts.
»Es stirbt«, flüsterte sie, ohne den Blick zu heben, »mein Butzerl. Es stirbt …«
Jetzt entdeckte Schwester Agape das kleine Bündel, das in der Nähe des Ofens in einem abgegriffenen Weidenkorb lag. Sie trat näher und betrachtete es. Der Säugling hatte die Augen geschlossen. Die Schwester schlug das abgewetzte Laken zurück und fühlte dem Kind den Puls. Dann legte sie die Hand auf dessen Stirn und erschrak.
»Habts Ihr ihm eine warme Geißmilch gegeben, wie ich Euch gsagt hab?«
Die Baumgartnerin antwortete nicht. Das Nachbarsmädchen, das die Schwester geholt hatte, trat ruhig näher.
»Es hat schon seit ein paar Tagen nichts mehr trinken wollen und ist allerweil magerer geworden, hat bloß noch gehustet, und Rotz und Gespei ist ihm rausgelaufen.«
Die Schwester nickte besorgt. Wieder legte sie die Hand auf die Stirn des Kindes. Dann richtete sie sich auf und herrschte die leise wimmernde Frau an.
»Bring mir zwei Wannen! Schick dich!«
Die Baumgartnerin hörte nicht.
»Zwei Wannen, Baumgartnerin!«
Als die Frau noch immer nicht reagierte, trat die Schwester zornig einen Schritt auf sie zu. »Ich schmier dir gleich eine, du blödes Weib!«, drohte sie böse.
Die Baumgartnerin erschrak und schien zu erwachen.
»Zwei Wannen, hab ich gesagt! Mach schon!«
»Ich … ich hab bloß eine …«
»Dann hol dir beim Nachbarn die andere! Herrgott! Bist doch sonst auch nicht aufs Hirn gefallen!«
Die Mutter erhob sich, winkte dem Mädchen und verließ eilig die Kammer. Die Schwester beugte sich wieder besorgt über den Weidenkorb. Das Kind lag im Sterben.
Nach kurzer Zeit kamen die Baumgartnerin und das Nachbarskind mit zwei Blechwannen zurück. Die Schwester wies sie an, eine der Wannen mit kaltem, die andere mit warmem Wasser zu füllen. Das kleine Mädchen packte mit an. Während die Baumgartnerin mit einem Kübel auf die Gasse lief, um am Brunnen kaltes Wasser zu holen, schöpfte das Mädchen das erwärmte Wasser in eine Wanne.
Die Schwester ließ zwei hässliche, sehnige Arme sehen, als sie ihre Ärmel hoch über die Ellbogen schob. Sie prüfte die Wassertemperatur, nickte zufrieden, entkleidete das kraftlose Körperchen und legte es hinein. Der Säugling rührte sich nicht. Mit einer schnellen Bewegung wechselte die Schwester nun die Wanne. Das Kind zuckte unmerklich, hielt aber die Augen geschlossen. Ängstlich beobachtete die Baumgartnerin jede Bewegung der Schwester, die den kleinen nackten Körper wieder in das warme Wasser tauchte. Noch immer reagierte das Kind nicht. Doch nun, als es erneut in das kalte gelegt wurde, zeigte sich unendlicher Schmerz auf dem greisenhaft ausgezehrten Gesichtchen.
»Du bringst es ja um«, flüsterte die Baumgartnerin entsetzt. Sie schlug die Hände vor ihre Augen. Schwester Agape schien die Welt um sich herum vergessen zu haben und wiederholte stur ihre Bewegungen. Schweiß troff von ihrer Stirn, lief glänzend über die hässlichen Furchen ihrer müden Wangen und sammelte sich unter dem Kinn.
Das Kind gab erneut kein Lebenszeichen von sich. Die mageren Ärmchen schlenkerten schlaff.
»Warm … kalt … warm … kalt …«, murmelte die Schwester zornig. Sie bewegte sich schneller.
»Du bringst ihn ja um!«, gellte die Baumgartnerin entsetzt und fiel der Schwester, die das Kind gerade wieder in das kalte Wasser getaucht hatte, in den Arm. Mit einem schmerzhaften Tritt machte sich Agape frei. Die Baumgartnerin hatte durch den heftigen Stoß das Gleichgewicht verloren und war polternd über die Stühle gefallen. Stöhnend richtete sie sich auf. Maßloser Zorn ergriff sie.
Plötzlich entkrampften sich die Züge des Säuglings, wurden weich wie im friedlichen Schlaf. Die Baumgartnerin, die ihre Hand zum Schlag erhoben hatte, erstarrte.
Die kleinen Fingerchen bildeten eine Faust. Das Kind stöhnte. Dann schrie es.
Zwischen den geröteten Augen der Schwester bildete sich eine tiefe Falte. Ihr Kinn begann zu zittern, und Tränen liefen über ihr Gesicht. »Es wird wieder … Baumgartnerin … es wird wieder …«, stieß sie erleichert aus und wischte sich schniefend mit dem Handrücken über Stirn und Wangen.
Der Säugling hörte nicht mehr auf zu schreien. Die Baumgartnerin schlug die Hände vors Gesicht. Ihre Schultern bebten.
Mit ruhigen, liebevollen Bewegungen begann die Schwester nun das Kleine in vorgewärmte Tücher zu wickeln und erklärte der Mutter, was sie in den nächsten Stunden zu tun habe. Dann legte sie es wieder in den Korb zurück.
Die Baumgartnerin beugte sich über ihr Kind, dessen verzweifeltes Brüllen nicht enden wollte. »Schau, Schwester«, sagte sie glücklich, »es kriegt schon wieder eine Farb.«
Auch Agape betrachtete den Säugling und nickte zufrieden. Dann stutzte sie. Ein eigenartiges Geräusch war von draußen zu hören.
»Still!« Herrisch hob die Schwester die Hand. Das Baby scherte sich nicht darum. Sie eilte zum Fenster, durch das nun eine seltsame Röte in den Raum drang.
»Es brennt«, flüsterte sie entsetzt. »Das muss beim Raschp drüben sein.«
10
Roter Schein beleuchtete bereits die Gasse. Schon waren aufgeregte Rufe zu hören. Das Viertel erwachte. Vom Turm der Mariahilfkirche setzte das Läuten der Feuerglocken ein. Beherzte Männer hatten sich bereits auf die Dächer der Nebenhäuser begeben und damit begonnen, mit Äxten eine schmale Gasse zu schlagen, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Eine Menschenkette hatte sich binnen kürzester Zeit gebildet, Eimer flogen von Hand zu Hand. Meckernde Geißen, aufheulende Hunde irrten durch die rasch anwachsende Menge.
Höllenhaftes Prasseln und Krachen erfüllte die Luft. Hitze durchflutete die Gasse. Mit zunächst noch fernem, dünnem Bimmeln näherten sich die Spritzenwagen der Feuerwehr.
Eine mächtige blaue Stichflamme fauchte plötzlich aus den Fenstern des Erdgeschosses. Die Männer, die dem Haus am nächsten standen, warfen schreiend ihre Eimer beiseite, stürzten zurück und kühlten die übermäßig erhitzte Haut ihrer Gesichter im Mühlbach.
Urplötzlich sanken die Flammen zusammen. Für Sekunden herrschten Finsternis und lähmende Stille.
Dann sprang erneut eine Flamme empor, stieß, nun höher als zuvor, Garben glimmernder Funken in den Nachthimmel. Jetzt war alles nur noch Glut, sengende, saugende, pochende Hitze, welche die Menschen immer weiter zurücktrieb. Alles war verloren.
Die Schwester stürzte nach vorn.
»Der alte Raschp!«, kreischte sie außer sich, »Holts den alten Raschp raus!«
11
Gedankenverloren schloss Inspektor Paul Kajetan die Tür hinter sich und nahm an seinem Schreibtisch in der Münchner Polizeidirektion Platz.
Also doch. Nach tagelangen Verhören hatte der Setzereigehilfe Hölzl endlich den Einbruch in die Parkus-Druckerei zugegeben. Verbittert über seine Entlassung, war er nach Mitternacht über ein Dachfenster des Nebenhauses in den Speicher der Setzerei eingedrungen und hatte sich mit einem Dietrich Eingang in das Büro der Buchhaltung verschafft. Dort hatte er eine nicht eben geringe Summe frisch gedruckten Geldes, das in jenem Betrieb hergestellt wurde, an sich gebracht.
Aufgefallen war er schließlich allein dadurch, dass er seine seit Monaten ausstehende Miete auf einen Schlag bezahlen konnte. Die Verrücktheit jener Tage brachte es mit sich, dass dies dem Vermieter äußerst verdächtig erschien und er den Schutzmann Eglinger aufforderte, den überraschenden Reichtum des jungen Mannes unter die Lupe zu nehmen.
Eglinger wagte jedoch nicht, die Kammer des Gehilfen, welche sich in einem von Arbeiterfamilien bewohnten Mietshaus in der Lothringer Straße befand, zu durchsuchen. Zu gefährlich war es bereits geworden, in Uniform in den Vorstädten aufzutauchen und dort gar eine Festnahme vorzunehmen. Der Schutzmann gab den Hinweis an Kriminalinspektor Gnott weiter, welcher ihn wiederum seinem Kollegen Kajetan gegenüber beiläufig erwähnte.
Zunächst hatte sich der Verdacht gegen den Betriebsrat Eckert gerichtet. Es bestand kein Zweifel, dass der Täter unter den Betriebsangehörigen zu suchen war. Dass das Druckhaus zur Straße hin bestens abgesichert war, im Speicher jedoch durch eine lächerlich dünne Dachtür fast ungehinderten Zugang erlaubte, konnten nur jene wissen, die dort arbeiteten.
Eckert hatte jedoch entrüstet erklärt, der Inhaber der Druckerei habe ihn der Tat bezichtigt, um damit einen Vorwand zu seiner Entlassung zu bekommen. Tatsächlich hatte der Betriebsrat, welcher das Vertrauen von Setzern und Druckern gleichermaßen genoss und nicht verschwiegen hatte, dass er glühender Anhänger der Unabhängigen Sozialisten war, sich zu einigen Äußerungen hinreißen lassen, die den Inhaber erschrecken mussten.
Bald werde einiges anders werden, hatte er angedeutet, als er wieder einmal einen Lehrbuben, einen gutwilligen, doch zuweilen etwas ungeschickten Jungen aus der Freyunger Gegend, in Schutz nehmen musste. Dieser hatte mit ein paar Ohrfeigen dafür gebüßt, dass er dem Herrn Abteilungsleiter beim morgendlichen Brotzeitholen nicht das Gewünschte gebracht hatte.
»Wenns bei ihm daheim nicht so notig wären, könnt er auch eine Rauchwurst von einem Geräucherten unterscheiden!«, hatte er gesagt und hinzugefügt, dass ihm das schon die Rechten seien, die am Sonntag in christkatholischer Frömmigkeit in die Kirche rennen und unter der Woch hilflose Lehrbuben abwatschen. Die sollten bloß aufpassen, die da dem Inhaber allerweil in den Arsch hineinkriechen, es könne sich ja alles auch einmal umkehren, gell?
Inspektor Kajetan sah aus dem Fenster. Er hatte also wieder einmal recht behalten, als er den Angaben des Betriebsinhabers und dem erkauften Alibi Hölzls misstraute. Dennoch wollte sich heute keine Zufriedenheit einstellen. Und er wusste auch genau, warum. Seine Gedanken irrten ab.
Wieder vergiftete ihn das Misstrauen, das ihn bereits seit einigen Wochen quälte und das seinen Anfang nahm, als er Irmi mit einem jungen, etwas bohemehaft gekleideten Mann im Gasthaus auf der Isarinsel gesehen hatte. Er hatte sofort Verdacht geschöpft.
Irmi hatte ihre Überraschung schnell überwunden und die beiden Männer einander vorgestellt. Der Herr Raths, erklärte sie, wohne im Haus ihrer Freundin und habe sie beide eingeladen, mit ihm einen Ausflug auf die Isarinsel zu machen. Von der Freundin war jedoch weit und breit nichts zu sehen.
»Er ist ein Dichter!«, gluckste Irmi gutgelaunt und blickte bewundernd auf Raths, der Kajetans Hand mit einem ernsten »Angenehm« geschüttelt hatte. »Und der Paule ist bei der Polizei, Herr Viktor!«
Der Dichter hob die Augenbrauen. »Ah ja?«
Kajetan nickte. Irmi sah vom einen zum anderen. Dann trat sie einen Schritt auf Kajetan zu und hängte sich bei ihm ein. Die Weichheit ihres Körpers tat ihm gut; augenblicklich wich sein Misstrauen.
»Der Herr Viktor schreibt nämlich grad an einem Theaterstück«, erklärte Irmi mit gespielter Ehrfurcht. »Gell, Herr Viktor?«
Raths nickte. »Doch, ja«, antwortete er zurückhaltend. Aber nun hatte auch Kajetan sich wieder gefasst.
»Da schau her«, sagte er mit höflicher Neugierde.
»Und du wirst es nicht glauben, da kommt auch unsereins vor, Paule. Ein armes Dienstmädel, wo sich …«
»… das sich aus seinen bürgerlichen Vorstellungen löst, sich der neuen Bewegung anschließt und als Revolutionärin stirbt«, ergänzte der Dichter mit leichter Ungeduld.
»Da schau her!«, wiederholte Kajetan freundlich.
»Nun, eigentlich stellt das nur den äußeren Rahmen dar. Hintergrund meines Romans werden die Machenschaften reaktionärer Kreise sein, und während das Schicksal des Dienstmädchens ein fiktives ist …« Er brach ab. »Aber das ist sicher etwas, was der Polizei wieder einmal wenig gefallen wird.«
»Oh, sagens das nicht, Herr Viktor!«, widersprach Irmi. »Das wird dem Paule bestimmt gefallen! Der Paule liest viel! Gell, Paule?«
»Sie haben Interesse an Literatur, Herr Wachtmeister?«, fragte Raths, und es war nicht zu überhören, dass er daran zweifelte.
»Schon«, antwortete der Inspektor zögernd, »wann eins halt dazukommt. Ich tät halt sagen, dass es einer in meinem Beruf mit mehr erfundenen Geschichten zu tun hat, als sich ein Herr Ganghofer in seinem ganzen Leben ausdenken könnt.«
»Ganghofer!« Raths sah zur Decke.
Kajetan war beleidigt. Er verspürte wenig Lust, diesen blasierten Herrn darüber aufzuklären, dass der Heimatdichter keineswegs seinem Geschmack entsprach.
»Nun«, lenkte Raths schließlich gönnerhaft ein, »Sie haben letztlich vielleicht gar nicht so unrecht. Die Wirklichkeit ist es schließlich, aus der wir unsere Werke zu schöpfen haben. Ich darf mich empfehlen? Die Gelegenheit ist nämlich günstig.« Er ging schnell in die Mitte des Gastraums.
Irmis Augen weiteten sich. »Jetzt pass auf, Paule!«
Kajetan verstand nicht.
»Komm«, flüsterte sie amüsiert, »wir müssen in Deckung gehen. Gleich gehts wieder los.« Sie hatte recht.
Der Rumor hatte nur wenige Minuten angedauert. Raths hatte sich in der Mitte des Raums aufgestellt und dem zustimmend murmelnden bürgerlichen Publikum mit salbungsvollen Worten eine vaterländische Ode zum Anlass der kürzlich heimgekehrten bayerischen Krieger angekündigt. Behäbige Stimmen riefen zur Ruhe.
Die Augen des Dichters blitzten vergnügt, als er mit dem Vortrag begann. Warum er jedoch auch dieses Mal nicht weiter als bis zum Beginn der zweiten Strophe kam, lag nicht etwa daran, dass das Gedicht kein besonders gutes war, dass die Reime hölzern und staksig klangen.
Bereits die erste Zeile der vaterländischen Ode endete mit »verhetzt«, das sich auf ein »zerfetzt« in der nachfolgenden Zeile reimte. Das nächste Zeilenpaar schloss mit »Arbeiterblut« und »Bürgerbrut«, als ein vielstimmiger, wütender Aufschrei ertönte. Rumpelnd rückten Stühle, und Gläser fielen klirrend zu Boden. Kuchenstücke platschten an die Brust des zufrieden grinsenden Dichters. Bald darauf zog er jedoch vor, in wilder Flucht das Weite zu suchen.
»Ja, der Herr Viktor«, flüsterte Irmi bewundernd.
Kajetan hatte sich noch nicht von seiner Überraschung erholt. Er schüttelte den Kopf. »So ein blöder Mensch«, entfuhr es ihm.
War Irmi daraufhin ärgerlich geworden? Oder bildete er sich das nur ein?
Kajetan fühlte sich plötzlich wieder unsicher. Er liebte Irmi, obwohl er bei jedem Mal, wenn er sich mit ihr traf, einen verborgenen, dünnen Schmerz, die Ahnung eines Verrats in der Brust verspürte.
12
Zornig hatte Inspektor Gnott die Tür geöffnet. Kajetan fuhr herum.
»Vorkommen muss sich einer, als hätt er selber was verbrochen!«, schimpfte Gnott aufgebracht.
»Weswegen?«, fragte Kajetan verdattert. »Wegen der Soldaten vor dem Eingang zur Polizeidirektion? Die stehen jetzt doch schon seit ein paar Tagen dort.«
Gnott nickte, noch immer erbost. »Eben. Und jeden Tag werden sie frecher. Wenn unsereins nicht mehr gebraucht wird, soll man uns das bitte schön sagen.«
»Auch eine Räterepublik«, beschwichtigte Kajetan, »wird eine Polizei brauchen. Warten Sies nur ab.«
»Nein!«, erwiderte Gnott, während er seinen Mantel umständlich an den Haken hängte. »Unsereins wird bald abgeschafft.«
»Gehns zu. Wie kommens da drauf?«
»Weil seit gestern der neue Mensch regiert. So hats wenigstens der Minister Heßstätter verordnet.«
»So? Na, der wird sich brennen.«
»Oder wir uns, Herr Kollege.«
»Jetzt tuns nicht gar so schwarzsehen«, versuchte Kajetan ihn aufzumuntern. »Die Zeiten haben doch auch was Gutes.«
»Das glaubens doch wohl selber nicht«, knurrte Gnott. »Was wär das schließlich?«
Kajetan überlegte, während er seinen Kollegen betrachtete. Er kannte ihn noch nicht gut. Inspektor Gnott, ein etwa vierzigjähriger Polizeibeamter, der zwar in München zur Welt gekommen war, nach seiner Ausbildung aber längere Zeit in Passau Dienst getan hatte, war erst vor wenigen Wochen in seine Abteilung versetzt worden.
Über die Gründe war wenig zu erfahren gewesen; der Inspektor selbst deutete an, mit einem Vorgesetzten nicht sonderlich gut ausgekommen zu sein. Er wirkte beherrscht; trotz seiner Zuverlässigkeit und einer gewissen kollegialen Freundlichkeit ging eine eigenartige Kühle von ihm aus, als umgebe ihn eine unsichtbare Mauer.
»Nun«, Kajetan räusperte sich, »so wie früher hätts doch schließlich auch nicht weitergehen können?«