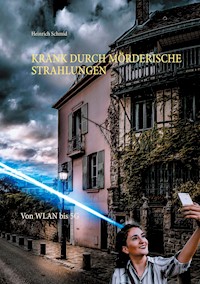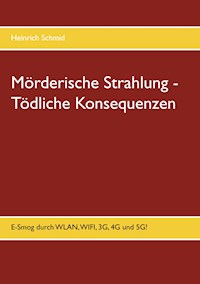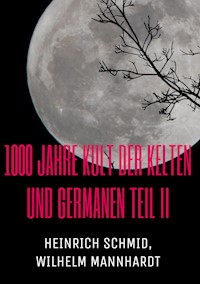
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: 1000 Jahre Kult der Kelten und Germanen
- Sprache: Deutsch
Eine Buchserie für alle, die sich für unsere ehemaligen und zum Teil schon weit über 1000 Jahre alten Traditionen und Rituale interessieren. Insbesondere gibt diese Reihe einen unmittelbaren Einblick in die Verbundenheit der damals lebenden Menschen mit der Natur, ihrem Tierreich und allen damit vebundenen Ritualen zur jeweiligen Jahreszeit. Teil 2 umfasst insbesondere die Maien-Brautschaft, Frühjahrskulte, Wald- und Baumgeister, Hansl und Gretel, Robin Hood und vieles mehr! Herrn Wilhelm Mannhardt ist es tatsächlich gelungen uns ein Zeitdokument zu hinterlassen, das einem von Anfang bis zum Ende fasziniert. Es werden Kulte, Gebräuche und Zeitzeugen aufgeführt, die einen etwas tiefer blicken lassen. Bereits im Buch 1 können wir hautnah miterleben, wie nahe wir einst unseren Bäumen, Tieren und Nutzpflanzen standen. Wie sehr wir sie doch verehrt haben und mit welchen wunderschönen Bräuchen und Ritualen wir sie alle Jahre wieder achteten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Haftungsausschluss: Die Inhalte dieser Publikation wurden sorgfältig recherchiert, dennoch haften Autor oder Verlag nicht für die Folgen von Irrtümern, mit denen der vorliegende Text behaftet sein könnte. Ebenso haften Autor oder Verlag nicht für Schäden und Folgeschäden, die aufgrund der im Buch enthaltenen Anleitungen, Hinweise und/oder Schutzmaßnahmen auftreten könnten.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zum Teil 2 von 4 von Heinrich Schmid
Die Grundanschauungen des Autors Wilhelm Mannhardt zu Band 1 und 2 finden Sie vollständig in Band 1
Zu beachten
Vorwort
Vorwort Wahrheiten
Sprungsschichten und ihrer Einschlüsse
Kapitel III. Baumseele als Vegetationsdämon
Teil 8.0. Christblock und Weihnachtsbaum
10.0 Der Schlag mit der Lebensrute
Palm - Rituale
Kapitel: Auslauf über die Irmensäule
Kapitel IV. Anthropomorphisohe Baum- und Waldgeister als Vegetationsdämonen
1. Persönlich dargestellte Baum- und Waldgeister als Vegetations-Dämonen
2. Doppelte Darstellung des Vegetationsdämons durch Baum und Menschen
Ein geschichtlicher Hintergrund dazu
§ 7. Das Maienreiten
Teil 9. Der Maigraf!
Teil 10. Pfingst - Wettlauf und - Wettritt
Teil 11. Pfingstwettritt, das Kranzstechen, Buschstechen
Teil 12. Wettaustrieb der Weidetiere
Teil 13. Wettlauf und Wettritt, Erläuterungen
Teil 14. Wettlauf nach der letzten Garbe
Teil 15. Eschprozession, Flurumritt
Teil 17. Hinaustragung des Vegetationsgeistes
Teil 18. Hinaustragung und Eingrabung des Vegetationsgeistes Todaustragen
Teil 20 Hinaustragung und Begräbnis des Vegetationsdämons, Erläuterungen
Kapitel V. Vegetationsgeister; Maibrautschaft
Teil 1. Das Maikönigspaar
Teil 2. Maiherr und Maifrau
Teil 3. Maipaare; Hansl und Gretl
Teil 4. Maibraut, Pfingstbraut
Teil 5. Huren, Feien
Teil 6. Bedeutung des Mailbrautpaars
Teil 7. Nachahmungen des Mailbrautpaares
Register; BUCH 2 von 4
Vorwort zum Teil 2 von 4 von Heinrich Schmid
Eine Buchserie für alle, die sich für unsere ehemaligen und zum Teil schon weit über 1000 Jahre alten Traditionen und Rituale interessieren. Insbesondere gibt diese Reihe einen unmittelbaren Einblick in die Verbundenheit der damals lebenden Menschen mit der Natur, ihrem Tierreich und allen damit vebundenen Ritualen zur jeweiligen Jahreszeit. Teil 2 umfasst insbesondere die Maien-Brautschaft, Frühjahrskulte, Wald- und Baumgeister, Hansl und Gretel, Robin Hood und vieles mehr!
Herrn Wilhelm Mannhardt ist es tatsächlich gelungen uns ein Zeitdokument zu hinterlassen das einem von Anfang bis zum Ende fasziniert. Es werden Kulte, Gebräuche und Zeitzeugen aufgeführt, die einen etwas tiefer blicken lassen. Bereits im Buch 1 können wir hautnah miterleben, wie nahe wir einst unseren Bäumen, Tieren und Nutzpflanzen standen. Wie sehr wir sie doch verehrt haben und mit welchen wunderschönen Bräuchen und Ritualen wir sie alle Jahre wieder achteten.
Ich für meinen Teil würde in meinem Leben etwas vermissen, hätte ich diese Bücher nicht ausführlich kennengelernt. Denn von heute an weiß ich mehr denn je, dass der ganze europäische Norden schon lange vor uns eine einzige große Völkergemeinschaft darstellte, die aber dann mit voller Absicht von bösen Mächten zerstört wurde.
Für mich steht es völlig außer Zweifel, dass bereits der damalige „kleine Mensch von der Straße“ den absolut freien und festen Willen zum gegenseitigen Miteinander hatte, und zugleich für ein vereinigtes Europa eingetreten ist.
Ansonsten wäre es nie zu einer solchen Gleichheit von gemeinsamen Ritualen und Gebräuchen in ganz Europa gekommen. Und dies, trotz aller damaligen Kriege und Streitigkeiten!
Der Mensch an sich wollte niemals Krieg führen, er wurde einfach immer wieder dazu verführt oder auch gezwungen. Dadurch gingen uns aber Dutzende von völkerübergreifenden Gemeinsamkeiten verloren, nach denen wir uns heute aber alle wieder sehnen. Nur können wir Sie heute kaum mehr wissen, was sie jemals bedeutet haben, oder vor allem, wie, wann und wo, sie anzuwenden sind.
Diese Lücke hat aber Wilhelm Mannhardt schon 1875 für uns wieder geschlossen. Wir müssen uns einfach nur wieder damit auseinandersetzen und dieses Wissen wieder neu entdecken.
Damit wären die derzeitigen Hürden der nordischen Völker untereinander und die weit größeren, angeblichen Unverbundenheiten mit der heutigen Natur überwunden.
Lassen Sie sich also von dem alten Wissen und dem früheren Umgang der Menschen untereinander inspirieren. Denn bereits „die“ sorgten immer wieder für ein gemeinsames Miteinander und einen harmonischen Umgang mit ihrer Natur. Davon können wir zwar heute momentan nur träumen. Aber wir wären sicherlich wieder auf einem guten Weg, wenn wir nur einige dieser Rituale und Gebräuche erneut wieder beachten würden und es wieder erlernen, wie sie auch anzuwenden sind.
PS: Und bitte entschuldigen Sie vielmals, dass es doch etwas länger gedauert hat, bis ich nun auch den 2 von 4 Teilen wieder vollständig reaktiviert habe.
Hunding, den 24.10.2022 IHR Heinrich Schmid
Somit übergebe ich hiermit nun zum zweiten Male das WORT an einen grandiosen Autor des 19. Jahrhunderts.
Herrn WILHELM MANNHARDT
Es folgen zunächst anschauliche Grundlagen von Wilhelm MANNHARDT zum Gesamtbuch
Inhaltsverzeichnis Buch 2.
Die obere Seitenzahl entspricht dem Original.
Grundanschauung:
Aus der Beobachtung des Wachstums schloss der Urmensch auf Wesensgleichheit zwischen sich und der Pflanze; er maß ihr eine der seinigen ähnlichen Seele bei. Auf dieser Grundvorstellung beruht der Baumkultus nordeuropäischer Völker.
Band 2 von 4
Drittes Kapitel.
Christblock und Weihnachtsbaum.
8.0. Christblock und Weihnachtsbaum. Junge Bäume Weihnachten ins Getreide gesteckt S. →, oder mit Getreide beschüttet und ins Feuer gelegt. S. →.
8.1. Baumzweige, Baumklötze im Weihnachtsfeuer verbrannt haben Zauberwirkung für Menschen, Tiere, Pflanzen. S. → – →.
Die Empfängnis durch Ähren auf dem Mantel der Madonna dargestellt. Vgl. S. 616. S. → – →.
9.0. Christus der himmlische Weizen in weiteren kirchlichen Sitten und Volksgebräuchen. S. → – →.
Diese christlichen Deutungen lösen nicht alle Züge; der Christblock mit dem Maibaum verwandt. S. → - →.
Ist (er) christlich umgedeutet. S. →.
9.1. Ebenso Verhaltes sich mit dem Weihnachtsbaum. Derselbe ist erst seit einem Jahrhundert allmählich verbreitet. S. → – →.
Ging möglicherweise aus dem Paradiesbaum hervor. S. → – →.
[Versinnlichung des „de fructu" in der Kirche S. →]. Doch ist ebenso wenig Übereinstimmung mit dem Maibaum zu verkennen. Maibäume mit Kerzen, Wepelrot, Sommerumtragung zur Weihnachtszeit machen den Maibaum als Figur des Mittwinterfestes und seine Umdeutung in christlichem Sinne wahrscheinlich. S. → – →.
Anmerkung 1) Auf älteren Gemälden sieht man häufig mitten im Burghof einen einzigen Baum stehen, der offenbar eine symbolische Bedeutung hatte. Statt vieler Beispiele erwähne ich den „Ridderlyk Hof van Hollaecken in Brabantia Illustrata und ein Aquarell von Hans Bol a. d. J. 1589."
9.2. Er bedeutet den Lebensbaum der idealen Menschheit. S. →.
Gesetz derartiger Umdeutungen. S. →.
9.3. Umdeutung des Maibaums in das Kreuz, der Wodans Jagd in die Jagd des Engels Gabriel. S. → – →.
10.1. Der Schlag mit der Lebensrute. Menschen, Tiere, Pflanzen zu gewissen Zeiten mit einem grünen Zweig (resp. Stock) geschlagen, um gesund, kräftig, fruchtbar zu werden S. →.
Zu Lichtmesse und Fastnacht (Fudeln). S. → – →.
Am Palmsonntag. S. → – →.
Zu Ostern (Schmackostern). S. →.
Auf Maitag. S. →.
Zu Weihnachten (Frischegrünstreichen, fitzeln, pfeifern). S. → – →.
Flöhausklappen. S. →.
Hudlerlauf. S. →.
Menschen und Tiere gepeitscht. S. → – →.
Tiere (Kälberquieken). S. → – →.
Bäume und Pflanzen, Krautköpfe, die letzte Garbe geschlagen S. → – →.
10.2. Erläuterungen. Die schlagende Rute (Lebensrute) soll Saft Wachstumskraft mitteilen, die Geister der Krankheit und des Misswuchses aus dem Körper vertreiben. S. → – →.
Dem ersten Anschein nach sind diese Sitten vom Palmsonntag ausgegangen. S. →.
Die Palmweihe. S. → – →.
10.3. Auf dem Palmbüschel sind in Griechenland nachweisbar vorchristliche Vorstellungen übertragen, welche mit dem Maibaum übereinstimmen, den die Eiresione als nicht kirchlich bewährt. S. → – →.
Auch die Peitschung des Brautpaars oder junger Eheleute. S. → – →.
Wozu Parallelen bei Naturvölkern. S. → – →.
Soll wohl die der Befruchtung hindernden Dämonen vertreiben. S. → – →.
11.0. Auslauf über die Irmensäule, Neben dem Maibaum als Lebensbaum der Gemeinde war die Irmensul vielleicht Lebensbaum des Volkes. S. → – →.
Doch erlauben die historischen Zeugnisse keine sichere Entscheidung der Frage (Vgl. S. →). S. → – →.
Viertes Kapitel.
Anthropomorphische Wald- und Baumgeister als Vegetationsdämonen.
12.0. Persönlich dargestellte Wald- und Baumgeister als Vegetationsdämonen. Die dem Maibaum innewohnende Seele durch eine daran gehängte Puppe oder einen nebenhergehenden oft in grünes Laub gehüllten Menschen veranschaulicht. S. →.
12.1. Doppelte Darstellung des Vegetationsdämons durch Baum und Menschen im Elsass (Pfingstquak, Mairesele) Franken (Walber) S. →.
Litauen (Maja), Kärnten (Grüner Georg). S. →.
Frankreich (Pere May), Elsass (Herbstschmudel). S. →.
England (Maylady). S. →.
Der Umzug mit diesen Stellvertretern des Vegetationsnumens eine sakramentale Handlung. S. →.
13.0. Laubeinkleidung, Umgang zu Fuß. Häufig fällt der Maibaum fort und der in Laub Gehüllte allein stellt den Wachstumsgeist dar (Grüner Georg, Pfingstblume, Pappel). S. → – →.
Derselbe wird in feierlicher Prozession zu Fuß aus dem Walde geholt, zuweilen mit Wasser begossen. Laubmännchen, Pfingstl, Pfingstsehlafer, Pfingstlümmel, Jack in the Green, Pfingsthütte, Schak, Füstge Mai, Kudernest, Latzmann. S. → – →.
Erläuterung der aufgeführten Sitten. S. → – →.
13.1. Laubeinkleidung, Regenmädchen. Auch bei Dürre ein den Wachstumsgeist darstellender, in Laub gehüllter Mensch behufs Regenzaubers mit Wasser begossen. S. → – →.
Weitere Fälle des Regenzaubers. (Vgl. S. →). S. → – →.
13.2. Laubeinkleidung; der wilde Mann.
Spielart des Laubmännchens. S. → – →.
Darstellung des wilden Mannes als Laubmann oder als behaarter Waldschrat bei Hoffesten, und in Kunst, Heraldik und Numismatik des Mittelalters. S. → – →.
14.0. Maikönig, Pfingstkönig, Maikönigin.
Der Vegetationsgeist als Herrscher aufgefasst wird zum Maikönig, Pfingstkönig, Lattichkönig, Graskönig, Maikönigin, Reine de Printemps, Reine de Mai. S. → – →.
14.1. Das Maienreiten. Der Umzug zu Fuß wird in Folge dessen zum ritterlichen Einritt. S. → – →.
Bei dem sich die Figur des Laubmanns, Pfingstlümmels, in mehrere spaltet. S. → – →.
Das böhmische Pfingstkönigsspiel. S. → – →.
14.2. Der Mairitt, Erläuterung. Der zu Ross aus dem Walde geholte Pfingstlümmel unterliegt als Wachstumsgeist dem Regenzauber.
[Regenzauber bei entlegenen Naturvölkern]. S. → – →.
Ihm wird der Maibaum zur Seite getragen; seine Laubhülle Amulett. S. →.
14.3. Der Pfingstkönig geköpft. Bedeutung dieses Brauchs entweder (eine) unbehilfliche Darstellung des voraufgegangenen Todes der Vegetation um das Auftreten im Frühling als Wiederaufleben zu bezeichnen. S. → – →.
Oder nach Analogie vieler Bräuche - bei wilden Völkern - S. → – →.
Ein Überbleibsel einer uralten barbarischen Sitte, mit dem Blute der geopferten Repräsentanten des Vegetationsgeistes den Äckern Wachstumskräfte zu geben. S. → – →.
Differenzierungen des Pfingstlümmels. S. →.
Analogien zum Schlag mit der Lebensrute. S. → – →.
Ämter des berittenen Gefolges. S. → – →.
Der Mairitt an fürstlichen Höfen. S. →.
15.0. Der Maigraf, ein städtischer Spross des ländlichen Pfingstlümmels. Die Bräuche des Festes. S. → – →.
Nachweis der Abzweigung vom Mairitt des Pfingstlings. S. → – →.
Zeit derselben das dreizehnte Jahrhundert. S. → – →.
Weitere Erläuterung der Bräuche. S. → – →.
15.1. Pfingstwettlauf und Wettritt. Wettlauf oder
Wettritt nach dem Maibaum. S. → – →.
Pfingstwettritt, das Kranzstechen, Buschstechen, die letzteren Spross Formen des ersten. S. → – →.
15.2. Wettaustrieb der Weidetiere. S. → – →.
15.3. Wettlauf und Wettritt, Erläuterungen.
Vermutlich liegt als Gedanke der wetteifernde Einzug der Vegetationsdämonen und rechtliche Besitznahme des Maikönigtums zu Grunde. S. → – →.
15.4. Wettlauf nach der letzten Garbe. S. →.
16.0. Eschprozession, Flurumritt, Umritt um die Gemarkung zum Gedeihen der Saaten, zumeist kirchlicher Brauch. S. → – →.
16.1. Stefansritt. Ausritt oder Wettrennen der Pferde am 26. Dezember. S. → – →.
Erläuterung der Eschprozession (und des Stefansrittes) als mutmaßliche Teile der Feierlichkeit beim Einzug des Pfingstkönigs. S. → – →.
17.0. Hinaustragung des Vegetationsgeistes. Darstellung des im Frühjahr wieder zum Walde kommenden Wachstumsdämons durch eine Puppe. Hetzmann in Schwaben. S. →.
Metziko in Estland (Vgl. Grand mondard in Orleannais S. →). S. → – →.
Waldmann bei Eisenach. S. →.
17.1. Hinaustragung und Eingrabung des Vegetationsgeistes. Todaustragen auf Fastnacht. S. → – →.
17.2. Hinaustragung und Eingrabung des Vegetationsdämons um Mitsommer. S. → – →.
Jarilo. S. →.
17.3. Hinaustragung und Begräbnis des Vegetationsdämons, Erläuterungen. S. → – →.
Fünftes Kapitel.
Vegetationsgeister: Maibrautschaft.
18.0. Das Maikönigspaar.
An Stelle des einen männlichen oder weiblichen Vegetationsdämons, Laubmanns, Pfingstkönigs usw. erscheint oft ein Paar. König und Königin (vgl. S. →). S. → – →.
18.1. Maiherr und Maifrau. Lord und Lady of the May in England. S. → – →.
Andere Formen des Brauchs. S. → – →.
18.2. Maipaare: Hansl und Gretl. S. → – →.
18.3. Maibraut, Pfingstbraut. Das Maipaar als Brautpaar dargestellt, wird im Walde gesucht. S. →.
Darstellung des Hochzeitzuges
(Pfingstbraut, Blumenbraut, Metzgerbraut). S. → – →.
Braut erweckt den schlafenden Laubmann.
(vgl. S. 617 Band 3). S. → – →.
18.4. Verlassene Braut. S. →.
Wiederkehrende Braut. S. →.
Metzgerbraut in Münster; Aschenbraut. S. →.
Umzug der Maibraut in Niederdeutschland und Frankreich. S. → – →.
19.0. Huren, Feien. Im Thüringer Brauche wandelt sich der Laubmann, Schoßmeier in die mit Weiberkleidern geschmückte „Hure/' Symbol der Werdefülle des Sommers. Vgl. die Feien der Altmark. S. → – →.
19.1. Bedeutung des Maibrautpaars.
Der Vegetationsdämon verlässt oder verliert im Winter seine Liebste (Gattin), im Lenze neue Vermählung. S. → – →.
Egarthansel. Kommt christliche Symbolik in Frage? S. → – →.
19.2. Nachahmungen des Maibrautpaars durch menschliche Liebespaare. Am 1. Mai Hochzeitritt, wobei je eine Dame en Croupe hinter dem Reiter sitzt. S. → – →.
19.3. Das Brautnennen am Drömling.
Brautmarkt zu Kindleben. S. → – →.
Inhaltsverzeichnis Ende BAND 2 von 4.
Die Grundanschauungen des Autors Wilhelm Mannhardt zu Band 1 und 2 finden Sie vollständig in Band 1.
Zu beachten:
Die Seitenzahlen wurden von Band 1 fortlaufend übernommen, um bei einer möglichen Rückschau zum Original Buch von 1875 nicht den Überblick zu verlieren.
Vorwort.
Zu den im ersten Bande dieses Werkes „Baumkult der Germanen und ihre Nachbarstämme" vorgeführten Vorstellungen und Gebräuchen weist das vorliegende Buch, den einzelnen Kapiteln desselben folgend, griechische, römische und vorderasiatische Seitenstücke auf. Buchhändlerische Rücksichten empfahlen eine Anzahl auf die antiken Ackerbaukulte (Lityerses, Eleusinien, Thesmophorien, Chthonien, Buphonien, Oetoberroß, Luperealien) bezüglicher Aufsätze für eine nächstfolgende besondere Veröffentlichung zurückzulegen; diese Fortlassung bot zugleich den Vorteil, eine größere Conformität mit dem ersten Teil herstellen zu können (1). Die Darstellung ist so gehalten, daß sie auch als selbständiges Ganze aus sich selbst verständlich bleibt; einem eindringenderen Studium ist die Nachprüfung der aufgestellten Behauptungen jedoch durch fortlaufende Verweisung auf die entsprechenden Untersuchungen und Tatsachen im ersten Teile erleichtert. Wer die Schwierigkeit aus Erfahrung kennt, die es macht, für das Ganze solcher Einzeluntersuchungen, wie sie in meinem
Werke vereinigt sind, eine allen theoretischen und praktischen Ansprüchen genügende Aufschrift zu finden, wird mit Nachsicht beurteilen, daß der Titel meines Buches nicht genau mit dem Inhalte sich deckt. Ich weiß recht wohl, daß er strenggenommen nach der einen Seite hin zu weit, nach der anderen zu eng gegriffen ist. Was das erstere betrifft, so erschöpfen meine Darlegungen den Umfang des europäischen Baum- und Waldkultus nicht. Wenn ich jedoch mit dem Tropus der Synekdoche den Namen des Ganzen für den wichtigsten Teil in Anspruch nahm, während ich nur diejenigen Vorstellungen und Gebräuche geschildert hatte, welche nach meiner Ansicht auf die Grundvorstellung der Baumseele und die daraus abgeleiteten bzw. mit ihr verbundenen Begriffe der Baum - und Waldgeister entweder zurückgehen oder mit denselben verknüpft sind, so habe ich keinen Augenblick verkannt, weder, daß noch einzelne abseits liegende Arten von Baumverehrung vorhanden waren und sind, die aus ganz anderen Gedankenkreisen ihren Ursprung nahmen (z. B, gewisse Fälle der Heiligung von Bäumen im Dienste von Göttern), noch habe ich eine reich entwickelte mythische Botanik leugnen wollen, welche Bäumen und anderen Pflanzen teils wegen auffallender Eigenschaften, oder zur Erklärung dieser Eigenschaften, teils in Folge ihrer mannigfaltigen Verwendung zur metaphorischen Bezeichnung anderer Naturgegenstände oder geistiger Begriffe eine Stellung in Sitte und Sage anweist. Da aber diese Gebilde in überwiegender Mehrzahl nicht sowohl Zeugnisse für die Verehrung der Bäume, als für die Verwendung von Bäumen in Kultus, Zauber und Aberglauben gewähren, glaubte ich sie mit gutem Rechte außer Betracht lassen zu dürfen. Zu eng aber kann der Titel Baumkultus erscheinen, einmal deshalb, weil ich in meinem Buche mich nicht allein mit den Kultgebräuchen beschäftigte, sondern auch in ebenso breiter Ausführung mythische Vorstellungen behandelte, welche aus derselben Wurzel, wie jene, erwachsen sind; sodann, weil ganze Abschnitte des Werkes (die auf die allgemeinen Vegetationsgeister, die Sonnwendfeuer, das Brautlager auf dem Ackerfelde, Pflugziehen u. s. w. bezüglichen) nicht eigentlich unter die Kategorie der Baumverehrung fallen, sondern nur wegen des engen Zusammenhanges der in ihnen dargelegten Anschauungen und Sitten oder wichtiger Teile derselben (vgl. z. B. den Maibaum, die Laubpuppen im Sonnwendfeuer) mit den in den übrigen Kapiteln besprochenen Traditionen herangezogen sind. Sie dienen eben zur Vervollständigung, ohne daß ich damit sie alle ihrem gesammten Inhalte nach aus der Grundvorstellung der Baumseele oder einer Personification der vegetativen Natur abgeleitet wissen möchte. Dies zur Vorbeugung von etwaigen Mißverständnissen. Den richtigen Gesichtspunkt für dasjenige, was ich mit meinen Auseinandersetzungen bezweckte und erstrebte, wird der Leser durch die Darlegung gewinnen, daß und wie die veröffentlichten Untersuchungen von der Ausführung eines größeren Planes, dessen Verwirklichung teils in mehreren fertig ausgearbeiteten Manuscripten, teils im Stoffe mehr oder minder abgeschlossen daliegt, nur einen Teil ausmachen. Diese Darlegung glaube ich dem Puplikum schuldig zu sein, selbst auf die Gefahr hin, dadurch den mich bedrückenden Abstand meines Wollens vom Können ans helle Licht zu ziehen. Wenn ich mir erlaube, dabei einige persönliche Verhältnisse anzudeuten, so geschieht es, weil die in Rede stehenden Arbeiten so enge mit meinem Leben verwachsen und in der Art ihrer Ausführung so sehr durch die Geschicke desselben beeinflußt sind, daß eine gerechte Beurteilung ohne einige Kenntnis der bei ihnen mitwirkenden subejktiven Faktoren kaum möglich zu sein scheint. Schon früh ist in mir ein Gefallen an mythologischen Gegenständen begründet worden. Als Knabe lange Zeit an ein Streckbett gefesselt, dass dem Übel, welches das große Hemmnis meines Lebens zu werden bestimmt war, nur weitere Ausdehnung gab, nahm ich in freien Stunden die hehre Wunderwelt der griechischen Götter - und Heroengestalten aus Beckers meisterhafter Wiedererzählung in meine Seele auf, um sie auf meinem Lager mit lebhafter Einbildungskraft in mir weiter zu verarbeiten. Zudem von Jugend auf durch ungewöhnliche Kurzsichtigkeit einer scharfen Erfassung der Dinge außer mir beraubt wurde ich auf die innere Welt der Phantasie zurückgeworfen und gewöhnte mich ihre Gestalten auseinanderzuhalten und unter verschiedenen Verhüllungen wieder zu erkennen. Als angehender Jüngling lernte ich während der durch meinen Gesundheitszustand nötig gewordenen Schulfreiheit eines Sommerhalbjahrs im grünen Wald und am rauschenden Meeresstrand zugleich Milton Ossian und eine nordische Mythologie kennen. Der Wunsch, einem befreundeten Dänen Widerpart zu halten, der mir, dem geborenen Schleswig - Holsteiner, als auszeichnenden Vorzug seines Volkes wieder und wieder dessen herliche Götterwelt vorhielt, veranlaßte mich, mich um J. Grimms „deutsche Mythologie" zu bemühen. Es waren die Sommerferien; der Augustapfelbaum inmitten unseres Gartens warf mir seine rotbackigen Früchte in den Schoß. So habe ich, damals Secundaner, das schwererrungene Meisterwerk von Anfang bis Ende gelesen — und die Richtung meines Lebens war entschieden. Die Verhältnisse, unter denen ich aufwuchs, zeitigten in mir frühe im Gegensatze zu meiner starr preußischen Umgebung eine entschieden nationale Denkweise, und ein lebhaftes Interesse an den verschiedenen Gestaltungen religiösen Lebens. So betrat ich 1851 die Schwelle der Universität mit dem Wunsche, durch das Studium der Altertümer unseres Volkes in dessen innerstes Wesen einzudringen und mich tüchtig zu machen, vor allem Grimms mythologische Forschung weiterzubilden. Mein Schicksal führte mich nach Berlin; ein Kollegienheft von Lobecks Griechischer Mythologie und der Mythologus von Buttmann waren meine Reisebegleiter. Lachmann war kürzlich gestorben; des Leiters entbehrend erfuhr ich manche Anregung, aber in der Hauptsache blieb ich auf mich selbst angewiesen und das außerordentlich geringe Maß meiner durch den Körper gehinderten Leistungsfähigkeit nötigte mich bei in die Weite strebendem Interesse immer wieder zur Beschränkung, und führte mich stets zur Mythologie als den Mittelpunkt zurück, auf den alle meine sprachlichen und sachlichen Studien Beziehung gewannen.
Als Lernender blieb ich selbstversändlich lange Zeit völlig unter dem Einfluss derjenigen Männer befangen, deren Forschungen damals der jungen Wissenschaft neue und vielverheißende Wege und Ziele zu eröffnen schienen. Dass waren außer J. Grimm selbst vorzugsweise A. Kuhn und W. Schwartz. Ich lebte mich gänzlich in den Gedankenkreis ihrer Erörterungen hinein und teilte auch die Irrtümer, welche diesen ersten Versuchen auf neuem Boden naturgemäß anhafteten. Grimms grundlegendes Meisterwerk ist ebensowenig, als alle sonstigen historischen Gebilde, unvermittelt in die Erscheinnung getreten. Schon seit dem Reformationszeitalter hatten, teils im Interesse einer Erläuterung des Abgöttereiverbots im Katechismus, teils aus humanistischem oder aus nationalantiquarischem Bestreben, Männer wie Mäletius, Agricola, Porthan, Arnkiel Döderlein, C. Schütz, Mone und Finn Magnussen vereinzelt Aberglauben, Bräuche und Sagen als Reste heidnischer Mythologie erkannt und benutzt. J. Grimms mit wunderbarer Kombinationsgabe ausgerüsteter Genius, der zugleich auch kindlich und naiv den Geist des Altertums nachzufühlen verstand, hat zum erstenmale in großartigstem Umfang derartige Quellen in ein Bett geleitet, mit den spärlich erhaltenen unmittelbaren Zeugnissen über deutsches Heidentum verbunden, und in Zusammenhang mit der von ihm zu historischem Verständniß gebrachten Sprache, mit den Sitten und Lebensanschauungen unserer Vorzeit und der Mythologie des verwandten Nordens gesetzt. Da erst war das Ei des Kolumbus gefunden und den Nationen ein Weg vorgezeichnet, der sie über ein weites „Mare incognihmv“ (Das Meer ist unbekannt) in das goldene Land ihrer eigenen Kindheit zu leiten und durch Ausdehnung ihrer Selbsterinnerung bis in eine ferne Periode rückwärts ihrem Leben und ihrer Persönlichkeit ein ansehnliches Stück hinzufügen zu können schien. Vor den Augen der staunenden Zeitgenossen stieg nun ein Bild der altgermanischen Religion empor, in den Hauptsachen so zutreffend, daß es für immer das zu entwickelnde und zu verbessernde Vorbild weiterer Untersuchungen bleiben wird, und zugleich so überwältigend reichhaltig, daß es nunmehr fast ein halbes Jahrhundert die Wissenschaft beherrscht.
Allmählich beginnt es sich soweit in das freie geistige Eigentum der Forscher zu verwandeln, um der so notwendigen kritischen Betrachtung anheimzufallen, und nach Ausscheidung seiner Mängel in geläuterter und verjüngter Gestalt daraus hervorzugehen. Nur selten hat ein Buch eine so großartige Nachfolge geweckt, wie dieses. Es ward zu einer nationalen Tat, Sitte, Sage, Märchen, Aberglauben, Lieder, kurz mündliche Ueberlieferungen jeder Art als Dokumente der vaterländischen Urzeit zusammenzubringen und zu verwerten.
Wir verdanken diesem Streben eine reiche Fülle z. T. trefflicher Sammlungen, und die anderen Stämme Europas taten es uns nach; am eifrigsten diejenigen, welche so gut wie aller Kunde über die Religion ihrer Urväter entbehrten und auf diese Weise in Erfahrung zu bringen glaubten, wie in der Zeit ungebrochenen nationalen Wesens vor Einführung des Christentums der Geist ihres Volkes sich in seinen idealsten Angelegenheiten geäußert habe (z. B. Slaven, Magyaren). Gleichgültiger verhielten sich dem entsprechend andere Völker (z. B. Skandinaven, Komanen), die im Besitze reichlicher Nachrichten über ihre Vorfahren keine Lockung verspürten, diesen Schatz, wie groß oder klein er sein mochte, aus den neuen bis dahin so verachteten Fundgruben zu vermehren. Dies anfängliche Vorwiegen dieser rein nationalen Tendenz auch in meinen Bestrebungen verschuldete, daß meine Arbeit vorzugsweise der lebendigen Volksüberlieferung, als der vermeintlichen Hauptquelle einer eigentümlich deutschen Mythologie zugewandt blieb. Selbst als ich erkannt hatte, wie notwendig u. a. zur Ergänzung die Forderung einer nicht bloß bruchstückweisen, sondern zusammenhangenden kritisch historischen Bearbeitung der gesammten nordischen Mythologie aufzustellen sei. Die Manen des teuren Meisters, der in echter Bescheidenheit seine Forschung als eine Scheuer voll nachgelesener Aehren demjenigen vermacht wissen wollte, welcher mit der Ausstellung und Ernte des großen Feldes in vollen Zug kommen werde, können nicht zürnen, wenn diejenigen, welche auf seinen Schultern stehen, heutzutage, neben dankbarster Anerkennung des von ihm empfangenen bleibenden Besitzes, der Erkenntnis Raum geben, daß seine großartige Leistung in vieler Hinsicht noch unvollständig und mangelhaft war, daß der Bau, den er aufführte, mehrfach schon in den Fundamenten eine schiefe Richtung hatte und zu unbrauchbarem Weiterbau Veranlassung gab. Eine alles Unhaltbare ausscheidende Kritik würde den Umfang seines Buches vielleicht auf nicht weniger als die Hälfte zu verkleinern haben. Es ist hier nicht der Ort, dies eingehender zu erörtern; (2) nur Einiges will ich andeuten.
J. Grimm machte den großen Fortschritt, die Mythologie nicht mehr als Erzeugniß bewußter Speculation, sondern als eine der Sprache analoge Schöpfung des unbewußt dichtenden Volksgeistes zu erfassen. Damit hat er den Grund gelegt für das wissenschaftliche Verständniß nicht allein der germanischen, sondern auch der griechischen und römischen und edler sonstigen Mythologie.
In der Ausübung aber machte er keine strenge Scheidung zwischen den als Wirklichkeit empfundenen Gebilden des Mythus und den ihnen vielfach zum Verwechseln ähnlichen Metaphern und Personifikationen subjektlver Dichter. Er verschloß sich noch der Einsicht, zu welcher bereits Heyne, noch mehr aber David Strauß den Weg bahnte, daß der Mythus auf einer bestimmten Anschauungsweise oder Denkform beruhe, deren sich jedes Volk auf gewissen Entwicklungsstufen mit Notwendigkeit bedienen muß. Diese Denkform bleibt bei fortschreitender Kultur das Eigentum rückständiger niederer Kreise des Volkes und hält in ihnen teils die geistigen Produkte der von den fortgeschritteneren Klassen überwundenen Vergangenheit als Überzeugung fest, teils zieht sie die Ideen und Schöpfungen einer reformierten oder von außen her eingeführten höheren Religion (Christentum, Islam, Buddhismus u. s. w.) auf ihr Niveau herab und formt sie nach ihren Kategorien um, teils äußert sie sich noch fortwährend in manchen neuen mythischen Apperzeptionen (Apperzeption bedeutet die klare und bewusste Aufnahme des jeweiligen Inhaltes eines Erlebnisses, einer Wahrnehmung oder eines Denkens) verschiedenartigen Stoffes. Indem J. Grimm diese Unterschiede hintenansetzte, mußte er geneigt sein, alles Mythische unter den Bevölkerungen der Jetztzeit für Niederschlag, Verkleidung, Abschwächung oder Vergröberung einer einstigen heidnischen Mythologie zu halten und zwar für den in grader Linie fortgepflanzten Nachklang der Mythologie gerade desjenigen Volkes, bei dem die in Frage kommende Tradition vorgefunden wurde. Denn auch dies ließ er außer Rechnung, daß im Lauf der Geschichte eine ununterbrochene Bewegung der Bevölkerungen und Stände auch in den unteren Volksklassen einen weitreichenden Austausch von Ideen und Überlieferungen selbst mit fremden Ländern begünstigt hatte. Letztendlich überschätzte er bei weitem den Einfluß des Mythus auf die Sprache. In Folge dieser Irrtümer verwertete er als Zeugnisse für die von ihm erstrebte deutsch-heidnische Mythologie vielfach ebensowohl rein poetische Personifikationen mittelalterlicher Dichter (Frou Zuht, Frou Êre; din Triuwe, Wunsch, u. s. w.) als aus christlicher Symbolik oder den zeitweiligen tendenziösen Phantasien einzelner kirchlicher Kreise entsprossene Sagen, abergläubische Vorstellungen und Bräuche, sowie mannigfache allgemein menschliche oder fremdländische Superstitionen von ungewisser Entlehungszeit. Vor allem aber schlug er die nach dem sicheren Zeugnis der Merseburger Sprüche und anderen Spuren nicht unbeträchtliche Übereinstimmung der nordischen und deutschen Sage dennoch zu hoch an, da er nach der Weise der alten Theologie die Eddamythen für einen einheitlichen Komplex gleichartiger, die altererbte Volksreligion der Nordgermanen ausprägender Anschauungen ansah, während in Wahrheit darin das letzte Ergebnis einer historischen Entwicklung zu erkennen sein wird, in welcher der Hauptanteil den letzten Jahrhunderten vor Einführung des Christentums, also nach der Trennung von den Südgermanen, und in diesem Zeitraum vorzugsweise der die Gedanken und Bilder ihrer Vorgänger immer weiter fortspinnenden bewußten Arbeit von Kunstdichtern der höheren Gesellschaft zufällt. Der Vorrat alter echter Volksmythen ist darin ein nur beschränkter (über eine solche s. Teil 1 S. 151); vielfach aber lassen sich noch die Stufen nachweisen, welche die Ausbildung einzelner Mythen durch Dichterhand durchmachte (4) In weit höherem Grade, als man seit J. Grimm anzunehmen pflegt, war die in Rede stehende Mythologie ein durch die Natur und Geschichte ihrer Heimat bedingtes eigentümliches Erzeugniß des skandinavischen Nordens (5).
Fassen wir alle diese Gesichtspunkte zusammen, so zeigt sich uns die Notwendigkeit, (entweder ein für allemal oder bis auf weitere Beweise) nicht allein die große Reihe lediglich aus dem Vorhandensein der den nordischen Götternamen zu Grunde liegenden Wortstämme in deutscher Rede erschlossener Gottheiten, wie Gart, Nanda, Rähana, Brego, Hadu, Pro (Gerclr, Nanna, Ran, Bragi, Hödhr, Freyr), sondern auch die Personifikationen von Festtagen wie Ostara (Bk. 505. 522), Berchta (unten S. 185), christliche oder historische Sagengestalten, wie den bergentrückten Kaiser (3) u. s. w. aus dem deutsch-heidnischen Götterhimmel zu entfernen, und nur in späterem Volksglauben bezeugte Gestalten, wie Holda, Here, Harke u. s. w. nicht unmittelbar mit den in alten Quellen überlieferten auf einen Boden zu stellen. Der Autorität des Meisters folgend und dessen Fehler oft ins Maßlose übertreibend versuchten die Schüler, unter ihnen der Verfasser dieses Buches, neben fleißiger Stoffsammlung den Weiterbau seines Systems, indem sie, zumeist gestützt auf das Zusammentreffen einzelner rein äußerlicher Merkmale in jede vereinzelte Sage, jedes Märchen, jede Heiligenlegende eine nordische Gottheit hineintrugen.
Gelangte diese Richtung in Simrock, J. W. Wolf, Hocker, Woeste, Rochholz u. A. zur vollen Blüte, so vermochten sich doch selbst die in Lachmanns Schule erzogenen Vertreter der deutschen Philologie ihr nicht gänzlich zu entziehen. Bleibenden Gewinn versprach nur eine solche Fortführung des begonnenen Riesenwerkes, welche zunächst einmal in dem Baumaterial selber sich orientierte und ohne Rücksicht auf ein vorher bestimmtes Resultat die Volksüberlieferungen einerseits unter sich, andererseits mit den zunächstliegenden verwandten Erscheinungen verglich. So wertvoll und ehrwürdig, ja unentbehrlich uns immer die Edda als eine der wichtigsten Quellen germanischen Altertums und insbesondere der Mythologie bleiben wird, stellen wir neidlos unseren skandinavischen, zumal norwegischen Brüdern ihren höheren Anspruch daran zurück. Ueber die übertriebene Wertschätzung derselben als „deutschen" Nationaleigentums äußerte H. Eückert viel Lesenswertes in einem Aufsatz, der mit nächstem in der von Cauer besorgten Ausgabe seiner kleinen Schriften zum Wiederabdruck gelangen wird.
Einen kleinen, aber schönen, von der späteren Forschung noch nicht ausgenutzten Anfang in letzterer Richtung machte K. Müllenhoff] indem er in der Vorrede zu seiner musterhaften Sammlung Schleswig-Holstein Sagen 1845 auf vielfache Berührungen mit der Poesie und Sitte des Mittelalters hinwies. Das andere aber versuchte zuerst A. Kulm. Als das bedeutendste Verdienst dieses großen Sprachforschers neben seinen drei großen und wichtigen Stoffsammlungen (Mark. Sag. 1843. Norddeutschen Sag. 1848. Westf. Sag. 1859) erachte ich die Anmerkungen zu den beiden letztgenannten Schriften, in denen viele Varianten zu den einzelnen Überlieferungen aus der Literatur der Sagensammlungen zusammengestellt und mit einander verglichen werden (6). Zahlreiche Verwandtschaften und Abweichungen traten unter ihnen hervor. Doch erstreckte sich die Vergleichung immer nur auf einzelne Züge oder auf kleinere Sagengruppen und auch Kuhn kam häufig genug auf eine aus bloß äußerlichen Ähnlichkeiten erschlossene Identifizierung von Sagengestalten mit nordischen Göttern und nicht selten grade mit den für Deutschland noch nicht nachgewiesenen hinaus (7).
Weit höheren Ruhm hat Kuhn durch die glänzenden und überraschenden Schlußfolgerungen in einer ganzen Reihe von Aufsätzen und Schriften erlangt, in welchen er, als einer der bedeutendsten Begründer und Förderer der vergleichenden Sprachwissenschaft, Grimms Methode auf das weitere indogermanische Gebiet übertrug und, gestützt auf die wirkliche oder vermeintliche Übereinstimmung von Namen und Sachen, mit genialem Scharfsinn in den Mythen und Göttergestalten der Veda (deren Verständniß sich ihm bei Belauschung der deutschen Volkssage unter ihren lebendigen Trägern, den Bauern, entzündete) die der Grundform noch sehr nahestehenden Niederschläge einer Urmythologie nachzuweisen unternahm, aus welcher auch die griechische und römische Mythenwelt geflossen sei.
* Diese Arbeiten wurden (ganz abgesehen von der Richtigkeit der durch sie zunächst zu Tage geförderten Ergebnisse) von entscheidender Bedeutung für das Schicksal der germanischen Mythenforschung, indem sie derselben neuen Ziele steckten und ihre Tendenz verschoben. In den Vedas, in der Götterwelt der indischen Epen und in derjenigen der Puranas lagen die verschiedenen Stufen des Lebensgangs seiner Mythologie von der Jugend bis zum Greisenalter vor Augen. Die Lieder des Rigveda, obwohl sie keinesweges eine rein ursprüngliche und naive, sondern eine vielfach schon subjeetive und mit Allegorie durchsetzte Poesie enthalten, zeigten, wie eine Mythologie in ihrem Werdeprozeß aussieht.
Man lernte hier eine noch ganz im Flusse befindliche gläubige Naturanschauung als Ursprung eines großen Teiles der späteren wunderbaren Göttergeschichten Indiens kennen und die Art; wie aus ihr eine persönliche Götterwelt hervorwuchs. Man schloß daraus, daß ganz ähnlich die Urtypen aller arischen Mythologien ausgesehen haben müßten. Seit diesen Beobachtungen war der Bann einer Auffassung der Mythen als eines fertigen Systems völlig gebrochen, das Prinzip der Entwicklung für sie gewonnen, der Nachweis ihrer Entstehung und allmählichen Ausbildung in die Aufgabe der Wissenschaft aufgenommen. Die Erforschung der germanischen Mythologie war nun unlösbar mit dem Problem der Entzifferung des Mythenschatzes der klassischen Völker im Altertum und der übrigen arischen Stämme verknüpft. Der einseitig patriotische Gesichtspunkt erweiterte sich zum indoeuropäischen und, als die seit 1860 von Lazarus und Steinthal begründete Völkerpsychologie diesen Bestrebungen hinzutrat, zum menschheitlichen. Wie aus der historischen Sprachforschung sich die Sprachphilosophie entwickelte, lernten wir immer deutlicher die psychischen Faktoren des Mythus als allgemein menschheitliche,
Nachtrag: Atli genannt war, was Grimm Myth. 2 154 Großvater, Altvater übersetzt, [während es doch unzweifelhaft Abwandlung von atall, acer, strenuus ist]. Nordd. Sag. Gebr. Anm. 102. Der Nix im Darmssen, der mit einem Schwerte bewaffnet in den See springt, muß Heimdall oder Freyr sein, weil ersterer in der Skaldensprache Schwert-Ase heißt, letzterer ein Schwert besaß, das er weggeschenkt hat (Westf. Sag. I, 54). Das zur Sonnenwende in Bezug stehende Notfeuer muß dem [hypothetischen] Sonnengott Frö geweiht gewesen sein, weil in England dabei ein Priap aufgepflanzt wurde, in Upsala aber war Frös Bildsäule mit einem Phallus ausgerüstet. Herabk. S. 101. Wissen wir aber, ob es überhaupt irgendeinem Gotte gewidmet war?
selbst auf den höchsten Kulturstufen noch wirksame kennen; wir erkannten bei dem engen Geschwisterbund zwischen Religion und Mythologie, zumal durch Steinthals und M. Müllers (8) Verdienst, in dem vertieften Mythenstudium ein wesentliches Hilfsmittel, die allgemeinen Gesetze religiösen Denkens klarzulegen, und dadurch an der Vorarbeit für die von den Besten in großem Stile ersehnte Reform des religiösen Lebens mitzuwirken. (9). Dies alles entkeimte der von Kuhn gegebenen Anregung. Auch werden wir freudig gestehen, daß ihm manches Rätsel zu lösen, manchen Zusammenhang aufzuhellen gelungen ist, Gleichwol darf ich mit dem Geständnis nicht zurückhalten, daß nach meiner Ansicht die vergleichende indogermanische Mythologie die Früchte noch nicht getragen hat, welche man allzu hoffnungsreich von ihr erwartete. Der sichere Gewinn beschränkt sich doch auf einige sehr wenige Gottesnamen (wie Dyaus — Zeus — Tius; Parjanya — Perkunas - Bhaga — Bog; Varuna — Uranos u. s. w.), und Mythenansätze, die im übrigen auf zahlreiche Analogien gründen, welche aber noch nicht notwendigerweise eine historische Urverwandtschaft begründen.
Gerade die beim ersten Anblick scheinbarer Vergleichungen, z. B.:
und ein großer Teil der in dem berühmten Buche „Herabkunft des Feuers" vorgeführten Parallelen halten nach meiner Überzeugung, die ich in kurzem mit Gründen zu belegen Gelegenheit haben werde, vor einer eindringenden Kritik nicht Stand; ich fürchte, daß die Geschichte der Wissenschaft sie einmal eher als geistvolle Spiele des Witzes, denn als bewährte Tatsachen zu verzeichnen haben wird. Schon der Umstand, daß sie nicht die stetig fortzeugende Kraft bewähren, welche Grimms und Bopps sprachlichen Entdeckungen innewohnte, muß gegen ihre Wahrheit mißtrauisch machen, und zur Vorsicht mahnen.
Selbst bei Beurteilung so wahrscheinlicher Identitäten, wie die vom Kampfe der Devas und Vritras oder Ahis mit den Sagen von Erlegung des schatzhütenden oder frauenraubenden Drachen und vom Tode des Cacus durch Recaranus - Hercules. Unzweifelhaft hat es neben der Sprache auch schon eine gemeinsame Grundlage der religiösen Vorstellungen in der arischen Urheimat gegeben, und die Veden bewahren die ältesten uns erhaltenen Sproßformen davon; ob aber ausgebildetere größere Mythenkomplexe von dorther in den (10) europäischen Mythologien übrig sind, bleibt vor der Hand noch eine offene Frage. Nicht das Prinzip trägt die Schuld davon, daß wir noch nicht weiter sind, sondern die angewandte Methode, deren Grundfehler in einem Mangel an historischem Sinne zu suchen ist.
Man ließ außer Rechnung, daß die Mythologien einen bei weitem verwickeiteren und weit weniger der Regel unterworfenen Zustand vielfach zusammengesetzter Bildungen darstellen, als die verhältnißmäßig einfachen Erscheinungen der Sprache. Man machte sich noch nicht klar, daß das geistige Leben der Kulturvölker niemals in der geraden Linie einer ungestörten Entwicklung aus nationalem Keime verlief, daß es von dem Zuströmen fremdländischer Ideen reichliche Impulse empfing; und indem man unmittelbar die beiden Endpunkte zweier in ziemlichem Abstand von dem hypothetischen Ausgangspunkt auslaufender Entwicklungen mit einander kombinatorisch verknüpfte, unterließ man, die letzteren durch die nachweisbaren Zwischenglieder Schritt für Schritt bis auf ihre wirklich erreichbare, oft nicht weit dahinten liegende Grundform rückwärts zu verfolgen. Ohne alte, und junge Überlieferungen, bloße Nachahmungen, dichterische Erfindungen, ätiologische Erklärungen zu scheiden und je anders nach ihrem wahren Werte zu verwenden, spannte man die europäischen Mythen in das Prokrustesbett (Schema, in das etwas gezwängt wird) einer nach den zwar alten aber doch schon national indischen Anschauungen entworfenen Schablone und vernachlässigte darüber ihre nächsten historischen Zusammenhänge, ihre Bedingtheit durch den Ideenkreis der Zeit oder der Schriftsteller, ihren ethischen Gehalt und ihre Beziehungen zu den lokalen Formen der Naturverhältnisse. Dazu stützte man die Vergleichung nicht selten auf Bruchstücke, die aus ihrem natürlichen Zusammenhang gerissen waren, oder man legte solche vedische Anschauungen zu Grunde, deren Bedeutung noch unklar und Gegenstand verschiedenartiger Auslegung ist. Die europäischen Mythen sollten nun fast durchgehend irdische Lokalisierungen einer bildlichen Veranschaulichung himmlischer Naturvorgänge sein; die zum Beweise des Ursprungs in der urarischen Periode vorgebrachte Übereinstimmung in Namen und Sachen zwischen den indischen und griechischen oder deutschen Traditionen, ist aber sehr häufig im etymologischen oder sachlichen Teile oder in beiden trügerisch, und damit fällt das Ganze in sich zusammen. Eine besondere Fraktion in der vergleichenden Mythologie gründete M. Müller (1856), indem er in mehreren Stücken von Kuhn abwich. Während nämlich dieser und seine Schule anfangs fast ausschließlich in den wechselnden Naturerscheinungen der Wolken und Winde die Ausgangspunkte der mythischen Bilder- welt suchte, setzte jener dieselben noch mehr ausschließlich in den überwältigenden Eindruck der sich täglich wiederholenden Phänomene, der Sonne und der Morgenröte, auf die kindliche Seele der Urväter. Außerdem wollte M. Müller nicht sowohl aus einer Erstarrung einfacher poetischer Metaphern, als vielmehr aus einem rein sprachlichen Vorgange die Mehrzahl der Mythen ableiten. (11) * Ein Abschnitt aus der „Herabkunft" ist S. 335 analysiert.
Eine andere Ausführung (Herabk. 238 ff.) finde hier kurz Erwähnung. Kuhn erörtert, der Götterbote Hermes sei ein Feuergotfc, weil der vedische Feuergott Agni auch Bote der Götter heiße [als ob nicht die Idee des Götterboten aus verschiedenen Anlässen, z. B. aus Personiflcation des Windes, entspringen konnte], sodann, weil er [der Gott der Erfindungen] das Feuerzeug erfand. Wahrscheinlich aber werde die Hypothese dadurch, daß Kallimachos (Hymn. in Dian. v. 64 —71) Hermes gradezu den feurigen Kyklopen gleichsetze, indem er ihn statt dieser, mit Ruß bedeckt, vom Herde her herbeikommen lasse. Was sagt nun Kallimachos? Die neugeborne Artemis geht mit ihrem Gefolge von Okeaninen zu den Kyklopen in den Aetna, um steh von ihnen Bogen und Pfeile schmieden zu lassen. Die Okeaninen fürchten sich vor den ungefügen Gesellen. Ganz natürlich. Denn, wenn ein Töchterchen bei den Göttern ungehorsam ist, ruft die Mutter nach den Kyklopen; und aus dem Innersten des Hauses kommt Hermes, mit Ruß bestrichen, und das Kindlein flieht in den Schoß der Mutter und bedeckt seine Augen mit den Händen. Artemis aber fürchtete sich nie, u. s. w. —
Daß ich jedoch nicht, wie man zu sagen pflegt, das Kind mit dem Bade verschütte, bezeugt mein Aufsatz „Lettische Sonnenmythen in Bastian-Hartmanns Zeitschr. f. Ethnol VII, 1875." 2 Auf den Wanderungen, welche W. Schwartz als Begleiter und Teilnehmer seines Schwagers Kuhn zum Zwecke der Sammlung märkischer und norddeutscher unternahm, fanden beide Gelegenheit, den Zusammenhang einiger Gruppen derselben, namentlich derjenigen vom Wode und der wilden Jagd mit der lebendigen Naturanschauung des Volkes zu beobachten. Während nun Kuhn dadurch auf die Beachtung analoger Erscheinungen in den Veden geleitet wurde, schöpfte Schwartz aus jener Beobachtung die in einem gewissen Umfang richtige Entdeckung, daß in den unter dem Volke noch lebendigen Sagenmassen eine „niedere Mythologie " enthalten sei, welche einen früheren Zustand, eine embryonale Entwickelungsform der späteren Götter- und Dämonenwelt festhalte, möge die letztere auch in weit früheren geschichtlichen Zeugnissen überliefert werden. Nicht also bloß Abschwächungen, Niederschläge der in der Edda u. s. w. vorliegenden ausgebildeteren Mythologie des Heidentums treten uns hier entgegen, wie Grimm wollte, sondern die Keime und Grund elemente, aus denen sie sich entwickelte.
Schwartz legte diese Beobachtungen in einem Schulprogramm nieder. Zugleich machte er fruchtbare Wahrnehmungen über die Veränderungen, denen die Sagen im Laufe ihrer Fortpflanzung von Mund zu Mund fast mit der Regelmäßigkeit eines Gesetzes unterliegen. Indem er in späteren Aufsätzen und Schriften auch bei anderen Völkern den bildlichen Naturauffassungen und den Residuen der rohesten und einfachsten Mythenelemente nachging, wurde er neben Th. Waitz (Anthropologie der Naturvölker 1859 — 1865) (13). Ich stellte mir zunächst nur das Verständnis des Ideengehalts dieser Lieder zur Aufgabe. Aus ihnen selbst ergiobt sich vermöge der Varianten, in denen einmal die Naturerscheinung, ein andermal die Personification mit den nämlichen Prädicaten verbunden ist, für die Sonnentochter die Bedeutung der Dämmerung oder der Morgenröte, für den Gottessohn die Bedeutung des Morgen - Abendsterns; jene poetischen Bilder aber tat ich als auch anderswo geläufige Metaphern für Zustände der himmlischen Lichterscheinungen dar.
Von der Berechtigung, ja der durch den Zusammenhang gebotenen Notwendigkeit, die Deutung in dieser Eichtun g zu suchen, wird sich überzeugen, wer aufmerksam und vorurteilslos prüft und seine Prüfung mit den Abschnitten über Sonnenroß (93), Sonnenboot (102), Sonnenapfel (103) beginnt. Nicht jede Deutung (z.B. die des Eichbaums) wage ich für bereits gelungen auszugeben. Nur als Analogien, als Illustrationen, welche durch den Nachweis psychischer Möglichkeit einer Apperception des nämlichen Naturvorgangs unter den nämlichen Metaphern, wie in den lettischen Sonnenliedern, meiner Deutung zur Stütze dienen sollen, nicht als Zeugnisse historischen Zusammenhangs werden deutsche und slavische Sonnenlieder, auf Sonnenwesen bezügliche vedische Hymnen , griechische Mythen und Dichter , Märchen und sogar die Sagen fremder Weltteile verglichen (vgl. darüber S. 325—329). Ich betone diese Absicht noch ausdrücklich hinsichtlich dessen, was ich über den Sonnentisch der Aethiopen (S. 230, vgl. 244), das goldene Vließ am Eichbaum (S. 283), die Hesperidenäpfel (234) ausgeführt habe. Einige der beigebrachten Analogien sind unrichtig. Der Stein Alatir (S. 287) z. B. entstammt christlicher Symbolik des M. A. (cf. Jagic im Archiv f. slav. Phil. 1,89— 101). Nur erst hinterher glaubte ich durch die über ihr Ganzes sich erstreckende überaus große Übereinstimmung der unbestrittenermaßen auf demselben Naturgebiete sich bewegenden Sagenkreise von „Ushas und den Acvins“, von Helena und den Dioskuren mit demjenigen von der Sonnentochter und den Gottessöhnen genötigt zu sein, als einstweilige Vermutung (S. 329) einen indogermanischen Ursprung für sie alle anzusprechen. Für bewiesen werde ich diese Vermutung nicht eher erklären, als bis erneute und eindringendere Unsersuchungen die von mir gegebene Konstruktion jedes der drei verglichenen Sagenkreise als der ältesten Ueberlieferungsform entsprechend bestätigt, und bis die Fortschritte unserer Kenntniß die indogermanische Hypothese in mehreren Fällen, denn bis jetzt, überzeugend gemacht haben werden.
Bahnbrecher für die zuerst von A. Bastian (14;15;) mit unerhörter aber unkritischer Gelehrsamkeit unter scharfsinniger Auffindung vieler wertvoller allgemeiner Gesichtspunkte gegründete, dann (zwar auch nicht ohne Verwendung manches ganz wertlosen Bausteines) mit nüchterner Besonnenheit von E. Tylor die fortgeführte ethnographischanthropologische Betrachtung der Sitte und Sage, welche darauf ausgeht, an Tatsachen bei den verschiedensten Naturvölkern den analogen Verlauf der ältesten Sitten-, Religions- und Mythenbildung zu veranschaulichen. Ihr verdanken wir namentlich die Einsicht, daß fast sämmtliche Entwicklungsphasen und Lebensformen, welche der geistige Zustand der Menschheit allmählich durchlaufen hat, in heutigen Völkern der Erde noch lebende Vertreter zählen und daß man in der Beobachtung dieser ein treffliches Hilfsmittel besitze, um die im Leben der civi- lisierten Nationen erhaltenen Überbleibsel früherer Kulturstufen zu studieren, und daß viele solcher Überbleibsel selbst bis in die primitive Stufe des Fetischismus und der Wildheit zurückreichen. Auf diese Weise wird durch Analogien Verständniß ermittelt; daneben wird man künftig auch hinsichtlich solcher rudimentärer Kesiduen in jedem einzelnen Falle die Frage stellen müssen, ob sie als Lehngut oder als eigenes Erzeugnis der Urväter ihres jeweiligen Besitzers zu betrachten seien. Diesen Forschungen kommt die Gunst der Zeitgenossen entgegen, seit im letzten Jahrzehnt unter dem Einfluss des Darwinismus die Urgeschichte unseres Geschlechtes gradezu in den Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses gerückt ist. Während aber die vergleichende Ethnologie die Mythologie bisher nur als Teil des geistigen Gesammtlebens in Betracht zog, widmet ihr Schwarte die ganze Breite seiner Forschung; auch knüpft er seine Erörterungen doch vorzugsweise an deutsche und griechische Mythen an. Leider muß man beklagen, daß er in seinen späteren Schriften auf dem in seinem bahnbrechenden Programm betretenen Wege nicht mit Besonnenheit fortgeschritten ist, sondern sich in eine größtenteils selbsterschaffene wirre Phantasiewelt verstrickt hat.
Indem er nämlich die Abstraktionen aus dem einen Mythenkreise, den er zuerst im Ganzen richtig beobachtet hatte, allzuhastig verallgemeinerte, gelangte er zu folgender Grundanschauung.
„Es zeigte sich als Ausgang und Mittelpunkt der ganzen Mythologie ein in den mannigfachsten Kreisen und Zeiten entstandenes Chaos gläubiger Vorstellungen von den in den wunderbaren Erscheinungen des Himmels und namentlich des Gewitters sich bekundenden Wesen und Dingen als einer zauberhaften Welt, die nur mit ihren Symptomen in diese Erdenwelt hineinzureichen schien, die aber das Volk oder vielmehr die Menschen sich nach Analogie der letzteren gläubig zurechtlegten, und deren Veränderungen ihnen also zu einer den irdischen Verhältnissen analogen Geschichte wurden."
x Den Beweis für seine Theorie lieferte ihm eine Methode, von deren Verhältniß zu den Anforderungen historischer Kritik dasselbe gilt, wie von derjenigen Kuhns. Ja es steht damit noch bedenklicher? insofern die verglichenen antiken Mythen zumeist aus ganz abgeleiteten Darstellungen, dem mythol. Lexicon u. s. w. entnommen werden. Doch ist andererseits ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Verfahren der beiden Gelehrten bemerkbar. Schwartz stellt nicht je zwei Sagen in ihrer Totalität einander gegenüber, wobei dann der Harmonistik zu Liebe ein Teil der einen sich häufig gewaltsame Verrenkungen gefallen lassen muß, sondern er geht überall auf die Urele- mente. Diese gewinnt er aber nicht durch historische Analyse, sondern indem er irgendeinen einzelnen auffallenden Zug, einen losen Faden aus dem zusammenhangenden Gewebe der Sage herauszieht und nun leichten Spieles mit einem ähnlich aussehenden Naturbilde combiniert. Zwar hat er das Verdienst, dabei viele volkstümliche Naturanschauungen und ihre Uebereinstimmung mit Metaphern der Dichter wirklich nachgewiesen zu haben; sehr viele der von ihm zum Ausgangspunkte der Mythen gemachten Naturauffassungen haben aber entweder nur in der äußerst fruchtbaren Einbildungskraft des Autors oder in der Subjectivität vereinzelter Poeten ein Dasein; und ebenso unberücksichtigt bleibt, daß nicht jede bildliche Apperception von Naturerscheinungen an sich Mythos ist oder überall zum Mythus sich weiterbildet und deshalb ihr Vorhandensein noch keinesweges von vorneherein die Vermutung begünstigt, sie in den Sagen wiederzufinden. (19)
Das deutsche Volk kennt die nämliche poetische Metapher (unten S. 203); in nordischen Volksrätseln nähert sich dieses Naturbild mythischem Character (Mannhardt German. Myth. 7., Götterwelt S. 89) in einem Sonnenliede (Germ. Myth. 7., vgl. dazu S. 386 ff.) ist es völlig zu mythischer Anschauung geworden, mit welcher vielleicht einzelne abergläubische Vorstellungen zusammenhangen mögen. Aber auch die Araber haben dieselbe Naturanschauung produziert.
Ich kann diese meine Bedenken gegen Schwartz nnd seine Nachfolger, deren besonnenster Äfanasieff sein dürfte, hier ebenfalls nur andeuten (Ygl. unten S. 101. 157. 292); ich werde auch sie im Gegensatze zu meiner eigenen Auffassung künftig an belehrenden Beispielen darzulegen Gelegenheit haben.
Durch die großartigen Entdeckungen auf die Gebiete der orientalischen, besonders der ägyptischen und assyrischen Altertumskunde und die Funde der prähistorischen Archäologie nicht weniger, als durch die vergleichende Sprachwissenschaft, hat die griechische Kulturgeschichte aufgehört mit Homer zu beginnen; sie ist zu einem in der Mitte liegenden Zwischengliede einer schon Jahrtausende früher anhebenden, immer mehr aus dem Dunkel hervortretenden Entwickelungsreihe geworden. Man beginnt der allmählichen Aufeinanderfolge des Einströmens mannigfaltiger Kulturerwerbungen vom früher zum Aufschwung gelangten nichtindogermanischen Asien her in die europäische Welt bis in deren vorhistorische Perioden nachzuspüren (V. Hehn); seit J. Olshausen zuerst zahlreiche phoenikische Wortstämme in griechischen Ortsnamen nachwies, macht sich bei einem Teil der Historiker (E. Curtius, C. Wachsmuth u. a.) das Streben geltend, das Vorhandensein und den Einfluß eines starken semitischen Elements unter der vorhomerischen Bevölkerung Griechenlands darzutun. Allen diesen in den Anfängen begriffenen neuen Erkenntnissen gegenüber muß die von einem Teil der klassischen Philologen festgehaltene Behauptung einer rein autochthonen hellenischen Entwicklung als einseitig zurückgewiesen werden. Dennoch verteidigen auch die Vertreter diese Richtung! Und sie findet sich mehrfach in deren ältester vorislamischer Poesie. Im 4. Jahrhundert, d. Hedschra stellte sodann Abu Bekr Ibn Duräid Ausdrücke über Wolke und Regen zusammen, die er größtenteils aus dem Munde improvisierender Wüstenbeduinen aufgezeichnet hatte. Da finden sich ganz dieselben Naturbilder, wie in den Veclen. Die Wolken sind Kameelherden, die einzelne Wolke heißt Wall oder Berg; oder sie wird als Kameel gefaßt, welches der Wind treibt und befruchtet, als gefülltes Euter, aus welchem die Regenmilch niederströmt, als Schlauch, aus dessen Ritzen Wasser sickert. (Will. Wright Opusc. arab. collect, a. edit. front Mss. in the University of Leyden. — Götting. gel. Anz. 1860, p. 694.) Aber alle diese Bilder sind hier rein poetisch, von einer Fortbildung zum Mythus ist nichts bekannt.
Vorwort Wahrheiten.
Und auf dem Gebiete der seit Preller nur in Hartungs verkehrter Religion der Griechen umfassend behandelten
antiken Mythologie, haben grade K. Lehrs und seine Schule in Einzelarbeiten sehr wertvolle Beiträge geliefert. Sie machen mit Recht geltend, daß man die griechische und römische Götterwelt zunächst vom Boden des hellenischen und römischen Volkstums aus begreifen lernen soll; sie haben uns die Empfindung nachfühlen lassen, welche die Alten in historischer Zeit mit ihren Göttern verbanden ; ein Verständniß von den mannigfachen Ursprüngen und den Lebensgesetzen der mythischen Bilderwelt besitzen sie nicht. Eine besondere Beachtung verdienen E. Plews Untersuchungen, weil sie (in Bezug auf die späteren Geschicke des lomythus und mehrere Kulte der in jüngerer Zeit entlehnten fremdländischen Gottheiten glücklich) mit einer historischen Betrachtung entschiedensten Ernst machen. Gleich sehr um seiner Methode willen hervorzuheben ist A. Eapps Aufsatz über die Mänade (Rhein. Mus. n. F. XXVII, 1872). Ganz neuerdings hat E. Curtius (Preuß. Jahrb. XXXVI, 1875, 1 ff.) die Frage aufgeworfen, ob nicht sämmtliche hellenische Göttinnen aus einer Differenzierung der durch Entlehnung angeeigneten großen semitisch -phrygischen Naturgöttin Vorderasiens hervorgegangen seien. Die Frage als solche ist berechtigt neben der nach dem indoeuropäischen oder ethnisch - griechischen Ursprung, da die Vielseitigkeit der meisten Göttinnen in der Tat an Pantheismus erinnert. Bewiesen ist aber noch nichts und die schließliche Lösung des Problems dürfte schwerlich so allgemein im Sinne des Fragestellers ausfallen. So sehen wir denn in den letzten Jahrzehnten von den verschiedensten Seiten her neue Wege eröffnet, um in das Verständniß der Mythologie einzudringen; aber alle diese Arbeiten stehen erst im Beginne, und ihrer manche haben sich, von der graden Richtung abgelenkt, in der Wildniß verlaufen. Wenn es jedoch für seinen freien Fortschritt ein unabweisliches Bedürfniß des menschlichen Geistes ist, die psychischen Petrefacten der Vergangenheit wieder lebendig zu machen, wenn die Wissenschaft unserer Tage sich als eines der letzten und höchsten Ziele ihres Ringens einen Stammbaum der gesammten Ideenwelt stellt, wenn endlich die verschiedensten Einzelwissenschaften an einem streng wissenschaftlichen Aufbau der Mythologie ein Interesse haben, dann darf das begonnene Werk nicht liegen bleiben. Indem der Verfasser dieses Buches sein Augenmerk darauf richtete, von allen angedeuteten Eichtungen zu lernen, das Wahre aus ihnen aufzunehmen, die Fehler auszusondern, bildete er sich seinen eigenen Standpunkt. Selbstverständlich nimmt er keine Unfehlbarkeit für sich in Anspruch, nur das Zeugniß gewissenhaften Strebens und eines deutlichen t Bewußtseins der zu verfolgenden Ziele und anzuwendenden Mittel. Und niemals wird er verleugnen, daß er von Männern wieWelcker, Preller, Lehrs, Bötticher, Kuhn, Schwartz, Tylor und andern lernte und sich ihnen oft zu Danke verpflichtet weiß, selbst da, wo er zu andern Ergebnissen gelangte, als sie. Der Befreiungsprozeß von den herrschenden Eichtungen vollzog sich in mir naturgemäß sehr allmählich, ein schärferes Auge wird seine Symptome bereits in meinen Jugendarbeiten 1 erkennen. Meine jetzigen Ansichten und Absichten lassen sich etwa in folgende Sätze zusammenfassen. Noch immer bleibt der wissenschaftliche Aufbau einer deutschen bzw. germanischen Mythologie der Mittelpunkt, auf welchen alle meine Bestrebungen hinzielen;
aber ich erkenne, daß es noch für lange nicht an der Zeit sein wird, den Bau im Ganzen auszuführen. Die Mythologie eines Volkes umfaßt mir alle in seinem Geiste unter den Einflüssen mythischer Denkform zu Stande gekommenen Verbildlichungen höherer Ideen, mögen die letzteren von ihm selbst erzeugt oder von außen her aufgenommen sein, sowie -die Geschichte dieser Geistesproducte und ihrer Veränderungen durch Verschiebung oder Umdeutung des ursprünglichen Sinnes, durch Zutaten, durch Verschmelzung und Mischung mit anderen rein mythischen oder geschichtlichen Traditionen, endlich durch dichterische oder künstlerische Behandlung, nachdem sie aufgehört haben im Bewußtsein ihrer Träger Wirklichkeit zu beanspruchen. Diese Betrachtung berührt Vieles, was weder Philosophie noch Religion ist (wenn auch noch so eine primitive). Sie fällt daher nicht zusammen, ist aber verschwistert mit einer anderen Betrachtung, welche den Gehalt und die Umwandlungen der mythisch ausgedrückten Ideen unter dem Gesichtspunkt der Entstehung und fortschreitenden Entwicklung des philosophischen und religiösen Gedankens zu prüfen hat. Diesen Grundsätzen gemäß stelle ich den Begriff der deutschen Mythologie anders, als J. Grimm tat. Nicht allein die Gestalten und Phantasiegebilde, unter welchen unsere Voreltern während der verschiedenen Epochen ihres Lebens vor Einführung des Christentums die Götter- und Geisterwelt zu erfassen suchten, rechne ich dahin, sondern auch diejenigen Personificationen und vermeintlichen Aeußerungen übersinnlicher Mächte, welche sie später vermöge der Fortdauer des mythenbildenden Triebes aus sich selbst oder durch Versinnlichung derIdeen des Christentums oder aus anderen Anregungen neu erschufen. Bei dieser Auffassung gewinnen dann auch Perchta, der bergentrückte Kaiser, der Teufel des Volksglaubens und Aehnliches wieder eine berechtigte Stelle in der deutschen Mythologie; fern aber bleiben die schon fertig übernommenen und unverändert fortgetragenen Verbildlichungen, mit denen die christliche Kirchenlehre ihre hohen Wahrheiten der menschlichen Anschauung nahebringt. Innerhalb des beschriebenen Kreises muß angestrebt werden, verschiedene Perioden (ältere und spätere Mythologie des Heidentums, Volksmythologie des Mittelalters u. s. w.) zu trennen und je mit dem ihnen eigentümlichen Inhalte zu erfüllen; es muß zwischen den Anschauungen (Sage, Brauch, Kultus) des gesammten Volkes und einzelner Teile desselben (Stämme, Stände, Familien u. s. w.) unterschieden werden. Quelle ist überall, wo es sich nicht um die späteren Schicksale der Mythen in Kunst und Literatur handelt, der lebendige Volksglaube. Ihn in seiner echten Form zu ermitteln und in seinen Entwickelungsphasen bis auf die ursprüngliche, die Grundidee am reinsten ausdrückende, Fassung zu verfolgen, ist eine der ersten Aufgaben, mag die Ueberlieferung unmittelbar aus dem Volksmundeoder aus dem Schrifttum entnommen sein. Hierbei wird jedoch ein Unterschied zu beobachten sein. Ueberall, wo eine Tradition (Sage, Brauch, Glaube) uns auf literarischem Wege überliefert wird, oder wo sie in den Strom geschichtlichen Lebens hineingerissen von diesem eine Zeitlang weitergetragen war, so daß sie innerhalb eines erkennbaren historischen Zusammenhangs steht, hat der Forscher vorab alle diejenigen durch Jahrhunderte lange Erfahrung ausgebildeten kritischen Handhaben zu ihrem Verständniß anzuwenden, deren sich die Philologie und Geschichtswissenschaft zur Lösung ihrer Aufgaben bedienen/ nur mit gebührender Berücksichtigung der eigentümlichen Beschaffenheit des zu bearbeitenden Stoffes. Jede Ueberiieferung ist zuerst aus sich selbst und aus ihrem nächsten Umkreise zu erklären; erst, wenn hier die Rechnung nicht aufgeht, darf schrittweise weiter und tiefer rückwärts gegriffen werden. Die Chronologie der Zeugnisse ist in erster Linie zu befragen; der Mythenforscher wird jedoch nicht vergessen, dass unter Umständen eine junge Aufzeichnung die ältere und echtere Form der Ueberiieferung zu Tage fördert. Wo unmittelbare Volkstradition vorliegt, ist nach inneren Gründen, auf dem Wege der Analyse und mit Hilfe von Analogien, die nach Wert und Inhalt scharf geprüft sind (1), ebenfalls nach Möglichkeit eine chronologische Fixierung und die Herstellung der Urgestalt zu erstreben. Sind jedoch solche Traditionen in geschichtslosen (2) Volksschichten nicht um auch nur im entferntesten eine Anschauung der vielen hiebei in Betracht kommenden Verrichtungen niederer und höherer Art weiter zu gewähren, (von der Textberichtigung und quellengeschichtlichen Untersuchung bis zu der durch innere Kritik erreichbaren Zerlegung des Objects in seine genetischen Elemente) sondern nur um von der Anwendung des Prinzips auf die in Rede stehenden Gegenstände überhaupt einen Begriff zu geben, deute ich Einiges an. Man vgl. den Nachweis über die verschiedenen Wandlungen der epischen Sage von Rauch - Else bis auf die Volkssage vom wilden Weibe zurück. (Bk. 108 ff.) Dem entsprechend ist die Darlegung der verschiedenen Entwickelungstadien der Sage vou Peleus und Thetis (unten S. 77). — Einen gediegenen Versuch kritischer Untersuchung der verschiedenen Aufzeichnungen einer Volkssage macht Otto Müller in seinem Programmaufsatz „die Krügerin von Eichmedien." Bartenstein 1875; doch der Schluß verläßt die eingeschlagene Bahn (leider), und gelangt daher zu unbefriedigenden Ergebnissen. (Vgl. unten S. 96.) Ein Muster der methodischen Bearbeitung eines Volksbrauches, der in einer von höherem geschichtlichen Leben (1) bewegten Volksschicht weitergebildet wurde, bietet „E. Pabst, die Volksfeste der Maigrafen. Berlin 1865." (Vgl. meine Weiterführung der Untersuchung Bk. S. 376 ff.) Dazu stellt sich gleichwertig K. Müllenhoffs monographische Behandlung des Schwerttanzes (Gaben für Homeyer. Berlin 1871.)
(1) Dies Wort werde „cum grano salis“ (mit Einschränkung, nicht ganz wörtlich zu nehmen) verstanden. Unter den Kulturvölkern haben freilich auch die rückständigen Volksschichten zum Kult als solches beigetragen, so sind wir meistenteils berechtigt, sie wie Naturobjecte zu behandeln, und nach vorgängiger" Prüfung ihrer Echtheit derjenigen Untersuchungsmethode zu unterwerfen, welche die Naturforschung für ihre Gegenstände anwendet. Wie in einem Gebirge sich die organischen Reste verschiedener Erdungsperioden über einander ablagern, bewahrt das Gedächtniß des Volkes unbewußt Ablagerungen der verschiedenen Kulturepochen, die dasselbe jemals durchgemacht hat, mit vielen fremden Einschlüssen; aber die Lage der Schichten hat sich vielfach verschoben und durchkreuzt, der Inhalt jedes einzelnen hat sich durch Verwitterung, Vermischung oder rein äußerliche Verbindung mit den Produkten anderer umgestaltet. (20) Damit aus den Versteinerungen die Geschichte der Vorwelt wiederhergestellt werden könne, mußte der Tätigkeit der Geologen und Paläontologen die elementare Arbeit descriptiven der Mineralogie, Zoologie und Botanik vorausgehen, weiche die Fülle der individuellen Erscheinungen nach Gattungen, Arten und Unterarten sonderte und die gemeinsamen Merkmale jedes derselben umgrenzte.
Sodann machte der Geologe seine Längen-, Queer- und Höhendurchschnitte und verzeichnete das Verhältniß der einzelnen Lagehistorischen Leben der Nation ihren Anteil, aber einen weit geringeren, als die höheren Klassen; und nicht alle Ideen und Lebensgebieto ihrer Angehörigen unterliegen in gleichem Maße den umbildenden Einfluss neuer Kulturströmungen. Wie wir in unseren Hansastädten vielfach alte Häuser antreffen, deren Fasade modern ist, oder dem Rockockostyl angehört, während in ihrem entlegenen Hinterhause noch die verblichene Pracht der Renaissancezeit erhalten ist, in der Seitenwand am Hintergäßchon und unter Dächern und Treppen gar noch unberührt die Gothik träumt, giobt es namentlich bei dem in einfacher, gleichmäßiger Arbeit dahin lebenden Landvolk noch einzelne Lebensgebiete, Winkel und Ecken der Yorstellungswelt , an denen eine mehrtausendjährige Geschichte fast ganz spurlos vorüberschritt. Ein solches Gebiet ist beispielshalber dasjenige der Erntegebräuche. Andere in den niederen Ständen haftende Vorstellungskreise repräsentieren ebenfalls längstvergangen, aber jüngere Kulturstufen, und im Großen und Ganzen darf man urteilen, daß der Wellenschlag der geschichtlichen Strömungen ihren Ideenvorrat nur langsam und selten bewegte.