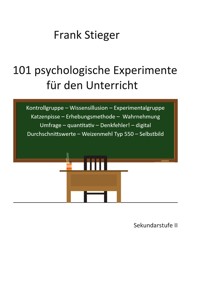
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
101 Psychologische Experimente für den Unterricht Die psychologische Forschung hat es sich in den letzten Jahren zur Aufgabe gemacht die Tücken unseres Denkens, Erinnerns und Wahrnehmens zu ergründen. Vernachlässigt wurde dabei, dass diese Experimente im Unterricht nachgestellt werden können. Denn: Durch psychologische Experimente wird auf unterhaltsame Weise erfahrungsbasiertes Lernen ermöglicht, indem die Lernenden mit psychologischen Phänomenen konfrontiert werden, die auch in ihrem (Berufs-) Alltag eine Rolle spielen. In diesem Buch werden ... ... psychologische Experimente mit Auswertungsvorlagen, Vorbereitungs- und Handlungsschritten vorgestellt. ... die psychologischen Phänomene und Mechanismen, die sich dahinter verbergen thematisiert. ... Tools (z.B. Mentimeter, Wooclap, Edkimo) als digitale Erhebungsmethoden eingebunden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bisher wurde in Schulen das Wissen aus psychologischen Experimenten nur zitiert. Jetzt geht es darum, es zu erleben.
Inhalt
A. Einleitung
B. Anwendungshinweise
B.1 Grundschema
B.2 Digitale Notwendigkeit
B.3 Erhebungsmethoden
B 3.1 Erhebungsmethode 1: Experimental- und Kontrollgruppe
B 3.2 Erhebungsmethode 2: Messung von Durchschnittswerten
B.3.3 Erhebungsmethode 3: Likert-Skala
B 3.4 Erhebungsmethode 4: Multiple-Choice-Umfrage
B 3.5 Erhebungsmethode 5: Single-Choice- Umfrage
B 3.6 Erhebungsmethode 6: Schätzwerte
B 3.7 Erhebungsmethode 7: Kategorisieren
B 3.8 Erhebungsmethode 8: Analoge Auswertung
B 4 Weitere Informationen
B 4.1 Kreative Aufgaben
B 4.2 Quantitative Aufgaben
B 4.3 Textfelder
C. Noch ein paar Regeln
1. Selbstbild
Nr. 1 Bestätigungstendenz
Nr. 2 Komplimente machen
Nr. 3 Lebensbilanz
Nr. 4 Egozentrische Verzerrungen
Nr. 5 Negatives Verhalten
Nr. 6 Ich bin überdurchschnittlich
Nr. 7 „Schmeichel mir“
Nr. 8 Jetzt-ist-für-immer-Trugschluss
Nr. 9 Das bedeutende Experiment
Nr. 10 Persönlichkeitsprofile
2 Diskriminierung
Nr. 11 Attraktivität
Nr. 12 Religion
Nr. 13 Hautfarbe
Nr. 14 Namen I
Nr. 15 Namen II
Nr. 16 Wortwahl
3 Wahrnehmung
Nr. 17 Select Attention Test
Nr. 18 Erster Eindruck
Nr. 19 Mann mit Hund
Nr. 20 McGurk-Effekt
Nr. 21 Der Geschmack von Süßigkeiten
Nr. 22 soziale Akzentuierung
Nr. 23 Wahrnehmung von Buchstaben
Nr. 24 Alkohol & Blumen (Priming I)
Nr. 25 Eine kurze Geschichte (Priming II)
Nr. 26 Bottum-up-Prozess
Nr. 27 Fake News
Nr. 28 Zeitwahrnehmung
Nr. 29 Besitztumseffekt
Nr. 30 Attributionsfehler
Nr. 31 Habituierung / Sensitivierung
Nr. 32 Erwartungshaltung
4. Emotionen
Nr. 33 Lügen erkennen (Vergleichsfragentest)
Nr. 34 Facial-Feedback-Hypothese
Nr. 35 Physikalische und emotionale Wärme
Nr. 36 Gereimte Wahrheiten
Nr. 37 „… und wie geht es dir?“
Nr. 38 Spiegelneuronen
Nr. 39 relative Deprivation
Nr. 40 Der Zustand der Welt
Nr. 41 Prähistorische Emotionen
Nr. 42 Eifersucht
5 Denken
Nr. 43 Logisches Denken
Nr. 44 Hauptstädte
Nr. 45 Aberglaube I
Nr. 46 Aberglaube II
Nr. 47 Aberglaube III
Nr. 48 Verlustaversion I
Nr. 49 Verlustaversion II
Nr. 50 Kategorisieren
Nr. 51 Köder-Effekt
Nr. 52 Basisratenfehler
Nr. 53 Suggestion
Nr. 54 Denke nicht an einen weißen Bären
Nr. 55 Denke an einen weißen Bären
Nr. 56 Ankereffekt I
Nr. 57 Ankereffekt II
Nr. 58 Ankereffekt III
Nr. 59 Verfügbare Informationen
Nr. 60 Paradoxon der Wahlmöglichkeiten
Nr. 61 Kontrollillusion
Nr. 62 False-Consensus-Bias
Nr. 63 Rückschau-Fehler
Nr. 64 Grußkarten ausdenken
Nr. 65 „Denke wie ein Kind“
Nr. 66 Mentale Buchführung
Nr. 67 Assoziative Kohärenz
Nr. 68 Wirkung von Hirnscans (Beeinflussung)
Nr. 69 Zahlenreihen
Nr. 70 Gefühl schlägt Logik
Nr. 71 Wissensillusion
Nr. 72 Zeugenaussagen
Nr. 73 Was du vergessen hast
Nr. 74 Der Effekt der bloßen Darbietung
Nr. 75 Die Fußball-Ergebnisse eines Spieltags
6 Lernen
Nr. 76 Merkfähigkeit
Nr. 77 IBAN merken (Segmentierung)
Nr. 78 Mustererkennung (Mnemotechnik)
Nr. 79 Merk dir Tiernamen
Nr. 80 Die LOCI-Methode
Nr. 81 Klare Ansagen
Nr. 82 „Ich kann mit Musik besser lernen“
7 Digitalisierung
Nr. 83 Das Smartphone und Du
Nr. 84 Das Problem der Anonymität
Nr. 85 Neugierigkeitseffekt
Nr. 86 Belästigung durch Smartphones
Nr. 87 Das griffbereite Smartphone
Nr. 88 Face-to-Face vs. Videokonferenz
Nr. 89 analog vs. digital
8 Gruppendynamik
Nr. 90 Die „Klausur“ im Klassenraum
Nr. 91 Holier-than-thou-Effekt
Nr. 92 Eine unsinnige Regel
Nr. 93 Wenn das Offensichtliche falsch ist
Nr. 94 „Stille Post“ für Anspruchsvolle
Nr. 95 Falsche Zeugen
Nr. 96 Die Tür-vors-Gesicht Technik
Nr. 97 Schätzungen (die Weisheit der Masse)
Nr. 98 „Du darfst jetzt nicht auf Toilette“
Nr. 99 Entscheidungen
Nr. 100 Mit fremden Menschen reden
Nr. 101 Eye Contact
Bibliographie:
A. Einleitung
Die psychologische Forschung hat es sich in den letzten Jahren zur Aufgabe gemacht, die Eigentümlichkeiten unseres Denkens, Wahrnehmens und sozialen Verhaltens zu ergründen. Vernachlässigt wurde dabei, dass diese Experimente im Unterricht nachgestellt werden können.
Durch das Nachstellen von psychologischen Experimenten können zwei didaktische Ansätze konsequent verfolgt werden: das erfahrungsbasierte und das forschende Lernen.
Abbildung: Experimente ermöglichen zwei wichtige Formen des Lernens zugleich.
Das Lernen durch Erfahrungen gilt als eine der effektivsten Lernmethoden und hat sich seit unserer Geburt als zuverlässiger Lernimpuls bewiesen. Mit psychologischen Experimenten werden in einem kontrollierten Rahmen Erfahrungen ermöglicht, die auf andere Situationen in unserem Alltags- und Berufsleben übertragen werden können.
Gemacht, um weitergedacht zu werden
Der zweite Aspekt setzt sich mit der Idee des forschenden Lernens auseinander. Alle Experimente wollen etwas beweisen. Um eine saubere Beweisführung antreten zu können, haben diese Experimente Szenarien, Tests, Fragen, Experimental- und Kontrollgruppen usw.
Auf diese Weise können nicht nur psychologische Erkenntnisse, sondern auch die Wege der Ermittlung und Überprüfung von Annahmen über die Psychologie des Menschen durch Erhebungsmethoden vermittelt werden. Dies kann Lernende dazu anregen, selbst aktiv zu werden und eigene Annahmen mit einer Methode zu überprüfen.
Es kommt anders, als du denkst
Es gab viele Momente, an denen ich dieses Buchprojekt massiv infrage gestellt habe. Der Grund: Die Experimente lieferten nicht das gewünschte Ergebnis. So saß ich des Öfteren vor meinen Klassen und fauchte ihnen ein „ihr seid doch nicht normal“ entgegen (was die allermeisten als Kompliment empfanden).
Experimente dürfen scheitern. Es geht um die psychologischen Phänomene und deren Mechanismen, die sich dahinter verbergen. Es geht um den Prozess, die Erfahrung, die Überprüfung des Ergebnisses und die Diskussion darüber.
Nicht zu unterschätzen ist dabei auch der Unterhaltungswert, den die allermeisten Experimente mitbringen. Lernende begegnen sich und der Lehrkraft experimentell. Es wird etwas ausprobiert und nach meinen Erfahrungen zeigen sich die Lernenden sehr offen für diesen Prozess.
Vom Wert der digitalen Tools
Das Arbeiten mit digitalen Tools ist bei vielen Experimenten ein wichtiger Baustein. Durch bestimmte Tools haben Lehrkräfte und Lernende die Möglichkeit, Situationen und Fragen zu erheben, deren Antworten in Echtzeit ausgewertet und gesichert werden können. Zur Erinnerung: Der Zustand vor der Digitalisierung war: langwierige Strichlisten. Diese fraßen unnötige Zeit und nahmen dem Unterricht die Spannung.
Damit der Umgang mit Tools auch gelingt, habe ich dazu ein eigenes Kapitel (B3) geschrieben.
B. Anwendungshinweise
B.1 Grundschema
Schritt A: Vorbereiten analog, auf der
Webseite oder in der App
Schritt B: Verfügbar machen, z.B. in ausgedruckter Form, über QR-Code, Link und Code
Schritt D: Visualisieren (und vertiefen)
Abbildung: Die einzelnen Schritte des 4V-Prinzips, die bei fast allen Experimenten elementar sind.
Ein paar Hinweise zur Nutzung dieses Buches:
Grundsätzlich laufen alle Experimente nach dem gleichen Schema ab. Dieses Schema habe ich das 4V-Prinzip genannt. Die 4 Vs stehen dabei für die eigentlichen Schritte, die zur Anwendung kommen (s.o.). Die Schritte A, B und D liegen in der Verantwortung der Lehrkraft. Um ständige Wiederholungen im Buch zu vermeiden, werden diese Schritte nicht immer wieder explizit erwähnt.
In der Anordnung stehen also nur jene Schritte, die vom 4V-Prinzip abweichen. Besonders die Vorbereitung, das Verfügbarmachen und die Visualisierung (und Vertiefung) werden somit nicht als einzelner Schritt aufgeführt. Sie werden als einzelne Schritte vorausgesetzt (s.u.)
Das Vorbereiten (der Lehrkraft) bezieht sich auf die Auswertungsvorlage. Dies ist Grundstein eines jeden Experiments und muss dementsprechend vorbereitet werden. Weitere Vorbereitungen (z.B. ein Arbeitsblatt) werden darüber hinaus im jeweiligen Experiment thematisiert.
Bei der Vorbereitung sollte zugleich auch immer mitgedacht werden, wie der Zugang zur Auswertungsvorlage gestaltet werden soll (verfügbar machen).
Weitere Hinweise
Jedes Experiment hat zu Beginn eine
kleine Tabelle
, die allgemeine und weiterführende Hinweise zu dem Experiment gibt (siehe →
B2
).
Die
Auswertungsvorlage
beinhaltet eine konkrete Aufforderung an die Lernenden und die dazugehörigen Antwortmöglichkeiten, die sich an der
Erhebungsmethode
orientieren.
Alles, was in der
Auswertungsvorlage
kursiv
steht, muss individuell angepasst werden.
Jedes Experiment besitzt eine
Versuchsanordnung
, die durch einzelne Schritte (A, B, C) gekennzeichnet ist. Darüber hinaus kann es noch
Vorbereitungsschritte
(mit einem → gekennzeichnet) und Aufgaben (im Kasten, Aufgabe 1, 2) geben. Aufgaben beinhalten konkrete
Arbeitsaufträge
, die sich immer direkt an den Lernenden richten.
Alle Bilder verstehen sich als Beispielbilder. Sie wurden den Webseiten
Pixabay
und
Pixels
entnommen (und teilweise bearbeitet).
B.2 Digitale Notwendigkeit
DN:
Digitale Notwendigkeit
(s.u.)
EM:
Erhebungsmethode
(siehe
Kap. B.2
)
Info:
weitere Informationen (optional)
Unter digitale Notwendigkeit gibt es eine Einschätzung, wie sinnvoll der Einsatz von digitalen Tools ist.
Wenn nicht mit digitalen Tools gearbeitet wird, ist es wichtig, dass die Lernenden die Auswertungsvorlage in Papierform vor sich haben und verbindliche Kreuze machen. Nur so kann verhindert werden, dass eine Entscheidung kurzfristig geändert und so das Ergebnis verfälscht werden kann.
Darüber hinaus sollte an dieser Stelle auch immer die individuelle digitale Situation der Schule beachtet werden.
Bei der Entscheidung für oder gegen die digitale Erhebung gilt folgende Daumenregel: Nur wenn der digitale Aufwand den tatsächlichen Nutzen (langfristig) unterbietet und ein reibungsloser Durchlauf realistisch ist, machen digitale Erhebungen Sinn.
B.3 Erhebungsmethoden
Mit Erhebungsmethode ist das „Muster“ gemeint, mit dem die Daten erfasst werden sollen. Die allermeisten Experimente haben eine Auswertungsvorlage. Wenn du diese digital oder analog überträgst, musst du das Prinzip der Erhebungsmethode verstanden haben, damit die Experimente auch nachvollziehbar durchgeführt werden können.
Insgesamt konnten alle Experimente auf acht unterschiedliche Erhebungsmethoden reduziert werden. Die folgenden Beschreibungen (außer Erhebungsmethode 8) fokussieren sich auf die digitale Umsetzung.
Insgesamt beziehe ich mich in diesem Kapitel immer wieder auf drei Anbieter (Edkimo, Wooclap und Mentimeter). Mit diesen drei Anbietern ist es grundsätzlich möglich, alle Experimente auch digital durchzuführen1. Darüber hinaus haben die Lernenden über einen (QR)-Code direkten Zugriff auf diesen Anbieter, ohne das weitere Vorbereitungen notwendig sind.
B 3.1 Erhebungsmethode 1: Experimental- und Kontrollgruppe
Schon gleich zu Beginn wird es kompliziert. Diese erste Erhebungsmethode ist noch keine abgeschlossene Methode an sich, denn schließlich braucht es noch einen weiteren Schritt, damit die Daten überhaupt erfasst werden können. Aus diesem Grund haben alle Experimente neben dieser Erhebungsmethode auch noch eine weitere Methode.
Auch ist das Erstellen von zwei Gruppen etwas kompliziert. Denn: Wenn du zwei Gruppen hast, kannst du ihnen nicht den gleichen Zugangscode geben, d.h. dass du zwei unterschiedliche Codes brauchst, was es wiederum bei der Visualisierung schwierig macht, da du nicht beide Ergebnisse gleichzeitig präsentieren kannst.2
Insgesamt hast du zwei Möglichkeiten, um diese Problematik souverän zu bewerkstelligen.
Erstens: Du erstellst zwei Umfragen mit jeweils zwei Zugängen. Der Nachteil dabei ist, dass du bei der Präsentation der Ergebnisse immer hin und her springen musst. Wenn du aber sowieso gleich mehrere Fragen hast, solltest du diese Variante nehmen.
Zweitens: Du machst einen Zugang für alle. Dabei machst du bei der Umfrage deutlich, was die Experimentalgruppe (oder auch einfach Gruppe A) und was die Kontrollgruppe (Gruppe B) ist. Dabei bietest du die Option „Keine Ahnung“ an. Alle, die nicht bei ihrer jeweiligen Gruppe sind, nehmen dann einfach die Option „Keine Ahnung“. Diese Option sollte nur in Klassen gewählt werden, die dieses Prinzip verstehen und gewissenhaft umsetzen können. Diese Option kann allerdings auch nur gewählt werden, wenn die Erhebungsmethoden 4 und 5 (s.u.) als zweite Erhebungsmethode zur Anwendung kommen.
B 3.2 Erhebungsmethode 2: Messung von Durchschnittswerten
Bei dieser Messung werden Häufigkeiten, persönliche Ausprägungen usw. angeben, wobei dann das Tool selbstständig die Durchschnittswerte errechnet.
Abbildung 3: Beispiel einer Auswertung von Durchschnittswerten mit Mentimeter (Experiment Nr. 4). Das Tool errechnet automatisch die Durchschnittswerte.
Die Zahlen werden in Skalen erfasst, d.h. sie haben eine Ober- und Untergrenze. Diese wird immer in Klammern hinter der Methode angegeben.
Die folgende Tabelle stellt drei kostenlose Anbieter vor, mit denen die Messung von Durchschnittswerten erfasst werden soll. Mit „Design“ ist jene Option gemeint, die bei dem jeweiligen Anbieter gewählt werden muss. Bei „Zahlenoptionen“ geht es um die Ober- und Untergrenze, die bei dem jeweiligen Anbieter gewählt werden kann.
Anbieter
Design
Zahlenoptionen
Edkimo
Noten und Zahlen
1-6; 1-5; 1-10; 0-10; 0-15
Wooclap
Rating
1 - (4-10)
Mentimeter
Scales
0-20
Am flexibelsten ist an dieser Stelle Mentimeter. Das Tool hat auch die Zahl „0“ im Programm, die bei der Erfassung bestimmter Zahlen unerlässlich ist. Auch bei der Frage nach der höchsten Zahl schneidet Mentimeter am besten ab.
B.3.3 Erhebungsmethode 3: Likert-Skala
Die Likert-Skala fragt nach bestimmten Einstellungen, indem sie eine Aussage tätigt und nach deren Grad der Zustimmung fragt. Edkimo ist dabei der einzige Anbieter, der die Likert-Skala in seinem Repertoire hat. Alternativ könnte man bei Edkimo auch noch die Smiley-Skala wählen, weil diese in ihrer Methodik gleich ist.
Rein theoretisch ist es auch möglich, diese Skala bei anderen Anbietern als Single-Choice-Frage (s. B3.5) selbst zu erstellen. Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass dann keine Mittelwerte ermittelt werden können, wie es auf Edkimo der Fall ist.
Abbildung 4: Beispiel einer 4er-Likert-Skala auf Edkimo. Unter Details ist es dann möglich, Mittelwerte zu erhalten (Experiment Nr. 10).
B 3.4 Erhebungsmethode 4: Multiple-Choice-Umfrage
Multiple-Choice-Fragen kommen immer dann zur Anwendung, wenn gleich mehrere Informationen erfragt werden.
Abbildung 5: Bei diesem Experiment (Nr. 79) werden anhand einer Multiple-Choice-Umfrage über Edkimo jene Wörter erfragt, die behalten wurden.
Anbieter, bei denen du kostenlos Multiple-Choice-Fragen erstellen und auswerten kannst, sind zahlreich. Berücksichtigt werden muss lediglich, dass sich hinter einer Multiple-Choice-Umfrage nicht in Wahrheit eine Single-Choice-Umfrage (s. B3.5) verbirgt, wie es bei zwei von unseren drei kostenlosen Anbietern (Wooclap und Mentimeter) der Fall ist. I.d.F. muss zusätzlich noch ein Reiter aktiviert werden.
Anbieter
Option
Sonstiges
Edkimo
Multiple- / Single-Choice
Anzahl der Optionen kann frei bestimmt werden.
Wooclap
Umfrage
Es muss der Reiter „mehrere Antworten“ aktiviert werden.
Mentimeter
Multiple-Choice
Unter „Extras“ muss der Reiter „Let participants choose multiple options“ gewählt werden.
B 3.5 Erhebungsmethode 5: Single-Choice-Umfrage
Bei der Single-Choice-Umfrage steht den Lernenden nur eine Option zur Verfügung. Bei unseren drei Anbietern ist die Single-Choice-Umfrage die Standard-Einstellung.
Anbieter
Option
Sonstiges
Edkimo
Multiple- / Single-Choice
Anzahl der Optionen kann begrenzt werden
Wooclap
Umfrage
Die Option „Multiple Choice“ beinhaltet automatisch die Methode „Single Choice“
Mentimeter
Multiple- Choice
Die Option „Multiple Choice“ beinhaltet automatisch die Methode „Single Choice“
Singe-Choice-Fragen kommen immer dann zur Anwendung, wenn die Lernenden sich für eine Idee, Haltung usw. entscheiden sollen.
Abbildung 6: Bei diesem Experiment (Nr. 74) wird anhand einer Single-Choice-Umfrage über Edkimo eine Wahl abgehalten.
B 3.6 Erhebungsmethode 6: Schätzwerte
Schätzwerte dienen dazu, individuelle Beurteilungen vorzunehmen. Zur Erfassung von Zahlen kann jene Strategie angewendet werden, die auch schon bei der Erhebungsmethode 2 zum Einsatz gekommen ist.
Passgenauer ist hier der Anbieter Wooclap (Option „eine Zahl erraten“). Diese Anwendung hat den Vorteil, dass hier auch die Abweichungen erfasst werden können.
Abbildung 7: Bei diesem Experiment (Nr. 62) soll eine Zahl geschätzt werden. Der Anbieter Wooclap errechnet dabei automatisch den Durchschnitt, die Abweichung usw.
B 3.7 Erhebungsmethode 7: Kategorisieren
Ähnlich wie bei der Experimental- und Vergleichsgruppe werden auch bei dieser Erhebungsmethode die Lernenden in zwei Gruppen unterteilt. Bei dieser Methode wählen die Lernenden jedoch ihre Gruppe (je nach Antwort) selbst. Dort bekommen die Lernenden wiederum eine Aufforderung, die identisch mit der der anderen Gruppe ist.
Ein Tool, das variablenspezifisch diese Daten erfasst, ist mir nicht bekannt. An dieser Stelle empfiehlt sich die Umfrage durch Handheben.
Haltung
dafür (13)
dagegen (6)
Textwahl
Pro- Text
Contra- Text
Pro- Text
Contra-Text
Anzahl
12
1
2
4
Abbildung 8: In diesem Beispiel (Experiment Nr. 1) bestimmen die Lernenden selbst, zu welcher Kategorie sie gehören (Haltung „dafür“ oder „dagegen“). Innerhalb dieser Kategorie geben die Lernenden i.d.F. dann Auskunft über den Text, den sie gewählt haben.
B 3.8 Erhebungsmethode 8: Analoge Auswertung
Es gibt zwei Gründe, die den Verzicht auf digitale Hilfsmittel nahelegen: wenn die digitale Notwendigkeit niedrig ist (s. B2) oder wenn eine quantitative Auswertung überhaupt nicht notwendig ist.
Bei den meisten Experimenten geht es darum, dass eine logische Beweisführung angestrebt werden soll. Doch darum geht es nicht immer. Manchmal soll auch einfach nur etwas demonstriert werden oder es steht die Erfahrung während des Experiments im Vordergrund. In diesen Fällen sind die digitalen Erhebungsmethoden überflüssig und es kann gänzlich ohne Digitalisierung experimentiert werden.
B 4 Weitere Informationen
B 4.1 Kreative Aufgaben
Bei einigen Experimenten müssen kreative Ideen generiert werden. Im besten Fall hast du eine eigene Idee, die thematisch passt. In diesem Fall ist das Experiment eine Erweiterung deines Themas, das weiterhin im Vordergrund bleibt.
Andererseits kannst du aber auch das Experiment selbst in den Vordergrund stellen. In diesem Fall brauchst du einen Input, der einen kreativen Prozess auslösen soll.
Für diesen Fall werden dir hier ein paar kreative Fragestellungen angeboten:
Erstelle einen Satz mit den Wörtern „Baum“ und „Auto“ (diese Wörter sind frei austauschbar).
Erfinde eine neue Berufsbezeichnung. Es sollte in der Bezeichnung ersichtlich sein, was diese Person tut.
Nenne kreative Verwendungsmöglichkeiten von CDs (werden eh kaum noch gebraucht) oder von Kleidung, die nicht mehr gebraucht wird.
Assoziationen zu einem Drudel (lassen sich schnell über Suchmaschinen finden).
Grußkarten ausdenken (siehe Experiment
Nr. 64
)
B 4.2 Quantitative Aufgaben
Bei einigen Experimenten müssen quantitative Aufgaben generiert werden. Im besten Fall können Aufgaben verwendet werden, die sowieso Bestandteil des Unterrichtes sind.
Darüber hinaus gibt es hier noch weitere Ideen für quantitative Aufgaben:
(kleine) Aufgaben
Fachbegriffe (Vokabeln) übersetzen
Anagramme
Sudokus
Kreuzworträtsel
B 4.3 Textfelder
Textfelder ermöglichen ein schnelles Tafelbild mitsamt den gesammelten Ideen von Lernenden, die im Zuge des Experiments entstanden sind. Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über passende Möglichkeiten an.
Anbieter
Option
Sonstiges
Edkimo
Offene Frage (Freitext)
Wooclap
Offene Frage Brainstorming
Beim Brainstorming können die Lernenden die Antworten gleich „liken“. D.h. es findet gleichzeitig ein Abstimmungsprozess
statt.
Mentimeter
Open Ended





























