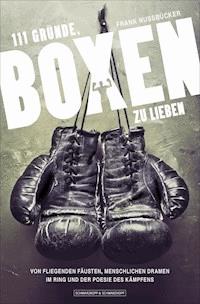
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Bei keinem anderen Sport scheiden sich derart die Geister wie beim Boxen. Höchste Kunst, Verdichtung des menschlichen Überlebenskampfs sagen die einen, brutale Prügelei und mieses Geschäft die anderen. Für einige wenige ist Boxen die Fahrkarte aus Armut und Erniedrigung zu Ruhm und Reichtum, für andere ein Trip ganz ohne Drogen, für viele eine ganz normale Arbeit. Zahllose Künstler aller Couleur erliegen seit jeher dem magischen Reiz des grell erleuchteten Rings, in dem zwei Menschen einander alles abverlangen, was ihre Körper, Herzen und Seelen in die Waagschale zu werfen haben. Kaum etwas erzählt mehr über den Zustand einer Gesellschaft als die Berichterstattung aus dem Boxring. Boxen ist, erfuhr der Autor am eigenen Leib, die intensivste Unterhaltung, die zwei Menschen miteinander führen können. EINIGE GRÜNDEWeil mich mein erster Kampf lehrte, mit meiner Angst umzugehen. Weil Ali bei der Musterung neben mir stand. Weil mir das Boxen in Liebesdingen half. Weil meine Tochter plötzlich kein Problem mehr damit hatte, dass ihr Vater k. o. ging. Weil wenige Sekunden eines Kampfes einen ganzen Roman erzählen können. Weil niemand so ehrlich ist wie ein Boxer direkt nach dem Kampf. Weil auch KZ-Häftling Nr. 9841 nicht vergessen ist. Weil 'Mi Vida Loca' der poetischste und schmerzvollste aller Kampfnamen ist. Weil fliegende Fäuste manchmal für Frieden sorgen. Weil Ali auf die Zuschauer hörte statt auf seine Ecke. Weil das größte menschliche Drama in einem Boxring ausgetragen wurde. Weil der hochkarätigste Schwergewichtskampf aller Zeiten nie stattfand. Weil der Wessi dem Ossi aufs Maul haut und umgekehrt. Weil Boxen die Seele gesund machen kann. Weil westdeutsche Olympiabuch-Schreiber sich vergeblich mühten, einen kubanischen Superstar zum US-Amerikaner zu machen. Weil Bertolt Brecht einen ordentlichen Punch in den Fingern hatte. Weil Charles Bukowski der literarische Vater des Promiboxens ist. Weil Hank Chinasky niemals Promiboxer war. Weil der tiefgründigste Text übers Boxen von einer Frau verfasst wurde. Weil das Boxen aus vermeintlichen Opfern Helden macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Frank Nussbücker
111 GRÜNDE, BOXEN ZU LIEBEN
Von fliegenden Fäusten, menschlichen Dramen im Ring und der Poesie des Kampfes
•WEIL ICH DIR IN DIESEM BUCH ’NEN SCHLAG ERZÄHLEN DARF 13
•Weil mit Ali und Onkel Rolf alles anfing 18
•Weil ich beim Boxen zum ersten Mal gern die Turnhalle betrat 22
•Weil mich mein erster Kampf lehrte, mit meiner Angst zu leben 26
•Weil mir das Boxen in der Schule jedwede Langeweile vertrieb 30
•Weil ich doch noch zu Ali fand 36
•Weil ich bei der Musterung neben Ali stand 40
•Weil mir das Boxen ein guter Freund wurde 44
•Weil mir das Boxen in Liebesdingen half 48
•Weil ein gebrochener Kiefer meine Liebe für kurze Zeit zum Boxfan machte 50
•Weil meine Tochter plötzlich kein Problem mehr damit hatte, dass ihr Vater k. o. ging 55
•Weil »Der Schönste« der Schnellste war 59
•Weil sich »Der Größte« im Ring häuslich niederließ 64
•Weil er wusste, wann der Tanz zu Ende ist 68
•Weil sich Ali nicht »hinrichten« ließ 72
•Weil er auf die Zuschauer hörte, statt auf seine Ecke 74
•Weil der beste PR-Mann ein Boxer war 78
•Weil alle Welt in einen philippinischen Hexenkessel schaute 83
•Weil sich zwei große Champs den vielleicht für alle Zeiten besten und härtesten Boxkampf lieferten 87
•Weil das größte menschliche Drama in einem Boxring ausgetragen wurde 91
•Weil der hochkarätigste Schwergewichtskampf aller Zeiten nie stattfand 93
•Weil Boxsportreportage in den 1930ern freundlich ging 98
•Weil Boxberichterstattung sehr entlarvend sein kann 102
•Weil deutsche Boxer in der BRD wieder normale Sportler sein durften 106
•Weil aus den siegreichen Kriegern von einst verwöhnte Wohlstandsbürger wurden 108
•Weil westdeutsche Sportjournalisten sich vergeblich mühten, einen kubanischen Superstar zum US-Amerikaner zu machen 111
•Weil nur die Politik den Größten der Amateure stoppen konnte 114
•Weil mein Freund Michel seinen Kampfsport fand 118
•Weil er seine Freundin zur Welt- und Europameisterin machte 122
•Weil Klasse auch Probleme mit sich bringt 126
•Weil auch Lehrgeld dazugehört 128
•Weil Michel sich nicht kaufen und seine Leute nicht hängen lässt 135
•Weil Manuel zweimal hintereinander einen zukünftigen Weltmeister besiegte 140
•Weil auch echte Schauspielkunst dazugehört 146
•Weil er auch in einem Showkampf zu glänzen weiß 152
•Weil Michel sich selbst treu blieb 155
•Weil wenige Sekunden eines Kampfes einen ganzen Roman erzählen können 159
•Weil sauteuer nicht immer saugut ist 163
•Weil niemand so ehrlich ist wie ein Boxer direkt nach dem Kampf 168
•Weil Sugar Ray Leonard einen umwerfenden Jab schlug 171
•Weil der Beste seinen »treuesten« Gegner in der Heimatstadt fand 174
•Weil nicht jeder Stier bereit ist, zu fallen 177
•Weil Sugar Ray gegen Rocky fightete 182
•Weil Zucker und Stein aufeinandertrafen 185
•Weil die Größten ihr Konzept ändern können 190
•Weil »Mi vida loca« der poetischste und schmerzvollste aller Kampfnamen ist 193
•Weil Henry Maske »Amateur« geblieben ist 197
•Weil Iron Mike eine eigene Liga darstellte … 201
•Weil er dennoch ein verletzlicher Mensch ist 205
•Weil ein cooler Typ aus Pensacola die Gewichtsklassen in beide Richtungen aufmischte 210
•Weil Roy Jones jr. betrogen und dadurch unsterblich wurde 214
•Weil der größte Fighter keine markigen Sprüche braucht 218
•Weil der Pac Man pure Energie ist 222
•Weil ein Ausnahmeathlet das Schwergewicht lahmlegt 229
•Weil gute Ringsprecher Künstler sind 235
•Weil das Boxpublikum keinen Firlefanz mag 237
•Weil Werner Kastor die deutsche Stimme des Boxens ist 240
•Weil englische Fans auch beim Boxen ihre Lieder haben 243
•Weil Morbus Parkinson keine Boxerkrankheit ist 246
•Weil ein Boxer mit all seinen Sinnen kämpft 250
•Weil Puncher boxen und Boxer punchen können 254
•Weil knapp acht Minuten Boxen Millionen Boxfans nachhaltig in Atem halten können 259
•Weil Marvelous tatsächlich fantastisch war 263
•Weil auch Axel Schulz seinen großen Kampf hatte 268
•Weil der Ossi dem Wessi aufs Maul haut und umgekehrt 275
•Weil ein Boxkampf oft besser als sein Urteil ist 278
•Weil Johnny Tapia und Denny Romero »the Battle for albuquerce« ausfochten 283
•Weil Andy Holligan und Shea Neary um die Liverpooler Stadtmeisterschaft boxten 289
•Weil Nehmen und Geben ähnlich spektakulär sein können 294
•Weil Micky Ward und Arturo Gatti einander nichts und ihrem Publikum alles schenkten 298
•Weil Vitali Klitschko gegen den Besten antrat 303
•Weil ein Sieger nicht immer der Sieger ist 306
•Weil sich ein wahrer Meister nicht zu schade für Arbeit ist 312
•Weil ein Gym bedeutet: Boxen atmen! 315
•Weil ohne Fleiß kein Preis 319
•Weil ein Meistercoach auch von seinen Schützlingen lernt 322
•Weil Ossi-Trainer das deutsche Berufsboxen aufmischten 326
•Weil Boxer auch am Mikrofon schlagfertig sind 330
•Weil sie sich auch auf offener Straße nicht blöd kommen lassen 334
•Weil Boxer-Adel erdig ist 337
•Weil »Wie ein wilder Stier« gedreht wurde 341
•Weil »The Boxer« kein Film-Märchen erzählt 347
•Weil Stadiongesang nicht gleich Stadiongesang ist 353
•Weil es ein Boxer war, der seine verfeindeten Landsleute friedlich vereinte 357
•Weil Barry McGuigan im Ring boxend Wort hielt 361
•Weil er niemals lockerließ 367
•Weil Barry bis weit nach dem Schlussgong ein Kämpfer blieb 370
•Weil The End for Barry McGuigan nicht das Ende von Barry McGuigan ist 376
•Weil Bertolt Brecht einen ordentlichen Punch in den Fingern hatte 382
•Weil Charles Bukowski der literarische Vater des Promiboxens ist 386
•Weil Hank Chinaski niemals ein Promiboxer war 393
•Weil Bukowski seinem Lieblingsfeind Hemingway am Ende die Hand reichte 396
•Weil einer der tiefgründigsten Texte übers Boxen von einer Frau verfasst wurde 399
•Weil Wolf Wondratschek mit Absicht Bert Brecht kopierte 403
•Weil auch ein namenloser Journeyman seine Geschichte hat … 406
•Weil auch er eines Tages seine große Stunde erlebt 409
•Weil ein kantiger Waliser sich nicht besiegen ließ 416
•Weil Joe Calzaghe mit 34 einen ungeschlagenen hungrigen Weltmeister alt aussehen ließ 419
•Weil er einen bärenstarken Wikinger auf die Hörner nahm 423
•Weil »The pride of Wales« schließlich doch noch die USA eroberte 428
•Weil das Boxen aus vermeintlichen Opfern Helden macht 435
•Weil sich Karl nicht gern reinlegen lässt 438
•Weil Boxen keine Schunkelmugge ist 442
•Weil jeder seine eigenen Gründe hat, zu boxen 446
•Weil die Faszination die Kombination ist 450
•Weil Stärke und Klugheit zusammengehören 455
•Weil der Walk-in der Boxer selbst als reine Showeinlage seine einzigartige Energie entfaltet 459
•Weil sich das Boxen nie ganz verbiegen lässt 465
•Weil auch KZ-Häftling Nr. 9841 nicht vergessen ist 467
•Weil Boxen die Seele gesund machen kann 471
•Weil Fäuste manchmal für Frieden sorgen 475
•Weil Bücherschreiben auch Boxen ist 479
»›Er hat mal geboxt …‹
›Shit, das haben wir doch alle mal.‹«
Charles Bukowski: »Hollywood«
EIN WORT ZUVOR ODER
WEIL ICH DIR IN DIESEM BUCH ’NEN SCHLAG ERZÄHLEN DARF
Liebe Leserin, lieber Leser, ich freue mich sehr, dich in diesem Buch zu begrüßen, welches ich aus der Tiefe meines Herzens heraus schreiben durfte. Seit ich am Nachmittag des 1. Oktober 1975 zufällig mit meiner Oma in der Wohnstube saß, just zu dem Zeitpunkt, als in Manila auf den Philippinen Muhammad Ali und Joe Frazier durch die Seile in den Ring kletterten und unser Fernseher genau das zeigte, liebe ich diesen Sport. Erst beim Schreiben dieser Zeilen wird mir klar, dass ich meiner Oma sehr dankbar sein muss. Ganz sicher wollte sie diesen Kampf sehen, denn nachmittags lief unser Fernseher gewöhnlich nicht und für gewöhnlich hatte ich als damals achtjähriger Stubenhocker nicht das Geringste mit Boxen zu tun.
Ich war ein ängstlicher Junge, der kaum etwas so sehr fürchtete, wie von anderen Jungen geschlagen zu werden. Wohl, weil man mir diese Angst ganz bestimmt ansah, verkündete mir der große Thomas auf dem Spielplatz gern, er werde mir bei nächster Gelegenheit »eine aufs Maul hau’n!«. Besonders gern redete er davon, wenn er ein paar Freunde um sich hatte.
»Ick breche nachts bei euch ein, wenn du schläfst, und dann biste dranne!«, drohte er mir eines Tages. Seitdem hatte ich große Angst vor ihm. Thomas war drei Jahre älter als ich, das heißt bei Steppkes: Er war mir körperlich haushoch überlegen. Dass es abgrundtief feige ist, einem deutlich Schwächeren Prügel anzudrohen, um sich an dessen Angst zu weiden, sah ich damals nicht. Ich schämte mich, weil ich Angst vor Thomas und seinen Kumpanen hatte, und alles, was in irgendeiner Weise mit Prügeln zu tun hatte, zutiefst verabscheute.
Nun aber sah ich auf der Mattscheibe, wie diese beiden Männer gegeneinander kämpften. Sie belauerten und umtanzten sich, und der Kleinere griff unermüdlich den Größeren an, auch wenn der ihn mit seinen langen Armen zunächst gut von sich fernhalten konnte. Ich bewunderte beide wegen ihres Könnens und ihres Muts. Und natürlich schlug ich mich auf die Seite des Kleineren und wünschte mir sehr, einmal so unerschrocken zu sein wie er. Und natürlich auch, derart hart schlagen zu können, denn schon bald versetzte er dem Großen fürchterliche Treffer.
Was mich vor allem berührte, war der Fakt: Auch nach einer Vielzahl harter Schläge geht das Leben weiter. Traf einer den anderen, schüttelte der sich nur kurz, oder schlug sofort zurück! Irgendwie sagten mir diese Fernsehbilder: »Dieser blöde Thomas kann dir gar nichts, oder meinst du, er hat derart viel Dampf in seinen Fäusten wie einer dieser beiden Männer? Und wenn er tatsächlich kommt, um dich zu hauen, dann reiß verdammt noch mal deine Arme hoch, dass er dich nicht am Kopf oder in den Bauch trifft. Und wenn er zuhaut, dann hau zurück, genau in jene Lücke in seiner Deckung, die sich auftut, wenn er dich schlägt!«
Ich war sehr traurig, dass der Kleine vor der letzten Runde aufgeben musste. Sein Auge war völlig zugeschwollen, der Mann total ausgepumpt, genau wie sein Kontrahent. Seit ich Joe Frazier und Muhammad Ali an diesem Nachmittag kämpfen gesehen hatte, ratterten die 14 Runden ihrer Begegnung als Endlosschleife an meinem inneren Auge vorbei. Ich zeichnete unzählige Bilder ihres Kampfes auf Papier, erfand ganze Generationen von Schwergewichtsweltmeistern, sah fortan jeden Boxkampf, den ich sehen konnte – und stand eines Tages in der von mir gehassten Turnhalle, meine bandagierten Hände zur Deckung erhoben, um meinen allerersten Boxkampf zu bestehen. Genau wie vor jedem weiteren Kampf drohte meine Angst vor den zu erwartenden Schlägen, mich vor dem ersten Gong umzuhauen. Und wie erleichtert war ich jedes Mal, wenn der Kampf endlich begann und meine Sinne völlig anderes zu tun hatten, als mich furchtsam bibbern zu lassen.
Heute weiß ich, dass ich mit meiner treuen Begleiterin namens Angst keineswegs allein dastehe. Trainerlegende Cus D’Amato soll über sie gesagt haben: »Angst ist entweder dein bester Freund oder dein ärgster Feind. Sie ist wie das Feuer. Wenn du sie kontrollieren kannst, kann sie für dich kochen, dir dein Haus wärmen. Wenn du sie nicht kontrollieren kannst, wird sie alles um dich herum verbrennen und dich zerstören.«1
Auch Schwergewichtsweltmeister Wladimir Klitschko weiß von ihr zu berichten: »Angst ist ein Geschenk der Natur. Sie gehört zu unserem Leben, sie kann unangenehm, manchmal schrecklich sein, einen aber auch vor einem Verhängnis retten. Denn Angst ist die Alarmanlage in unserem Körper. Sie macht uns aufmerksam, sie sorgt dafür, dass wir wach bleiben, um im Leben zu bestehen, um überhaupt überleben zu können. Darum geht es auch beim Boxen«, bekennt er in einem Interview mit der Zeitschrift BoxSport: »Ich vergleiche Angst immer mit dem Gift einer Kobra. Wenn du eine zu große Dosis davon bekommst, bist du tot. Eine richtig dosierte Menge kann einen Menschen aber auch heilen, einen Kranken gesund machen. Die Schlange ist ein Sinnbild dafür, sie kann dich umbringen, aber auch zum Leben erwecken. Es ist immer die Frage, wie du mit dem Gift umgehst. Genauso ist es mit der Angst.«2
Aber zurück zu mir: Durch hartes und vor allem fleißiges Training konnte ich irgendwann halbwegs gut boxen. Als mir jedoch klar wurde, dass aus mir nie ein DDR-Meister, ja nicht mal ein Bezirks-, Kreis- oder Stadtmeister würde, hängte ich meine Boxhandschuhe ans Bücherregal. Dort hängen sie bis heute. Zwei Paar, die ich nur runterhole, wenn meine dreijährige Tochter fordert: »Papa, boxen!« Zu einem echten Kampf würde ich sie nur überstreifen, wenn eines Tages der »große Thomas« von damals vor meiner Tür steht.
Was seit dem Nachmittag jenes 1. Oktober 1975 bis heute unverändert blieb, ist mein nie erlöschendes Interesse an diesem Sport – und meine Dankbarkeit dafür, dass er mich am eigenen Leib lehrte, mit meinen Ängsten umzugehen. An alledem – und natürlich auch an den Kämpfen und Kämpfern, die mich ganz besonders beeindruckten, möchte ich dich, liebe Leserin und lieber Leser, auf diesen Seiten teilhaben lassen. Sei mir dazu herzlich willkommen – und: »Box!«
Frank Nussbücker
KAPITEL 1
DAS BOXEN IN MEINEM LEBEN
1
Weil mit Ali und Onkel Rolf alles anfing
Wie fing alles an? Vielleicht damit, dass ich als Achtjähriger zufällig »Thrilla in Manila« am heimischen Fernseher verfolgte? In jedem Fall begann ich an jenem Nachmittag, Muhammad Ali, den Sieger jenes Kampfes auf den Philippinen, nicht zu mögen.
Oder sage ich besser: Alles begann an einem sommerlichen Vormittag mit meinem Onkel Rolf. Onkel Rolf arbeitete in der LPG meines thüringischen Heimatdorfes und war für mich vaterlos aufgewachsenen Jungen der stärkste Mann der Welt, den ich persönlich kannte. Noch heute sehe ich es vor mir, wie er an jenem Vormittag auf dem ehemaligen Großbauernhof vor mir steht, den linken Fuß vorn, seine mächtigen Arme zur Deckung erhoben, den Blick grienend auf mich Steppke gerichtet, als fordere er mich zum Kampf.
Als Onkel Rolf so in für meine Augen perfekter Boxerpose vor mir steht, kann ich nicht anders, als ihn staunend anzustarren. Derart überwältigt bin ich vom Anblick dieses Kämpfers. Als ich wieder sprechen kann, sage ich: »Weißt du wa-has? Du könntest gegen Muhammad Ali antreten!«
Augenblicklich ließ Onkel Rolf, geschüttelt von einem kräftigen Lachanfall, seine Deckung fallen. »Der soll mich wohl dohtschlahren?«, röhrte er in seinem angenehmen thüringischen Bass. Onkel Rolf kriegte sich vor Lachen kaum ein, dabei hatte ich jene Kampfansetzung völlig ernst gemeint. Ja, mehr noch, ich war beseelt von der Vorstellung, mein superstarker Onkel würde diesem überheblichen amerikanischen Großmaul endlich mal den Mund stopfen. Diesem Mistkerl, der bei Fernsehauftritten vor dem Kampf seinem Gegner ständig ins Wort fiel, sich über ihn lustig machte, ihn lauthals verspottete. Ich dagegen wollte, dass er fair mit seinen Kontrahenten umging. Ich war bis dato behütet aufgewachsen, ich hatte keine Ahnung vom wahren Leben.
Wie auch immer, Ali tönte, verhöhnte – und gewann unbeirrt jeden seiner Kämpfe und mir wurde in jenem Augenblick auf dem ehemals großbäuerlichen Hof klar: Wenn diesem Unhold irgendjemand Einhalt gebieten konnte, dann der Welt stärkster Mann – mein Onkel Rolf!
Ich sah die alles entscheidende Begegnung der beiden vor mir: Ali tänzelte in seiner albernen kurzen Hose und mit freiem Oberkörper durch den Ring, um meinen Onkel bedingungslos zu attackieren, sobald der ihm eine Gelegenheit dazu bot. Onkel Rolf ließ seinen Gegner ebenfalls nicht aus den Augen. Mächtig wie ein Felsblock stand er da, seine Füße in den schweren, filzgefütterten Gummistiefeln, darüber seine abgewetzte blaue Latzhose, die er im Schweinestall wie auf dem Fahrersitz seines Mähdreschers trug. An den Händen hatte er, genau wie Ali, Boxhandschuhe.
Ali tänzelte also wild herum. Onkel Rolf behauptete die Ringmitte, deckte Gesicht und Oberkörper mit seinen riesigen Händen und drehte sich jeweils so, dass ihm sein Gegner nichts anhaben konnte. Klar, Ali war schneller und gewandter. Was ihm fehlte, war die pralle Urkraft meines Onkels Rolf. Beide erschienen sie mir unbesiegbar – und doch würde am Ende nur einer von ihnen siegreich die Arme hochreißen, während der andere geschlagen den Ringstaub schmeckte. Zwei unüberwindliche Helden, welcher von beiden würde dies auch nach dem Kampf sein? Wer also würde gewinnen und auf welche Weise?
Nichts auf der Welt erschien mir in jenem Augenblick begehrenswerter, als den von mir herbeifantasierten Kampf dieser beiden absoluten Superhelden leibhaftig mitzuerleben. Selbst eine mögliche Niederlage meines geliebten Onkels konnte mich da nicht abschrecken. Außerdem würde er doch garantiert gewinnen … oder etwa nicht? Beim Himmel, ich wusste es nicht und wollte des Rätsels Lösung unbedingt mit eigenen Augen und allen anderen Sinnen erleben! Genau das ist es, was für mich bis heute den ungeheuren Reiz dieses Sports ausmacht, dem ich mich nicht entziehen kann.
Seit jenem Sommervormittag Mitte der 1970er-Jahre sah ich mir jeden Boxkampf an, den ich irgend erhaschen konnte. Ob Weltmeisterschaft im Schwergewicht, die zumeist in Amerika ausgetragen wurde und wegen der Zeitverschiebung bei uns erst gegen vier, fünf Uhr am Morgen begann, ob Chemie- oder TSC-Pokal, Europa- oder Weltmeisterschaft der Amateure – wann immer ich es hinbekam, saß ich rechtzeitig vorm Fernseher, um keine Sekunde des jeweils alles entscheidenden Kampfes zu verpassen. Meine Helden jener Tage und Jahre hießen Smokin Joe Frazier, Ken Norton, Karl-Heinz Krüger, Stefan Förster, Uli Kaden, Richard Nowakowski und der Größte von allen: Theófilo Stevenson.
Egal, ob Welt- oder Kreismeisterschaft, ob Madison Square Garden oder eine Turnhalle in meiner Heimatstadt – wann immer zwei Helden, und das ist für mich ein jeder, der das gefährliche Abenteuer eines Boxkampfs furchtlos in Angriff nimmt, vor meinen Augen in einen Boxring stiegen, bewegte mich die Frage: Welcher der beiden hat jetzt gleich die bessere Idee, um den Kampf für sich zu entscheiden? Welches Szenario hatte das Schicksal hier geschrieben?
Dass ich mich eines Tages höchstselbst in dessen Hände begab, indem ich mir die meinen bandagierte und mir Boxhandschuhe anziehen ließ, verdanke ich dem mir ansonsten überaus verhassten Unterrichtsfach Sport, aber das ist schon wieder eine andere Geschichte.
2
Weil ich beim Boxen zum ersten Mal gern die Turnhalle betrat
Ich selbst zählte mich in keinem Fall zu jenen Helden, die es draufhatten, die Gefahr eines Boxkampfs auf sich zu nehmen. Ja mehr noch, der schlimmste Teil meiner Schulzeit waren zweifelsohne die Unterrichtsstunden in der Turnhalle. Jede Woche sah ich mich endlose 90 Minuten lang gefangen in dieser überdimensionierten Folterkammer mit ihren Instrumenten Sprossenwand, Kasten, Kletterstange und Handballfeld. Damit nicht genug! Warteten in dem staubigen Geräteraum Barren, Reck, Pferd und der Bock darauf, mir die engen Grenzen meiner körperlichen Leistungsfähigkeit aufzuzeigen. Geräteturnen, Staffelspiele, Handball – ich schätzte mich glücklich, machte ich mich einmal nicht durch herausragend schlechte Leistungen lächerlich wie die Pechmarie bei Frau Holle.
Ich war ein Meister in Sachen sich selbst erfüllender Prophezeiungen: Weil ich so derart unsportlich bin, fange ich keinen Ball, bin ich bei Staffelspielen die größte Niete und breche mir beim Bockspringen an diesem vierbeinigen Monster sämtliche Gräten. Folglich zählte ich beim Auswählen der Handball-, Fußball- oder Staffelspielmannschaften zu den beiden letzten Mauerblümchen, die lediglich als fünftes Rad des jeweiligen Teams fungierten. Immerhin dem Bruch meiner Knochen ging ich aus dem Weg, indem ich den Sprung über den Bock konsequent verweigerte.
Eines Tages empfing uns der Sportlehrer, ein drahtiger Draufgänger mit Errol-Flynn-Schnauzbart, den wir den Graf nannten, zum Begrüßungsritual an der Mittellinie mit einem großen, prall gefüllten Stoffsack. »Die nächsten drei Wochen werden wir boxen«, lüftete der Graf das Geheimnis um des großen Sackes Inhalt, aus dem er nun jedem von uns ein Paar abgetragene Boxhandschuhe zuwarf.
»Erstes Kapitel: die Grundstellung!« Der Graf stellte seinen linken Fuß nach vorn, den rechten leicht versetzt dahinter. Mit einem Nicken deutete er uns an, es ihm gleichzutun.
Nun beugte der Graf leicht die Knie und ließ seine Füße in kleinen Schritten über den Hallenboden gleiten. »Ihr müsst beweglich sein!«, rief er uns zu. »Dabei solltet ihr jedoch tunlichst vermeiden, eure Füße zu weit vom Boden zu entfernen oder gar zu springen. Erwischt euch der Gegner, wenn ihr mit beiden Füßen in der Luft seid, haut er euch aus den Latschen.«
Nebeneinanderher tänzelten wir über den Boden. Vielleicht, weil ich durch unsere Anordnung entlang der Mittellinie nicht sehen konnte, dass es alle anderen – wie immer – von vorn herein besser hinbekamen als ich, machte mir das Ganze sogar Spaß. Bisher hatte ich mir Boxen immer als das tumbe Austeilen von Faustschlägen vorgestellt. Dieses Tänzeln hingegen hatte, zumindest beim Grafen, etwas ungeahnt Elegantes.
»Mindestens ebenso wichtig wie das Schlagen ist das Vermeiden von Schlägen«, eröffnete der seine nächste Lektion. »Seid ihr Rechtshänder, ist die Rechte eure Schlaghand. Sie kommt rechts vors Kinn, den Kopf schön tief runter. Die Augen weit auf, Ellenbogen nahe am Körper, bietet ihr wenig Trefferfläche und habt freien Blick auf euren Gegner. Die Linke ist eure Führhand, sie kommt leicht versetzt vor die Rechte – und los!«
Tänzelnd erhoben wir unsere Hände zur Deckung und ließen unsere Haltung vom Grafen korrigieren. Schnell wurden mir die Hände schwer und wollten hinuntersinken. Ein kurzer Seitenblick verriet mir, den Jungs neben mir erging es nicht anders. »Die Hände oben lassen!«, rief der Graf. »Das ist im Ring eure Lebensversicherung.
Anschließend übten wir unseren ersten Schlag, die linke Gerade. Zunächst jeder für sich an der Mittellinie, anschließend paarweise. Der eine schlug seine Linke in die geöffnete Rechte seines Gegenübers, dann sammelte der Graf die Boxhandschuhe auch schon wieder ein. Die Stunde war wie im Flug vergangen. »Zum nächsten Mal besorgt sich jeder aus der Spowa3 ein Paar Boxbandagen!«, schickte uns der Lehrer nach dem »Sport frei!« in die Umkleidekabine.
Lag es womöglich daran, dass wir jeder für sich allein die Lektionen des Grafen absolvierten? In jedem Fall machte mir das Ganze Spaß, und weil ich so vertieft ins Training war, hatte mein Geist keine Chance, mir klarzumachen, dass ich zweifelsohne auch in dieser Disziplin der Schlechteste von allen war. Ja, dieses Boxen interessierte mich! Es sah elegant aus und zu tänzeln machte mir, nachdem ich es einigermaßen hinbekam, sogar Spaß. Das Üben des jeweiligen Schlags – der linken Geraden folgte der rechte Haken, sowohl aufwärts wie zur Seite – hätte ich eindeutig meditativ genannt, wenn ich dieses Wort bereits benutzt hätte. Zum allerersten Mal betrat ich die Turnhalle frohen Mutes und – ja – ausgesprochen gern!
3
Weil mich mein erster Kampf lehrte, mit meiner Angst zu leben
In der dritten Woche folgte der Pflicht die Kür: ein Übungskampf. Der Graf stellte die Paarungen zusammen. Ich bekam es mit Scholle zu tun. Der stand in der Jungenriege einen Platz vor mir. Ein drahtiger, durchtrainierter Junge, der in Sport zwar besser als ich war, jedoch dank seiner langen Nase und der vorstehenden Oberlippe bei den Mädchen noch tiefer im Kurs stand.
Das war jetzt egal, da wir uns in dem aus den Körpern unserer Mitschüler gebildeten Ring gegenüberstanden. Ich hatte mich nie zuvor richtig geprügelt. Meine Angst davor, in einer Schlägerei eins auf die Fresse zu bekommen, war nahezu ebenso groß wie die Furcht, mir beim Bockspringen sämtliche Knochen zu brechen. Meine Knie waren weich wie Gummi, im Bauch rumorte meine Angst vor Scholles Schlägen.
Der Graf gab den Ring frei, und wir tänzelten aufeinander zu. Kurz darauf traf mich Scholles erste Gerade zwischen den Augen. Der nachgezogene Haken haute mir meinen rechten Boxhandschuh gegens Kinn. Ich lief gegen eine Wand. Falsch! Nicht ich war es, der sich bewegte. Die Wand bewegte sich gegen mich, die Wand aus Scholles Schlägen. Hatte der Kerl überhaupt Boxhandschuhe an? Seine Schläge waren hart, trafen mich an der Stirn, dem Unterkiefer – der ganze Kerl war so hart wie Holz, merkte ich, als mein gesenkter Kopf auf seine Schulter traf.
Als der nächste Schlag meine Nase erbeben ließ, war in meinem Kopf kein Platz mehr für meine so überaus treue Begleiterin, die Angst. Scholle hatte sie geradewegs aus mir herausgeprügelt. Wieder ein Treffer – in meinem Mund ein salziger Geschmack, etwas platzt in meiner Magengrube, doch ich spüre keinen Schmerz, im Gegenteil. Mir ist, als habe tief in mir gerade etwas sein Gefängnis verlassen, in dem es eingesperrt war, solange ich denken kann. Dieser Mistkerl hatte mich voll erwischt, nun wollte auch ich ihm ordentlich was einschenken. Während ich mit der Rechten aushole, trifft mich Scholles Linke erneut. Ich reiße beide Fäuste zur Deckung hoch und sehe zu, dass ich aus seiner Reichweite komme.
Jetzt muss mir schleunigst was einfallen. Spüre ich doch, der Graf ist kurz davor, den Kampf aufgrund Scholles drückender Überlegenheit abzubrechen. Sicher haben die meisten meiner Mitschüler mittlerweile ordentlich Angst um mich Weichei. Hörte ich nicht gerade ein »Gib auf! Der bricht dir das Jochbein!«? Alles, nur jetzt nicht den Kampf abbrechen! Ich drücke mein Kinn runter auf die Brust, reiße die Unterarme vors Gesicht, die Oberarme decken so gut es geht meinen Körper. In dieser Stellung mache ich einen Satz nach links, dann einen nach hinten. Scholles Faust saust ins Leere. Meine Füße gleiten über den Hallenboden. Eine Atempause, dann steht Scholle wieder vor mir. Er hat den Mund offen und knallt mir seine Führungshand auf die Handschuhe. Dann drischt er gegen meine Stirn. Wieder ein Treffer, aber er tut nicht weh.
Ich warte, bis Scholle seine nächste Aktion bringt, und schlage meine Linke in die dabei in seiner Deckung aufklaffende Lücke. Kurz darauf fliegt meine Rechte heraus. Sie trifft auf etwas Hartes, Sprödes – etwas, was sich bei aller Härte überaus zerbrechlich anfühlt. Das muss Scholles Kinn gewesen sein, oder? Keine Antwort von seinen Fäusten. Ja Mensch, durchfährt es mich, das war ein Treffer! In meinen Ohren tost etwas, was wie Beifall klingt. Ein gellender Pfiff beendet die Runde.
Pumpend wie ein Maikäfer taumele ich in meine Ecke. Meine Knie sind wieder schrecklich weich, jetzt jedoch nicht aus Angst, sondern vor Erschöpfung. Mein Kumpel Berge redet auf mich ein. Der Schwall seiner Worte klingt nach Instruktionen für den Kampf, doch ich vermag nicht, ihm auch nur eine Silbe lang zuzuhören. Das Blut rauscht in meinen Ohren, meine Arme hängen an mir herunter wie ausgeleierte Gummistrippen, an deren Ende ein übermäßig schweres Gewicht baumelt. Um Himmels willen, was mache ich hier? Und vor allem: Wie soll ich diese Tortur eine weitere, unendlich lange Runde durchhalten?
Wieder ein Pfiff, zurück in den Ring. Auf ein Neues attackiert mich Scholle mit seinen Fäusten, doch jetzt halte ich von Anfang an dagegen. Keine Wand, eine Welle aus Schlägen bricht über mich herein. Ich weiche ihr aus, um kurz darauf wieder mitten in sie hineinzuspringen. Arme hoch und schlagen, Gerade oder Haken, Hauptsache, schlagen, meiden, blocken, wieder schlagen. Es rauscht in meinen Ohren, meinem ganzen Leib. Aus weiter Ferne höre ich, wie sie uns anfeuern. Eine tosende Brandung aus verzerrten Stimmen. »Hau ihn auf die Fresse«, kreischt eine hohe Mädchenstimme. Mehr verstehe ich nicht. Meine bei jedem Schlag schwerer werdenden Arme lernen schnell dazu. Haken brauchen weniger Kraft. Meine Arme verwandeln sich erneut in Gummiseile. Blitzartig schleudern sie heraus und bringen ihr schweres Ende, meine Fäuste, ins Ziel. Auch Scholle landet weiter seine Treffer.
In der Pause zur dritten und letzten Runde weiß ich: Ich werde diese zwei Minuten bewältigen. Auch körperlich fühle ich mich weitaus besser als nach der ersten. Endlich der Pfiff: »Ring frei!« Während wir erneut aufeinander einschlagen, erlebe ich in meinem Kopf eine angenehme Leichtigkeit, wie ich sie selten zuvor – und niemals in dieser Halle – erlebte. Scholles und mein Körper ergehen sich in einem Gespräch ohne Worte, dafür mit grenzenlos ehrlicher Hingabe. Geben ist seliger denn nehmen. Wie abgrundtief begreife ich in diesen Augenblicken den wahren Sinn dieser Worte.
Am Ende der 3. Runde schließen wir uns unter dem Jubel unserer Mitschüler in die Arme. Mir blutet die Lippe, Scholles rechtes Auge zeigt die deutlichen Vorboten eines Veilchens. Wir beide kennen uns von nun an besser, als wir es je mit Worten ausdrücken können.
Meine Angst vor dem Schmerz hatte mich an diesem Tag keineswegs verlassen. Aber von nun an wusste ich, sie war nur ein Teil des Ganzen. Einer, der dazugehörte – und der rasch verflog, hatte der Kampf erst begonnen. Ich würde niemals ein ausgesprochen guter Boxer werden, und doch half mir meine Begegnung mit diesem Sport, mit meiner übermannsgroß anmutenden Angst auszukommen – nicht nur in der Turnhalle.
4
Weil mir das Boxen in der Schule jedwede Langeweile vertrieb
Mochte der Unterrichtsstoff mitunter noch so öde sein, Langeweile in der Schule kannte ich über Jahre hinweg nicht – vor allem dank ihm. Ja natürlich, ich rede hier von dem Größten aller Zeiten. Mehr als ein Jahrzehnt beherrschte er das Schwergewicht nach Belieben, heimste er nationale wie internationale Titel ein wie bis zum heutigen Tage kein anderer Boxer dieser Welt. Siegreich in gefühlten 111 Weltmeisterschaftskämpfen, ferner acht deutsche Meisterschaften sowie fünf Siege beim legendären PBC-Pokal zieren seinen Kampfrekord. Die Rede ist von Oliver Kniebleich, dem Superhelden meiner ganz persönlichen Boxsport-Historie.
Selbige füllte am Ende ein halbes Dutzend eigenhändig von mir vollgemalter Kladden im DIN-A5-Format. Die passten gut in die Schultasche und, ganz wichtig, sie waren kleiner als das Gros der Lehrbücher. Näherte sich ein Lehrer meinem Platz, legte ich schnell ein solches über mein geschichtsschreiberisches Werk. Nicht von ungefähr zeichnete ich den größten Teil meiner Boxbücher während des Unterrichts.
Saison für Saison verewigte ich in meinen Kladden. In jede passten etwa vier Jahrgänge. Jede Saison begann mit den »Deutschen Meisterschaften im Boxen«, bei der acht Kämpfer im K.-o.-System den nationalen Meister ermittelten. Über viele Jahre dominierten hier die Kämpfer des PBC. Dieses Kürzel hatte nichts mit den frömmelnden Gutmenschen der »Partei Bibeltreuer Christen« zu tun, sondern stand für »Pfeifenraucher-Box-Club«. Oliver Kniebleich sowie seine beiden Nachfolger auf dem nationalen Thron, Hans Kraftstulle und Horbert Sorbier, boxten unter der Flagge des PBC. Die Pfeifenraucher waren allesamt abgeranzt daherkommende Männer mit Glatze und Bartstoppeln, die ihre Mitmenschen mittels permanentem Pfeifenrauchabsonderns terrorisierten. Olli und die anderen nahmen ihre Rauchgeräte einzig während ihrer Auftritte im Ring aus dem Mund.
Daselbst leistete ich mir in meinen Boxchroniken einige Extravaganzen. So verfügte besagter Hans Kraftstulle, ein kleiner, schmächtiger Kerl mit kurzen Armen, über eine äußerst effiziente Spezialwaffe. Zwischen seinen Boxhandschuhen und Unterarmen verbargen sich mächtige, im Normalfall unsichtbare Stahlfedern. Hans stellte sich außerhalb der Reichweite seines Gegners auf. Sobald er die Chance zu einem Treffer sah, ließ er den Stahlfedern freien Lauf und verfügte blitzschnell über eine enorme Reichweite. Wie Blitze schossen seine Hände heraus und erzielten mitunter eine enorme Wirkung, bevor sie ebenso abrupt wieder in ihre Ausgangslage zurückschnellten und Kraftstulle lediglich ein schmächtiger Kerl mit kurzen Armen und Stoppelschädel war.
Hans brachte es dank seiner Stahlfeder-Hände immerhin auf zwei deutsche Meisterschaften und einen sechsten Platz in der seinerzeit äußerst stark besetzten Weltrangliste. Nicht ganz so erfolgreich verlief die Karriere seines Clubkollegen Herbert Stechbrennerschinken. Auch dessen Boxhandschuhe, mit jeweils fünf superspitzen Spezialspikes ausgestattet, vermochten jedweden Gegner äußerst schmerzhaft zu treffen.
Der Deutschen Meisterschaft folgte der »PBC-Pokal in Rudendudel«, Letzteres ein meiner Fantasie entsprungenes Pisskaff. Dessen ungeachtet, war dieses Turnier international wie äußerst prominent besetzt. Stars wie Sergej Iwanowitsch Chachsan aus der UdSSR, der Argentinier Aguala Nussgorillio, Fidel Castero aus Kuba, Mexikos Stolz Hegown Gonzalez oder der riesige Chinese Soranj du Shen-Shen Hunon gehörten zu seinen Stammgästen. Gegen Ende der Blütezeit des Pfeifenraucher-Box-Booms erlangte der PBC-Pokal den Rang eines WM-Turniers. Die 16 besten Boxer der – bei mir stets gewichtsklassenübergreifenden – WM-Rangliste kürten hier, ebenfalls im K.-o-System, den neuen Champ oft the World. Bis dato hatten meine WM-Kämpfe jeweils in der turnierfreien Zeit nach meinen beiden Meisterschaften stattgefunden.
Alle wichtigen Kämpfe erlebte ich live mit, indem ich sie höchst selbst Bild für Bild aufs Papier zauberte. Für einen Fight unterteilte ich zwei Buchseiten meiner linierten Kladden in insgesamt 14 Teile, indem ich alle drei Zeilen eine Trennlinie zog. Diese 14 Teilbilder markierten die Dauer des Kampfes, sofern der über die volle Distanz ging. Auf dem ersten Bild standen sich beide Kontrahenten mit erhobenen Boxhandschuhen gegenüber. Jedes zeigte ausschließlich ihre Köpfe und Oberkörper, sprich sämtliche Trefferflächen. Auf dem zweiten Bild brachte einer der Boxer seine erste Attacke. Das Schicksal führte meine zeichnende Rechte und entschied darüber, wer schlug und auch, ob er Kopf, Körper oder nur des Gegners Deckung traf. Derart ging es weiter, bis ein Mann k. o. ging oder nach 14 Bildern mit dem Schriftzug »Doingg!« der Schlussgong folgte. Dann zählte ich die Treffer und schrieb das offizielle Urteil.
Es war wichtig, dass ich den gesamten Kampf in einem Zug zeichnete, denn jedes Teilbild bestimmte durch seinen Strich den Inhalt des nächsten. Nur so folgte jeder Fight seiner eigenen Dramaturgie. Natürlich fieberte mein Herz stets für einen der beiden Boxer, was jedoch keinesfalls bedeutete, dass dieser am Ende auch siegte. Ich weiß noch genau, wie mir fast die Tränen kamen, als Olli Kniebleichs WM-Kampf gegen den mächtigen Japaner Hong Suang Dey-Dey eine dramatische Wendung zu Ungunsten meines größten Boxers aller Zeiten nahm.
Nur wenige Tage nach Oliver Kniebleichs erster K.-o.-Niederlage nahm mich mein Schulfreund Berge, der wie einige andere Jungen und Mädchen der Klasse mittlerweile lebhaften Anteil an meinen Boxbüchern nahm, zur Seite. »Ich glaube, Olli sollte jetzt sterben«, vertraute er mir an. Das leuchtete mir ein. Noch am Nachmittag zeichnete ich die Beerdigungsfeierlichkeiten. Sie nahmen, genau wie jeder wichtige WM-Kampf, exakt zwei Buchseiten ein. Auf dem ersten Bild war Oliver Kniebleichs aufgebahrter Leib zu sehen. Dann zeichnete ich, wie viele seiner Kollegen, Wegbereiter und Gegner gemeinsam den riesigen Sarg zur ausgehobenen Grabstelle trugen. Zu den Trägern gehörten unter anderem Hong Suang Dey-Dey, Hegown Gonzalez, Sergej Charykin aus der UdSSR und der US-Star Joe Gummikralle. Pfarrer Ibo Hompenbuss und Odo Herberts, Chef des PBC, hielten die Trauerreden. Die von Herberts endete mit den Worten: »Oliver war ein guter Sportler. Auch hatte er einen sehr guten Charakter und war hilfsbereit.« Das war zweifelsfrei der einschläfernde Beurteilungssound aus meinem Zeugnisheft. Ollis Bezwinger Dey-Dey bekräftigte am Ende seiner Trauerworte: »Oliver war zwar mein Konkurrent, aber auch gleichzeitig mein Freund.«
Ollis früher Abgang war für alle seine Fans, insbesondere für Berge und mich, ein tiefer Schock, und doch kam er keinesfalls aus dem Nichts. Eine vorab in meiner Kladde veröffentlichte Pressemitteilung hatte die Vermutung enthalten: »Die Ursachen für seinen Tod sind wahrscheinlich in seinem starken Pfeiferauchen zu suchen.«
Vor allem aber war Oliver Kniebleichs Beerdigung tagelang das Pausengespräch in meiner Klasse. Fortan hatte ich so viele Boxinteressierte um mich, dass ich große Kämpfe nur noch in den Pausen zeichnen konnte, denn selbstredend wollten auch die anderen live dabei sein, wenn ich meine rechte Hand die nächste Deutsche oder gar Weltmeisterschaft im Boxen zelebrieren ließ. Dank jener Kladden, die sich noch heute in meinem Besitz befinden, verlebte ich über Jahre hinweg eine äußerst kurzweilige Schulzeit.
5
Weil ich doch noch zu Ali fand
Als ich Muhammad Ali 1975 am Fernsehbildschirm kennenlernte, hatte »Der Größte« bereits den größten Teil seiner Ringkarriere hinter sich. Ich mochte ihn, wie gesagt, überhaupt nicht, und sah ich einen seiner Kämpfe, wollte ich nur eines: dass endlich einer dieses Großmaul schlug. Es ging mir mit dem »alten« Ali, der ein Jahr zuvor den ihm von seiner Regierung geraubten WM-Titel zurückerobert hatte, auf den ersten Blick wie vielen, vor allem weißen Amerikanern, die einst den jungen Ali gehasst hatten. Allerdings hatte meine Abscheu nicht das Geringste mit Alis Religion oder gar seiner Hautfarbe zu tun. Ich war Fan von Teófilo Stevenson, dem schwarzen Kubaner, der Nummer 1 der Amateure.
Ich mochte es einfach nicht, dass Ali auf den Pressekonferenzen so herumschrie, dass er bei gemeinsamen Fernsehauftritten seine Gegner verhöhnte, ihnen ins Wort fiel, sie mitunter gar beim Schlafittchen packte. Für den Witz seiner Shows war ich viel zu naiv. Ich sah nur einen überaus bösen Mann, der anderen das Wort verbot und das offenbar sogar durfte. Aus meinem eigenen Leben kannte ich viele, die selbiges mit mir taten. Onkel Wolfhart zum Beispiel, der mir gegenüber immer recht hatte, weil er erstens ein Erwachsener und zweitens Lehrer von Beruf war. In meiner Schule versuchten eine ganze Reihe seiner Berufskolleginnen und -kollegen, meinen Freunden und mir mit Alleinherrscher-Stimmen zu erklären, wer in der Welt die Guten und wer die Bösen waren. Dass wir Jungs unbedingt drei Jahre zur Nationalen Volksarmee müssten, um unser Land wie den Weltfrieden gegen all die Bösen zu verteidigen, war ja wohl das Mindeste, was wir undankbaren faulen Säcke dem uns päppelnden Staat der Arbeiter und Bauern zurückzugeben hatten!
Mein Schulfreund Willi nahm sich meiner Ali-Abscheu an, indem er mir vom mächtigsten aller Boxer erzählte, der nur darauf warte, es dem Großmaul endgültig heimzuzahlen: »Alle Kenner wissen, der Allergrößte ist dieser Riese, den alle nur ›Jumbo‹ nennen. Noch sitzt Jumbo im Knast, aber in seiner Zelle hängt ’n Sandsack. Außerdem verprügelt er jeden Tag ein Dutzend schwer bewaffneter Wärter, um sich für den Tag der großen Abrechnung mit Ali in Form zu halten.«
Ich nehme an, Willi meinte mit jenem sagenumwobenen »Jumbo« den Exchamp Sonny Liston. Den jedoch hatte Ali zweimal im Ring verprügelt. Außerdem war Liston seit dem 30. Dezember 1970, also bereits seit etlichen Jahren, tot. Das allerdings wusste ich damals nicht. Und wenn, dann hätte ich es nicht wissen wollen, denn die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, und die hieß für mich nun mal Jumbo!
Mein Hass auf den großen »Mundverbieter« Muhammad Ali endete an jenem Tag, da ich seine Autobiografie Der Größte in die Hand bekam. Das war Anfang der 1980er, und der Boxer Ali hatte seine Handschuhe längst an den berühmten Nagel gehängt. Nach einer Schulaufführung zu Ehren des deutschen Dichterstars Johann Wolfgang von Goethe, in der ich oben auf der Bühne einen tumben österreichischen General sowie den mindestens ebenso dämlichen Schüler aus Goethes Faust mimen durfte, wusste ich zum ersten Mal in meinem Leben, was ich werden wollte: Schauspieler! Wie staunte ich darüber, genau hier in Muhammad Ali einen Bruder zu sehen. Seine große Klappe, all die Wutausbrüche und Beinahe-Schlägereien vor laufender Fernsehkamera – all das hatte er meisterhaft gespielt!
Er war diesen Weg gegangen, um sich den großen Boxpromotern zu empfehlen – ja mehr noch, er drängte sich ihnen mit seiner Show derart auf, dass die gar nicht anders konnten, als große, lukrative Kämpfe mit ihm zu besetzen. Der Schauspieler Ali hatte dem Boxer Ali die guten Jobs besorgt – und der Boxer wusste, was es bedeutete, derart in Szene gesetzt, auf der großen Bühne den Bösen zu geben: »Ich habe Angst, (…), weil ich nach der Angeberei, nach den Prophezeiungen und dem Wunsch der Zuschauer, mich verprügelt zu sehen, tief in der Klemme sitze. Wenn ich verliere, jagen sie mich aus dem Land. Ich hocke auf einem dünnen Ast und weiß, daß ich gewinnen muß. Da stehe ich nun im Rampenlicht und hab Todesängste. Aber das wissen nur wir beide«4
In jenem Absatz seines Buches sprach Ali zu seinem engen Vertrauten True »Bundini« Brown – und zu mir, seinem Leser und Komplizen. Denn wenn ich oben auf der Bühne stand, wollte ich dort nichts anderes als er. Ich wollte glänzen, meine Rolle so spielen, dass keiner meiner Zuschauer mich je vergaß. Und ganz sicher hätte ich nicht das Geringste dagegen einzuwenden gehabt, wäre der Direktor eines großartigen Theaters nach der Vorstellung zu mir gekommen, um mich an seinem Haus zu engagieren. Das ist nie passiert, und doch denke ich, dass ich dem Publikum fast immer eine gute Show bot. Und wer weiß, ohne die Bühne wäre ich womöglich etliche Jahre länger Jungfrau geblieben. In jedem Fall verstand ich jetzt, warum Muhammad Ali mich einst zu einem Mitglied seiner millionenstarken Gegnerschaft gemacht hatte.
6
Weil ich bei der Musterung neben Ali stand
Endgültig mein Bruder wurde Muhammad Ali in jenem Kapitel, in dem er gegen den mächtigsten aller Gegner antrat: die Herrschenden seines Landes. Ich rede hier vom Kapitel über seine Musterung zur Army. Das Land, in dem er selbst nach seinem Olympiasieg dank seiner Hautfarbe als Bürger 2. Klasse galt, der in »weißen« Restaurants nicht bedient wurde, wollte ihn anlässlich des Vietnamkriegs in seiner Armee dienen sehen. Ganz sicher hätte er als Promi nicht vor Ort Wälder vergiften, eigenhändig vietnamesische Frauen und Kinder abschlachten oder Vietkong-Soldaten im tödlichen Kampf gegenüberstehen müssen. Als Weltmeister im Schwergewicht wäre sein Platz in einer Faschingsgarde gewesen, in der er höchstens mal vor laufender Fernsehkamera eine Waffe in die Hand hätte nehmen müssen. Und doch weigerte sich Ali, an diesem Krieg des weißen Amerika teilzunehmen.
Wie überall auf der Welt nannten die Mächtigen den in ihrem Interesse angezettelten Massenmord einen »heiligen Krieg fürs Vaterland«, die Teilnahme daran eine »patriotische Pflicht«. Um von ihrem eigenen Versagen abzulenken, richten die Mächtigen ihren langen Finger auf jemand anderen, der angeblich schuld an allem Schlamassel ist. Ob Indianer, Juden, Kommunisten, Imperialisten, Weiße, Schwarze, Homosexuelle, Radfahrer, Hartz-IV-Empfänger oder Vietkong, immer ist ein anderer der Bösewicht, dem im Namen von Kaiser, Gott, Vaterland, des Sozialismus, Weltfriedens oder Pipapo der Garaus gemacht werden muss. Die Drecksarbeit des Mordens lassen die Mächtigen selbstverständlich von den »kleinen Leuten« verrichten. Die meisten Amerikaner, die in Vietnam starben, waren schwarz.
Und zu diesem ganzen Beschiss, der bei den meisten Untertanen funktioniert, sagte Ali Nein! Statt in der sicheren Faschingsgarde symbolisch Krieg zu spielen, riskierte er Berufsverbot, fünf Jahre Gefängnis und eine hohe Geldstrafe. Als Ali zur Musterung erschien, musste er sich zunächst, wie jeder Wehrpflichtige auf dieser Welt, einer Reihe halbwegs entwürdigender militärärztlicher Untersuchungen stellen. Anschließend stand er, die Hände an der Hosennaht, zusammen mit anderen Rekruten in einem Raum. Auf einem Podest thronte ein Offizier und rief ihre Namen auf. Der Genannte musste einen Schritt nach vorn tun – und trat somit offiziell der US-Army bei. Der eine vollführte jenen Schritt mit stolzgeschwellter Brust, andere zögerlich und ängstlich, wieder andere mit Abscheu. Muhammad Ali, den der Offizier bewusst mit seinem »Sklavennamen« Cassius Clay aufruft, bleibt stehen, was ihm prompt einige bewundernde Blicke der anderen Rekruten einbringt: »Es ist, als seien sie insgeheim froh darüber, daß jemand der Macht die Stirn bietet, die alle Soldaten von ihren Heimen und Familien trennt.«5
Zu diesen anderen Rekruten gehörte auch ich, etliche Jahre später und in einem anderen Teil der Welt. In dem Land, in dem ich ein junger Mann war, verurteilten die Mächtigen den Vietnamkrieg der USA als Verbrechen. Auch sie entschieden darüber, wer Gut und wer Böse war und zwangen uns, »Für Frieden und Sozialismus« unseren sogenannten »Ehrendienst« in ihrer sogenannten »Volksarmee« zu leisten. Einer Armee, in welcher, anders als in der Bundeswehr, noch in den 1980ern die in Preußischem Heer wie faschistischer Wehrmacht gültige Hackordnung der unteren Dienstgrade herrschte.
Die Soldaten des dritten Diensthalbjahrs nannten sich »Entlassungs-Kandidaten«. Sie hielten die »Zwischenpisser« aus dem zweiten Diensthalbjahr an, den neu einberufenen »Sprallen« die Hölle heiß zu machen. Die »jungen Genossen« hatten sämtliche Zimmer und Reviere zu reinigen und jene, die schon länger dabei waren, zu bedienen und zu belustigen. Ein weiterer Unterschied zur Bundeswehr: Deren Mannschaften fuhren am Wochenende nach Hause, wir hingegen sicherten in der Kaserne die Gefechtsstärke unserer Wundertruppe. »Würden wir die BRD Freitagnachmittag angreifen, stünden wir nach wenigen Stunden kampflos an der französischen Grenze«, sahen wir unsere Kasernenhaft mit Humor.
Offiziell herrschten bei der NVA sozialistische Menschenbeziehungen. Ich lernte während meiner Kasernenhaft, was dieser Sozialismus rein menschlich wert war: Erfülle bedingungslos die Befehle deiner Vorgesetzten und sieh zu, dass du deinen Arsch an die Wand kriegst. Nach oben buckeln, nach unten treten, genau wie in jeder anderen Armee.
Bei meiner Musterung sah ich Ali neben mir – und traute mich nicht, wie er zu sagen: »Nee, Leute, ich mache nicht mit!« Nun führten NVA und die damalige Bundeswehr keine Kriege, abgesehen vom permanenten Kalten Krieg. Ich musste als »Affenarsch«, so unsere Übersetzung des Begriffs »Armeeangehöriger«, lediglich das alle vier bis elf Wochen von einem Wochenendurlaub unterbrochene Knastleben der Kaserne überstehen. Einer meiner Freunde hatte es zumindest gewagt, den Offiziersbüttel bei der Musterung zu fragen: »Was passiert eigentlich, wenn ich mich weigere, zur NVA zu gehen?«
»Dann ziehen wir Sie trotzdem ein!«, hatte der Militär-Knecht losgebrüllt. »Und wenn Sie nicht erscheinen, sperren wir Sie ein, und zwar für die Dauer Ihres Ehrendienstes! Und wenn Sie rauskommen, ziehen wir Sie wieder ein, und wenn Sie dann wieder nicht erscheinen, sperren wir Sie noch mal ein, und zwar für die Dauer …«
Ob es tatsächlich so gekommen wäre, wagte ich nicht, herauszubekommen. Ali jedenfalls saß keine fünf Jahre, sondern lediglich zehn Tage im Knast, offiziell für ein Verkehrsvergehen, das bereits Jahre zurücklag. Sie erkannten ihm seinen Weltmeistertitel ab und erteilten ihm in der Blütezeit seiner Boxerkarriere ein gut dreijähriges Berufsverbot. Seinen Pass zogen sie ein. Er durfte das Land nicht verlassen und musste ständig damit rechnen, dass sie ihn doch noch für Jahre ins Gefängnis warfen.
Nicht er hatte anderen den Mund verboten, wie ich einst dachte, sondern die Mächtigen versuchten, eben das mit ihm zu veranstalten. Auch wenn ich damals nicht wagte, was Ali sich traute, bin ich ihm bis heute für seine Standhaftigkeit dankbar, lehrt sie mich doch: Du selbst und nur du bist verantwortlich für das, was du in deinem Leben tust!
7
Weil mir das Boxen ein guter Freund wurde
Meine Zeit als kindlich-jugendlicher Hobbyboxer dauerte etwa anderthalb Jahre. Es waren jene drei Halbjahre, in denen auf meinem Zeugnis im Unterrichtsfach Sport die Note 2 stand, statt der sonst von mir abonnierten 3. Die zahlreichen Laufeinheiten des Boxtrainings halfen meiner Kondition auf die Sprünge, das intensive Krafttraining sorgte dafür, dass an den optisch entscheidenden Stellen meines Körpers Muskeln zu erkennen waren, und selbst das Seilspringen beherrschte ich schließlich recht ordentlich. Durch emsiges Training boxte ich halbwegs ansprechend. Ich brachte die gängigen Schläge schnell und irgendwann sogar äußerst präzise, doch was mir fehlte, war der Punch. Das lag wohl daran, dass ich meine Schläge an Kopf oder Körper meines Gegners setzte, statt »durch sie hindurch« zu schlagen, wie es mein Trainer vehement forderte.
Auch ich konnte mitunter einen äußerst harten Schlag anbringen, aber wenn es passierte, kam das Ganze über mich wie ein plötzlicher Gewittersturm. Ich konnte derartige Attacken nicht abrufen, sobald es die Kampfsituation erforderte. Hatte ich meinen Gegner an den Seilen gestellt, fehlte mir oft genug einfach der Biss, die Sache zu Ende zu bringen, also den Ringrichter dazu zu bewegen, den Kampf vorzeitig zu meinen Gunsten abzubrechen. Nun ging es beim Jugend-Amateurboxen nicht vor allem darum, seine Kämpfe durch einen technischen oder gar echten Knock-out zu gewinnen, aber meine Zögerlichkeit verriet mir doch, dass ich im Ring niemals Bäume ausreißen würde. Der Gegner musste mich, genau wie einst Scholle, erst ein paar Mal ordentlich durchrütteln, bis ich die Aggressivität entfaltete, die es im Ring nun mal braucht. Ob die dann bei mir derart kontrolliert war, wie es für einen Boxer gut ist, möchte ich aus heutiger Sicht bezweifeln.
Wie auch immer, ich hörte wieder auf zu boxen und sank in Sport auf meine Note 3 zurück. Was mir bis heute blieb, ist meine Liebe zu diesem Sport. Vor allem mag ich es, mir Boxkämpfe anzuschauen, live im Berliner Prater Garten, einem großen Freiluft-Bier-Restaurant bei mir um die Ecke, in kleinen Hallen, großen Arenen oder eben im Fernsehen. Den späten Kämpfen Alis und jenen der stets stark besetzten DDR-Boxstaffel bei Chemiepokal, Welt- oder Europameisterschaften aus meiner Kindheit folgten nach der Wende die Ringauftritte Henry Maskes, über die ich an späterer Stelle erzähle.
Der einzigartige Mike Tyson brachte mich dazu, mir anlässlich seiner Kämpfe regelmäßig Nächte um die Ohren zu schlagen. Seine letzte große Zeit ab 1995 nach seiner Haftentlassung fiel genau in den wildesten Teil meiner Junggesellenjahre. Hin- und hergerissen von Liebesfreud und -leid fand ich am ehesten beim Betrachten eines guten Boxkampfs meine Ruhe. Erstere brachte mich vor Freude um den Verstand, hatte ich eine neue Liebe gefunden. Letzteres warf mich aus der Bahn, hatte mich eine bis eben Geliebte aus ihrem Herzen verbannt.
Die mich da im positiven wie negativen Sinne verrückt machten, waren Frauen, und was sah ich beim Boxen? Männer, die ihre Arbeit erledigten, und zwar mit äußerster Hingabe – allen voran der obercoole Ringrichter Mills Lane und natürlich vor allem Iron Mike Tyson. Ich genoss es, ihn für die Minuten seiner Ringauftritte zu meinem absoluten Helden zu machen, ohne je so leben oder sein zu müssen wie er. Wie auch immer: Sobald Tyson boxte, hatte ich keinen einzigen Gedanken mehr frei für die mich sonst gnadenlos verzehrende sinnliche Liebe.
Als mein Held mit Evander Holyfield zum zweiten Mal in seiner Profikarriere auf einen Mann traf, der ihn in den Ringstaub schickte, konnten mich einzig die mich umschlingenden Arme, Beine und Lippen meiner Geliebten trösten, nachdem ich sie morgens gegen acht Uhr, so zärtlich es mir irgend möglich war, aus ihrem Schlummer riss. Sie tat es, wofür ich ihr an dieser Stelle noch einmal aus tiefstem Herzen danke!
So also sorgten das Boxen und die Liebe dafür, dass ich mein Leben jener Jahre bis heute und nahezu ganz ohne Wehmut als ein äußerst buntes bezeichnen darf. Die Geliebten kamen und gingen, die edle Kunst des Faustfechtens, wie mein Lieblingskommentator Werner Kastor den Boxsport zu nennen pflegt, steht mir bis zum heutigen Tag als überaus treuer wie verlässlicher Freund zur Seite.
8
Weil mir das Boxen in Liebesdingen half
Noch einmal kurz zurück in meine Junggesellenjahre. Das Leben erschien mir hart, intensiv und vor allem ungeheuer einfach. Stand ich gerade solo da, vegetierte ich gefühlsmäßig in einem unterirdischen Maulwurfsgang dahin, ohne in irgendeiner Weise Lust auf diese Art des Lebens zu haben. Hatte ich dagegen eine Freundin, ging es mir wunderbar. Waren es gar deren zwei, schwebte ich, egal, wie zerschlagen ich von den süßen Mühen der Liebe war, einen halben Meter über dem Erdboden.
Zum Glück verliebte ich mich nie in ein Mädchen, mit dem ich nicht geschlafen hatte. Das rettete mich davor, dass mich eine begehrenswerte Schöne allzu lange an der Nase herumführen konnte. Mein großes Problem bestand darin, dass ich mich jedes Mal unsterblich in die Angebetete verliebte, sobald ich mit ihr geschlafen hatte. Aus diesem Grunde musste ich es irgendwie schaffen, mein Lager nur mit denjenigen zu teilen, bei denen es die Chance gab, dass wir mehr zueinanderpassten, als dies beim Liebesakt rein körperlich gegeben war, sprich: Meine Herzallerliebste sollte zumindest eine meiner Macken mindestens tolerieren können. Die Erste, die mir in diesem Zusammenhang einfiel, war die mit dem Boxen. Weit über 40 VHS-Kassetten mit Boxkämpfen, eine jede mindestens 240 Minuten lang, hatte ich mittlerweile aufgenommen, wobei ich wohlgemerkt nur jene Fights auf dem Band beließ, die mich wirklich gefesselt hatten.
Bei einem Stelldichein mit der womöglich zukünftigen Liebsten stellte ich dann zu vorgerückter Stunde wie nebenbei die Frage: »Hab ich dir eigentlich schon mal ein paar meiner Lieblingskämpfe gezeigt?« Das Ganze bei aller Beiläufigkeit in genau jenem Tonfall, als seien wir beide Vollblutphilatelisten, und ich habe gerade erwähnt, ihr die Blaue Mauritius zeigen zu wollen, um sie ihr hernach zu schenken.
Zumeist lagen wir da bereits zusammen auf meinem Hochbett, von dem aus man einen wunderbaren Blick auf einen riesigen Uralt-Röhrenfernseher hatte. Konnten die Mädchen meine Frage zunächst als einen Streich ihrer Ohren abtun, wussten sie doch spätestens nach den folgenden drei Bewegungen meines rechten Zeigefingers, dass ich das Angekündigte wirklich ernst gemeint hatte, denn schon jene beiden Augenblicke später zeigten sich Lennox Lewis, Óscar de la Hoya, Mike Tyson oder Roy Jones jr. auf der Mattscheibe und legten los, uns ihre Kunst nahezubringen.
Setzte es an dieser Stelle neben mir Protest oder fand ich mich kurz darauf gar allein in Hochbett und Einraum-Außenklo-Bude wieder, wusste ich, dass mir ein weiterer, viel zu früher Bruch meines Herzens erspart geblieben war. Nahm meine Besucherin das Ganze cool oder gar mit Humor, erwies sich das als gutes Zeichen. Eine von ihnen fand nicht nur Gefallen beim Ansehen meiner Lieblingskämpfe. Das Zucken ihres rechten Armes, begleitet von einem leichten Pendeln ihres Oberkörpers, verriet, dass sie von der ersten Minute an mitboxte. Wir sind noch heute miteinander befreundet.
9
Weil ein gebrochener Kiefer meine Liebe für kurze Zeit zum Boxfan machte
Auch meine Liebe hatte dereinst ein paar meiner Lieblingskämpfe zu sehen bekommen. Sie nahm es mit Humor. In den folgenden Jahren verbrachten wir so manchen Boxabend im gleichen Raum. Bei Kämpfern, die ihr sympathisch waren oder sagen wir lieber, die ihr optisch gefielen wie Markus Beyer, Sebastian Sylvester oder die Klitschko-Brüder, verfolgte sie das Geschehen sogar mit einigem Interesse. Gaben sich dagegen Timo »Die Deutsche Eiche« Hoffmann oder Nikolay Valuev die Ehre, las sie lieber, malte ein Bild oder klöppelte an der Schmuckspitze für ihr Hochzeitskleid.
Zu den Boxern der ersten Kategorie zählte irgendwann auch Arthur Abraham. Mir gefiel dieser Draufgänger, der, nachdem er die ersten drei bis vier Runden gegen gute Gegner für gewöhnlich abgegeben hatte, förmlich explodierte und den Sieg durch seine harten Schläge errang. Meiner Liebe gefielen wohl hauptsächlich seine nicht zu sehr definierten, aber doch äußerst ansehnlichen Oberarmmuskeln.
So kam der Boxabend des 23. September 2006. Im Hauptkampf stand Arthur Abraham einem gewissen Edison Miranda gegenüber. Beider Kampfrekorde hatten es in sich. IBF-Weltmeister Abraham hatte 21 Kämpfe als Berufsboxer bestritten, alle gewonnen, 17 davon vorzeitig. Mirandas Bilanz las sich noch eindrucksvoller: 26 Kämpfe und Siege, 23 durch K. o. Obgleich keiner der beiden bisher einen Weltklassemann vor den Fäusten gehabt hatte, las sich das doch vielversprechend.
Miranda deutete beim Walk-in mehrfach mit martialischer Geste an, er werde seinem Gegner die Kehle durchschneiden, womit er sich beim Publikum und ganz besonders bei meiner Liebe äußerst unbeliebt machte. Endlich begann der Kampf. Arthur begann für seine Verhältnisse geradezu offensiv, zeigte Einzelschläge und Kombinationen, ließ seinen muskelbepackten Gegner langsam, geradezu hilflos aussehen. Der 2. Runde drückte »Straßenkämpfer« Miranda seinen Stempel auf. Er setzte einen Tiefschlag, der Arthur ausrutschen ließ. Nach dem Schlussgong schlug er nach, worauf sich beide Boxer eine kurze Prügelei lieferten. »Du bist doch klug, nich er!«, fing sich Abraham prompt die verbale Kopfnuss seines Trainers Ulli Wegner ein.
Nach anderthalb Minuten schien Miranda die 3. Runde in der Tasche zu haben, da übernahm Arthur mit beeindruckenden Attacken das Kommando. In der 4. trifft er links wie rechts, klingelt Miranda an. Der kommt gegen Rundenende mit ein paar unspektakulär anmutenden Schlägen durch, da sehe ich Arthurs Mund offen. Er blutet. Ist das nur die Lippe?
In der Ringpause höre ich Arthur etwas sagen, was wie »… gebrochen« klingt. »Ach, da ist jar nüscht jebrochen«, beschwichtigt sein Coach und lässt Schlimmes ahnen. Spätestens jetzt gibt es auch für meine Liebe nichts anderes mehr als diesen Kampf.
5. Runde, Arthurs Mund steht offen, es scheint, als könne er ihn gar nicht mehr schließen. Blut läuft heraus. Beide gehen in den Clinch, Miranda rammt seinen Schädel mit voller Wucht gegen Arthurs Schädel. Der fasst sich ans Ohr, dreht sich ab, krümmt sich. »Intentional headbutt!«, entscheidet der Ringrichter, »Time-out, a foul!« Zwei Punkte Abzug für Miranda, lautet sein Urteil, aber hat das überhaupt noch eine Bedeutung? Der Ringarzt ist bei Arthur, seine prompte Diagnose: »Kiefer ist gebrochen!« – »Kam der Bruch durch jenen Kopfstoß?«, fragt der ARD-Kommentator scheinheilig. Sicher wäre ihm das am liebsten, denn dann bliebe der Verletzte Weltmeister. »TKO!«, höre ich den Ringrichter sagen. Klar, so unfair und brutal Mirandas Foul auch war, es hatte nun mal nicht zum Bruch geführt.
Arthur tut das im normalen Leben Unfassbare. Er sorgt für das Ende jeder Diskussion, indem er signalisiert: Ich kämpfe weiter. Sein Gesicht gleicht kaum noch jenem auf den überlebensgroßen Abraham-Porträts über dem Ring. Der Mund eine einzige, schmerzverzerrte Fratze, aus der unentwegt das Blut rinnt, die linke Wange schwillt mehr und mehr an, während der Rest seines Körpers noch immer die Arbeit eines Boxers verrichtet.
Meine Liebe steht derweil quasi direkt unten am Ring. Es ist keinesfalls das Blut, was sie anzieht. Im Gegenteil, sie muss ihren Blick abwenden, sobald die Kamera Arthurs Gesicht von vorn zeigt. Sie will nur eines: dass er diesen Kampf irgendwie überlebt – und ja, dass er ihn gegen diesen brutalen Verbrecher gewinnt! Das jedoch scheint unmöglich. Arthur Abraham erreicht das Ende der 5. Runde wie ein Ertrinkender den buchstäblichen Strohhalm. »Der ist nicht kaputt!«, brüllt Uli Wegner. Auch Co-Trainer wie Cutman decken ihren Boxer mit Durchhalteparolen ein. Der antwortet mit unverständlichem Gurgeln – und macht weiter!
Runde für Runde, eine quälender als die andere. Arthur blutet, pumpt – und boxt und schlägt. Miranda wird langsamer, und Arthur greift weiter an, trifft seinen Mann wieder und wieder. Sobald er sich im Rückwärtsgang befindet, sieht er aus, als gehe er jeden Moment zu Boden. In der 7. Runde setzt Miranda kurz hintereinander zwei Tiefschläge, wieder zweimal Time-out, wieder zwei Punkte Abzug. Ein weiterer Punktabzug folgt im 11. Durchgang. In der Zeitlupe sehe ich, dass Mirandas Schlag lediglich auf Abrahams Hosenbund landete, aber wen interessiert das jetzt noch? Arthur klammert seinen Gegner mit Hilfe des Ringseils, dann greift er wieder an, eins, zwei – klare Treffer. Schließlich kann er nicht mehr. Auch die Ansprachen seiner Ecke werden bedeutend ruhiger. Alle wissen, jetzt muss er nur noch durchhalten, überleben – und genau das tut er, bis zum Schlussgong.





























