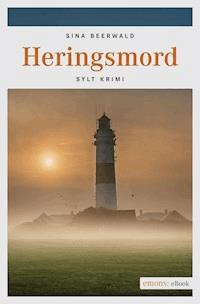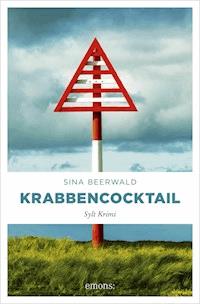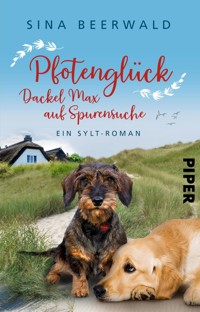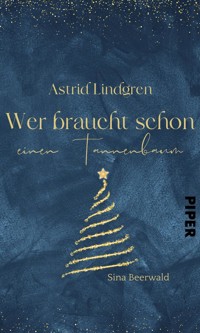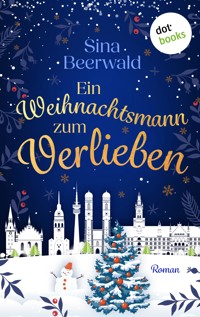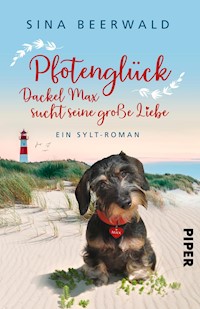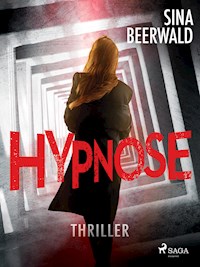Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: 111 Orte ...
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Eine Million Gäste machen jährlich Urlaub auf Sylt, doch der Grundstein für den Tourismus wurde bereits 1857 gelegt. Lange bevor die Champagner-Prominenz auf die Insel kam, schrieb Sylt schon Geschichte(n). Wussten Sie, dass der erste deutsche Bestseller der Nachkriegszeit in einem Sylter Bunker entstand? Dass der Hindenburgdamm nur knapp einer geplanten Sprengung entging und Reichspräsident Hindenburg der Patenonkel eines Sylter Mädchens war? Kennen Sie die Geschichte, warum der erste Kurdirektor von Westerland entmündigt wurde? Entdecken Sie die geschichtsträchtigen und geheimnisvollen Orte Sylts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
111 Orte auf Sylt, die Geschichte erzählen
Sina Beerwald
emons: Verlag
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Emons Verlag GmbH // 2017 Alle Rechte vorbehalten Texte: Sina Beerwald © der Fotografien: Sina Beerwald, außer: siehe Fotonachweis © Covermotiv: fotolia.com/white Gestaltung: Emons Verlag Kartenbasisinformationen aus Openstreetmap, © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL ISBN 978-3-96041-303-5 E-Book der gleichnamigen Originalausgabe erschienen im Emons Verlag
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Inhalt
Vorwort
1_Das Altarbild | Warum das verschwundene Gemälde nie weg war
2_Die Andreas-Dirks-Straße | Ein Maler als Möweneierdieb?
3_Die Apotheke | Kognak als Heilmittel
4_Der Arnikaweg | … der eigentlich Aereboeweg heißen müsste
5_Badekarren und Rüschenkleider | Strandleben anno dazumal
6_Der Bahnhof Munkmarsch | Einstiger Hauptankunftsort aller Sommerfrischler
7_Die Baumannshöhle | Wo der »Verein der Matratzenschoner« tagte
8_Die Bethesda-Heilstätte | Wo skrophulose Kinder Heilung fanden
9_Das Bleick-Peters-Haus | Ein Auswanderer begründet das Altfriesische Museum
10_Das Boy-Lornsen-Haus | »Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt« lernen fliegen
11_Der Burgenbau am Strand | Hier finden Damen liebevolle Aufnahme
12_Das C.-C.-Feddersen-Grab | Ein Maler wird für tot erklärt
13_Das C.-P.-Hansen-Porträt | Ein Lehrer auf der Kirchenempore
14_China-Bohlken | Fernöstliche Schätze als Urlaubssouvenir
15_Conserven und Schokolade | Modje Köhler in ihrem Kuriositätenkabinett
16_Das Conversationshaus | Treffpunkt der ersten Touristen
17_Das Dahlke-Haus | Der Buddha kommt von Sri Lanka nach Sylt
18_Das Damen- und Herrenbad | Strenge Regeln für sündenfreies Baden
19_Die Deckerstraße | Ein Kurdirektor wird entmündigt
20_Die »Dina« vor Rantum | Eine Bergungsaktion macht Schlagzeilen
21_Das Dirk-Meinerts-Hahn-Grab | Ein Sylter in Australien
22_Die Dr.-Nicolas-Straße | Ein Arzt, der kein Honorar wollte
23_Die Dr.-Ross-Straße | Ein Arzt als Werbeikone
24_Die Elisabethstraße | Die rumänische Königin als Märchenerzählerin
25_Der FKK-Strand Abessinien | Wie 74 Postkarten die Justiz beschäftigten
26_Das Franz-Korwan-Haus | Ein verfolgter Sylter Maler
27_Das Frenssen-Grab | Ein Landvogt hat 69 Gläubiger auf den Füßen
28_Der Friesenhof | Gestern und heute
29_Die Fünf-Häuser-Zeit | Rantum als sterbendes Dorf
30_Der Gasthof Königshafen | Austern für den Pastor
31_Der Gasthof Rothes Kliff | Schicksalhafte Begegnung von Rowohlt und Fallada
32_Die Giftbude | Wenningstedts erste Strandversorgung
33_Hablik im Avenarius-Haus | Kriegszeichner auf Sylt
34_Der Hafen Rantum | Rätselhafter Bauschutt
35_Die Halmpflanzer-Hütten | Küstenschutz auf Knien
36_Das Haus Enzian | Marlene Dietrich wird das Geigespielen untersagt
37_Das Haus Erika | Wo Thomas Mann der Sinn nach Grog stand
38_Das Haus Griepke | Operationen an Hühneraugen
39_Das Haus Wohner | Für die Liebe 1.200 Kilometer zu Fuß
40_Das H.B.-Jensen-Kaufhaus | Sylts erster Gemischtwarenladen
41_Das Heiratsbureau | Ehestiftung mit Augenzwinkern
42_Der Henriettenweg | Deutschlands erste Zahnärztin
43_Der Hobokenweg | … und das Suhrkamp-Haus
44_Der Hörnumer Bahnhof | Das einstige Tor zur Insel
45_Der Hörnumer Hafen | Vom Naturhafen zum Ausflugshafen
46_Das Hotel Christianenhöhe | Ein Wirt als Hotelier mit Pioniergeist
47_Das Hotel Hohenzollern | Vom Logierhaus zum Apartmentbau
48_Das Hotel Reichshof | Vom Logierhaus zum Haus der Geschenke
49_Das Hotel Royal | Wo sich einst das Rathaus befand
50_Das Hotel Union | Sylts erstes Hotel
51_Das Hotel zum Kronprinzen | Der Dolch von Hermann Göring
52_Das Hotel zur Nordsee | Wo es Rosa Luxemburg mit Sandflöhen zu tun bekam
53_Der Hugo-Köcke-Weg | … oder auch: »Wollen Se det nach Jewicht vakofen?«
54_Ing und Dung | Rätselhafte Steine im Kirchturm
55_Die Inselbahntrasse | Radfahren auf dem Gleisbett
56_Die Jahrhundertflut 1962 | Das Meer in Westerlands Straßen
57_Der Jens-Mungard-Wai | Ein Sylter Dichter im KZ
58_Das Julius-Meyer-Haus | Ein Logierhaus mit Buchladen und Leihbücherei
59_Der Kampener Bunker | Wo der erste Bestseller der Nachkriegszeit entstand
60_Die Käpt’n-Christiansen-Straße | Oder auch: Käpt’n Corl, ein Westerländer Original
61_Das Kernkraftwerk | Geheime Pläne gelangen an die Öffentlichkeit
62_Die Künstlerklause | Freddy Quinn in Hörnum
63_Das Kurhaus in Kampen | Wo Ernst Rowohlt die guten Bücher roch
64_Der Liliencronweg | Pidder Lüng erobert die Weltliteratur
65_Das Lister Hallenbad | Bombensicherer Schwimmspaß
66_Das Löwenhotel | Schutzhütte und Piratennest in den Dünen
67_Die Lutine-Gedenktafel | Ein Geschenk aus England für den Strandvogt
68_Die Minen im Strandparadies | Die Nordsee als Pulverfass
69_Das Monbijou | Von der Villa zum Hochhaus
70_Die Mörderkuhle | Wo es nie einen Mörder gab
71_Der Morsumer Bahnhof | Der Reichspräsident als Patenonkel
72_Die Mungard-Grabstätte | Ein Keitumer Familienschicksal
73_Die Munkmarscher Mühle | Verschwundenes Wahrzeichen
74_Nolde im Haus Kliffende | Wo er Wein trinkt, als ob er Trinker wäre
75_Der Ostbahnhof | Einstiger Ankunftsort der Zugreisenden
76_Die Panzersperre | Wie der Hindenburgdamm einer Sprengung entging
77_Die Paulstraße | Der erste Sylter Fotograf
78_Die Pension Safari | Wo Gottfried Benn Nordsee und Roulette genoss
79_Die Pesttafel in Morsum | Schreckenszeit auf Sylt
80_Pförtners Photohaus | Von den ersten Strandfotografen
81_Das Projekt Atlantis | Sagenhafte Baupläne in Westerland
82_Die Rantum-Inge | Ein sturmfluterprobtes Gästehaus
83_Der Rantum-Inge-Deich | Wer nicht deichen will, muss weichen
84_Das Restaurant Seestern | Schildkrötensuppe als Spezialität
85_Die Rettungsschwimmertürme | Vom Badewärter zum hauptamtlichen Rettungsschwimmer
86_Vom Ruderrettungsboot | … zum Freiwilligen Rettungs-Corps
87_Die Ruine | Kunstvolles Täuschungsmanöver
88_Das Schloss am Meer | Protest durch Hausbesetzung
89_Die Seebrücke Hörnum | Ankerplatz für Dampfschiffe
90_Der Seefliegerhorst | Sylt als Festung
91_Die Segelfliegerschule | Auf Weltrekordjagd am Roten Kliff
92_Das Spiro-Haus | Wo Emmy Göring Tee trank
93_Die Strandpromenade | Von der hölzernen Wandelbahn zur Flaniermeile
94_Die Straße der Höflichkeit | Einspurig nach Hörnum
95_Stresemann im Miramar | Der dichtende Politiker
96_Der Südbahnhof | Wie er zum Seefahrermuseum und Parkplatz wurde
97_Das Trocadero | Das Lido von Sylt
98_Das Victoria-Hotel | Wo »vornehmster Verkehr« herrschte
99_Victoria Luise auf Sylt | Ein Luftschiff landet in Westerland
100_Die Villa Baur-Breitenfeld | Der Streit um die Zweitwohnungssteuer beginnt 1884
101_Die Villa Roth | Vom Logierhaus zum Hotel am Strand
102_Das Von-Stephan-Denkmal | Die Postkarte kommt nach Sylt
103_Das Walkiefertor | Das etwas andere »Stadttor«
104_Das Walross vor List | Spektakuläres Wettrennen um Fotos
105_Das Warmbadehaus | Von der Badeanstalt zum Syltness Center
106_Das Weidemannhaus | Ein Akt malender Pastor auf Sylt
107_Der Westerländer Bahnhof | Wo Reichspräsident Hindenburg als Erster ausstieg
108_Wiedermanns Wiener Café | Wie der Friesenkeks die Welt eroberte
109_Der Ziegenstall | Wo die Gäste gemolken wurden
110_Zum Deutschen Kaiser | Wo Stefan Zweig einen schwarzen Tag erlebte
111_Zur Erholung | Das Strandcafé, wo der König frühstückte
Bildteil
Übersichtskarten
Vorwort
Wer hätte gedacht, dass der Grundstein für den Tourismus auf Sylt bereits 1857 gelegt wurde, lange bevor die Champagner-Prominenz die Insel entdeckte? Wussten Sie, dass der erste deutsche Bestseller der Nachkriegszeit in einem Sylter Bunker entstand? Dass der Hindenburgdamm nur knapp einer geplanten Sprengung entging und Reichspräsident Hindenburg der Patenonkel eines Sylter Mädchens war? Warum Freddy Quinn in Hörnum war und Marlene Dietrich zwei Mal des Hotels verwiesen wurde? 111-mal Sylter Inselgeschichte(n) erzähle ich in diesem Buch. Seit 2008 lebe ich auf der Insel Sylt, meiner Herzensheimat, und mein Herzensprojekt ist dieses Buch, mit dem ich Sylter Geschichte(n) bewahren und lebendig halten möchte.
Ich habe lange gesucht, geforscht und gefragt – und plötzlich tauchte wieder ein fehlender Puzzlestein auf, und dann war ich wie im Fieber. Dieses Gefühl ist aller Mühen Lohn. Durch verloren geglaubte oder bislang unbekannte Dokumente werden so manche Geschichten widerlegt oder sogar erstmals erzählt.
Ohne die Unterstützung des Sylter Archivs und ohne die fortwährende und unermüdliche Mithilfe von Christa und Maren Stöver, Jörn Radzuweit und Dirk Jacobsen bei der Suche nach historischen Aufnahmen und Informationen hätte dieses Buch so nicht entstehen können. Mein besonderer Dank geht auch an: Kay Abeling, Holger Bernau, Martina Blum, Helga Dahlke, Gretel Droske, Martin Elsen, Jan-Hinrich Frauz, Thomas und Annemarie Hansen, Heidemarie Jordan, Dirk Lässig, Ekkehard Lauritzen, H. Henning Lehmann, Margot und Dirk Lornsen, Cassian von Salomon, Sylta Schmidt, Eugen Schmitz, Pastor Ekkehard Schulz, Martin Tschepe, Dieter und Inge Wangelin, Thomas Weymar.
»Ach, so sah das tatsächlich mal aus« – »Unglaublich, was dort passiert ist« – »Wie spannend, das habe ich noch nicht gewusst«. Ich wünsche mir, dass Sie mit diesen Ausrufen die folgenden Seiten lesen werden.
Sina Beerwald
1_Das Altarbild
Warum das verschwundene Gemälde nie weg war
weiter
Die Kirche in Morsum hat viele Geschichten zu erzählen, wie zum Beispiel die Pesttafel belegt. Die Mysterien beginnen jedoch schon mit der Erbauung der Kirche im 13. Jahrhundert, als die Bausteine bereits auf einem Stück Land im Inselosten lagen, das sich heute im Watt befinden würde. Über Nacht wurden die Steine »von unsichtbarer Hand«, so will es die Sage, an den heutigen Standort der Kirche verbracht. Wem auch immer die Auswahl des Baugrundstücks nicht gepasst haben mag, die Morsumer sahen es als Fingerzeig Gottes und fügten sich.
Unsere Geschichte vom Altarbild nahm ihren unglücklichen Lauf, als man 1738 befand, dass der mittelalterliche Flügelaltar mit der barocken Zeit gehen müsse, und eine komplette Umgestaltung vornahm. 1933 war der Zeitgeist wieder ein anderer. Der barocke Altaraufbau wurde abgenommen, als mittelalterlicher Flügelaltar mit den zwölf Aposteln rekonstruiert sowie mit den drei großen Mittelfiguren Gottvater mit dem toten Christus im Arm, Sankt Martin und Sankt Severin versehen an die Nordwand gehängt.
Info
Adresse Haawerlön 1, 25980 Sylt OT Morsum | ÖPNV Bus 4, Haltestelle Serkwai | Öffnungszeiten Mo–So circa 10–18 Uhr, So um 10 Uhr Gottesdienst | Tipp Hängt das verschwunden geglaubte Altarbild wieder an der Nordwand – allein und gut sichtbar.
Nach dem Krieg die große Aufregung. Wohin ist das schöne barocke Altarbild aus dem Mittelteil mit der Abendmahlsdarstellung und der goldenen Inschrift »Der Mensch prufe aber sich selbst und also esse er von diesem brodt und trincke von diesem kelch Denn welcher unwürdig isset und trincket der isset und trincket ihm selber das Gericht« nach der Umgestaltung verschwunden? Es bleibt verschollen, über 50 Jahre lang. Bis der Altaraufsatz 1999 von seinem Wandplatz abgehängt wird, weil er restauriert werden soll. Und dabei traut der Restaurator seinen Augen kaum: Das verloren geglaubte Gemälde war nie weg. Es hing die ganze Zeit über an der Nordwand, als Rückseite des Flügelaltars von 1933.
Die vier Ovalbilder der Seitenflügel wurden übrigens nicht, wie zeitweilig angenommen, übermalt, sondern 2014 in einem Museum wiederentdeckt.
In der Nähe
Die Pesttafel in Morsum (0.02 km)
Der Morsumer Bahnhof (0.47 km)
Die Panzersperre (2.49 km)
Das Boy-Lornsen-Haus (4.62 km)
Zur Online-Karte
Zum Kapitelanfang
2_Die Andreas-Dirks-Straße
Ein Maler als Möweneierdieb?
zurück
weiter
Um 1900 verzeichnen die Westerländer Kurlisten über 800 Maler als Gäste. An einen gebürtigen Sylter und berühmten Vertreter der Kunst erinnern gleich zwei Straßen: In der Dirksstraße, Ecke Kampende in Tinnum wurde Andreas Dirks 1865 als Sohn eines Schiffskapitäns geboren. Sein Atelier richtete er sich im Haus Windhuk Ecke Steinmann-/Brandenburger Straße ein, das seiner Schwester Paula Kayser gehörte. Dort um die Ecke liegt heute die Andreas-Dirks-Straße. Sein Vater wuchs übrigens als Vollwaise und Verwandter des bekannten Inselchronisten C. P. Hansen eine Zeit lang in dessen Haus auf. Andreas Dirks entdeckte die Reize »seiner« Insel auch von seinem Boot »Nes Pük« aus, und zwar zu einer Zeit, als der Tourismus noch in den Kinderschuhen steckte.
Dirks studierte an der Kunstakademie Düsseldorf, 1916 wurde er Professor und kehrte regelmäßig in seine Heimat zurück. Der kräftige, hochgewachsene Mann mit gezwirbeltem Schnurrbart und hellwachen Augen war eine markante Erscheinung, über die man sich zahlreiche Anekdoten erzählte. So meldete der Leuchtturmwärter Reich 1898 aufgeregt, dass ein Mann mit einem Korb am Lister Ellenbogen suchend herumstreife – der vermeintliche Möweneierdieb entpuppte sich jedoch als Andreas Dirks mit seinen Malutensilien. Als der Maler einmal mit dem Zug unterwegs war, schwappte sein Wein aufgrund der ruckartigen Fahrweise des Lokführers aus dem Glas. Dirks zog die Notbremse. Als der Schaffner den Maler für die Vorsätzlichkeit zu 100 Mark Geldstrafe verdonnerte, brummelte Dirks: »Sie können zweihundert haben, aber sorgen Sie gefälligst dafür, dass ich in Ruhe mein Gläschen austrinken kann.«
Info
Adresse Andreas-Dirks-Straße, 25980 Sylt OT Westerland | ÖPNV Stadtbus A, B, Haltestelle Syltness Center | Tipp Dirks’ Elternhaus steht an der Ecke Dirksstraße/Kampende 52, sein Atelier gibt es nicht mehr. Das Luther-Bildnis und die Darstellung des Sylt-Chronisten C. P. Hansen in der Keitumer Kirche schuf Andreas Dirks.
Bereits im Alter von 57 Jahren starb Dirks in seiner Wahlheimat Düsseldorf. Seinem Anspruch, »die Kraft der Farbe zu erfassen, die Logik des Lichts zu ergründen«, ist er in seinen Aquarellen und Ölbildern im meist impressionistischen Stil treu geblieben.
In der Nähe
Das Monbijou (0.06 km)
China-Bohlken (0.08 km)
Die Villa Roth (0.08 km)
Das Hotel Hohenzollern (0.1 km)
Zur Online-Karte
Zum Kapitelanfang
3_Die Apotheke
Kognak als Heilmittel
zurück
weiter
Gleich drei Ärzte kümmerten sich 1885 um das gesundheitliche Wohlergehen von Insulanern und 3.500 Kurgästen, ebenso war die Logistik zur Einlösung der Rezepte geklärt: »Die Briefkästen für die Apotheke befinden sich im Hause des Badearztes Herrn Dr. Lahusen am Badebureau und im Hotel z. Deutschen Kaiser. Dieselben werden nach Bedarf ein-, zwei- und dreimal täglich geleert.«
In der Theorie wunderbar, doch in der Praxis kam es zu massiven Beschwerden, da sich die Apotheke abgelegen im Inselosten befand. So sah sich der Keitumer Apotheker Erich Schwennen 1885 sogar zu Worten der Verteidigung in der Sylter Zeitung genötigt: »Zur gefälligen Beachtung. Um den vielen, auf den Unterzeichneten gerichteten Anfeindungen entgegen zu treten, fühlt sich derselbe zu nachstehender Klarstellung veranlaßt: Die Apotheke in Keitum gehört der Landschaft Sylt. Es findet der Apotheker daselbst nur eine bescheidene Existenz dadurch, daß die Landschaft demselben Haus-, Geschäfts-Einrichtung und einen gewissen Waarenbestand mieth- und zinsfrei überläßt. – Da also die Apotheke kein persönliches Eigentum ist – und des geringen Umsatzes wegen nicht sein kann – so steht es nicht in der Macht des Verwalters, die Apotheke nach Westerland zu verlegen; ebensowenig ist ihm die Einrichtung einer Filiale möglich, da die Unterhaltungskosten für dieselbe sein jährliches Einkommen übersteigen.«
Info
Adresse Friedrichstraße 17, 25980 Sylt OT Westerland | ÖPNV Stadtbus A, Haltestelle Friedrichstraße-Ost | Tipp Der frühere Eingang ist noch gut erkennbar, erst 1975/76 erfolgten die Verlegung ins Erdgeschoss und die Einrichtung von Arztpraxen im oberen Geschoss.
Die Keitumer Apotheke bestand bereits seit 1825, der frisch verheiratete Schwennen übernahm sie 1880, und er entschloss sich tatsächlich erst 1892 zur eigenen Apotheke in Westerland – erst 1950 kam eine zweite Apotheke hinzu. Wie auf einer Schlosstreppe führten die Stufen hinauf zum Eingang in der Beletage, bewacht von der griechischen Göttin Hygieia als Turmfigur. Seine Werbung würde heute allemal auffallen: »In bevorzugter Lage (Friedrichstrasse) Apotheke und Logirhaus. Bezugsquelle für Weine, Kognak und alle gangbaren Mineralwässer.« Der Begriff »Heilmittel« war früher eben durchaus denkbar.
In der Nähe
Das Haus Enzian (0.03 km)
Die Paulstraße (0.06 km)
Das Julius-Meyer-Haus (0.07 km)
Die Baumannshöhle (0.08 km)
Zur Online-Karte
Zum Kapitelanfang
4_Der Arnikaweg
… der eigentlich Aereboeweg heißen müsste
zurück
weiter
»Wenn ich Jahrzehnte auf Sylt gelebt habe, so ist es die unvergleichliche Meernatur dieser Insel gewesen, die mich gebannt hat und mich durch ihr Wesen immer neu inspirierte.« So begründete der 1889 in Lübeck geborene Maler Albert Aereboe bei seiner Dankesrede am 23. April 1959 im Gasthaus Rotes Kliff – als er zum Kampener Ehrenbürger ernannt wurde, seine Entscheidung – auf Sylt zu leben. Im Jahr zuvor hatte er den Kulturpreis des Landes Schleswig-Holstein erhalten. Der Ehrenabend war zugleich sein Abschied von der Insel, weil es ihn im Alter zurück in seine Geburtsstadt zog.
1925 hatte er sich nach seinen Jahren als Professor in Kassel in List niedergelassen, seiner geliebten und oft gemalten Dünenlandschaft wegen. »Ich arbeite fleißig! In meinen Pausen trete ich aber hinaus vor’s Haus und freue mich über die schöne Natur hier.« An die Frau des Malers Wenzel Hablik, mit der er 26 Jahre lang eine Brieffreundschaft unterhielt, schrieb er: »Wenn man ins Freie trat, lag die ganze Dünenkette vor einem, die das Gelände List mit seinem Königshafen umschloß. Der Kiebitz und die vielen Wasservögel, viele Schafe, Pferde, Kühe, alles auf den satten, tiefer liegenden Wiesen in der Morgensonne.«
Info
Adresse Arnikaweg, 25999 Kampen | ÖPNV Bus 1, Haltestelle Kampen Mitte | Tipp Im Arnikaweg deutet nichts auf Aereboe hin. Auf dem Wenningstedter Friedhof befindet sich sein Grab.
Es hätte ein schönes Leben werden können, doch nur fünf Jahre nach der Hochzeit starb seine Frau, die Malerin und Professorin Julie Katz-Aereboe, die bei Lovis Corinth gelernt hatte, mit nur 47 Jahren. Er blieb dennoch in dem Haus wohnen. Erst als sich das Militär im Ort ausbreitete, zog er zunächst nach Berlin, wo er ausgebombt wurde. So flüchtete er zurück zu seiner Schwägerin nach Kampen in den Hoogenkamp, wo er nach dem Krieg eine Malschule einrichtete.
Der Gemeindevertreterbeschluss, einen Abzweig von der Hauptstraße nach Aereboe zu benennen, wurde übrigens auch nach dem Tod des Malers 1970 nicht umgesetzt – bis heute geht man dort durch den Arnikaweg.
In der Nähe
Hablik im Avenarius-Haus (0.21 km)
Der Gasthof Rothes Kliff (0.45 km)
Der Ziegenstall (0.61 km)
Der Kampener Bunker (0.74 km)
Zur Online-Karte
Zum Kapitelanfang
5_Badekarren und Rüschenkleider
Strandleben anno dazumal
zurück
weiter
Den Startschuss für die Entwicklung des Badelebens gab der Landvogt von Levetzau 1855 mit der Aufstellung der ersten Badekarren am Strand. In jenem Jahr besuchten 98 Gäste die Insel, 1859 waren es bereits 470.
Doch der Chronist Julius Rodenberg war 1859 weniger begeistert: »Erstlich ist das Baden bei Ebbezeit einigermaßen beschwerlich; die Badehäuschen, in denen man sich entkleidet, stehen alsdann so weit vom Wasser, daß man oft zwei Minuten über den Sand und durch die kalte Luft, zuweilen im Regen, laufen muß, ehe man die äußerste Welle fängt.« Wegen der Flut konnten die Karren nicht näher ans Wasser gestellt und aufgrund des weichen Sandes nicht wie andernorts mit Rädern beweglich gemacht werden. Darum baute man auf Sylt Holzhütten auf Kufen, die im Winter per Pferd abgezogen wurden. Um 1910 herum durfte eine Badekarre maximal 45 Minuten benutzt werden und kostete 75 Pfennige, ein Zelt mit zwei Stühlen pro Woche acht Mark, Einsitzer- und Doppelstrandkörbe drei und vier Mark pro Woche.
Info
Adresse Kurpromenade, Brandenburger Strand, 25980 Sylt OT Westerland | ÖPNV Stadtbus A, Haltestelle Friedrichstraße-West | Tipp Über eine halbe Million Gäste kommen jährlich allein nach Westerland. Badekarren gibt es nicht mehr.
»Ein großartiges Meer, ein Strand meilenlang ausgebreitet, wie der köstlichste Samtteppich, die phantastische Dünenwelt, die hehre Schönheit der ganzen Insel«, schwärmte der Kurgast Dr. Ross 1856. Und 1906 beschreibt ein Reiseführer die Szenerie: »Der Brennpunkt des gesellschaftlichen Lebens ist der Strand, auf welchem sich die vornehme, internationale Badegesellschaft vereinigt in sorgloser Behaglichkeit einem fröhlichen Lebensgenusse hingiebt.« In Maßen, versteht sich. »Für das Baden sind vollständige, hochgeschlossene Badekostüme von dunkler Farbe zu benutzen, welche zur Bequemlichkeit der Badegäste in Westerland selbst, in allen einschlägigen Geschäften in reicher Auswahl zu erhalten sind.« Muster zulässiger Badebekleidung konnten im Badebureau eingesehen werden.
In der Nähe
Stresemann im Miramar (0.04 km)
Die Strandpromenade (0.06 km)
Das Heiratsbureau (0.08 km)
Der Burgenbau am Strand (0.11 km)
Zur Online-Karte
Zum Kapitelanfang
6_Der Bahnhof Munkmarsch
Einstiger Hauptankunftsort aller Sommerfrischler
zurück
weiter
»Eine stürmische Fahrt durch das Inselmeer, die einen Tag lang dauerte, dann noch zwei Stunden bei blasendem Weststurm auf offenem Wagen durch Sand und Heide bis in ein kleines, niedriges Friesenhaus neben der Dünenhalle …«, so klang eine Anreisebeschreibung 1868, als es noch keinen Hindenburgdamm gab und Munkmarsch der zentrale Ankunftshafen war. Angesichts der 5.500 Badegäste im Jahr 1887 sei dies ein unhaltbarer Zustand, wie der Seebadbesitzer Dr. Pollascek Minister Maybach vortrug, und der Kreis erteilte eine Betriebskonzession für eine Kleinbahn von Munkmarsch nach Westerland bis auf Widerruf – ohne die erhoffte finanzielle Unterstützung.
Am 8. Juli 1888 findet nach nur siebenwöchiger Bauzeit um 14.15 Uhr die 4,2 Kilometer lange Einweihungsfahrt statt. »Der erste Dampfwagen zieht jetzt seine graue, wirbelnde Rauchspur über die braune Inselheide«, berichtet die Sylter Kurzeitung.
Info
Adresse Hafen Munkmarsch, 25980 Sylt OT Munkmarsch | ÖPNV Bus 3, 3a, Haltestelle Munkmarsch Hafen | Tipp Im linken Gebäudeteil des Hotels »Fährhaus« erkennt man noch das als Wartesaal und Restauration konzipierte Ankunftsgebäude.
Der Bau des Bahnhofs Munkmarsch, aus dem das heutige Fährhaus-Hotel hervorging, kostete 750 Mark, die Bahn-Gesamtbaukosten beliefen sich auf 131.400 Mark – die Dr. Pollascek aus der eigenen Schatulle bezahlte.
Acht Mann Personal bedienten anfangs beide Bahnhöfe und die Zugstrecke, auf der die Dampfloks »Präsident von Maybach« und »Herzog Maximilian von Württemberg« fuhren. Bahnmeister Sprenger war zeitweilig Zugführer, Schaffner und Gepäckträger in einer Person. Zugtickets kosteten eine Mark – für zwölf Minuten Fahrtstrecke ein hoher Preis, da nahm so mancher doch lieber wieder die Kutsche. Es sei denn, er wollte sein Pferd mit dem Zug transportieren, das kostete zwei Mark – Ferkel, Lämmer und Geflügel in Körben 30 Pfennige. Schwarzfahrer hat es damals auch schon gegeben, nur der Tonfall hat sich verändert: »Wir erlauben uns sehr ergebenst anzuzeigen, daß der Zimmermann Heinrich Friedrich Mißfeldt, wohnhaft bei Steffens, hierselbst am 23. d. M. ohne Fahrausweis angetroffen wurde.«
In der Nähe
Die Munkmarscher Mühle (0.35 km)
Vom Ruderrettungsboot (1.52 km)
Die Segelfliegerschule (1.65 km)
Das Frenssen-Grab (1.98 km)
Zur Online-Karte
Zum Kapitelanfang
7_Die Baumannshöhle
Wo der »Verein der Matratzenschoner« tagte
zurück
weiter
»Wer sich in Westerland erholt, ist selbst schuld.« Das war die Parole eines legendären Vereins, der am 30. Juli 1930 von Rechtsanwalt und Notar Busch, genannt »Buschi«, gegründet wurde und zu dessen Mitgliedern keine Geringeren als Marlene Dietrich, Max Schmeling und Hans Albers zählten: »Der Verein der Matratzenschoner«. Zu den Statuten gehörte, dass jedes ankommende Mitglied sich unverzüglich beim Präsidenten zu melden hatte und eine Ankunftsrunde schmeißen durfte. Gefeiert wurde, denn der Name war schließlich Programm, bis morgens um fünf im Nachtlokal Baumannshöhle in der Paulstraße 3, das sich bereits 1906 als »grösste Sehenswürdigkeit der ganzen Insel« bezeichnete. Frauen durften übrigens laut den Statuten eigentlich nicht aufgenommen werden – Marlene Dietrich war die einzige Ausnahme. Das in den Sommermonaten erscheinende Klatsch-Blättchen »Die Qualle« gibt darüber Auskunft.
Bei Pilsner Urquell, Münchner und Elbschloss-Bier und in den Goldenen Zwanzigern vor allem mit jeder Menge Sekt und Champagner konnten die Gäste, umgeben von »Wand-Dekorationen berühmter Künstler«, feiern. Erfrischt wurden sie durch eine »Ventilation mit Elektromotor«, die dem Besitzer in seiner Anzeige eine eigene Erwähnung wert war. Kunigunde Socher, genannt Gundel, war eine der Kellnerinnen und erlebte, wie sich die insgesamt sieben dicken, in Leder gebundenen Gästebücher mit Eintragungen in sämtlichen Sprachen füllten.
Info
Adresse Paulstraße 3, 25980 Sylt OT Westerland | ÖPNV Stadtbus A, Haltestelle Friedrichstraße-Ost | Öffnungszeiten Mi–Mo ab 18 Uhr, Küche 18–23 Uhr | Tipp In dem Gebäude befindet sich heute das American Bistro, und die Paulstraße ist noch immer ein beliebtes Ziel für Nachtschwärmer.
Zum Vereinsabzeichen wurde eine Möwe gewählt, die in ihren Krallen drei Knobelwürfel mit Einsen hält. Natürlich durfte auch eine entsprechende Fahne nicht fehlen, die während der Nazizeit nicht gehisst werden durfte, doch Henriette Baumann, genannt Henny, holte sie nach Kriegsende und dem gleichzeitigen Tod ihres Mannes Reinhold, »dem Riesen«, 1945 wieder hervor und feierte mit dem Verein noch 1960 mit 18 Mitgliedern das 30-jährige Bestehen. Sie starb 1980 im Alter von 80 Jahren in Westerland.
In der Nähe
Das Haus Enzian (0.06 km)
Die Apotheke (0.08 km)
Das H.B.-Jensen-Kaufhaus (0.1 km)
Die Paulstraße (0.1 km)
Zur Online-Karte
Zum Kapitelanfang
8_Die Bethesda-Heilstätte
Wo skrophulose Kinder Heilung fanden
zurück
weiter
»Am 03.07.1890 konnte das eigene Heim der Kinderheilstätte, dies großzügige Werk der Nächstenliebe, das minderbemittelten Kindern Aufenthalt und Erholung gibt, eingeweiht werden«, berichtet die Sylter Zeitung. Der Grundstein war bereits 1887 im Verbund mit dem »Verein für Kinderheilstätten an den deutschen Seeküsten« in angemieteten Räumen gelegt worden.
Unter Leitung von Diakonissen nahm es von Mitte Mai bis Ende Oktober Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren auf. 1910 wurde das ursprüngliche Haus durch einen Anbau nach dem Entwurf des Westerländer Architekten Bomhoff erheblich vergrößert und das Personal verdoppelt, sodass nun 76 Kinder aufgenommen werden konnten. 44.000 Mark kostete der Anbau, wobei 40.000 Mark von der Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein übernommen wurden. Behandelt wurden »vorzugsweise skrophulose Kinder«, 60 Prozent von ihnen bekamen einen Freiplatz, ansonsten mussten um 1910 pro Woche 25 Mark für den Aufenthalt bezahlt werden. Dr. Nicolas, der seit 1887 der Kinderheilstätte vorstand, wies bei der Eröffnungsrede des Neubaus darauf hin, »daß das Gerede, daß man Kinder nicht mit nach Sylt nehmen dürfe, durch die Erfolge in ›Bethesda‹ widerlegt« sei. Die Badeverwaltung rief regelmäßig zu Spendenaktionen auf, es wurden Wohltätigkeitskonzerte veranstaltet, und die Kurzeitung wurde nicht müde, die Namen von Urlaubsgästen als private Spender zu veröffentlichen, darunter auch die rumänische Königin, die 300 Mark spendete. Zum Vorstand des Kinderheims gehörten Anfang des 20. Jahrhunderts neben dem Arzt Dr. Nicolas Bürgermeister Frommhold, Pastor Nielsen und der Kaufmann Dirk Boy Brodersen als Schatzmeister.
Info
Adresse Schützenstraße 20, 25980 Sylt OT Westerland | ÖPNV Stadtbus A, Haltestelle Schützenplatz | Tipp An der Stelle der Kinderheilstätte steht heute das Dorint Hotel.
Heutzutage erinnern sich noch viele Insulaner grinsend an ihre Kinderzeit, in der sie, vom Hausmeister verfolgt, über die Mauern des Kinderheims kletterten, um dort im Sandkasten zu spielen oder mit den Mädchen anzubandeln.
In der Nähe
Das Victoria-Hotel (0.13 km)
Der Südbahnhof (0.28 km)
Die Dr.-Ross-Straße (0.29 km)
Das Damen- und Herrenbad (0.38 km)
Zur Online-Karte
Zum Kapitelanfang