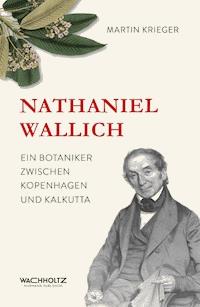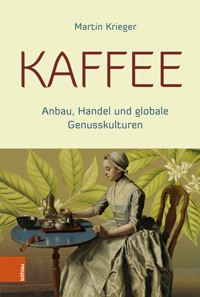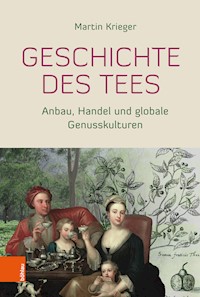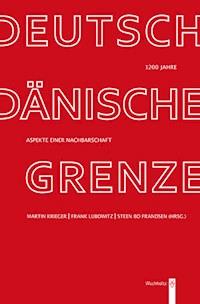
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wachholtz
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Im Jahre 811 wurde die Eider erstmals als Grenze zwischen dem Karolingerreich und Dänemark in den Quellen genannt. Beinahe ein Jahrtausend lang stellte dieser Fluß nicht nur die physische Grenze dar, sondern bildete ebenso Erinnerungsort wie später Gegenstand nationaler Debatten. Aber auch die nachfolgenden Grenzziehungen an der Königsau und nördlich der Stadt Flensburg konstituieren Orte der Abgrenzung wie auch der Schaffung kollektiver Identitäten - und sind es bis heute geblieben. Das Buch untersucht die lange Geschichte der deutsch-dänischen Grenze in ihrer zeitlichen und inhaltlichen Breite und will Impulse für einen neuen Blick auf das Thema liefern. Mit Beiträgen von Martin Krieger, Alexander Drost, Hansjörg Küster, Ulrich Müller, Oliver Auge, Nils Hybel, Bjørn Poulsen, Kurt Villads Jensen, Wolfgang Burgdorf, Michael Bregnsbo, Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt, Torsten Fried, Jan Schlürmann, Lars Henningsen, Steen Bo Frandsen, Inge Adriansen, Frank Lubowitz, Karl Christian Lammers, Thomas Steensen, Katrin Leineweber, Martin Klatt und Manfred Bornewasser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Deutsch
1200 JAHRE
Dänische
Grenze
TAGUNGSBAND
STEEN BO FRANDSEN
MARTIN KRIEGER
FRANK LUBOWITZ
zeit+geschichte
Sparkassenstiftung Schleswig–Holstein
Band 28
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Ton- und Bildträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
Print: ISBN 978-3-529-02865-6
E-Book: ISBN 978-3-529-09205-3
www.wachholtz-verlag.de
© 2013 Wachholtz Verlag, Neumünster
Vorwort
Für das Jahr 811 wird in den Quellen erstmals die Eider als Grenze zwischen dem Fränkischen Reich und dem entstehenden Dänemark genannt. Das zwölfhundertste Jubiläum des denkwürdigen Geschehens an der Eider im Jahre 2011 bot Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Rahmen einer internationalen Fachtagung in Kiel Gelegenheit, in ausführlicher Tiefe über die lange Geschichte der dänischdeutschen Grenze und ihre Entwicklung nachzudenken. Der Ertrag dieser Konferenz findet sich nunmehr in dem vorliegenden Buch gebündelt.
Die Herausgeber sprechen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, der Syddansk Universitet, dem königlich dänischen Generalkonsulat in Flensburg, der deutschen Botschaft in Kopenhagen und dem Bund Deutscher Nordschleswiger ihren herzlichen Dank für die Unterstützung der Tagung aus; gleiches gilt auch für die Käserei Holtsee, die kulinarisch zum Erfolg der Konferenz beitrug. Frau Saskia Helgenberger (Kiel) beteiligte sich mit großem Engagement an der Erarbeitung des Druckmanuskriptes.
Zu besonderem Dank sind die Herausgeber der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein verpflichtet, die in großzügiger Weise die Entstehung und Herausgabe dieses Bandes ermöglicht hat.
Steen Bo Frandsen
Martin Krieger
Frank Lubowitz
Kiel, Sonderburg und Apenrade,
im Januar 2013.
Inhalt
Vorwort
Inhalt
Einleitung
Martin Krieger
Die Grundlagen
Historische Grenzräume und kognitive Grenzziehungen der Gegenwart
Alexander Drost
Natürliche Grundlagen von Grenzen in Schleswig–Holstein
Hansjörg Küster
Mittelalter: Vom Grenzsaum zur linearen Grenze
Grenzen, Grenzregionen und Grenzüberschreitungen in archäologischer Perspektive
Ulrich Müller
Konflikt und Koexistenz. Die Grenze zwischen dem Reich und Dänemark bis zur Schlacht von Bornhöved (1227) im Spiegel zeitgenössischer Quellen
Oliver Auge
Marca und Feudum – Das dänische Königtum und der Kaiser, 842–1214
Nils Hybel
Was trennte Schleswig von Holstein im späten Mittelalter? Von frühem Nationalbewusstsein und Fürstentreue
Bjørn Poulsen
Das dänische Imperium. Idee und Konzept – und einige Beispiele aus dem Mittelalter
Kurt Villads Jensen
Frühe Neuzeit: Die Grenze im Zeitalter frühmoderner Staatlichkeit
Die frühneuzeitlichen Grenzen des deutschen Reiches in staatsrechtlicher und politischer Hinsicht
Wolfgang Burgdorf
Das dänische Imperium der Frühen Neuzeit in der norddeutschen Historiographie
Michael Bregnsbo
Die holsteinische Landesstadt Hamburg auf dem Weg in die Reichsunmittelbarkeit und zur Freien Stadt
Klaus–Joachim Lorenzen–Schmidt
Eine Propagandamedaille für zwei Herrscher: Karl VII. und Christian VI.
Torsten Fried
Eider und Eiderkanal im Wirtschaftsnetz des dänischen Gesamtstaates, 1784–1863
Jan Schlürmann
19. – 21. Jahrhundert: Zwischen nationalem Diskurs und europäischer integration
Sprach–, Kirchen– und Identitätsgrenzen. Schleswig als komplizierter Fall
Lars Henningsen
Die deutsch–dänische Grenze im Zeitalter der nationalen Gegensätze
Steen Bo Frandsen
Dänemark bis an die Eider! Die deutsch–dänischen Grenzen als Erinnerungsorte im 19. und 20. Jahrhundert
Inge Adriansen
„Grenzland Schleswig“ – Die Clausen–Linie und die Grenzziehung von 1920 zwischen Eider und Königsau
Frank Lubowitz
Die neue dänisch–deutsche Grenze als „Versailles–Grenze“. Die Grenzfrage in den dänisch–deutschen Beziehungen 1933–1955
Karl Christian Lammers
Die Nordfriesen an der Grenze
Thomas Steensen
Die Eider als historische Kulturlandschaft. Von der Quelle bis zur Mündung
Katrin Leineweber
Euroregion Schleswig, Sønderjylland/Schleswig, Sønder – jylland – Schleswig, Syddanmark – Schleswig–Holstein. Von der Grenze zur grenzüberschreitenden Region?
Martin Klatt
Die deutsch–dänische Grenze zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Vergleich: Ein Ort der Trennung oder der Kooperation?
Manfred Bornewasser
Quellen und Darstellungen
Einleitung
Martin Krieger
1200 Jahre deutsch-dänische Grenze? Zu Recht mag die Leserin oder der Leser dieses Buches einwenden, dass es vor 1200 Jahren weder ein Dänemark noch ein Deutschland gab – ganz zu schweigen von einer gemeinsamen Grenze. Dennoch entwickelte eine denkwürdige Begebenheit an der Eider im Jahre 811 eine Nachhaltigkeit, die uns durchaus berechtigt, in jenem Jahr den Beginn einer Entwicklung zu sehen, die auch heute noch nicht abgeschlossen ist: das kontinuierliche Aushandeln und Überwinden, aber auch den Konflikt um eine wie auch immer geartete Trennungslinie zwischen Dänisch und Deutsch. Lag jene zunächst als weiter Grenzsaum irgendwo im unwegsamen Raum zwischen Eider und Schlei/Danewerk, nahm sie im Laufe der Jahrhunderte immer stärker Kontur als eine konkrete Grenzlinie an. Seit dem hohen Mittelalter lag die Grenze schließlich als mehr oder weniger eindeutig definierte Linie an der Eider, wechselte dann aber in den vergangenen beiden Jahrhunderten mehrmals ihre Lage: Mit dem letztlich gescheiterten Versuch der Inkorporation Holsteins in die dänische Monarchie 1806 lag sie kurzfristig an der Elbe, seit 1864 an der Königsau und seit 1920 an ihrer gegenwärtigen Stelle.
Der vorliegende Band beschäftigt sich mit der langen Geschichte erst der dänisch-karolingischen und dann der dänisch-deutschen Grenze. Welche natürlichen Voraussetzungen legten den konkreten Grenzverlauf nahe – oder verliefen die natürlichen Grenzen vielleicht in gänzlich anderer Richtung? Wie stellten sich die Menschen in der Vergangenheit überhaupt eine Grenze vor? Wie entwickelte sich aus einem breiteren Grenzsaum im Laufe der Geschichte die lineare Grenze, wie wir sie heute kennen? Weshalb besitzt jene seit dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein nicht nur Bedeutung als staatliche, administrative oder rechtliche Scheidelinie, sondern auch als ein nationales Symbol, als ein emotionsgeladener Erinnerungsort? Wie sieht ihre Zukunft im Kontext eines immer stärker Kontur annehmenden „Europa der Regionen“ aus? Diese Fragen bieten ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Anlass, jeweils für die von ihnen erforschte Epoche nach Antworten zu suchen und Zusammenhänge darzulegen. Dabei gliedert sich der Band in vier Teile, von denen sich der erste mit den Voraussetzungen, der zweite mit dem Mittelalter, der dritte mit der Frühen Neuzeit und der vierte mit dem 19. und 20. Jahrhundert beschäftigt. Den besonderen Reiz dieses Buchprojektes macht der multinationale Ansatz aus. So stehen die dänische und die deutsche Geschichtswissenschaft jeweils in ihrer ganz eigenen Tradition, die selbst zu einem großen Teil aus den historischen Befindlichkeiten des 19. Jahrhunderts herrührt. Mit diesem Buch wird zwar nicht der Versuch unternommen, die historiographischen Traditionen in Dänemark und Deutschland zu überwinden – aber sie sollen dargestellt und miteinander in Bezug gesetzt werden.
Eine Grenze stellt nicht allein physische Realität dar, sondern sie entsteht in vielleicht noch größerem Maße in den Köpfen der Menschen. Sie schafft Strukturen im Raum und bedingt gleichzeitig die Interaktion zwischen verschiedenen Staaten, Kulturen, Sprach- oder Konfessionsräumen. Dabei entspricht eine historisch gewachsene Grenze zwischen zwei Territorien nicht automatisch den natürlichen Scheidelinien – im Falle der kimbrischen Halbinsel also den in nord-südlicher Richtung verlaufenden Linien zwischen Marsch, Sanderrücken und dem östlichen Moränengebiet oder der das Land in dieselbe Richtung durchziehenden Wasserscheide zwischen Nord- und Ostsee. Auch ein landläufig als Grenze angenommener Fluss kann oftmals weniger eine Trennmarke als vielmehr ein Bindeglied darstellen. Und so war auch die Eider viele Jahrhunderte lang nicht allein die Südgrenze Schleswig-Dänemarks, sondern in vielleicht noch bedeutenderem Maße ein Handelsweg vor allem für den regionalen Handel Holstein und Schleswigs, insbesondere nach der Eröffnung des Schleswig-Holsteinischen Kanals 1784.
Ebenso erweist sich der vermeintlich unveränderliche lineare Verlauf von Flüssen nur als theoretische Annahme, wie das Beispiel des Rheins zeigt: heute in Deutschland liegende Dörfer konnten morgen schon durch die Verlagerung einer Flussschleife zu Frankreich gehören. Auch wenn sich die Eider in der Geschichte vielleicht nicht ganz so unwägbar zeigte wie der Rhein, verlief auch hier die Grenze alles andere als eindeutig, sondern musste im Zuge politischer Interaktion immer wieder neu verhandelt werden. Ein Beispiel mag das illustrieren: So gilt die Stadt Rendsburg, deren ursprünglicher Kern sich auf einer inmitten der Eider gelegenen Insel befindet, spätestens seit dem 13. Jahrhundert als zu Holstein gehörig. Diese Annahme entspricht auch weitgehend den geographischen Tatsachen, verläuft doch der Hauptarm des Flusses nördlich der Altstadtinsel. Die territoriale Zuordnung wurde im Laufe der Frühen Neuzeit aber in zunehmendem Maße infrage gestellt. Als der städtische Rat etwa im Jahre 1671 den Antrag an den König richtete, das ebenfalls auf der Insel liegende Schlossgelände auch der städtischen Gewalt zu übertragen, wurde diesem Ersuchen nur unter der Prämisse stattgegeben, jenes unterstände dem König „alß Hertzogen zu Schleswig“1. Nun lag, zumindest der dänischen Vorstellung nach, die Grenze nicht mehr im Bereich des Hauptarmes, sondern beim weiter südlich gelegenen Mühlengraben, der die Altstadtinsel durchschnitt. Als im Jahre 1726 der Eiderstein mit der berühmten Inschrift „Eidora Romani Imperii Terminus“ angebracht wurde, geschah das am Altholsteiner Tor südlich der Altstadtinsel, also vor dem Holstengraben. Im Laufe der Zeit rückte die Grenze im Bereich Rendsburgs also stückweise immer weiter nach Süden. Bemerkenswerterweise steht auf jenem heute im Kopenhagener Tøjhusmuseum aufbewahrten Stein nicht, hier ende Dänemark, sondern die Inschrift besagt, die Eider sei die Nordgrenze des Heiligen Römischen Reiches. Es ging also nicht um Selbstdefinition aus dem eigenen Territorium heraus, sondern um eine Abgrenzung vom Heiligen Römischen Reich.
Nur schemenhaft entrollen sich uns die Anfänge der langen Geschichte von Grenzen auf dem Gebiet des heutigen Schleswig-Holstein und im Süden Dänemarks. Schon in der römischen Eisenzeit errichteten vermutlich die frühen Stammesfürsten Wallanlagen, die sich wie Sperrriegel über die Hauptroute des Landhandels zwischen Nord und Süd, den Ochsenweg oder Heerweg, legten. In Nordschleswig sind heute noch Vendersvold nördlich von Rødekro/Rothenkrug und Olgerdiget östlich von Tinglev/Tingleff andeutungsweise im Landschaftsbild nachzuvollziehen. Aber auch das Danewerk ist deutlich älter als es die bislang erfolgte dendrochronologische Datierung auf das Jahr 737 vermuten lässt.
Archäologen wie Historiker haben uns in den vergangenen Jahren auch in anderer Hinsicht gelehrt, von liebgewonnenen Vorstellungen Abschied zu nehmen. So stellte nach neuesten archäologischen Erkenntnissen der sogenannte „Limes Saxoniae“ keineswegs einen scheidenden, undurchdringlichen Saum zwischen dem Land der Sachsen und Slawen dar, sondern war in großem Maße durch kulturelle Austausch- und Überlagerungsprozesse geprägt und ist vielleicht eher ein intellektuelles Konstrukt denn historische Wirklichkeit. Auch die Grenze zwischen Dänemark und Deutschland (oder zwischen Dänisch und Deutsch) ist heute alles andere als eindeutig definierbar. Für die Anfänge erweist sich die traditionelle Ortsnamenforschung nur als bedingt tauglich, um ethnische Grenzen klar zu definieren, wie uns etwa auch die jahrzehntelange Debatte um die skandinavischen Ortsnamen im wikingerzeitlichen England lehren kann.
Etwas klarer wird das Bild mit der wachsenden Dichte schriftlicher Überlieferung, auch wenn diese von Anfang an alles andere als wertfrei ist, wie beispielsweise eine Analyse der Fränkischen Reichsannalen offenbart. Mit den Sachsenkriegen und dem fränkischen Machtzuwachs in Nordalbingien hatte sich das Reich Karls des Großen seit den letzten Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts immer weiter in nördliche Richtung ausgedehnt. Bald schon erstreckte sich die karolingische Macht bis an die Eider – wobei wir in dieser frühen Zeit sicherlich noch nicht von einer vollständigen territorialen Durchdringung des nördlich der Elbe liegenden Landes ausgehen können. Jenseits der Eider bildete sich etwa zur selben Zeit ein dänisches Regionalkönigtum heraus, von deren Herrschern wir allerdings meist nicht mehr als den Namen wissen – bisweilen nicht einmal den. Der signifikante Aufstieg des Handels zwischen südlicher Nord- und Ostsee über die Schleswiger Landenge, Haithabu und die Schlei, machte die sich herausbildende Grenzregion zwischen dem Frankenreich und den dänischen Landen für die frühmittelalterlichen Herrscher der Region gleichwohl interessant – denn eine Kontrolle des Handels bedeutete gleichzeitig, dessen Überschüsse abschöpfen und damit die eigene Staatlichkeit festigen zu können.
Der Kontakt zwischen dem expandierenden Karolingerreich und den frühen Dänen musste unweigerlich zum Konflikt um den Einfluss in dieser wirtschaftlich interessanten und dynamischen Region führen. Eine frühe oder vermutlich erste Auseinandersetzung führte im Frühjahr 811 zum Friedensschluss: Zwölf „vornehme Männer“ trafen sich an der Eider, nahmen einander den Eid ab und schlossen Frieden. Mit dem Frieden wurde – wie Helmold von Bosau später ausführt – die Eider als Grenzfluss zwischen beiden Reichen festgelegt. Inwieweit der Fluss aber schon in der zeitgenössischen, karolingischen Wahrnehmung eine abgrenzende Rolle spielte, oder ob es sich bei dieser Vorstellung um eine spätere Rückprojektion handelte und nicht eher von einer unscharfen, variablen Grenzregion ausgegangen werden kann, ist zu untersuchen.
Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die Eider schließlich aber doch zur linearen, staatsrechtlichen Grenze zwischen dem Heiligen Römischen Reich und dem Königreich Dänemark. Während Holstein Teil des Reiches war, bildete sich Schleswig im ausgehenden Mittelalter als ein dänisches Fürstenlehen heraus. Doch noch bis heute haben sich die Spuren des ursprünglich unwegsamen Grenzsaumes zwischen Eider und der Schlei-Danewerk-Linie erhalten. Wo könnte der trennende Charakter des einsamen, dünnbesiedelten Sanderrückens deutlicher zutage treten als im Kropper Busch am alten Ochsenweg und an der modernen Chaussee, wo der Reisende dereinst (und auch heute noch) mit dem Hinweis „Du büs Kropper Busch noch ni vörbi“ vor Treibsand und Räubern gewarnt wurde?
In der Frühen Neuzeit spielte die Eidergrenze eine ebenso große Rolle für Staatsrecht und Politik wie sie sich sozial, ökonomisch, kulturell und dynastisch als durchlässig erwies. Schon längst hatte sich die deutsche Sprache in weiten Teilen des südlichen Schleswig durchgesetzt und auch die Fürsten des Landes besaßen Gebiete in Schleswig wie in Holstein – das dänische Königshaus ebenso wie die Gottorfer Herzöge oder die „abgeteilten“ Sonderburger Linien. Die großen Adelsfamilien des Landes besaßen in beiden Herzogtümern Grundbesitz und Herrenhäuser.
Auch wenn die staatsrechtliche Bedeutung der Eidergrenze im Laufe der Zeit durch die zahllosen Verflechtungen zwischen Nord und Süd immer mehr zurückging, erlebte sie gleichwohl im 19. Jahrhundert eine Renaissance als nationales Symbol und Erinnerungsort. Ihr vermeintlich national abgrenzender Charakter wurde im Kontext der dänischen Verfassungsdebatte der 1840er Jahre in eine scheinbar uralte Vergangenheit zurückprojiziert, wie von schleswig-holsteinisch-deutscher Seite gerade das grenzüberschreitende Moment der „up ewich ungedeelten“ Herzogtümer (freilich unter national-deutschem Vorzeichen) propagiert wurde. Die Chance zur Aufrechterhaltung einer multinationalen, gesamtstaatlichen Identität wurde in jener Zeit schlichtweg verspielt. Als von vielleicht noch größerer Bedeutung für die mentale Wahrnehmung der Grenze erwiesen sich der Deutsch-Dänische Krieg 1864 und der Verlust Schleswig-Holsteins für die dänische Krone. Im Zeichen des Selbstbestimmungsrechts der Völker entstand schließlich 1920 die auch heute noch bestehende Grenze zwischen Dänemark und Deutschland ungefähr im Bereich der alten Sprachgrenze. Anfangs unter Dänen und Deutschen heftig umkämpft und diskutiert (was auch diese Grenze zu einem Erinnerungsort macht), hat sich deren Festlegung auf lange Sicht doch als sehr weitsichtig und klug erwiesen. Im Zweiten Weltkrieg kaum infrage gestellt, bot sie 1955 einen Ansatzpunkt zu einem allmählichen, wenngleich nachhaltigen Ausgleich zwischen Nord und Süd. Seitdem kommt gerade den nationalen Minderheiten diesseits und jenseits der Grenze eine tragende Rolle bei der politischen Interaktion und dem zwischenmenschlichen Kontakt zu.
Nicht nur in den Quellen seit der Karolingerzeit erweist sich die Grenze als ambivalent, sondern in noch viel größerem Maße in der Historiographie besonders des 19. und 20. Jahrhunderts. So kommt es auch bei einer vermeintlich unbestechlichen und wertfreien historischen Betrachtung in Wirklichkeit immer auf den Blickwinkel an. Schon die Humanisten des 16. Jahrhunderts legten den Beginn nationaler Eigenständigkeit in eine ferne Vorvergangenheit. Dieses Muster kommt auch bei der Erforschung der dänisch-deutschen Beziehungen und insbesondere der Grenzproblematik zum Tragen. Die Geschichte erweist sich dabei meist als die Geschichte der Mächtigen – sei es zum 17. und 18. Jahrhundert mit einem gegenüber den norddeutschen Nachbarn übermächtigen dänischen Imperium oder nach 1864/1871 mit einem schwergewichtigen Preußen-Deutschland. Erst allmählich wichen die traditionellen Denkmuster einer moderneren, methodengeleiteten Forschung.
Dieser Wandel in jüngerer Zeit korrespondiert mit der politischen, ökonomischen und zwischenmenschlichen Situation an der Grenze heute. Trotz aller Debatten um eine Wiedereinführung von Grenzkontrollen – wie sie etwa im Mai 2011 in Dänemark aufgekommen waren – und eines gewissen Europa-Skeptizismus steht die deutsch-dänische Grenze in Realität und Diskurs heute vielleicht entspannter dar als jemals zuvor. Auch die dänische und die deutsche Geschichtswissenschaft haben sich einander geöffnet, ohne freilich legitime eigene Forschungstraditionen auf dem Weg zueinander über Bord zu werfen. Dass gerade Dänemark tatsächlich nach langer Zeit wieder in der gemeinsamen gesamtstaatlichen Vergangenheit angekommen ist, zeigt nicht nur das gegenwärtig tiefe Interesse an Schleswig-Holstein, wie es in dänischen Buch- und Forschungsprojekten seinen Ausdruck findet, sondern auch das wachsende Bemühen um eine Erforschung der dänischen Kolonien in Übersee. Diese Öffnung sollten wir als Chance begreifen, die Grenze in unseren (auch akademischen) Köpfen weiter zu überwinden, ohne allerdings unsere Traditionen und liebgewonnenen Eigenheiten ganz aufzugeben. In diesem Sinne möchte der Band als Anregung dienen und zum Nachdenken anregen.
Anmerkungen
1 Zit. n.: Hoop, Geschichte der Stadt Rendsburg, S. 243.
Die Grundlagen
Historische Grenzräume und kognitive Grenzziehungen der Gegenwart
Alexander Drost
Einleitung
Von der Friedhofsmauer bis zur Staatsgrenze schaffen Grenzen in unserem Alltag Ordnung. Sie können Menschen ein- und ausschließen, Rechte gewähren oder verweigern sowie Menschen- oder Warenströme verhindern. Grenzen schaffen auf diese Weise einen Raum, in dem sich Menschen verorten können und zusammen mit Kultur, Sprache und Traditionen bietet dieser Raum einen Identifikationspunkt, der von anderen Räumen getrennt ist. In der Beziehung zum „Anderen“ bildet sich in diesem meist staatlich organisierten Raum eine spezifische Identität aus. In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Grenzen trennt man sich zusehends von der Abschottung – Linien, Mauern, Zäune – und betont vor dem Hintergrund von Globalisierungsrhetorik und Integrationsprozessen mehr und mehr die Durchlässigkeit von Grenzen. Dabei werden nicht nur grenzüberschreitende Austauschprozesse und ihr Einfluss auf die Beschaffenheit von Grenzen diskutiert, sondern teilweise auch schon die Auflösung linearer Grenzen prognostiziert. Die Etablierung von Grenzräumen nimmt den Platz linearer Grenzkonzepte in der Forschung ein.
Dieser Überblick zur Entwicklung der historischen und gegenwärtigen Grenzkonzepte widmet sich dem grundlegenden Wandel der Ordnungsprinzipien und -notwendigkeiten von Menschen und Gesellschaften bei der Schaffung und Bewahrung ihrer Lebensräume. Bereits die seit der Antike errichteten Mauern und Wälle hinterließen erste Exklusions- und Sicherheitsvorstellungen und schlugen sich in Wortbedeutungen und Denkmustern nieder. Im Folgenden wird der Fokus aber insbesondere auf dem Wandel der Bedeutung von Grenze und Grenzraum seit dem europäischen Mittelalter und im Kontext der Herausbildung moderner Staatlichkeit liegen. An die Stelle des mittelalterlichen Universalitätsgedankens tritt als Gegenkonzept zunehmend die Vorstellung von einem abgrenzbaren Raum, der nach innen zunächst vor allem religiös und dann auch sozio-kulturell eine Einheit bildet. Die Vorstellung einer Kongruenz von Territorium, staatlicher Souveränität und Gesellschaft bestimmt bis heute unser Denken, das stark vom Konzept der Nationalstaatsgrenzen geprägt ist. In der geographischen und politikwissenschaftlichen Forschung begründete dieses Denken in topografisch-territorial bestimmten Grenzkonzepten die sogenannte „territorial trap“1, der man seit den 1990er Jahren mit einem symbolischen und metaphorischen Verständnis von Grenzen zu entkommen versucht.2 Auch die historische Forschung folgte mit ihren Forschungsfragen zur sich verfestigenden Frontier3, zur Nationalstaatsgrenze4, zur Kontaktzone5 und zur Grenze als Resultat sozialer Praxis6 diesen sich wandelnden Manifestationen von Grenzen, bis sie heute – beeinflusst von einer scheinbaren Bedeutungslosigkeit von Grenzen – sich der Diskussion um die Notwendigkeit von Grenzen und deren Beschaffenheit neu stellen muss.
Ordnung im Raum
Grenzen sind Konstruktionen und sie unterliegen der Interpretation und Aneignung des Menschen, der mit ihrer Hilfe seine Welt konstituiert. Das heißt, mittels Grenzziehungen schafft der Mensch Ordnung in einem andernfalls unbegrenzten Raum. Henk van Houtum betont den Aspekt des Ordnens als eine Hauptfunktion der Grenze, die weder fest im Raum oder der Zeit verankert ist, noch nur als Trennlinie wahrgenommen werden sollte.7 Grenzziehungen (bordering) helfen auf verschiedenen Ebenen räumlich zu differenzieren. Dabei gewinnen insbesondere die Unterschiede zu anderen an Bedeutung. Hierbei kann es sich um Unterschiede zwischen Staaten und ihren Territorien, aber auch um Unterschiede zwischen kulturellen Gruppen innerhalb eines Territoriums handeln. Durch die Feststellung differenzierender Charakteristika zwischen „eigen“ und „fremd“ (othering) werden auch die Grenzen der eigenen Identität bestimmt und unterschiedliche Aktionsräume sowie Einflusssphären voneinander getrennt.8 Vor diesem Hintergrund kommt der multidimensionale Charakter von Grenzen zum Ausdruck. Grenzen strukturieren nicht nur geographische oder politische, sondern auch soziale, kulturelle oder wirtschaftliche Räume, in denen sich Menschen und Gesellschaften verorten. Gleichzeitig verweist van Houtum mit der Ordnungsfunktion von Grenzen auch auf die Gedächtnisleistung des Menschen, der in seinem tagtäglichen Dasein Grenzziehungen vornimmt bzw. bestehende Grenzen für sich interpretiert, insbesondere wenn es darum geht, seine Identität zu bestimmen.9
Topographisch-räumliche Modelle boten bislang den besten Zugang, um die Bedeutung von Grenzen und der durch sie konstituierten sozialen Welt zu verstehen. Denn Grenzsteine, Stadtmauern, Befestigungsanlagen, Zollstationen, Kampflinien oder auf Karten verzeichnete Grenzlinien zwischen Territorien sind in der Wirklichkeit existente Produkte der menschlichen Gedächtnisleistung, die Schutz, Eigentum, Exklusivität und einen klar abgegrenzten Raum erfahrbar machen. Auch Küstenlinien, Wüsten oder Wälder können dieser Interpretation unterliegen. Sie sind dabei aber nicht per definitionem als sogenannte „natürliche Grenzen“ zu verstehen, da Grenzen einem Denk- und Kommunikationsprozess entstammen, in dem Wasser, Wüsten und Wälder sowohl als Demarkation aber eben auch als nicht hinderlich angesehen werden können.10 Seit der Antike transportieren Manifestationen von Grenzen wie zum Beispiel der Limes oder die chinesische Mauer konkrete Vorstellungen von Exklusion und Schutz im Denken der Menschen. Das universale Denken des Mittelalters sukzessive überwindend, sind es dann vor allem die zwischenstaatlichen Konflikte im frühmodernen Europa, die die ansonsten losen Enden der kleinen und großen Reiche zu verfestigen halfen und einen Bedeutungswandel des Grenzkonzeptes andeuteten.
Von der Frontier zur Staatsgrenze: Im Grenzraum
Die Frontier des mittelalterlichen Europa wird hauptsächlich als Kampflinie verstanden. Mit diesem Begriff werden aber auch Randzonen von Machtbereichen bzw. nicht weiter bestimmbaren Grenzräumen fernab der Machtzentren eines größtenteils durch einen monarchischen Mittelpunkt gekennzeichneten Raumes bezeichnet. Es handelt sich bei diesen Räumen noch nicht um klar abgegrenzte Souveränitäten, Ethnien oder Kulturen. Vielmehr zeigen die Arbeiten von Naomi Standen, Daniel Power oder David Abulafia für die mittelalterlichen Grenzen eine große Ambiguität des Konzeptes, in dem die Grenze noch lange nicht als lineares Limit verstanden werden kann. Vielmehr ist die Grenze ein Raum, eine Grenzregion, in der Kulturen meist konfliktreich aufeinandertreffen, um auf diese Weise religiöse, machtpolitische oder die Souveränität betreffende Dispute auszutragen. Es geht dabei immer wieder um im Kampf errungene Machtpositionen über den Anderen, die Aneignung von Territorien und die Ausbreitung von gesellschaftlichen und kulturellen Mustern auf Kosten einer unterlegenen Macht.11 Diese konfliktreichen Begegnungen führten immer wieder zu bisweilen starken Verschiebungen von Herrschafts- und Kulturräumen, insbesondere in der Auseinandersetzung mit Andersgläubigen an den Rändern Europas im Mittelmeerraum, in der Ostsee oder auch auf der Iberischen Halbinsel.12 Diese Verschiebungen zogen außerdem vielfältige Überlagerungen von kulturell und politisch abgegrenzten Räumen nach sich. Vor diesem Hintergrund konnte die Frontier des Mittelalters keine lineare Grenze sein. Ihre Dimensionen reichten von einem offenem Raum, der – beispielsweise bewohnt von Nomaden – zwischen zwei Herrschaften lag, bis zu punktuellen Markierungen in Form von Festungen an der Peripherie eines Reiches. Sie hatte nicht nur politische Ordnungsfunktionen, sondern auch kulturelle in Form von Sprach- und Religionsgrenzen. Diese waren an kein festes Territorium gebunden und traten oftmals nur zeitweise in Konflikten deutlicher hervor. Hierin liegt auch der Charakter der Frontier als bewegliche Zone zwischen Kontrahenten begründet. Die Frontier konnte kaum räumlich und wenn dann nur zeitweise fixiert werden. Durch die Überwindung des Konflikts mittels Ausschaltung des Gegners konnte sie sogar aufgelöst werden.
Das frühmoderne Europa blieb zunächst gekennzeichnet von der Unbestimmtheit und konfliktreichen Aushandlung seiner inneren und äußeren Grenzen. Administrative Zuständigkeiten, kulturelle Raumkonstruktionen sowie politische und religiöse Loyalitätsansprüche überlagerten einander und formten unterschiedlich komplexe Räume. In dieser Hinsicht geht es um Herrschaften (z. B. Grafschaft, Herzogtum, Königreich), nationale Kulturräume (z. B. französisch sprechender Kulturraum), maritime Handelsnetzwerke (Ostseeraum), Glaubensräume (z. B. katholisches Bayern, reformierte Pfalz, multikonfessionelles Polen-Litauen) und politische Räume und Enklaven, die dem Phänomen der Doppelpflichten13 entstammten, wenn einem Herrscher aufgrund imperialer Grenzen solche Pflichten (z. B. ist der König von Dänemark zeitgleich ein souveräner Herrscher über Dänemark und Reichsfürst in seiner Würde als Herzog von Holstein) auferlegt wurden. Ähnlich gestaltete sich die Herrschaft Phillips II. über die Provinzen des burgundischen Reichskreises sowie die Iberische Halbinsel. Dabei bietet die Loslösung der Niederlande vom spanischen Weltreich im Achtzigjährigen Krieg seit 1568 ein anschauliches Beispiel, wie sich eine zwischen Nord- und Südprovinzen etablierte Kampflinie sukzessive verfestigte und mit dem Westfälischen Frieden 1648 eine endgültige Bestätigung erfuhr. Gleichzeitig lösten sich hierdurch politisch-monarchisch-administrative Verschränkungen mit dem Spanisch-Habsburgischen, Österreichisch-Habsburgischen und dem Heiligen Römischen Reich für die sich zur Republik entwickelnden nördlichen Provinzen auf. Die Kampflinie zwischen Nord- und Südprovinzen verfestigte sich zu einer territorialen Grenze, die auch symbolisch für die Trennung zwischen Calvinisten im Norden und Katholiken im Süden stand sowie insbesondere im 17. Jahrhundert auch eine Wohlstandsgrenze bildete. Die nördlichen Provinzen stiegen zu einer weltweit agierenden Handelsmacht auf, während die südlichen Provinzen Teil des zerfallenden spanischen Weltreiches blieben.14 Am Beispiel des Niederländischen Aufstands zwischen 1568 und 1648 können deutliche Tendenzen der Veränderung des Grenzkonzeptes in der Frühen Neuzeit von einem sich bewegenden und unbestimmten Grenzraum zu einer sich verfestigenden, ein homogenes staatliches Territorium umgebenden Grenze aufgezeigt werden. Auch wenn sich dieser Trend in der Frühen Neuzeit fortsetzt, bleiben Grenzen in Form der sich bewegenden Frontier erhalten. Insbesondere in den überseeischen Gebieten, die während der europäischen Expansion nach Amerika und Asien verschiedene Siedlungsbewegungen erfuhren, wurde die Frontier als Kultur- und Zivilisationsgrenze zu einem bestimmenden Merkmal. Für Nordamerika entwickelte Frederick Jackson Turner vor dem Hintergrund der Siedlerkolonisation und Ausbreitung gen Westen seine Frontier-These, die der Überzeugung folgt, dass durch die kontinuierliche Interaktion zwischen Zivilisation und Wildnis den Vereinigten Staaten eine Position außerhalb der allgemeinen Regeln und Gesetze zukomme.15 James C. Scott und Willem van Schendel haben aber auch für Festlandsüdostasien ähnliche Interaktionsmuster zwischen „zivilisiertem Tal“ und „freiem Berg“ festgestellt.16 Außerdem spielt in Asien die Frontier europäischen Zuschnitts im zeitweiligen Errichten von Kampflinien zwischen den europäischen Kontrahenten im asiatischen Gewürzhandel eine Rolle. Auf diese Weise werden europäische Grenzkonzeptionen auch über die Grenzen Europas hinausgetragen, vornehmlich in Gebiete, in denen bis heute die indigene Bevölkerung Probleme mit der „Übersetzung“ des Bedeutungshorizontes des Grenzkonzeptes in die eigenen Vorstellungswelten hat.17
Neben der Kampflinie bilden die zahlreichen Überlagerungen von politischen, kulturellen und religiösen Bindungen der Menschen charakteristische Grenzräume, in denen klare lineare Trennungen nur schwer feststellbar sind. Zu diesen Grenzräumen gehörten auch Schleswig und Holstein. Seit 1460 äußerlich unter der Herrschaft von Christian I. vereint, war Holstein im Gegensatz zu Schleswig ein Reichslehen und unterstand dem Kaiser, der aber keinen Widerspruch gegen die Wahl Christians durch die Ritterschaft übte und 1474 Holstein sogar zu einem Herzogtum erhob. 1544 setzte Christian III. gegen die starken Ständevertretungen eine neuerliche Teilung durch und mit Schleswig-Holstein-Gottorf wurde eine weitere Landeshoheit geschaffen. Der König von Dänemark übte in diesem Konglomerat von Hoheiten die Oberhoheit über Schleswig aus, hielt Holstein aber nur als Lehen, das zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehörte.18 In dieser Grenzregion zwischen zwei Reichen wurden ganz eigene regionale Ordnungen geschaffen, die nicht nur einem entfernten König oder Kaiser untertänig waren, sondern in der auch noch starke Stände die wechselseitigen Spannungen für ihre eigenen Ziele auszunutzen versuchten. Hier entstehen, wie auch in vielen anderen Regionen Europas, lokale bzw. regionale Räume, die in Folge der nationalstaatlichen Konsolidierung fast ganz verschwinden. Zu diesen regionalen Räumen gehörte zum Beispiel auch der südliche Ostseeraum, der jahrhundertelang zahlreiche kulturelle und rechtliche Transferprozesse erfuhr. Zunächst stand er im Mittelalter insbesondere unter dem Einfluss der Hanse, dann beflügelten in der Frühen Neuzeit die schwedische Expansion im Ostseeraum und auch die Ausbreitung des Polnisch-Litauischen Großreiches regionale Transfers und integrative Prozesse, wobei diese sich immer auch durch Adaptionen an lokale Gegebenheiten auszeichneten.19 In den jüngsten Diskussionen über ein postnationalstaatliches Europa werden diese lokalen bzw. regionalen Räume als historische Grenzräume wiederentdeckt.20 Außerdem machen diese Wiederentdeckungen deutlich, dass das nationalstaatliche Konzept von Grenzen, das unser heutiges Denken bestimmt, die Multidimensionalität von religiösen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Grenzen der Frühen Neuzeit kaum zu fassen mag und teilweise überdeckt. Vielmehr wird der Charakter eines Grenzraumes im Sinne des „borderland“-Konzeptes von Gloria Anzaldúa21 sichtbar, in dem sich Kulturen begegnen und durch Interaktion und Austausch gewachsene Kulturräume in unterschiedlichster Ausprägung mit jeweils eigenen sozialen Strukturen schaffen.
Demarkation und Referenzrahmen: Die Nationalstaatsgrenze
Mit der Krise des Ancien Régime Ende des 18. Jahrhunderts wurde ein ideologischer Freiraum geschaffen, in dem aufklärerisches Gedankengut und ein sich entwickelndes Wir-Gefühl nach neuen, sichereren Ordnungen suchten. Denn der „Wandel durch Vernunft“ bedingte im Streben nach Freiheit eine Pluralisierung von Ideen und Modellen gesellschaftlicher Ordnung, die in ihrer Vielzahl nicht nur die alten Ordnungen monarchisch-despotischer Art substantiell hinterfragten, sondern auch ein Gefühl der Unsicherheit vermittelten.22 Diese Phase der Unbestimmtheit mündete in einen Prozess der räumlichen Neuordnung in Form von Nationalstaaten. Sie ist zeitlich grob im 19. und 20. Jahrhundert zu verorten. Es ist schwierig eine einheitliche Definition für den Nationalstaat in den historischen Diskursen zu finden. Dafür wurden aber hinreichende Merkmale bestimmt, die den Nationalstaat charakterisieren und auch unsere Vorstellungen einer nationalstaatlichen Grenze bestimmen. Otto Danns Definition des Nationalstaates, „in dem die Nation als die Gesamtheit der Staatsbürger der Souverän ist“ und „die gleichberechtigte Teilhabe aller Bürger an den Institutionen und Projekten des Staates“23 gewährleistet, kann nur im Idealfall zutreffen und ist nur schwer für die einzelnen Staaten zu einem festen Zeitpunkt zu bestimmen. Länder des Ostblocks oder Diktaturen würden im Sinne dieser Definition nicht als Nationalstaaten gelten. Deshalb sind alternative Beschreibungen für den Weg zum Nationalstaat, wie Jürgen Osterhammel sie aufzählt, hilfreicher, wenn es darum geht, den Raum des Nationalstaates und die ihn umgebende Grenze näher zu definieren. Er geht von der Idee eines politisch agierenden Kollektivs aus, das auf einer gemeinsamen Identität in Form einer Sprach- und Schicksalsgemeinschaft beruht. Es bildet die Grundlage für eine Weltordnung, in der die Nation als „natürliche“ Grundeinheit angesehen wird.24 Nach Osterhammel hieße das: „Die Nation … ist der primäre Bezugspunkt individueller Loyalität und der maßgebliche Rahmen für Solidaritätsbildung. … Eine Nation erstrebt politische Autonomie auf einem definierten Territorium und benötigt zur Gewährleistung einer solchen Autonomie einen eigenen Staat.“25 Neben den Diskussionen um die Herkunft des Nationalstaates – nach Hagen Schulze nimmt sich im 19. Jahrhundert ein „Massennationalismus“ des Staates an26, Wolfgang Reinhard sieht den Nationalstaat eher als ein Produkt von Machteliten, die diese Form des Staates von oben einzuführen versuchen27 – interessiert uns im Kontext des sich herausbildenden Verständnisses von Nationalstaatsgrenzen vor allem die Leistung, die ein solches einheitliches Gebilde bieten soll. Hierzu gehört in erster Linie die Schaffung eines autarken Wirtschaftsraums, zusammen mit einer international wirksamen Diplomatie sowie einer homogenen Kultur mit identitätsstiftenden Symbolen und Werten. Dieses Ideal der Homogenität von Ethnie, Sprache, Kultur und Recht im Nationalstaat dominiert unsere Vorstellungen von diesem und von seinen Grenzen, obwohl Wolfgang Reinhard mit Recht behauptet, dass die meisten Nationalstaaten aufgrund der sich politisch organisierenden Minderheiten und ihrer Berücksichtigung in der Politik multinationale Staaten sind. Vor diesem Hintergrund wirkt die idealisierende Form des Nationalstaates aber sehr erfolgreich auf Gesellschaften weltweit, die an den Rändern ihrer Staaten eine feste, territorial fixierte Grenzlinie gezogen haben und nach innen eine Gemeinschaft von Staatsbürgern mit gleichen Rechten und Pflichten gegenüber dem Staat bilden. Die Nationalstaatsgrenzen werden durch strikte und weniger strikte Grenzregimes kontrolliert. Mittels Pass- und Zollkontrollen steuern Beamte Waren- und Menschenströme nach sozio-politischen Gesichtspunkten, die insbesondere den Prinzipien eines streng getrennten „Innen“ und „Außen“ sowie „Eigen“ und „Fremd“ folgen. Diese Vereinheitlichung von kulturellem, wirtschaftlichem und politischem Raum durch die klare Definition der Nationalstaatsgrenze ließ den beweglichen Charakter der Frontier verschwinden und erlaubte Grenzräume nur noch als Form des Niemandslandes oder als Verteidigungszone. Darüber hinaus entwickelte sich die Randregion eines Nationalstaates aufgrund des Demarkationscharakters seiner Grenzen wirtschaftlich oft zu einer strukturschwachen Region.
Vom Eisernen Vorhang zur Neuordnung der Räume: Im Grenzraum
Eine Steigerungsstufe der Verfestigung setzte mit der ideologischen Teilung der Welt zwischen Ost und West ein, die die Undurchdringlichkeit mancher nationaler Grenze noch einmal verstärkte. Doch reichten der Begriff und das Konzept Grenze nicht mehr zur Beschreibung dieser Undurchdringlichkeit aus. Man benutzte den Begriff „Eiserner Vorhang“, der bis heute zum Beispiel noch die „Nicht-Beziehungen“ zwischen Nord- und Südkorea bestimmt. Mit seiner Auflösung in Europa setzte ein neuerlicher Diskurs zum Konzept der Grenze ein, der auch die Nationalstaatsgrenze betraf. Denn mit der Gründung der EG und später der EU wurden seit der Mitte des 20. Jahrhunderts transnationale Strukturen geschaffen, die zunächst insbesondere den Wirtschaftsraum aus dem homogenen Konstrukt des Nationalstaats heraushoben. Durch diese Entwicklung unterstützten zunächst vor allem die westeuropäischen Staaten die transnationale wirtschaftliche Interaktion, wodurch den wirtschaftlichen Grenzen zunehmend ein permeabler Charakter verliehen wurde. Gleichzeitig entließ man den Wirtschaftsraum aus der Einheit mit dem kulturellen und politischen Raum, deren Grenzen teilweise bis heute Bestand haben, allerdings in veränderter Form.
Einen Schub erhielt die Diskussion um die Auflösung von Grenzen bzw. die Aufhebung der Kongruenz von Wirtschafts-, Sozial- und Kulturraum einer Nation mit dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ und dem Globalisierungsprozess vornehmlich wirtschaftlicher Strukturen. Zahlreiche Migrations- und Transferprozesse bedingten einen intensiveren Austausch und regionale sowie transregionale Integrationsprozesse. Die größte Wirkung solcher Prozesse zeigte sich nach 1989/90/91 insbesondere in Europa. Der unmittelbare Verlauf des „Eisernen Vorhangs“ quer durch Europa sowie der Erfolg der US-amerikanischen Diplomatie und Kulturexpansion nach dem Fall der Sowjetunion bedingten eine Vorreiterrolle Europas in der nachhaltigen Veränderung seiner Grenzen und damit auch des Diskurses über Grenzen und Grenzkonzepte.
Aber es ist durchaus falsch, im Zuge dieser Veränderungen von der Redundanz staatlicher und anderer Grenzen zu sprechen, wie Liam O’Dowd feststellt.28 Die Permeabilität staatlicher Grenzen in einem sich zunächst wirtschaftlich und administrativ langsam integrierenden Europa bedingt eher einen Wandel in der Interpretation und Wahrnehmung von Grenzen, deren grundlegenden Konzepten sowie deren Bedeutungen. Nach einer Phase vermeintlicher Kongruenz von verschiedenen Räumen im Nationalstaat und der Überlagerung verschiedener Grenzen in einer Linie schaffen Warenströme, Migrationsbewegungen, grenzübergreifende Institutionen (EU, NATO) sowie gleiche kulturelle Werte und Normen im EU-Europa des 21. Jahrhunderts einen scheinbar grenzenlosen Raum, in dem zuvor unterschiedliche Grenzregimes wirkten. Diese Öffnung beflügelte in bedeutendem Maße die intellektuelle Wahrnehmung und Interpretation von Grenzen und Grenzräumen. Das Verlassen des nationalstaatlichen Referenzrahmens beflügelte die Wahrnehmung der Grenze als Brücke und löste damit die Interpretation der Grenze als Barriere im Denken der Menschen in Bezug auf bestimmte Räume – wie zum Beispiel den Wirtschaftsraum – ab. Insbesondere die Grenzregionen innerhalb der neuen EU-Außengrenzen – zuvor meist strukturschwache Regionen oder sogar Niemandsland – konnten vom gestiegenen wirtschaftlichen Austausch und einer erhöhten Migration profitieren.29 Grenzräume avancierten unter diesen Bedingungen auch schnell zu Innovationszentren, weil die Auseinandersetzung mit fremden Ideen nach der Öffnung der Grenzen hier am intensivsten stattfand und Lösungen hervorbrachte, die den Gesellschaften beiderseits der Grenze zu einem besseren Auskommen miteinander verhelfen konnte. Darüber hinaus werden durch die Abschaffung tarifärer Grenzhemmnisse Anreize zur wirtschaftlichen Entwicklung gegeben.30 Außerdem treffen in diesen Grenzräumen Kulturen aufeinander, die aus der Interaktion heraus hybride Strukturen schaffen, um so ihr Zusammenleben zu organisieren. Hierdurch wird ebenfalls das Verbindende von Grenzen gegenüber dem Trennenden betont. Richard White31 und Homi Bhaba32 haben mit ihren Konzepten zum „Middle Ground“ und „Dritten Raum“ Hybridisierungsvorgänge an den Grenzen zwischen kolonialen Eroberern und indigenen Bevölkerungen im 17. und 18. Jahrhundert beschrieben. Diese Konzepte haben erste Deutungsmuster für den Wandel europäischer und globaler Grenzen im Zuge verstärkten interkulturellen Austausches geliefert und beförderten so Kulturtransfernarrationen und die Beschreibung integrativer Muster auf verschiedenen Ebenen des europäischen Einigungsprozesses. Insbesondere historische Betrachtungen von Regionen wie dem Mittelmeer oder dem Ostseeraum haben die neuen Möglichkeiten und Strukturen von regionalem Austausch und regionaler Kohärenz vor dem Hintergrund traditioneller Verbindungen im Handel, in der Kunst, der Bildung und der Religion gespiegelt.33 Hierbei gewannen Konzepte wie die „Croos-border-Cooperation“ oder „Global Governance“ zunehmend an Bedeutung, um grenzüberschreitende Phänomene der Zusammenarbeit zu beschreiben.34
Doch die Beschwörung eines offenen Raumes, in dem sich das menschliche Denken wieder in einen Fluss abseits des Nationalstaates begibt und so, wie Georg Schmidt35 festgestellt hat, wieder Anklänge an die innovativen gesellschaftlichen Diskurse der Aufklärungszeit im vornationalstaatlichen Zeitalter deutlich werden, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Grenzen weiterhin eine große Bedeutung besitzen. Wenn man Grenzen wie Anssi Paasi als Prozess der sozialen Verhandlung versteht36, dann wird deutlich, dass es den Menschen nun möglich geworden ist, über nationale Grenzen hinweg aufeinander zuzugehen, aber man in einem ständigen Aushandlungsprozess immer wieder damit konfrontiert ist, die Identität gegenüber dem anderen in einem kontinuierlichen Prozess abzugrenzen. Ethnische, religiöse, lokale oder regionale Verortungen rücken in den Vordergrund und es scheint, dass die hierdurch gezogenen meist kulturell-symbolischen Grenzen teilweise eine größere Undurchdringlichkeit entwickeln als sie nationalstaatliche Grenzen vorher besaßen. Die jüngsten Diskussionen in der aktuellen Politik über eine multikulturelle Gesellschaft und ihr angebliches Scheitern haben es gezeigt. Die zahlreichen „kulturellen“ und ethnischen Enklaven in den Metropolen Europas – türkische Stadtteile in Berlin, die Romadebatte in Paris oder die nach ethnischen Gruppen getrennten Stadteile im Osten Londons – weisen auf die wachsende Bedeutung dieser Grenzen hin.
So wird das „Borderland“ bzw. Grenzland von Anzaldúa, in dem Tag für Tag verschiedene Identitäten ausgehandelt werden, zu einem gängigen Prinzip der gegenwärtigen Grenzwahrnehmung. Darüber hinaus gewinnen Wohlstandsgrenzen mit ihren strengen, fast militärischen Grenzregimes zunehmend an Bedeutung, wenn wir die östliche und südliche Außengrenze der EU betrachten. Die unmittelbare Schutzund Barrierefunktion der nationalstaatlichen Grenzen wurde im Zuge des Integrationsprozesses europäischer Staaten an die äußersten Enden verlagert, während die Gesellschaften innerhalb dieser Barriere versuchen, neue Modelle der räumlichen Ordnung und Governance zu schaffen und dabei die Grenzräume als Kontakt-, Entwicklungs- und Innovationsräume wiederzuentdecken. Das Modell des Nationalstaates wird also sukzessive von seinen Grenzen her verändert, aber nicht obsolet. Vielmehr zeigt sich in vielerlei Hinsicht eine Ambivalenz zwischen Integrationswillen und Identitätsbewahrung im Kontext von Globalisierung und postkolonialer Befreiung.37
Die feste Linie einer nationalstaatlichen Grenze mag in der Großräumigkeit Europas in wirtschaftlicher und touristischer Hinsicht an Bedeutung verloren haben – obgleich die Nationsbildungsprozesse im Osten Europas auch innerhalb der EU noch nicht abgeschlossen sind –, aber damit sind Grenzen nicht obsolet geworden. Sie gewinnen mit einem veränderten Konzept zunehmend wieder an Bedeutung, vor allem, wenn in einem Grenzland nicht hinreichend Klarheit darüber besteht, wo sich der Einzelne verorten soll und will. Vor diesem Hintergrund rücken symbolische und soziale Dimensionen der Grenzen in den Vordergrund und helfen, kleinräumigere Ordnungen zu entwerfen, um sich in der Pluralität eines sich langsam integrierenden Europas zurechtzufinden.38 Dass mit den dänischen Grenzkontrollen im Sommer 2011 auch ältere nationalstaatliche Grenzregimes wieder Einzug hielten, ist kein Widerspruch in den hier aufgezeigten Entwicklungen. Gleichwohl es sich um ein populistisches Vorgehen der damals konservativen dänischen Regierung handelte, besteht die Möglichkeit, dass die EU-Außengrenze vielen in Mitteleuropa fern und abstrakt erscheint. Die Schutzfunktion dieser Grenze ist mancherorts nicht mehr zu „spüren“. Kleinräumige Grenzziehungen und unmittelbarere Grenzregimes könnten dieses eher leisten. Die neue sozialdemokratische dänische Regierung hat im Herbst 2011 die Kontrollen bereits wieder aufgehoben. Diese kurze Episode zeigt einmal mehr, dass die Interpretation und Wahrnehmung von Grenzen und Grenzräumen in einer gewissen Abhängigkeit von Problemen und Bedürfnissen von Menschen und Gesellschaften in einem bestimmten Zeitabschnitt betrachtet werden müssen. Das Beispiel verdeutlicht auch die Unbeständigkeit von Grenzen.
Dansk resumé
Med afgrænsning skaber menneskene en rumlig orden, der skiller dem fra andre og bliver et identifikationspunkt for deres samfund. I videnskaben har interessen for afgrænsning været for nedadgående, mens der kan iagttages en stærkt voksende interesse for grænseoverskridende og grænsenedbrydende udviklinger. Her forbindes grænser i stedse højere grad med noget rumligt frem for noget lineært. Denne oversigt over historiske og nutidige grænseforestillinger drejer sig specielt om ordensprincipperne bag menneskenes indretning og bevaring af de rum, som de lever og udfolder sig i.
Middelalderens grænser havde dybde og var ikke lineære i en senere tids forstand. Magten over grænseområderne var ofte uafklaret, og der udspandt sig mange konflikter om kontrollen over dem. Kulturer og religioner stødte sammen flere steder i Europa, og frontier-begrebet dækker en situation, hvor grænserne var bevægelige og genstand for konflikt. I det tidligt moderne Europa skete der en ændring hen imod mere faste grænser, men da administrative, kulturelle, politiske og religiøse grænser overlejrede hinanden, tegnede der sig ikke et afklaret men derimod et meget komplekst billede. Herskabsforholdene i hertugdømmerne eksemplificerer det. Her herskede den oldenborgske konge over Slesvig og Holsten trods deres forskellige status.
Nationalstaterne skabte de klare og entydige lineære grænser. Bag dem opbyggedes stater med et betonet enhedspræg, idet opbygningen af et selvstændigt økonomisk system og en homogen kultur med identitetsskabende symboler og værdier blev denne statsforms kendetegn. Dette ideal af en stat præget af etnisk, sproglig, kulturel og juridisk homogenitet præger fortsat grænseforestillingerne, men i de seneste årtier er der sket mange forandringer. Efter Anden Verdenskrig forstærkede „jerntæppet“ opfattelsen af en skarp grænse, men efter dets fald begyndte en ny rumlighed at gøre sig bemærket. Det understregedes af de transnationale strukturer, der i flere årtier havde været under opbygning i Vesteuropa. Grænseområder blev ikke mindst kontaktzoner. De afgrænsede nationalstater mistede deres rolle som altdominerende referencepunkter og ikke mindst i den økonomiske debat tabte de nationalstatslige grænser i betydning. Grænserne opfattes i en del af forskningen først og fremmest som resultat af en social praksis. De mange udviklinger, der har virket i retning af at flytte forestillingen om en grænse fra linje til rum, kan dog ikke skjule, at grænser stadig spiller en meget stor rolle i de enkelte samfund.
Anmerkungen
1 Agnew, Territorial Trap, S. 59.
2 Paasi, Boundaries as Social Practice and Discourse, S. 118.
3 Jackson Turner, Significance of the Frontier in American History, S. 27-37.
4 Demandt, Deutschlands Grenzen in der Geschichte; François/Seifarth/Struck, Grenze als Raum, Erfahrung und Konstruktion; Duhamelle/Kossert/Struck, Grenzregionen; Kaplan/Carlson/Cruz, Boundaries and their Meanings.
5 Krieger/North, Kultureller Austausch zwischen Westeuropa und dem Ostseeraum; Burke, Kultureller Austausch; White, The Middle Ground.
6 Paasi, Boundaries as Social Practice and Discourse, S. 117-136; Houtum/Kramsch/Zierhofer, B/ordering Space, S. 1-13.
7 Van Houtum/van Naerssen, Bordering, Ordering and Othering, S. 126.
8 Ebd., S. 126; van Houtum/Kramsch/Zierhofer, B/ordering Space, S. 1-13; Migdal, Mental Maps and Virtual Checkpoints, S. 5f.
9 Van Houtum/Kramsch/Zierhofer, B/ordering Space, S. 1-3; s.a. Paasi, Bounded Spaces in the Mobile World, S. 139-141.
10 Berg/van Houtum, Prologue: A Border is Not a Border, S. 2.
11 Abulafia, Introduction: Seven Types of Ambiguity, S. 5, 11, 17f., 20; Power, French and Norman Frontiers in the Central Middle Ages, S. 106ff.
12 Moreno, Creation of a Medieval Frontier, S. 32-54; Mažeika, Granting Power to Enemy Gods in the Chronicles of the Baltic Crusades. Hintergrundinformationen zu Osteuropa und die Ostsee liefern die Kapitel 2.6 und 2.7 bei North, Europa expandiert 1250-1500, S. 196-249. Für das Mittelmeer siehe Abulafia, The Great Sea, S. 318-333.
13 Duchhardt, Der Herrscher in der Doppelpflicht.
14 Van Deursen, De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, S. 205; Israel, The Dutch Republic, S. 254-259, 311f., 316-327, 516ff., 533f., 541-545; North, Geschichte der Niederlande, S. 22-36.
15 Turner, The Significance of the Frontier, S. 2f.
16 Scott, The Art of Not Being Governed, S. 54; van Schendel, Geographies of Knowing, S. 282, 284f.
17 Drost, Grenzenlos eingrenzen.
18 Bohn, Geschichte Schleswig Holsteins, S. 39ff., 50f.
19 North, Europa expandiert, S. 157, 196-199, 203ff.; ders., Geschichte der Ostsee, S. 66-77, 136-143.
20 Thormählen, Entwicklung europäischer Grenzräume.
21 Anzaldúa, Borderlands, Preface.
22 Schmidt, Wandel durch Vernunft, S. 11-14.
23 Dann, Nation und Nationalismus in Deutschland, S. 17.
24 Osterhammel, Die Verwandlung der Welt, S. 582.
25 Ebd.
26 Schulze, Staat und Nation in der europäischen Geschichte, S. 189-208; s.a. Dann, Nation und Nationalismus. S. 149-158.
27 Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, S. 447f.
28O’Dowd, Changing Significance of European Borders, S. 13.
29 Schack, Grenzen und Grenzregionen, S. 9-17.
30 Morehouse, Theoretical Approaches to Border Spaces and Identities, S. 26-32; Clement, Economic Forces Shaping the Borderlands, S. 41f.
31 White, Middle Ground.
32 Bhabha, Location of Culture.
33 Krieger/North, Land und Meer; North, Geschichte der Ostsee; Abulafia, The Great Sea.
34 Anderson/O’Dowd/Wilson, New Borders for a Changing Europe.
35 Schmidt, Wandel durch Vernunft, S. 14.
36 Paasi, Boundaries as Social Practice and Discourse.
37 Morehouse, Theoretical Approaches to Border Spaces and Identities, S. 26f.
38 Zur symbolischen Dimension von Grenzen: Migdal, Mental Maps and Virtual Checkpoints.
Natürliche Grundlagen von Grenzen in Schleswig-Holstein
Hansjörg Küster
Einführung
Wer Verbindungen zwischen natürlichen, wirtschaftlichen und politischen Grenzen erkennen will, hält wohl am ehesten Flüsse für grenzprägend. Sie können nur an wenigen Stellen gequert werden, jede Brücke, die eine solche Grenze überwindet, ist ein aufwendiges Bauwerk. Fremde Armeen können an Flüssen aufgehalten werden. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass ein solcher Blickwinkel vergleichsweise modern ist und sich erst in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat, in denen Landwege an Bedeutung gewannen. Im Mittelalter wurden hingegen Wasserwege stärker zum lokalen Warentransport genutzt als heute. Im Einzelfall ist es nicht einfach zu entscheiden, ob Flüsse eher trennten oder verbanden.1
Aufgezeigt werden sollen hier natürliche Voraussetzungen, die zur Herausbildung von Grenzen führen konnten oder hätten führen können. Die aktuellen Grenzen sind von diesen natürlichen Voraussetzungen häufig nicht oder nur nur in geringem Maße abhängig, weil beispielsweise politische Aspekte bei ihrer Herausbildung eine stärkere Rolle gespielt haben.2 Allerdings liegen die Zusammenhänge zwischen naturräumlichen Bedingungen und der Ausbildung von Grenzen nicht immer klar auf der Hand, sondern sie ergeben sich erst, nachdem verschiedene Evidenzen miteinander in Verbindung gebracht worden sind.
Eine solche Annahme soll in diesem Beitrag verdeutlicht werden, der nicht auf Studien in Archiven bzw. historischen Quellen in eigentlichem Sinne beruht. Vielmehr geht der Verfasser von Landschaftsanalysen aus, in deren Folge Archivstudien die geäußerten Gedanken sicher präzisieren könnten.
Die landschaftliche Gliederung Schleswig-Holsteins
Wenn heute von Schleswig-Holstein als einem Grenzland die Rede ist, so denkt man an die Staatsgrenze zwischen dem nördlichsten deutschen Bundesland und dem nördlich davon liegenden Dänemark; diese Grenze wurde im Zusammenhang mit Kriegen der letzten zwei Jahrhunderte mehrfach verschoben. Doch aus natürlicher Sicht bestehen ganz andere Grenzen. Die jütische Halbinsel, auf deren südlicher Hälfte das Bundesland Schleswig-Holstein liegt, bildete sich aus einem Moränenwall, der in der zweiten Hälfte der Saale-Eiszeit, der vorletzten Vergletscherungsphase, vor etwa 150.000 Jahren gebildet wurde. Diese Vereisungsphase wird als Warthe-Phase bezeichnet. Der damals von Gletschern abgelagerte gewaltige Wall aus lockerem Sediment trennte die beiden Schelfmeere Nord- und Ostsee voneinander, die zuvor miteinander verbunden gewesen waren. Jütland also ist die Grenze zwischen diesen beiden Meeren, deren völlig unterschiedliche Charaktere unter anderem von ihren verschiedenen Salzgehalten hervorgerufen werden. Die Wassermassen der Nordsee befinden sich in stetigem Austausch mit denjenigen der anderen Weltmeere, und daher trifft man dort auf den gleichen Salzgehalt des Wassers wie in den Ozeanen. Zwischen Nord- und Ostsee findet hingegen nur ein geringer Wasseraustausch statt, und das meiste Wasser der Ostsee stammt aus Süßwasserzuflüssen. Ostseewasser hat daher einen sehr viel geringeren Salzgehalt als das Wasser anderer Meere, und die Ostsee enthält auf diese Weise die größte Brackwassermenge auf der Erde.3
Vor allem seit dem frühen Mittelalter, als das Netz überregionaler Handelswege über die südliche Nordsee in den Ostseeraum erweitert wurde, erwies sich die jütische Halbinsel als markantes Verkehrshindernis. Die Halbinsel konnte zwar im Norden umfahren werden, doch sind die dortigen Gewässer bis heute gefährlich. Noch im 19. Jahrhundert strandeten an der dänischen Nordseeküste deutlich mehr Schiffe als anderenorts.4 Daher wurden diese gefährlichen Gewässer erst recht in früheren Jahrhunderten gemieden, und man suchte eher verbindende Verkehrswege, die über die Halbinsel hinweg führten. Dabei mussten in früherer Zeit auch Landwege in die Handelswege einbezogen werden, um die Wasserscheide zwischen den Flüssen Schleswig-Holsteins, die überwiegend zur Nordsee entwässern, und jenen Buchten der Ostsee zu überwinden, die sich durch Gletschervorstöße der letzten Eiszeit, der Weichsel-Eiszeit, und Schmelzwasser gebildet hatten, das unter dem Eis nach Westen ablief.
Das Land im Osten der Halbinsel, das erst in der letzten Eiszeit von Gletschern deponiert worden war, ist reich an Mineralstoffen; in der Nacheiszeit wurden diese Stoffe noch nicht aus dem Boden ausgeblasen oder ausgewaschen. Das hügelige Jungmoränengebiet im Osten Schleswig-Holsteins ist daher ein exzellentes Ackerland. Weniger gut sind hingegen die Bedingungen für den Feldbau auf den Böden, die bereits in der vorletzten Eiszeit abgelagert worden waren. Besonders in der Zeit, in der sie während der Weichselvergletscherung im unmittelbaren Vorfeld des Eises lagen, wurden die fruchtbaren Mineralstoffe ausgewaschen und ausgeblasen, so dass vielerorts nur unfruchtbarer Sand zurückblieb. Dieses Land ist der sogenannte „Mittelrücken“ der jütischen Halbinsel, die trockene Geest. Sowohl das Hügelland im Osten als auch die Geest waren in der Nacheiszeit komplett bewaldet und ihre Böden sind arm an Steinen; daher konnten sie nach Rodungen von Wald bereits in der Kupferzeit (seit etwa dem 4. Jahrtausend vor Chr.) bäuerlich bewirtschaftet werden.
Völlig andere Bedingungen herrschen im Westen Schleswig-Holsteins vor. Dort stieß in den letzten Jahrtausenden die Nordsee immer wieder bis an den Geestrand vor und schuf dort ein markantes Kliff. Das Meer trug ehemaliges Geestland ab. Die Komponenten des lockeren Abtragungsmaterials wurden von den Strömungen sortiert. Steine der Moränen blieben an Ort und Stelle liegen; sie wurden vor allem in Küstennähe von anderen Meeresablagerungen überdeckt. Sand blieb dort liegen, wo die Meeresströmung nachließ, aber immer noch ausreichend stark war, um feineres Erdmaterial weiter zu tragen. Jener akkumulierte sich auch in Sandriffen, an denen sich verschiedene Strömungen trafen. Aus diesen Riffen konnten sich Strandwälle entwickeln. Wenn sie als Sandbänke zeitweilig aus dem Wasser ragten und abtrockneten, konnte der Wind den Sand weiter bewegen. Es bildeten sich Dünen, deren Oberfläche weit über den Meeresspiegel hinausreichte. Auf diese Weise entstanden Düneninseln und Nehrungen. Eine solche Sandablagerung wird in Dithmarschen als Donn bezeichnet.
Feiner, mineralstoffreicher Schluff und Ton wurden, vermischt mit Überresten von Meeresorganismen, in strömungsberuhigten Meeresbereichen abgelagert. Aus diesem Schlick entwickelten sich die fruchtbaren Böden der Marschen. Doch Marschenböden sind nur schwer zu bearbeiten. Diese wurden entsprechend nur in der Römerzeit und seit dem frühen Mittelalter besiedelt, was aber nur teilweise mit den Schwierigkeiten der Bodenbearbeitung zusammenhängt, sondern auch mit dem Fehlen von Holz in der Marsch. Marschen gehören zu den wenigen Gegenden in Mitteleuropa, die natürlicherweise nicht von Wäldern bestanden sind. Die heimischen Bäume ertragen kein Salzwasser, das ursprünglich immer wieder die gesamte Marsch überflutete. Andererseits musste Holz aber vorhanden sein, damit Menschen dauerhaft in unseren Breiten siedeln konnten: Holz ist wichtiger Bau-, Werk- und Brennstoff.
Auf der Grundlage der landschaftlichen Gliederung ist zu erkennen, dass die wichtigsten natürlichen Grenzen in Schleswig-Holstein von Nord nach Süd verlaufen. Für die Herausbildung von Herrschaftsbereichen spielten diese Grenzen aber gleichwohl kaum eine Rolle.
Verbindungen zwischen West und Ost, Nord und Süd
Seit dem frühen Mittelalter kam es darauf an, möglichst kurze Wege über den Mittelrücken hinweg zwischen Häfen der Nordsee und Häfen der Ostsee zu finden und zu nutzen. Diese Wege wandelten sich mit steigendem Umfang des Handels und wachsender Größe der Schiffe, mit denen die Güter transportiert wurden. Mit kleinen Booten des frühen Mittelalters konnten nicht nur die Eider, sondern auch deren Nebenfluss Treene und wohl sogar deren Nebenbach Rheider Au befahren werden. Mit Booten gelangte man also von der Nordsee aus bis in unmittelbare Nähe der Schlei, der ehemaligen Schmelzwasserbahn eines sogenannten Tunneltals, das sich unter dem Gletscher der letzten Eiszeit gebildet hatte. An deren äußerstem westlichem Ende bestand damals der Hafen Haithabu. Handelswaren zwischen Nord- und Ostsee mussten damals nur wenige Kilometer über Land transportiert werden, von der Rheider Au nach Haithabu.5 Vielleicht wurden sogar die ganzen Boote über Land von der Rheider Au zur Schlei gezogen.
Mit den größeren Schiffen der Hansezeit waren indes die Gewässer des schleswig-holsteinischen Wattenmeeres und der Eider nicht mehr zu erreichen. Für von Westen kommende Schiffe wurde Hamburg zum wichtigsten Hafen; der korrespondierende Hafen im Ostseeraum war nunmehr Lübeck. Zwischen Hamburg und Lübeck wurden einerseits Landwege, seit dem späten 14. Jahrhundert auch Kanäle genutzt.6 Auf Initiative Dänemarks hin wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Eisenbahnen zwischen Nord- und Ostseehäfen gebaut, zuerst zwischen Kiel und Altona, dann auch zwischen Flensburg und Tönning.7 Für die Hochseeschifffahrt folgte noch später die Anlage des Kaiser-Wilhelm-Kanals, des heutigen Nord-Ostsee-Kanals, zwischen der Elbmündung und Kiel.
Auf dem Mittelrücken bestand dagegen schon seit vorgeschichtlicher Zeit der sogenannte Ochsenweg, auf dem Tiere aus den Marschen nach Süden transportiert wurden. Dieser Landweg verlief weithin auf der Wasserscheide zwischen Nord- und Ostsee, so dass nur an wenigen Stellen Gewässer gequert werden mussten.8
Hamburg und die Marschen
Wie nun aber die natürlichen Bedingungen die tatsächlichen Grenzen in Schleswig-Holstein beeinflussen konnten, scheint komplizierter zu ergründen zu sein. Das soll am Beispiel der Niederelbe und angrenzender Marschen deutlich gemacht werden. Die Niederelbe selbst bildete keine natürliche oder auch wirtschaftliche Grenze; vielmehr wurde die seit dem Mittelalter rasch wachsende Großstadt Hamburg auf dem Wasserweg mit zahlreichen für sie notwendigen Gütern versorgt. Zwischen den Gebieten der Marschen und den näheren und entfernteren Städten entwickelte sich ein lebhafter Handel, der zunächst die Voraussetzung dafür darstellte, dass die Marschen überhaupt besiedelt werden konnten. Über den Handel musste insbesondere Holz als lebensnotwendige Ressource in das Land kommen, das immer wieder von Meerwasser überschwemmt wurde. Um Holz zu erwerben, erwirtschafteten die Marschbauern Überschüsse an Gütern, die sie auf die städtischen Märkte brachten. Ursprünglich waren das vor allem tierische Produkte wie Fisch, Fleisch bzw. lebende Tiere, Milchprodukte oder Wolle. Nachdem im 13. Jahrhundert Marschen eingedeicht worden waren, konnten auf den fruchtbaren Böden auch Getreide und andere Kulturpflanzen angebaut werden. Jede Marsch spezialisierte sich auf andere Produkte; dabei ist festzustellen, dass leicht verderbliche Produkte wie Milch, Käse, Eier oder Obst eher in der Nähe von Hamburg produziert wurden. Getreide kam aus größerer Distanz in die Stadt, beispielsweise aus der Wilstermarsch, Kohl und Raps (zur Gewinnung von Lampenöl, das auch auf den Schiffen verwendet werden konnte) wiederum aus dem Mündungsgebiet der Elbe, aus Hadeln und Dithmarschen.9 Die Herausbildung dieses Versorgungssystems begann im Mittelalter und wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein verfeinert.
Alle Marschen profitierten von den Handelsbeziehungen, indem städtische Produkte importiert wurden.10 Zwischen den einzelnen Marschen bildeten sich dennoch landschaftliche Unterschiede und auch mentale Grenzen heraus, die im Selbstverständnis der Bevölkerung bis heute lebendig geblieben sind.11 Produkte aus Hamburg lassen sich nördlich von Dithmarschen und der Eidermündung in deutlich geringerer Zahl nachweisen als an der Elbmündung. Denn die Beziehungen zwischen den Eiderstedter und nordfriesischen Marschen und Hamburg waren längst nicht so intensiv wie die Handelskontakte zwischen Dithmarschen und der Hansestadt, was mit der Reichweite eines sehr speziellen Verkehrssystems zusammenhängt. Dessen Grenzen wurden durch natürliche Voraussetzungen gesteckt, die im Folgenden dargestellt werden sollen.
In der Nordsee sind die Tidenhübe, also die Differenzen zwischen Hoch- und Niedrigwasser, unterschiedlich hoch. Unter dem Einfluss der unterschiedlich starken Tidenströmungen bildeten sich verschiedene Formen von Küsten heraus. Liegt der Tidenhub bei unter etwa 150 Zentimetern, entwickeln sich geschlossene Nehrungen. Das ist im Westen der Niederlande und an der dänischen Westküste Jütlands weithin der Fall. Nur an wenigen Stellen sind die Nehrungen durchbrochen, so dass dort Häfen angelegt werden konnten. Gemeinhin wurden stattdessen die auf Kiel gebauten Boote aufs Gestade gezogen, um sie zu be- und entladen; heute geschieht das immer noch bei Fischerbooten. Bei einem Tidenhub zwischen etwa 150 und 300 Zentimetern bilden sich Barriereinseln, zwischen denen vor allem der starke Ebbstrom tiefe Wasserbahnen von Gatts oder Gaten schuf. Besonders gut ist das an der Küste von West- und Ostfriesland zu erkennen. In Nordfriesland gibt es dagegen Geestinseln, vor und zwischen denen Sandbänke liegen, die den Barriereinseln vergleichbar sind. Bei noch höherem Tidenhub, der in der inneren Deutschen Bucht, an der Mündung von Elbe und Weser, herrscht, entstanden anstelle von Barriereinseln annähernd runde Platen.12 Durch die Gatts oder durch Priele im Watt, die dort die Fortsetzungen der Flüsse aus der Geest bilden, konnte vom Meer aus die Festlandsküste mit den dortigen Häfen oder einfachen Liegeplätzen erreicht werden. Dort wurden die Boote traditionell auf eine besondere Weise be- und entladen. Man setzte sie bei Niedrigwasser auf dem Wattboden ab, so dass sie von Land aus mit Pferdegespannen zu erreichen waren. Beim nächsten Hochwasser schwammen die Schiffe wieder auf dem Meerwasser auf.
Die Schiffe wurden dadurch erheblich beansprucht, vor allem dort, wo der Tidenhub besonders groß war, also an Niederelbe und Unterweser. Dort aber konnte Nadelholz zum Bau von platten Schiffsböden verwendet werden, das am Oberlauf der Elbe verfügbar war und auf der Elbe flussabwärts geflößt wurde; an der Weser wuchsen erheblich weniger Nadelbäume, erst recht nicht im Hinterland kleinerer Flüsse wie der Ems oder der Treene.13 Vor allem im Bereich der Elbmündung wurden daher Boote mit völlig platten Böden eingesetzt, die Ewer.14 Weiter im Westen, in Ost- und Westfriesland, verwendete man dagegen komplett aus Eichenholz gebaute Tjalken, deren Boden nicht genauso platt war wie derjenige der Ewer; allerdings konnte man auch Tjalken auf dem Wattboden trockenfallen lassen. In Nordfriesland und im Eidermündungsgebiet wurden Boote gebaut und verwendet, deren Schnitt demjenigen der Tjalk ähnelte: Auch die Eidergaliot wurde vollkommen aus Eichenholz gebaut, ihr Boden war ebenso nicht völlig platt.15
Zwischen den Einsatzgebieten des mit Nadelholz gebauten Plattbodenschiffes Ewer und den Laubholzbooten Tjalk und Eidergaliot entwickelten sich wirtschaftliche Grenzen: zwischen dem Elb- und Wesermündungsgebiet einerseits und Ostfriesland andererseits, ferner zwischen den Gebieten nördlich und südlich der Eider. Diese Grenzen wirkten sich auch auf das Hinterland aus, denn die diversen Plattbodenschiffe verkehrten auch auf den Nebenflüssen von Elbe und Weser, beispielsweise auf Stör und Oste.
Folgerungen
Das Beispiel der unterschiedlichen Bootstypen zeigt, auf welch komplizierte Weise natürliche, wirtschaftliche und politische Grenzen zusammenhängen können: Unterschiedliche Tidenhübe an der Nordsee machten es notwendig, verschieden konstruierte Schiffe an den Küsten zu verwenden. Dadurch wurden wirtschaftliche Einflussbereiche voneinander getrennt, und davon könnten dann auch Einflüsse auf die Ziehung politischer Grenzen ausgegangen sein: auf die Grenze zwischen Schleswig und Holstein oder die Grenze zwischen dem Gebiet der Marschen an den Mündungen von Elbe und Weser sowie Ostfriesland.
Aus dem Zusammenführen von Daten zu natürlichen Gegebenheiten und zur Verbreitung von Schiffstypen lassen sich aber hier nur Grundlagen für weitere Arbeiten ableiten, die durch Archivstudien ergänzt werden sollten. Sehr viel detaillierter müsste untersucht werden, wie die Warenströme entlang der Nordsee- und Flussmarschen verliefen und wie sich diese im Laufe der Zeit entwickelten. Das könnte auf der Basis einer engeren Kooperation zwischen Landschaftswissenschaft und historischen Disziplinen erfolgen.
Dansk resumé
Sammenhængen mellem naturforhold og grænser er ikke entydig. Floders betydning som grænser er fx. en nyere ide, der vandt frem, da transporten til lands udviklede sig. Nutidens grænser er som i det dansk-tyske tilfælde i mange tilfælde uafhængige af naturlige forudsætninger og i stedet bestemt af politiske grunde. I geografien gør andre grænser sig gældende. Hele den kimbriske halvø blev til i istiden for 150.000 år siden, og halvøen dannede fra begyndelse skel mellem Nord- og Østersøen. Naturgrænser delte halvøen i forskellige zoner, især på langs.
Da det var vanskeligt og forbundet med stor risiko at sejle nord om halvøen, blev det især i Slesvig og Holsten af stor betydning at finde forbindelsesveje, der kunne forbinde havnene på vest- og øst-siden med hinanden. Kanalbyggeri som mellem Lübeck og Hamborg, landeveje og siden jernbaner skulle sikre denne forbindelse.
Et eksempel viser, hvordan tidevandet på Nordsøkysten var bestemmende for skibstyper og dermed for mulighederne for at sejle mellem forskellige havne. Det bestemte igen de enkelte handelsområders udstrækning, hvilket igen influerede den politiske grænsedragning – fx. mellem Slesvig og Holsten eller mellem marsken og Elbens og Wesers mundinger.
Anmerkungen
1 Borger, Siedlung und Kulturlandschaft; Bloemers, Mündungsbereich, S.17-30.
2 Bloemers, Siedlung und Kulturlandschaft.
3 Küster, Ostsee.
4 Jankuhn, Haithabu, S. 156ff.
5 Jankuhn, Haithabu, Plan 1 (gegenüber von Seite 72).
6 Goldammer, Schaale-Kanal, S. 21.
7 Staisch, Hauptbahnhof Hamburg, S. 19ff.
8 Pieplow, Von Jütland an die Elbe.
9 Küster, Die Elbe, S. 265ff.; Küster, Hamburg, Elbe und Ewer.
10 Küster, Die Elbe.
11 Groth, Die holsteinischen Elbmarschen.
12 Die Zusammenhänge zwischen Tidenhöhen und Inselformen werden u.a. dargestellt in: Behre, Entwicklung der Nordseeküsten-Landschaft; Pott, Nordsee.
13 Küster, Gedanken zur Holzversorgung.
14 Küster, Die Elbe.
15 Zur Verbreitung der Schiffstypen: Szymanski, Segelschiffe der deutschen Kleinschiffahrt.
Mittelalter:Vom Grenzsaum zur linearen Grenze
Grenzen, Grenzregionen und Grenzüberschreitungen in archäologischer Perspektive
Ulrich Müller
Grenzen rückten seit den 1990er Jahren wieder in den Blickpunkt der Mediävistik und werden dementsprechend auch in der schleswig-holsteinischen Landesforschung thematisiert.1 Diese Tatsache reflektiert nicht zuletzt Prozesse, die sowohl den politischen Umbrüchen der späten 1980er und frühen 1990er Jahre in Mittel- und Ostmitteleuropa, als auch der weltweit geführten Globalisierungsdebatte geschuldet sein dürften. Die Erkenntnis, dass Grenzen nicht zwangsläufig lineare Gebilde darstellen, dass sie hingegen konstruiert und konstituiert werden, über den geografischen Raum hinaus auch soziale und kulturelle Räume definieren, hat vielerorts zu neuen Analysen herausgefordert und zu neuen Einsichten geführt. Hiervon war auch die Archäologie nicht unberührt. In der öffentlichen Wahrnehmung stellen zwar Bodendenkmäler wie der römische Limes das Symbol für Grenzen dar, doch zeigt sich bereits in der angloamerikanischen Diskussion und den daraus hervorgegangenen Begriffen wie „frontier“, „border“ und „borderlands“, dass Grenzen in jeder Hinsicht multidimensional ausfallen und je nach Skalenniveau auch unterschiedlich betrachtet werden können.2 Das von zwei Meeren eingefasste Schleswig-Holstein stellt einen Grenzraum dar, der traditionell als Brücke zwischen Skandinavien und dem kontinentalen Europa gesehen wird. Schleswig-Holstein war in der zweiten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrtausends eine Region, in der Sachsen, Dänen und Slawen mit ihren spezifischen Sprachlandschaften siedelten (Abb. 1) – eine geografisch dreigegliederte Landschaft, die eine Mittlerstellung zwischen dem Süden und dem Norden sowie zwischen Westen und Osten einnahm. Neben seinen naturräumlichen Grenzen besaß Schleswig-Holstein im frühen Mittelalter zwei anthropogene Grenzen, welche die Entwicklung des Landes in Teilen bis heute bestimmen: Das Danewerk und den Limes Saxoniae (Abb. 2 und 3). Die nördliche Grenze zwischen dem sächsischen bzw. karolingischen Nordelbingen und dem dänischen Königreich ist zwar in der Zeit des 8. bis 12. Jahrhunderts (und darüber hinaus) durch eine ganz eigene Dynamik gekennzeichnet, doch scheint sie verhältnismäßig einfach fassbar, denn 811 wurde in der berühmten Zusammenkunft zwischen Karl dem Großen und König Hemming die Eider als Grenze festgelegt, die in einiger Entfernung durch das Danewerk geschützt wurde.3