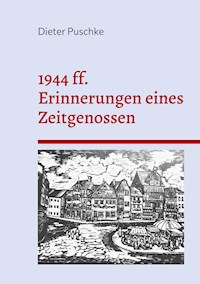
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vor hundert Jahren sah es in der Eifel noch anders aus. Sie war karg und wenig erschlossen. Ihre Einwohner mussten mit den Umständen, die sie vorfanden, zurechtkommen. Sie waren sparsam und innovativ. Sie trotzten den schweren Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg, dem Währungsverfall der 1920er-Jahre und den Wirren der Separatistenaufstände. Der Nürburgring brachte erste kleine wirtschaftliche Verbesserungen. Der Zweite Weltkrieg unterbrach diese Zeit des Aufbruchs. Sein Ende und der Zusammenbruch des Staatswesens zog die Region abermals herunter. Dennoch begann eine Zeit, in der der wirtschaftliche Aufschwung der Nachkriegszeit auch hier ankam. Die Hocheifel blühte auf. Ich war Zeitzeuge. Dennoch waren die Unterschiede zu heute riesengroß. Davon und von den Erschwernissen junger Menschen für ihren Werdegang handelt dieser Bericht. Er soll auch ein Gespür dafür geben, was wir verlieren können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieser Band ist der erste Teil eines persönlichen Rückblicks. Meine Erinnerungen sind ganz sicher vergleichbar mit denen vieler meiner Altersgenossen. Versetzt man sich in die jeweilige Zeit, ist das Geschilderte normal, heute allerdings weit entfernt oder gar fremd. Deshalb habe ich meine Geschichte notiert.
Mit 161 Abbildungen.
Inhaltsverzeichnis:
Einführung
Meine Kindheit in Adenau
Familie und Herkunft
Geburt in unruhigen Zeiten
Meine Großeltern mütterlicherseits
Die Heimatregion
Die Großeltern in Adenau in den Krisenjahren der Weimarer Republik
Der Putsch der Separatisten im Rheinland
Die rheinischen Separatisten in Adenau
Familiengründung und Geldentwertung
Meine Eltern
Meine Mutter
Mein Vater
Kindheit
Als Baby in Adenau
Das letzte Kriegsjahr
Familienverhältnisse und Schulschicksale
Unsere Familie findet zusammen
Selbstversorgung und Schwarzmarkt
Zwischenstation in Leimbach
Die Brennerei
Anfänge neuer Staatlichkeit
Währungsreform
Umzug nach Adenau
Zur Miete in der Pickelsgasse
Das Haus in der Hauptstraße 22
Mein Vater – Beruf und Hobby
Meine Mutter - Geschäft, Haushalt und Freizeit
Der Nürburgring Die Anfänge
Der Nürburgring als Wirtschaftsfaktor
Die großen Rennen
Kindheitserlebnisse am Nürburgring
Der Nürburgring verändert sich
Kindergarten und Schuljahre in Adenau
Wirtschaftswunder in Adenau
Der „Kalte Krieg“
Eingliederung ehemaliger Wehrmachtsangehöriger in den Staatsdienst
Die Bundeswehr entsteht
Volksschulzeit in Adenau
Im Progymnasium von Adenau
Schüleraustausch
Jugenderlebnisse
Stadtteiljungs
Messdiener
Badevergnügen
Erste Ausflüge
Gefährliche Spiele
Fahrten mit den Eltern
Gastwirtskind
Beeindruckende Berufe
Anmerkungen
Schulwechsel und Bundeswehr
Schulwechsel nach Münstermaifeld und Abitur
Bundeswehr 1965-1967
Standort Straubing
Ausblick
Literaturverzeichnis:
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis:
Orts- und Personenverzeichnis:
Einführung
Es ist für einen fast 80-Jährigen nicht einfach, eine ungeschönte Lebensbilanz zu ziehen. Wir Menschen sind so veranlagt, dass wir die guten Seiten im bisherigen Leben überhöhen und sogar verklären, dafür aber die dunklen Kapitel verdrängen und oft gedanklich wegschließen. Ich habe allerdings keinen Grund, unzufrieden über den Verlauf auch nur eines einzigen Lebensabschnittes zu sein.
Blickt man nach sieben Lebensjahrzehnten auf seine eigene Vergangenheit zurück, entdeckt man nur in seltenen Fällen eine gerade Lebenslinie und logisch oder folgerichtig aneinander gefügte Lebensstationen. Aus der groben Einteilung von Jugend und Berufsausbildung sowie Familiengründung und beruflichem Werdegang ergibt sich ein erstes Raster. Es wird ergänzt durch einen Lebensabschnitt nach dem Berufsleben, in dem oftmals auch eine schmerzliche Zäsur fällt. So war es jedenfalls bei mir.
Die Motivation, Geschehnisse aus meinem bisherigen Leben zu erfassen, entstand erst spät, steigerte sich allerdings immer mehr. Sie wurde zum nicht geringen Teil durch meine Erfahrung gestärkt, dass ich manches Mal von jüngeren Gesprächsteilnehmern oder Zuhörern recht ungläubig angesehen wurde, wenn ich aus Ereignissen meiner Jugendzeit, der Studienzeit oder von Begegnungen in meinem beruflichen Leben erzählte. So reifte mein Entschluss, einiges davon zu Papier zu bringen.
In vielen Gesprächen mit Gleichaltrigen, meinen früheren Klassenkameraden oder in geselliger Runde in meinen Vereinen erfuhr ich immer wieder von Gleichaltrigen, dass das von mir Erlebte nicht einzigartig oder gar außergewöhnlich war. Ich erfuhr im Gegenteil parallele Erlebnisse und hörte von ähnlichen Erfahrungen aus der Kindheit, der Jugend oder aus dem Berufsleben meiner Gesprächspartner. Erzählte ich davon allerdings meinen Kindern oder jüngeren Leuten aus meinem Bekanntenkreis, stieß ich mit meinen Aussagen so manches Mal auf Skepsis bis hin zu ungläubigem Staunen. Oftmals witterte ich dahinter geradezu den Vorbehalt, ich würde von Dingen erzählen, die es nach den heutigen Alltagserfahrungen gar nicht so gegeben haben könnte. So kam ich manchmal in den Geruch eines Berichterstatters aus fremden Welten oder Märchenerzählers.
Deshalb habe ich auch alsbald eingesehen, dass man bei der Schilderung früherer Lebensphasen die geschichtlichen Bezüge mit einfließen lassen muss. Sie belegen oftmals, dass das selbst Erlebte fast immer gar nicht so exotisch war und durchaus in die Zeit passt. Zum Glück hält die heutige Geschichtsschreibung viele Werke vor, an denen sich der Amateur in dieser Disziplin orientieren kann. Auch dabei habe ich häufig feststellen können, dass meine Lebensstationen gar nicht so ungewöhnlich waren und durchaus in die Zeit passten.
Auf der anderen Seite haben gerade wir Deutschen erfahren müssen, dass gerade das Fach Geschichte Tür und Tor öffnet für Manipulationen und sogar Verführungen. So wurde manches, was längst niedergeschrieben war, einfach nicht weitergegeben. Dies habe ich vor allem in meiner Schulzeit oft genug erlebt. Dort endete, wo auch immer ich war, die deutsche Geschichte vor dem Ersten Weltkrieg. Napoleon, dem gerade das Rheinland die Befreiung Aller vom Feudalismus und ein vergleichsweise modernes Rechtssystem zu verdanken hatte, wurde als Monster dargestellt. Ebenso erging es der preußischen Herrschaft im Rheinland, die mit ihren wirklichen Bezügen erst heute nach und nach regional und lokal aufgearbeitet wird.1 Derartige, von Vorurteilen getragene Reflexe schimmern allerdings heute immer noch bei aktuellen Fragestellungen durch, wie beispielsweise beim Sozialdemokraten-Bashing unserer Mainstream-Presse zu Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine.2 Kein Wunder also, dass ich als Kind und Heranwachsender von den damals vorherrschenden Sichtweisen geprägt wurde und mich durch eigene Erfahrungen erst allmählich davon befreien konnte.
Meine Kindheit in Adenau
Familie und Herkunft
Geburt in unruhigen Zeiten
Ich kam am 10. August 1944 in Adenau in der Eifel zur Welt. Der von der in Deutschland herrschenden nationalsozialistischen Diktatur unter Adolf Hitler angezettelte Zweite Weltkrieg befand sich in seiner Endphase. An der Ostfront hatte General Friedrich Paulus bereits im Januar 1943 mit seiner 6. Armee im Kessel von Stalingrad kapituliert, die von der Wehrmacht eingekesselte Stadt Leningrad war im Januar 1944 von der Roten Armee befreit worden. Im Juni 1944 war den westlichen Alliierten die Anlandung ihrer Bodentruppen in der Normandie gelungen. Die deutschen Truppen befanden sich überall auf dem Rückzug. Luftangriffe durch alliierte Bomber und Jagdflugzeuge waren im Westen an der Tagesordnung, so auch ihre Bedrohung über Adenau. Die deutsche Luftwaffe war dezimiert, weitgehend handlungsunfähig und konzentrierte sich auf die industriellen Zentren.Meine Mutter Elisabeth Puschke, geborene Koll war ein Kind dieser Region. Sie war noch keine 22 Jahre alt, als sie mich gebar. Zudem wurde sie die Älteste von drei Geschwistern mit ihren jüngeren Brüdern Franz-Josef und Rolf. Sie kam am 17. August 1922 ebenfalls in Adenau zur Welt und wuchs dort wohlbehütet auf. Sie durchlief, wie damals bei den meisten Mädchen üblich, ihre schulische Ausbildung in der Volksschule und absolvierte danach eine Verwaltungslehre bei der damaligen Amtsverwaltung von Adenau. Hier war sie zuletzt bis zu meiner Geburt als Assistentin des Amtsbürgermeisters tätig. In dieser Funktion begegnete sie auch erstmals 1941 meinem Vater, der als Kompaniefeldwebel mit seiner Kompanie in der Phase der Vorbereitung des Überfalls der Wehrmacht auf Frankreich in einem Nachbarort von Adenau stationiert war.
Meine Großeltern mütterlicherseits
Die Eltern meiner Mutter stammten von der oberen Ahr. Großmutter Anna Koll, geborene Wieland, am 13. Mai 1897 geboren, war die älteste von zehn Kindern und wuchs in Brück/Ahr auf. Ihre Eltern bewirtschafteten einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, der zum Fortführen durch eines der Geschwister wegen seiner geringen Größe allerdings schon damals nicht mehr geeignet war. Deshalb lernten all ihre Brüder Berufe, die sie später auch erfolgreich machten. So wurde einer von ihnen in Koblenz Leiter einer Vorgängerbehörde meiner letzten dienstlichen Verwendung. Ihre Schwester Maria, meine Patentante, lernte wie meine Großmutter Hauswirtschaft.
Abb. 1: Urgroßmutter Katharina Koll, geb. Wagner, geb. 01.12.1867
Großvater Josef Koll, geboren am 29. Januar 1898, stammte aus Staffel, einem kleinen Dorf in einem Seitental der Ahr. Er hatte drei Geschwister, von denen sein Bruder Alois und seine Schwester Maria die elterliche Landwirtschaft mit Gaststätte und Brennerei fortführten. Als Geburtsjahrgang 1898 war er beim Beginn des Ersten Weltkrieges erst 16 Jahre alt und wurde nicht mehr als Soldat eingezogen.
Abb. 2: Die Großeltern Anna und Josef Koll 1926
Meine beiden Großeltern mütterlicherseits verbrachten ihre Kindheit und Jugend in den kleinen landwirtschaftlichen Betrieben ihrer Eltern, die damit immerhin ihre großen Familien durchbringen konnten. Schon früh wurden sie in die landwirtschaftlichen Abläufe eingebunden, mussten mit aufs Feld, Kühe hüten und bei der Ernte mithelfen. Die kleinen landwirtschaftlichen Anwesen in der Region meiner Großeltern betrieben etwas Viehzucht mit Milchkühen und Schweinemast. Die Feldarbeit wurde dort nicht mit Pferden, sondern mit Kühen, allenfalls mit einem oder zwei Ochsen, betrieben.
Abb. 3: Großmutter Anna, geb. Wieland, mit Urgroßmutter und ihren Kindern
Getreideanbau war in der rauen Eifel nur eingeschränkt möglich; der Kartoffelanbau diente hauptsächlich zur Selbstversorgung. In der elterlichen Landwirtschaft meines Großvaters wurde auch Waldwirtschaft betrieben. Der Holzeinschlag aus ihren kleinen Wäldern war immer ein sicheres Zubrot. Dort lagen auch die familiären Wurzeln, die im Familiennamen Koll für Köhler erkennbar sind. Daneben wurde im Anwesen meiner Urgroßeltern Schnaps gebrannt und eine Gaststätte betrieben, die wegen der vollkommen abseits gelegenen Lage allenfalls von den Dorfbewohnern besucht wurde.
Die Eltern meiner Mutter waren Kinder aus benachbarten Dörfern der katholischen Pfarrei Kesseling, zu der auch die Orte Brück/Ahr und Kesseling gehörten. Sie begegneten sich bei ihren Kirchgängen und waren sogar weitläufig über die Generation ihrer Großeltern miteinander verwandt. So wurden sie bereits als Jugendliche miteinander bekannt.
Bis zu ihrem Alter als Heranwachsende genossen sie eine Kindheit in einer Zeit des Friedens, bis der Ausbruch des Ersten Weltkrieges sich bis unmittelbar in ihre Familien und den benachbarten Dörfer bemerkbar machte. Beide Väter mussten in den Krieg; beide ließen in ihm ihr Leben. Ihre zurückgebliebenen Familien konnten nur aufgrund der tätigen Mithilfe auch der Kinder überleben. Für weiterführende Ausbildung und höhere Qualifikation blieb allen keine Zeit. Allerdings litten sie wegen ihres bäuerlichen Hintergrundes mit bescheidenem Grundbesitz auch keine direkte materielle Not, da die Grundversorgung der bäuerlichen Familien gesichert war.
Die Heimatregion
Der Landkreis Adenau, zu dem die Orte Brück/Ahr und Staffel gehörten, umfasste in der Hocheifel die damaligen Ämter (Bürgermeistereien) Aremberg, Brück, Virneburg, Kempenich, Kelberg und Adenau. Der Kreis lag an der nördlichen Peripherie des früheren Regierungsbezirks Koblenz in der zu Preußen gehörenden Rheinprovinz und grenzte im Norden an den Kreis Ahrweiler, den Regierungsbezirk Köln, im Westen an den Regierungsbezirk Trier, im Osten an den Kreis Mayen und im Süden an den Kreis Cochem. Seine Größe betrug bis zu seiner Auflösung im Jahr 1932 insgesamt 9,672 preußische Quadratmeilen (ca. 549 km2) mit 25.153 Einwohnern.3
Der Kreis Adenau war von seiner Einwohnerzahl her der kleinste der acht Landkreise des preußischen Regierungsbezirks Koblenz, allerdings flächenmäßig der drittgrößte Landkreis. Seine Fläche lag in der Eifel um ihre höchsten Erhebungen herum. Seit seiner Gründung 1816 gehörte er zu den ärmsten Kreisen im gesamten Preußen. Die dort anzutreffenden Bodenverhältnisse wurden 1831 als gebirgig und im Ganzen bei einer rauen und feuchten Luft als wenig fruchtbar beschrieben. Den größten Teil nähmen Wald, Heide- und Gesträuchlandschaften ein. Nur im Tal der Ahr und ihrer Seitentäler fänden sich Wiesen und Ackerflächen. Das geerntete Heu und die Futterkräuter reiche kaum für die Fütterung des dort gehaltenen Viehbestandes.4
Abb. 4: Der Landkreis Adenau 1836
Allerdings ist auch belegt, dass sich der Ahrweinbau bis um die Wende zum 20. Jahrhundert über Brück/Ahr und Kesseling bis nach Hönningen/Ahr erstreckte.5 So wurden mir bei meinen Ferienaufenthalten bei meiner Patentante Maria, die als jüngste Schwester meiner Mutter zunächst im elterlichen Haus in Brück/Ahr zusammen mit ihrer Familie wohnte, Reste von Weinbergs-Terrassen gezeigt, auf denen ich als Kind noch verwilderte Weinstöcke mit vereinzelten Reben fand. Möglicherweise lagen im Weinanbau die Ursprünge für die Brennrechte im Haus meines Großvaters, da der sonstige Bodenertrag kaum zum Schnaps Brennen reichte.
Mein Großvater Josef Koll beschrieb 1932 die wirtschaftliche Situation im Kreis Adenau wie folgt:
„Der Eifelkreis Adenau, im Regierungsbezirk Koblenz gelegen, wurde von jeher als eines der Gebiete des Deutschen Reiches angesehen, die von Natur aus mit ungünstigen Lebensbedingungen ausgestattet sind. Auf einem Flächenraum von 55.010,88 ha verteilt sich die 27.000 Einwohner umfassende Bevölkerung auf 185 Wohnplätze mit 107 politischen Gemeinden. Der weitaus größte Teil der Bevölkerung –etwa 90 v. H.- betreibt Landwirtschaft. Der Durchschnittsflächenertrag des Grundbesitzes beträgt 5,69 Reichsmark je Hektar, wobei zu berücksichtigen ist, dass von diesem Gesamtbesitz im Allgemeinen nur etwa drei bis vier Hektar landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich nutzbar sind.
Diese betriebswirtschaftlichen Verhältnisse in Verbindung mit einer ungünstigen Bodenbeschaffenheit werden zum Nachteil der landwirtschaftlichen Erzeugung noch durch ein raues Klima und eine gebirgige Lage beeinträchtigt. Alle diese Umstände zwingen die Landwirtschaft des Kreises, in der Hauptsache Viehwirtschaft zu betreiben. Auch in dieser Hinsicht ergeben sich durch den erschwerten Absatz der tierischen Erzeugnisse für die Wirtschaftlichkeit der Betriebe erhebliche Nachteile gegenüber den landwirtschaftlichen Niederungsgebieten und den landwirtschaftlichen Gegenden in der Nähe von größeren Städten.
Aus dieser wirtschaftlichen Eigenart ergibt sich die Tatsache, dass die Bevölkerung durch harte Arbeit und unter Entbehrungen ihr Dasein fristen muss. Von jeher hat der Ertrag der bäuerlichen Betriebe nur für die Bestreitung des nackten Lebensunterhalts der Familien ausgereicht. Trotz dieses schweren Lebenskampfes, der stets bestand und in Zeiten wirtschaftlicher Abwärtsentwicklung zeitweise zu krassen Notverhältnissen führte, ist die Bevölkerung immer von dem Bestreben beseelt gewesen, in ihren Betrieben den einzelnen Wirtschaftszweigen die Förderung angedeihen zu lassen, die volkswirtschaftlich erforderlich war und sich aus der allgemeinen technischen Gesamtentwicklung der Landwirtschaft ergab. Es ist auf den starken Lebenswillen der Bevölkerung, - verbunden mit Sparsamkeitssinn und Fleiß zurückzuführen -, dass besonders in den Nachkriegsjahren und trotz des Niedergangs der Gesamtwirtschaft auf den verschiedensten Gebieten in der Landwirtschaft eine Reihe sichtbarer Verbesserungen durchgeführt werden konnten“.6
Regionales Zentrum für die Orte, aus denen meine Großeltern mütterlicherseits stammten, war die 15 km entfernte damalige Kreisstadt Adenau. Als Verwaltungssitz des Landkreises hatte Adenau seit 1816 eine städtische Gemeindeverfassung; seine Einwohnerzahl betrug um 1920 etwa 2.200. Die Orte Brück/Ahr und Staffel gehörten zur Landgemeinde Kesseling, in der die katholische Pfarrei ebenfalls das örtliche Zentrum für die weit überwiegend katholische Bevölkerung bildete.
Abb. 5: Rheinland-Besetzung seit 1919
Die an der Ahr und ihren Seitentälern lebende Bevölkerung orientierte sich für ihre Einkäufe, für die Abwicklung von Behörden- und Gerichtsangelegenheiten und die medizinische Versorgung Richtung Adenau, das seit der Wende zum 19. Jahrhundert mit der Ahrtalbahn und seit 1912 sogar durch das gesamte obere Ahrtal bis nach Jünkerath mit der Eisenbahn erreicht werden konnte. Kempenich war über die Brohltalbahn zur Rheinstrecke hin verbunden, von der die Ahrtalbahn in Remagen abfuhr. An der Betreiberaktiengesellschaft hielt der Landkreis Adenau zusammen mit den Nachbarkreisen Ahrweiler und Mayen 55% der Anteile.7 So konnte ein großer Teil der Einwohner des Kreises mit der Eisenbahn Köln, Koblenz und sogar Trier erreichen. Größere Einkäufe wurden in Köln getätigt. Nur von den Ämtern Kelberg und Virneburg gab es keine Eisenbahnverbindungen nach Adenau.
Der Landkreis Adenau wurde zum 1. Oktober 1932 über 106 Jahre nach seiner Begründung durch die preußische Verordnung über die Neugliederung von Landkreisen vom 1. August 1932 aufgelöst.8 Die Sparmaßnahmen des Reichspräsidenten nach dem „Preußenschlag“ vom 20. Juli 1932, durch die preußische Staatsregierung abgesetzt und ein Reichskommissar eingesetzt wurde, traf den Kreis Adenau ebenso, wie 57 andere Landkreise in Preußen, darunter die Kreise Bad Kreuznach und Meisenheim im Regierungsbezirk Koblenz. Großvater Josef verfasste auf Veranlassung des damaligen Landrats Dr. Otto Creutz seine 27 Seiten umfassende Schrift, die den Kampf der Adenauer Bevölkerung gegen eine im November drohende Herrschaft der rheinischen Separatisten im Kreis Adenau in Erinnerung brachte. Sie schrieb er vor allem auch deshalb, um mit ihr die Entscheidung im preußischen Innenministerium im Sinne einer Aufrechterhaltung des Kreises Adenau zu fördern. Seine Mühen, -wie die vieler anderer Bürger und Kommunalpolitiker-, waren jedoch vergeblich, obwohl seine Schrift ausdrücklich dem damaligen Reichspräsidenten Paul v. Hindenburg gewidmet war. Ob der sie jemals zu Gesicht bekommen hat?
Die Großeltern in Adenau in den Krisenjahren der Weimarer Republik
Großvater besuchte im benachbarten Kesseling die Volksschule und war, so wurde er mir aus dem Kreis seinen früheren Bekannten in Adenau geschildert, ein begabter Autodidakt, der sich den Journalismus bei einer kleinen Zeitung in Adenau selbst beibrachte. Dort spezialisierte er sich neben tagesaktuellen regionalen Themen zunächst auf die Bereiche der bäuerlichen Landwirtschaft und des Weinbaus im Rheinland. Er gründete einen landwirtschaftlichen Fachverlag und veröffentlichte seine Artikel in Fachblättern zu landwirtschaftlichen Themen - insbesondere über bäuerliche Klein- und Mittelbetriebe. Geprägt von den politischen Ereignissen nach dem Ersten Weltkrieg in der Rheinprovinz griff er zunehmend auch tagespolitische überregionale Themen auf.
Im Rheinland herrschte seit 1919 eine Sondersituation. In der gesamten preußischen Rheinprovinz und dem südlich anschließenden Rheinland bis zur Grenze des wieder zu Frankreich gehörenden Elsass durften keine Truppenteile der Reichswehr stationiert werden. Diese Zone erstreckte sich auch rechts des Rheins ostwärts 50 km tief bis zur Schweizer Grenze.9 Sie stand unter Besatzung der Streitkräfte von Belgien, Frankreich, Großbritannien und der USA. Seit Januar 1920 hatte in Exekution des Versailler Vertrages die Rheinlandkommission der Alliierten die Aufsicht über die Verwaltung dieses besetzten Gebietes übernommen. Sie wurde vom französischen Hochkommissar Paul Tirard (1879 - 1945) von Koblenz aus geleitet.
Zwar sollte die Verwaltung des Gebiets weiterhin durch die deutschen Behörden und auf der Grundlage der deutschen Gesetzgebung erfolgen. Den Besatzungsmächten standen allerdings einschneidende Eingriffsmöglichkeiten zu. Sie nutzten sie auch dazu, nicht in ihrem Sinne kooperationsbereite Regierungspräsidenten, Landräte oder sonstige leitende Beamte ihrer Ämter zu entheben und aus dem besetzten Gebiet auszuweisen.10 Die Befugnis, ihnen genehme und willfährige Beamte als Ersatz einzusetzen, maßten sie sich allerdings nicht an. Die Dienstposten der Ausgewiesenen blieben einfach ohne Nachbesetzung.
Belgische Truppen wurden von Aachen entlang des Niederrheins stationiert und übten dort die militärische Befehlsgewalt aus. Britische Truppen setzten sich in der Stadt Köln sowie den früheren Landkreisen Köln, Mühlheim, Bergheim, Gummersbach und Waldbröl des Regierungsbezirks Köln fest. Amerikanische Truppen besetzten das Gebiet um Koblenz von der Ahrmündung bis nach Bacharach und rückwärts bis zu den Westgrenzen der früheren Landkreise Adenau und Cochem. Französische Truppen hatten die militärische Kommandogewalt südlich der amerikanischen Einflusssphäre in Rheinhessen und der Pfalz.
Westlich des britischen Brückenkopfs von Köln und des amerikanischen Brückenkopfs von Koblenz besetzten französische Truppen den früheren Regierungsbezirk Trier sowie vom Regierungsbezirk Köln die Landkreise Bonn, Sieg, Rheinbach und Euskirchen, darüber hinaus vom Regierungsbezirk Aachen die Kreise Düren, Jülich und Schleiden. Damit hatte die französische Besatzungsmacht westlich der nicht zu ihrer Einflusssphäre gehörenden Brückenköpfe Köln und Koblenz bis zur Westgrenze des Deutschen Reichs einen durchgehenden Korridor von Düren und Schleiden bis in die Pfalz in ihrer Hand.11
Bereits 1919 begann in Deutschland eine inflationäre Geldentwertung, die von der deutschen Reichsregierung hingenommen wurde, weil sie die damals noch nicht der Höhe nach feststehenden Reparationsverpflichtungen minderte. Als aber am Ende der Londoner Konferenz vom 1. bis zum 7. März 1921 die Höhe der von Deutschland zu leistenden Reparationen feststand, setzte hier eine Hyperinflation ein, die durch die politischen Wirren der Ruhrbesetzung und Putschversuchen des Jahres 1923 ins Uferlose gesteigert wurde. Sie nahm so verheerende Ausmaße an, dass die Reichsregierung die Geldversorgung der Bevölkerung nicht mehr sicherstellen konnte. Der Staat verlor in Deutschland das Monopol der Geldversorgung. Nachdem die Druckerpressen der Reichsbank mit dem Ausdruck von Reichsmarknoten mit Werten von bis zu 5.000 Mark pro Note nicht mehr nachkamen und selbst ihr Überdruck mit Milliardenwerten nicht mehr möglich wurde, übernahmen neben Wirtschaftskonzernen die Kommunen den Ausdruck und die Auslieferung von Notgeld. Auf dem Höhepunkt der Krise betrug der Wert eines US-Dollars dem Umtauschwert von 4,2 Billionen Mark.12 Auch in Adenau und Umgebung wurde eigenes Notgeld ausgedruckt.
Abb. 6: Adenauer Notgeld 1923
Als meine Großeltern im Jahr 1921 heirateten und ihre Familie gründeten, steuerte die krisenhafte Entwicklung der Weimarer Republik ihrem Höhepunkt zu. Ab 11. Januar 1923 wurde das Ruhrgebiet durch französische und belgische Truppen besetzt. Als Begründung wurden von den Siegermächten des Ersten Weltkrieges Rückstände Deutschlands bei Reparationslieferungen angeführt. Sie sollte, wie von der heutigen Geschichtsforschung aufgearbeitet ist, das Bestreben vor allem Frankreichs überdecken, die deutsche Wirtschaft zu schwächen und nach der Rückgewinnung des Elsass und von Lothringen einen frankreichfreundlichen Rheinstaat vom Reich abzuspalten.13 Frankreich und Belgien übernahmen in diesem Gebiet auch die Kontrolle über die Reichsbahn und führten sie als ihre Regiebahn (regie de chemins de fer des régions occupées) von Düsseldorf, später von Mainz aus.14
Die Einführung der Rentenmark ab dem 15. November 1923, die im gesamten übrigen Reich einen damals kaum erwarteten Wirtschaftsaufschwung brachte, verschaffte dem Rheinland keine Besserung seiner Währungsmisere. Die Bevölkerung musste bis zur Einführung der goldgedeckten Reichsmark am 30. August 1924 mit kommunalem Notgeld als alleinigem Zahlungsmittel auskommen. Berlin hatte, so der Historiker Heinrich August Winkler, das Rheinland sich selbst überlassen. Für die Reichsregierung sei die Gefahr einer Verselbstständigung des Rheinlandes im Staatenverbund des Reichs geringer beurteilt worden als der wirtschaftliche Zusammenbruch des Gesamtstaats. Dessen Ruin sah man vor Augen, wenn das besetzte Gebiet durch die Währungsstabilisierung wirtschaftlich gestützt worden wäre.15 Dahinter könnte auch das Kalkül gesteckt haben, das Rheinland als Faustpfand von Belgien und Frankreich nicht durch stabiles Geld zu Lasten des Reichs aufzuwerten.
Abb. 7: Das ehemalige Landratsamt in Adenau 1920, durch Bomben zerstört 1945
Als die amerikanischen Besatzungstruppen im Januar 1923 aus der Zone um Koblenz abgezogen wurden, übernahm Frankreichs Militär die bewaffnete Macht von der Grenze zum heutigen Nordrhein-Westfalen bis in die Pfalz. In allen Verwaltungszentralen, so nun auch den Landratsämtern und Regierungspräsidien der von den französischen Truppen überwachten Gebiete, wurden sogenannte Delegierte der Militärmacht mit ihren Stäben eingerichtet, die das Verwaltungshandeln dieser Behörden kontrollierten und in ihrem Sinne beeinflussten. Damit übten sie auch die Kontrolle über den Polizeiapparat aus; deutsches Militär war hier ohnehin nicht vorhanden.
Der Putsch der Separatisten im Rheinland
Ab August 1923 lebte hier die Bewegung der militanten rheinischen Separatisten wieder auf. Sie hatte unter der britischen und amerikanischen Besetzung im Rheinland um Köln und Koblenz keine Rolle gespielt, wurde jedoch von der belgischen und französischen Besatzung um Aachen und Mainz geschützt und logistisch unterstützt. Ihre Zonen wurden zu Aufmarsch- und Rückzugsgebieten für ihre bewaffneten Kommandos. Es lag durchaus im Interesse der damaligen belgischen und französischen Staatsführung, ihre Einflussgebiete vom Reich aus zumindest zu neutralisieren und in den dortigen Verwaltungen bis in die Kreisebenen hinein Einfluss zu gewinnen.16
In der zweiten Hälfte des Jahres 1923 spitzte sich die krisenhafte Situation im Rheinland zu. In Koblenz, dem Sitz des Oberpräsidiums der Rheinprovinz, versammelten sich am 15. August die unterschiedlichen Gruppierungen der rheinischen Separatisten und riefen eine „Vereinigte rheinische Bewegung“ aus, die von Hans Adam Dorten (1880 - 1963), Josef Friedrich Matthes (1886 - 1943) und dem Aachener Fabrikanten Leo Deckers geleitet werden sollte. Als Ziel der Bewegung wurde nun, anders als bei den früheren Bestrebungen der rheinischen Separatistenbewegung im Zuge der Debatten um die Weimarer Reichsverfassung des Jahres 1919, die völlige Abspaltung des Rheinlands vom Deutschen Reich unter dem Protektorat Frankreichs proklamiert. Sie sollte durch Kundgebungen und Versammlungen, aber auch durch gewaltsame Besetzungen von Verwaltungszentren im Rheinland befördert werden.17
Die ersten gewaltsamen Putschversuche der Separatisten vollzogen sich ab Oktober 1923 im Aachener Raum. In Eschweiler versuchten sie am 22. und 23. Oktober einen Putsch im Rathaus, der jedoch an den Selbstschutzeinheiten der Stadt scheiterte. Diese Einwohnerwehren hatten sich seit 1920 mit Unterstützung des Reichs und der Länder überall dort gebildet, wo die Polizei nicht schlagkräftig genug für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sorgen konnte. Im von deutschen Truppen entmilitarisierten Rheinland ersetzten sie teilweise die bewaffnete Macht.18 Es folgte ab dem 21. Oktober der Separatistenputsch in Aachen mit Schusswechseln zwischen den Separatisten und der lokalen Polizei, der am 2. November auf Befehl des belgischen Hochkommissars beendet wurde.
Der paramilitärische Arm der Separatisten bestand aus den „Rheinland-Schutztruppen“ Sie sollen sich aus mehreren Tausend gewaltbereiten Männern des Rheinlandes, des Ruhrgebietes und der Pfalz rekrutiert haben, deren Vorgehensweise allerdings ohne militärischer Grundkenntnisse nach der Art von Räuberbanden gekennzeichnet war. Auf ihr Konto gingen die Überfälle und Schießereien in Limburg und im Lahntal, im Westerwald und rund um Maria Laach im November 1923, die überall Tote und Verwundete kosteten.19 Das Ziel ihrer Aktionen war, die lokalen Verwaltungszentren zu besetzen, ihre Funktionsfähigkeit zu beseitigen und durch die eigene Kommandogewalt zu ersetzen, die grün-weiß-rote Fahne der „Rheinischen Republik“ aufzupflanzen und die Bevölkerung einzuschüchtern und in Schach zu halten.
Am Sitz des Oberpräsidiums in Koblenz versuchten seit dem 21. Oktober 1923 bewaffnete Separatisten den Putsch gegen die Verwaltung der Rheinprovinz. Zwei Tage später gelang es den mit der Eisenbahn transportierten Einheiten der Rheinland-Schutztruppen, das Koblenzer Schloss zu erstürmen und auf dem Gebäude ihre grün-weiß-rote Flagge zu hissen. Hans Adam Dorten und Josef Friedrich Matthes übernahmen die Führung der Regierung der Rheinischen Republik. Ebenfalls am 23. November 1923 kam es in Wiesbaden zu Besetzungen öffentlicher Gebäude durch die Separatisten.
Als die Separatisten in Koblenz am 23. Oktober 1923 durch die örtliche Polizei unter Leitung des Oberbürgermeisters Karl Russell aus dem Schloss verdrängt wurden, unterstellte die französische Militärverwaltung sie ihrem Befehl. Damit erhielten sie am Sitz des Oberpräsidiums freie Hand für ihr Vorgehen. Am 26. Oktober erkannte der Hochkommissar der Rheinland-Kommission Tirard die Vertretung der Separatisten in Koblenz als „Inhaber der tatsächlichen Macht“ an und bestätigte Matthes als Ministerpräsident der rheinischen Republik. Damit wurde die Regierung der preußischen Rheinprovinz entmachtet. Oberbürgermeister Russell wurde seines Amtes enthoben und ausgewiesen.20
Die Herrschaft der Separatisten konnte in Koblenz nur bis zum 27. November 1923 aufrechterhalten werden. Sie scheiterte am Widerstand der Koblenzer Bevölkerung, an ihrem eigenen Unvermögen zu einer effektiven Verwaltungsarbeit und schließlich an der schwindenden Unterstützung durch die französische Militärverwaltung. Der Hauptgrund ihres Scheiterns ist jedoch in dem zunehmenden Zerwürfnis zwischen Dorten und Matthes zu sehen. Dorten strebte mit der französischen Militärverwaltung einen einheitlichen Staat von der Ruhr bis zur Pfalz an, während Matthes mit dem Hauptdrahtzieher des Aachener Putsches vom 21. Oktober 1923, Leo Deckers, auf eine von Belgien unterstützte Bildung von drei Staaten im Rheinland hinarbeitete. Matthes verlor so die Unterstützung des französischen Hochkommissars Tirard und trat am 27. November 1923 von seiner Funktion als selbsternannter Ministerpräsident der rheinischen Republik zurück.21
Abb. 8: Die „Pickelsgasse“ in ‘Adenau,in den 1950er Jahren, rechts Metzgerei Schmitz (Mäxe), Schreinerei Breuer, Hotel Eifler Hof, vorn links das ehemalige Bürgermeisteramt
Die rheinischen Separatisten in Adenau
Im November 1923 stießen starke Trupps der rheinischen Separatisten von Norden kommend westlich der britischen Militärzone vorbei auch in die Eifel vor. Die benachbarte Kreisstadt Daun und der Eisenbahnknotenpunkt Gerolstein waren seit dem 22. Oktober 1923 in ihrer Hand22. Auch im Landkreis Mayen hatten sich Ortsgruppen der Separatisten gebildet, die in Mayen, Andernach und in den benachbarten Rheinorten ihr Unwesen trieben. Sie erschossen in Auseinandersetzung mit der Bevölkerung von Mayen und Brohl vier Bürger, plünderten öffentliche Kassen und konnten erst Ende Oktober 1923 nieder gerungen werden.23 Dass sie auch bis Adenau vordringen könnten, lag durchaus im Bereich des Möglichen. Dies geschah dann am 12. November 1923. Die Ereignisse, die nun folgten, beruhen auf einer Zusammenfassung der Schilderung meines Großvaters aus dem Jahr 1923.24
Am 11. November 1923 wurde in Adenau die Martinskirmes gefeiert. Wegen der wirtschaftlichen Situation der Zeit waren die Kirmesvergnügungen sehr bescheiden. Dennoch begann das Leben in der Kreisstadt Adenau nicht mit der preußischen Pünktlichkeit eines normalen Montagmorgens. Plötzlich machte folgende Nachricht überall die Runde: „Die Separatisten sind da.“ Sie kamen mit dem ersten Zug von Remagen und Ahrweiler aus gegen acht Uhr in Adenau an25 und marschierten sofort in einer Stärke von 115 Männern in geschlossener Formation mit einer grün-weiß-roten Fahne vom Bahnhof aus zum Landratsamt. Dort war wegen des vorangegangenen Kirmes sonntags noch kein Bediensteter anwesend. Kurzerhand verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Dienstgebäude und sicherten seine Eingänge mit bewaffneten Doppelposten.
Die Dienstgeschäfte im Landratsamt Adenau wurden damals von Obersekretär Josef Groll geführt, da Landrat Friedrich Gorius von der Besatzung der Rheinprovinz seiner Dienstgeschäfte enthoben worden war. Groll betrat am besagten Montag als erster Amtsangehöriger das Dienstgebäude, wies sich bei den Posten aus und wurde zum Anführer der Separatisten geführt. Dieser „Kommissar“ trat ihm mit zwei bewaffneten Begleitern entgegen und forderte ihn auf, ihm alle Kassen- und Geldschrankschlüssel herauszugeben und ihn zu den Kassenräumen zu führen. Danach eigneten sich die Separatisten alle im Landratsamt lagernden Gelder an, vorwiegend Gehälter und Unterstützungsgelder. Groll und weitere vier eingetroffene Bedienstete wurden danach festgesetzt und im obersten Stockwerk des Gebäudes unter Bewachung eingesperrt.
Abb. 9: Skizze meines Großvaters zur Situation am früheren Landratsamt
Im Verlauf des Morgens des 12. November verließ der „Kommissar“ in bewaffneter Begleitung das Landratsamt in Richtung Markt und ließ die Hotels „Halber Mond“ und „Eifler Hof“ als Quartiere für die Separatisten beschlagnahmen und besetzen. Am Fahnenmast des Landratsamtes wehte nun die grün-weiß-rote Fahne der Separatisten. Die Nachricht von den Gewaltakten der Separatisten ging in Adenau blitzschnell von Haus zu Haus. Widerstand formierte sich.
Der Bürgermeister des Amtes Adenau, Gerhard Müller, nahm rasch das Heft des Handelns in seine Hand. Er bat den Kaufmann Eugen Baur und meinen Großvater zu einer Lagebesprechung. Sie vertraten damals als Wirtschaftssachverständige des Kreises Adenau seine Interessen gegenüber dem Kreisdelegierten der französischen Besatzung. Es kam jetzt vordringlich darauf an abzuklären, wie sich die Besatzungsmacht zur gewaltsamen Übernahme der Staatsgewalt im Kreis durch die Separatisten stellte. Ein Telefonanruf meines Großvaters vom Haus des Bürgermeisters aus im Kreishaus in Ahrweiler brachte Klarheit. Der Kreisdelegierte, der in Ahrweiler residierte und von dort aus auch für den Kreis Adenau zuständig war, konnte nicht erreicht werden. Sein Adjutant, Leutnant Conan gab meinem Großvater am Telefon die Auskunft: „Wir erkennen die Regierung an, die die Macht hat.“ Damit war den Besprechungsteilnehmern klar, dass man keine Unterstützung von der Besatzungsmacht zur Beseitigung des Putsches der Separatisten im Kreis Adenau erwarten konnte.
Abb. 10: Marienkapelle gegenüber dem ehemaligen Landratsamt
Als Nächstes einigte sich Bürgermeister Müller mit Baur und meinem Großvater darauf, dass alles versucht werden müsse, um die im Landratsamt gefangen gesetzten Kreismitarbeiter zu befreien. Zwischenzeitlich hatten die Separatisten dort auch den Zeitungsverleger Peter Herbrand festgesetzt, der in seiner Druckerei auch das Notgeld des Kreises Adenau herstellte. Er konnte vor seiner Verhaftung allerdings die Druckklischees des Notgeldes sicher verstecken. Zur Lagebesprechung bei Bürgermeister Müller war nun auch der Bäckermeister Franz Xaver Weber hinzugezogen worden. Baur, Weber und mein Großvater sollten im Landratsamt beim „Kommissar“ der Separatisten die Befreiung der dort Inhaftierten bewirken.
Die drei eilten unverzüglich zum vom Bürgermeisteramt etwa 100 Meter entfernt liegenden Landratsamt und verlangten an der dortigen Wache der Separatisten, zu ihrem Anführer vorgelassen zu werden. Sie wurden in das Gebäude eskortiert, in ein Büro geführt und dort zunächst wartend sitzen gelassen. Nach etwa einer halben Stunde trat ihnen der „Kommissar“ entgegen. Er erklärte den dreien, dass sie ihm bereits bekannt seien und auf seiner „Ausweisungsliste“ geführt würden. Dann ergoss er sich in Ausführungen zu den Zielen des rheinischen Separatismus und schloss mit der Drohung, alle Bürger zu erschießen, wenn sie Widerstand gegen sein Regime leisteten. Den drei Adenauern gelang es jedoch, dem „Kommissar“ einsichtig zu machen, dass die Adenauer Bevölkerung nur dann ruhig gestellt werden könne, wenn die im Landratsamt Inhaftierten freigelassen würden. Sie erreichten so tatsächlich deren Freilassung, und konnten sie so für die weiteren Vorbereitungen des Abwehrkampfes gewinnen
Sodann wurde über die Herausgabe der von den Separatisten beschlagnahmten Unterstützungsgelder und Gehälter verhandelt. Und auch hier hatte die Delegation Erfolg. Man einigte sich darauf, den Separatisten gegen die Herausgabe des größten Teils der requirierten Gelder solange Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, bis die Lage beim französischen Kreisdelegierten in Ahrweiler geklärt sei.26 Der Führer der Separatisten akzeptierte auch die Bedingung, dass eine Delegation aus Adenau zu der Besprechung mit dem Kreisdelegierten hinzu gezogen werden müsse. Die Verhandlung war also bis hierhin für die Adenauer ein erster Erfolg.
Abb. 11: Marktplatz in Adenau in den 1950er-Jahren
Zurück im Bürgermeisteramt wurde noch vor Mittag festgelegt, dass der Kreisausschusssekretär Baur, Peter Herbrand und mein Großvater an der Besprechung mit dem Kreisdelegierten in Ahrweiler teilnehmen sollten. Die Fahrt dorthin war auf zwei Uhr nachmittags festgelegt worden. Baur war pünktlich bei der Abfahrt am Landratsamt anwesend; Herbrand und mein Großvater verspäteten sich jedoch um zehn Minuten. Deshalb fuhr der Führer der Separatisten mit Baur im requirierten Wagen des Landratsamtes ab. Herbrand und meinem Großvater gelang es noch, in einem weiteren, bereits ausgemusterten Dienstwagen des Landratsamts mit einem Chauffeur hinterher zu fahren.
In Ahrweiler kamen sie deshalb am Sitz des Kreisdelegierten im Amtsgericht verspätet an. Der „Kommissar“ hatte seine Besprechung bereits beendet und erklärte den Ankommenden, dass er nun nach Koblenz zur „Rheinlandregierung“ fahren werde, um Anweisungen für sein weiteres Vorgehen im Kreis Adenau zu erhalten. Dorthin machte er sich auch auf den Weg und war während der späteren Geschehnisse in Adenau am Abend des 12. und Morgen des 13. November 1923 nicht anwesend.
Die Adenauer Delegation wurde dennoch zusammen mit Baur, der an den Verhandlungen des „Kommissars“ nicht teilnehmen durfte, zum Büro des Kreisdelegierten vorgelassen. Dort erklärte der deutsch sprechende Adjutant des Kreisdelegierten, Leutnant Conan, dass die Separatisten aus Adenau nicht abgezogen würden, sondern allenfalls ihre Zahl reduziert werden könne. Die Mission der Adenauer Delegation war also gescheitert.
Abb. 12: Marktplatz mit Hotel „Halber Mond“ in den 1930er-Jahren
Die Delegierten fuhren in einer abenteuerlichen Fahrt die 45 km lange Fahrt nach Adenau zurück und musste sich in der Dunkelheit wegen defekter Autoscheinwerfer mit einer Taschenlampe den Weg suchen. Der Wagen wurde spätabends im Landratsamt abgestellt und mein Großvater zunächst wiederum von den Wachen der Separatisten festgesetzt. Nach vielen Erklärungen konnte er sich befreien und zur Berichterstattung in das nahe gelegene Bürgermeisteramt gelangen.
Bei Bürgermeister Müller wurde mein Großvater nach seinem Ergebnisbericht über die Entwicklung der Lage in Adenau informiert. Es fand noch am Abend eine geheime Versammlung in der Volksschule von Adenau statt, in welcher der Widerstand der Bevölkerung organisiert werden sollte. Außerdem wurde der Selbstschutz von Bad Neuenahr und Kempenich sowie die Bürgermeistereien des Kreises um Unterstützung des Widerstandes gebeten. Dies wurde auch zugesagt.
Die Versammlung der verteidigungsbereiten Adenauer fand um neun Uhr abends in der Volksschule unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen statt. Hier wurden zwei Einheiten von bewaffneten Bürgern gebildet, von denen eine unter Führung von Ludwig Stumpf auf vereinbartes Zeichen das Quartier der Separatisten im „Halben Mond“ und die andere Einheit unter Justizsekretär Brensing zeitgleich das Landratsamt angreifen sollten. Angriffszeitpunkt sollte der frühe Morgen des 13. November sein; das Zeichen zum Losschlagen sollte durch das Geläut aller Kirchenglocken in Adenau gegeben werden. Nach Mitternacht sollte sich keiner mehr in der Nähe der Angriffsobjekte aufhalten. Nach abschließender Mahnung von Bürgermeister Müller, alles Besprochene streng geheim zu halten, löste sich die Versammlung auf. Die nach Hause eilenden Männer nutzten nun die Gelegenheit, ihre Waffen für die Auseinandersetzung vorzubereiten.
Die beiden Gebäude, in denen sich die Separatisten festgesetzt hatten, waren einzeln stehende Gebäude in besonderer Lage. Das Landratsamt lag etwa 500 Meter vom Bahnhof entfernt an der Peripherie des Zentrums von Adenau, dem Marktplatz. Auf der gegenüberliegenden Seite lag die Marienkapelle mit einem größeren Vorplatz, etwa 1, 5 Meter über dem Niveau der hier recht breiten Hauptstraße. Auf der Rückseite des Landratsamts befand sich sein Hof und anschließend ein Garten, der sich bis zum Adenauer Bach erstreckte. Hinter diesem Bach lagen Gärten und Wiesen bis an den Steinweg, der auch am Krankenhaus von Adenau vorbeiführte.
Abb. 13: „Halber Mond“ Rückseite. In der Mitte unten am Gebäude der frühere Standort des Gedenksteins für Karl Nett
Das weitere Quartier der Separatisten, das heute abgerissene Hotel „Halber Mond“, hatte mit seiner besonderen Lage eine Schlüsselstellung. Es war ein nach allen Seiten freistehendes Gebäude mit zwei Eingängen und einer vierstöckigen Fensterfront. Das Gebäude lief an seiner Ostseite spitz zu. Dort befand sich sein Hintereingang. Von den hier liegenden Stockwerksfenstern konnte die Hauptstraße fast bis zum früheren Viehmarkt eingesehen werden. An seiner Nordseite floss der damals noch offene Adenauer Bach und wurde an der Westseite des Gebäudes unterhalb des Marktplatzes geleitet, um dann auf der Höhe der Kollengasse in einem offenen Graben weitergeführt zu werden. Jenseits des offenen Bachs führte ein kleiner Weg an der dortigen Häuserfront vorbei. An der Südseite des Hotels verlief die vom Markt und Pferdemarkt kommende Hauptstraße in Richtung Viehmarkt.
Die Vorderfront des Hotels öffnete sich zum westlich gelegenen Marktplatz mit einem repräsentativen Eingangsbereich und breiten Fenstern in jedem seiner vier Stockwerke. Die Sicht aus seinen Erkern und hochragenden Dachfenstern im Dachgeschoss überdeckte alle übrigen Häuser an Marktplatz, Pferdemarkt und entlang der Hauptstraße weit über die einmündende Wimbachgasse hinaus. Für einen Verteidiger im Häuserkampf lag es dort mit seinem Hochparterre, kleinen vergitterten Kellerfenstern und einer dem Haupteingang vorgelagerten Balustrade wie eine Festung.
Hier hatte sich die überwiegende Mehrzahl der Separatisten festgesetzt. Das Hotel gab ihnen Möglichkeiten für Ruheräume und Verpflegung. Von hier aus wurden die Wachen und Posten im etwa 300 Meter entfernt liegenden Landratsamt in zweistündigem Wechsel abgelöst. Die kampfbereiten Adenauer Bürger und vor allem ihre Anführer wussten, dass sie eine schwierige Aufgabe vor sich hatten, wenn ihr Plan der gewaltsamen Vertreibung der Separatisten gelingen sollte. Es blieb ihnen keine andere Wahl, als in zwei unabhängig voneinander handelnden Einheiten zeitgleich gegen die beiden Stützpunkte der Separatisten vorzugehen.
Abb. 14: Skizze meines Großvaters zur Situation am „Halben Mond“
Die, wie Großvater sie nannte, Abteilung „Landratsamt“ formierte sich beim damaligen Wasserturm des Bahnhofs. Dorthin waren auch 40 Bewaffnete des Selbstschutzes von Bad Neuenahr mit zwei Lastwagen angekommen und verstärkten die Adenauer. Sie bildeten zwei Stoßtrupps. Einer sollte sich entlang der Hauptstraße vom Bahnhof aus zum Landratsamt vorarbeiten. Der andere Trupp sollte über den Steinweg in Höhe des Krankenhauses vordringen und von dort aus über die Bachwiesen die Rückfront des Landratsamts angreifen, wobei auch seine Gartenmauer zu überwinden war.
Aus der Abteilung „Halber Mond“ wurden vier Stoßtrupps gebildet. Eine Gruppe bezog an der katholischen Kirche Stellung, eine weitere an der Einmündung der Kollengasse zum Marktplatz, eine weitere in Deckung hinter dem Pferdemarkt und die vierte Gruppe in der Wimbachgasse. Ein Sanitätsdienst unter Leitung der Ärzte Dr. Kloninger und Dr. Brangs hielt sich im St. Josefs-Krankenhaus bereit. Bei den beiden Abteilungen verrichteten Willi Lehmann und Stephan Friedrich den mobilen Sanitätsdienst. Der Angriffszeitpunkt war für sechs Uhr morgens vorgesehen. Alle Einheiten hatten bis dahin ihre Positionen bezogen.
Kurz vor sechs Uhr fiel am Landratsamt ein Schuss. Unmittelbar darauf setzte das Glockengeläut zum Zeichen des Angriffs ein. Ludwig Stumpf, Karl Nett und Toni Merten stürmten von der Wimbachstraße aus auf den „Halben Mond“ zu, an dem jedoch sofort die gesamte Außenbeleuchtung eingeschaltet wurde. Die Hauptstraße am rückwärtigen Eingang des Hotels war nun hell erleuchtet. Die Angreifer liefen in das Abwehrfeuer der Separatisten hinein. Karl Nett wurde tödlich getroffen und fiel. Den beiden anderen gelang es noch, die Außenbeleuchtung durch Schüsse zu zerstören, mussten sich jedoch mit dem gefallenen Nett in die Wimbachstraße zurückziehen.
Abb. 15: „Hotel Krone“ am Marktplatz und Hauptstraße nach Bonn
Um den „Halben Mond“ entwickelte sich nun zwischen den angreifenden Adenauern und den im Hotel verschanzten Separatisten ein Stellungskampf. Ein weiteres Vordringen der Stoßtrupps war nicht möglich, da die Separatisten Kugelhagel um Kugelhagel auf die Stellungen der Adenauer um den Markt abfeuerten und ihre Abwehr durch Salven von Handgranaten auf die Plätze und Straßen um das Hotel verstärkten. Ludwig Stumpf, der Führer der Angreifer am „Halben Mond“ erlitt bei seinen Versuchen zur Lageerkundung Schussverletzungen an Arm und Kopf und musste schließlich nach einem Schuss in den Unterleib ärztlich versorgt werden.
Die beiden Formationen der Abteilung „Landratsamt“ waren seit 05:14 Uhr vom Bahnhof aus vorgerückt. Die auf der Hauptstraße vorrückenden Angreifer standen vor der Schwierigkeit, sich auf der hell erleuchteten Straße unentdeckt vorwärts bewegen zu müssen. Sie hatten es nicht gewagt, die Straßenbeleuchtung funktionsunfähig zu machen, um keinen Verdacht zu erwecken. Deshalb kamen die Kämpfer am Beginn des Angriffs lediglich in Schussweite an die Vorderfront des Landratsamtes heran und mussten in den gegenüber liegenden Häusern und an der Marienkapelle Stellung beziehen. Von dort aus konnten sie allerdings die Separatisten im Landratsamt mit ihrem Feuer in Schach halten und in Deckung zwingen.
Den Angreifern hinter dem Landratsamt gelang es indessen, bis an die Gartenmauer hinter dem Landratsamt vorzudringen. Von dort aus nutzten sie die Möglichkeit, alle Lichtquellen im Amt und der Umgebung zu zerschießen und zugleich viele Separatisten auf dem Außengelände kampfunfähig zu machen. Da von der Rückseite des Landratsamts seine Erstürmung nicht möglich war, zog sich diese Formation zurück und eilte über die Kollengasse als Verstärkung zum Marktplatz.
Abb. 16: Hauptstraße am „Halben Mond“, linke Fahrbahn in den1930er-Jahren
Auf dem Marktplatz ging der Stellungskampf unvermindert weiter. Schuss um Schuss fiel; die Handgranaten der Separatisten explodierten unvermindert immer wieder um den „Halben Mond“. Die angreifenden Adenauer und die im Hotel gebundenen Separatisten zwangen sich gegenseitig in ihre Stellungen. Die Leitung des Adenauer Selbstschutzes trieb allerdings in den frühen Morgenstunden des 13. November die Sorge um, wie die Reaktion der Besatzungsmacht auf die Nachricht ausfallen würde, dass in Adenau der Kampf gegen die Besetzung der Separatisten tobte. Die Einwohner befürchteten, dass die Separatisten Verstärkung erhalten würden. Das war jedoch nicht der Fall.
In dieser Situation entschloss sich die Leitung des Angriffs auf den „Halben Mond“, ihre Schussposition auf den Haupteingang des Hotels zu verbessern. Sie entsandten einen Trupp unter Peter Herbrand und Josef Merten durch das Bachbett des Adenauer Bachs und in die dortige Einmündung des Wimbachs, von wo aus der Trupp geschützt die Einfahrt des Hotels „Zur Krone“ erreichen und von seinem vorderen Eingang aus den Haupteingang des „Halben Mondes“ unter Feuer nehmen konnte. Nun waren die Separatisten von allen Seiten aus unter Gewehrfeuer gesetzt. Sie erlitten schwere Verluste, darunter einen Toten und drei schwer Verletzte.
Bei Tagesanbruch am 13. November 1923 waren die Besetzer des Landratsamtes und des „Halben Mondes“ durch die bewaffneten Adenauer getrennt. Der Anführer der Separatisten im Landratsamt versuchte gegen acht Uhr eine Kontaktaufnahme mit dem Trupp im „Halben Mond“, scheiterte aber bei der Apotheke Schüller gegenüber der Grabenstraße am weiteren Vorkommen durch die dort in Stellung gegangenen Adenauer und erklärte ihnen seine Verhandlungsbereitschaft. Nach Aufforderung durch Peter Herbrand legten er und seine zwei Begleiter ihre Waffen nieder. Er bedeutete Herbrand, dass der Trupp im Landratsamt sich ergeben werde, wenn ihm der unbehelligte Rückzug ohne Waffen aus Adenau zugesichert würde. Dies wurde zugesagt unter der Bedingung, dass auch der Trupp im „Halben Mond“ seine Besetzung aufgibt.
Abb. 17: Hauptstraße unterhalb des Marktplatzes, rechts Apotheke Schüller, links Brücke zum Eingang Grabenstraße, hinten „Halber Mond“
Die Adenauer führten nun den Anführer der Separatisten im Landratsamt und seine beiden Begleiter mit schussbereiten Gewehren vor sich her vor das Hotel „Halber Mond“. Dort forderte er die Besetzer des „Halben Mondes“ auf, ebenfalls die Waffen nieder zu legen und sich ohne Waffen im Hoteleingang zu versammelt. Wegen der Abwesenheit des „Kommissars“ gab es bei den Separatisten keine einheitliche Führung und kein klares Lagebild. Die Besetzer des „Halben Mondes“ waren offensichtlich wegen ihrer Verluste während der nächtlichen Schießerei demoralisiert und folgten dem Vorschlag des Unterhändlers aus dem Landratsamt.
Als nun die Eingangstür des Hotels geöffnet wurde, trat zunächst Josef Surges heraus, der in der Nacht von den Separatisten des „Halben Mondes“ bei seinem Vorstoß auf das Hotel gefangen genommen worden war. Er wäre von ihnen nach seinen Angaben fast liquidiert worden. Da er aber lediglich mit einer Schrotflinte bewaffnet und in Jägerkleidung war, hatte er sich damit herausreden können, dass er sich nicht an den Kämpfen habe beteiligen, sondern lediglich ins benachbarte Leimbach zur Jagd gehen wolle. So sei er als Geisel hinter der Eingangstür des Hotels festgesetzt worden.
Nun ergaben sich die Separatisten im „Halben Mond“. Sie wurden auf dem Marktplatz von den angreifenden Adenauern festgesetzt, entwaffnet und ihre Personalien wurden aufgenommen. Der Marktplatz war jetzt voller Menschen, weil jedermann in Adenau wissen wollte, wie der nächtliche Kampf ausgegangen war. Das Hotel „ Halber Mond“ wies in seinen Fassaden Hunderte von Einschusslöchern auf, alle Fenster waren zerschossen und mit Betten und sonstigem Mobiliar verbarrikadiert. In vielen Zimmern befanden sich Blutlachen; das Mobiliar war zerstört.
Abb. 18: Hauptstraße oberhalb des „Halben Mondes“, im HintergrundHotel „Wildes Schwein“
Auf dem Marktplatz wurde auch der gefallene Karl Nett vorbei getragen und kurzzeitig von seinen Trägern abgesetzt. Dieser Anblick erregte die versammelten Adenauer so sehr, dass sie begannen, die entwaffneten und festgesetzten Separatisten zu verprügeln. Dadurch wurden nach den bei den nächtlichen Kämpfen verwundeten 15 Separatisten noch weitere 18 so schwer verletzt, dass sie ins Adenauer Krankenhaus gebracht werden mussten. Die im Landratsamt verschanzten Separatisten versuchten inzwischen, mit einer Geisel, die ihnen an der gegenüberliegenden Marienkapelle in die Hände gefallen war, in geschlossener Formation den nahe gelegenen Bahnhof zu erreichen. Sie wurden abgefangen und ebenfalls auf dem Marktplatz festgesetzt. Hier wurden nun alle nicht verletzten Separatisten gefesselt und unter Bewachung über Münstereifel in das englisch besetzte Gebiet gebracht. Dort wurden sie der Polizei übergeben. Die im Krankenhaus von Adenau verbliebenen Separatisten wurden nach ihrer Transportfähigkeit mit der Eisenbahn ins Brüderhaus nach Koblenz abgeschoben. Dort erlagen nach dem im „Halben Mond“ ums Leben gekommenen Separatisten noch drei weitere Männer ihren schweren Verletzungen.
Bereits am Vormittag des 13. November traf der französische Kreisdelegierte mit seinem Adjutanten und einer Polizeieskorte in Adenau ein, um die Vorfälle der letzten Nacht und des Morgens zu untersuchen. Er konnte zwar die Kampfspuren am Landratsamt und am Hotel „Halber Mond“ deutlich sehen und die verletzten Separatisten im Adenauer Krankenhaus befragen, stieß allerdings bei seiner Befragung bei den Adenauern auf eine Mauer des Schweigens. Die Hauptakteure aufseiten der Adenauer hatten sich vorsichtshalber seinem Zugriff entzogen und mit dem Abtransport der Separatisten in die englische Zone in Sicherheit gebracht. So blieb ihm nichts übrig, als über den Kreis Adenau den Belagerungszustand zu verhängen. Fortan wurde eine Einheit marokkanisch-stämmiger französischer Soldaten in Adenau stationiert, die darüber wachte, dass die nächtliche Ausgangssperre von 19 Uhr abends bis 07 Uhr morgens eingehalten wurde.
Abb. 19: Gruppenbild der Separatisten in Adenau (aus der Schrift meines Großvaters)
Gegen 14 Uhr nachmittags am 13. November kehrte der „Kommissar“ der Separatisten von seiner Besprechung in Koblenz kommend mit dem beschlagnahmten Dienstwagen des Landrats nach Adenau zurück. Mein Großvater kannte offensichtlich seinen Namen, bezeichnete ihn aber in seinem Bericht immer nur als „L.“. Bereits auf Höhe des Landratsamts begriff dieser die Lageentwicklung zum Nachteil seiner Bewegung. Er ließ seinen Wagen wenden und entfernte sich unter Abgabe mehrerer Schüsse in Richtung Leimbach und Ahr, um sich über die Oberahr in Richtung der belgischen Zone abzusetzen.
Jetzt entwickelte sich eine abenteuerliche Flucht des „Kommissars“ in Richtung Norden. Die Adenauer hatten sofort alle Ortschaften auf seinem möglichen Weg nach Altenahr über seine Flucht informiert und darum ersucht, sein Auto zu stoppen. Der „Kommissar“ wich allerdings in Dümpelfeld in Richtung Oberahr ab, ganz offensichtlich, um über Antweiler nach Blankenheim und von dort nach Schleiden zu gelangen. Hier wäre er in der belgisch besetzten Zone angekommen. Vor Fuchshofen aber wurde er von Personen der französischen Eisenbahnregie über eine Sperrung der Straße vor Antweiler informiert. Es blieb ihm also nichts übrig, um nach Norden abzubiegen und zu versuchen, über Wershofen und Hümmel nach Bad Münstereifel zu gelangen.
Vor Wershofen fiel das Auto des „Kommissars“ wegen Benzinmangels aus. Der „Kommissar“ und seine Begleiter setzten nun ihre Flucht zu Fuß fort und betraten mit schussbereiten Pistolen Wershofen. Am Hof von Landwirt Johann Raths, der in seiner Scheune mit Dreschen beschäftigt war, glaubten die Eindringlinge etwas Verdächtiges zu bemerken. Sie schossen auf Raths, der lebensgefährlich verletzt wurde und kurz darauf starb. Die nun entstehende Verwirrung bei den Dorfbewohnern nutzten die fliehenden Separatisten, um unbehelligt über die Kreisgrenze zu entkommen.
Abb. 20: Gedenkstein für den gefallenen Karl Nett
In Adenau war sich trotz der erfolgreichen Wehr gegen die Separatistenbewegung keiner sicher, ob sie vor einem Vergeltungsschlag der Bewegung sicher waren. Es kursierten sogar Gerüchte, dass mehrere Lkw mit bewaffneten Separatisten von Blankenheim kommend nach Adenau unterwegs seien. Deshalb errichtete der Selbstschutz von Adenau unverzüglich an den Zufahrtstraßen in den Ort Barrikaden aus dicken Baumstämmen, die sie sich wohl auf dem großen Lagerplatz für Grubenholz auf dem Bahnhofsgelände besorgten. Tags drauf wurden die Sperren wieder entfernt, weil sich das Gerücht nicht bestätigte. Die Alarmbereitschaft des Selbstschutzes wurde dennoch noch weitere Tage aufrechterhalten.
Karl Nett wurde am 16. November 1923 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung, jedoch auch unter wachsamer Beobachtung der Besatzungsmacht auf dem Adenauer Friedhof bestattet. Dem französischen Kreisdeputieren wurden allerdings auf Grund von Denunziationen Informationen über die Köpfe des Adenauer Widerstandskampfes zugetragen. Die französische Gendarmerie vernahm deshalb sehr intensiv die ihnen benannten Rädelsführer, den Kreisdeputierten Dechant Eisvogel, Peter Herbrand, August Rademacher und meinen Großvater. Darüber hinaus aber blieben sie unbehelligt.27
Was mein Großvater damals noch nicht wusste und wohl auch noch nicht aufgearbeitet worden war: Auch die Koblenzer Separatistenregierung befand sich damals bereits im Niedergang. Ihr „Kommissar“ konnte bei seiner Vorsprache in Koblenz keine aktive Unterstützung seines Putsches in Adenau bekommen. Seine Truppe in Adenau war auf sich gestellt. Selbst die späteren Kämpfe der Separatisten um Aegidienberg im Siebengebirge vom 14. bis 16. November 1923 konnten das Blatt zu ihren Gunsten nicht wenden. Sie kosteten 14 Separatisten das Leben. Danach brach ihr Aufstand in sich zusammen.
Abb. 21: Mein Großvater als Journalist
Das Scheitern der militanten Separatistenbewegung im Rheinland war nicht selbstverständlich. Immerhin scheiterte 1923 in München der Hitler-Ludendorff-Putsch am Widerstand der Reichswehr und nicht der Bevölkerung. Im selben Jahr wurden die von der KPD organisierten Arbeiteraufstände im mitteldeutschen Industriegebiet um Merseburg und Halle und in Hamburg von Polizei und Reichswehr nieder gerungen. Der „Ruhrkampf“ der Arbeiterschaft hatte 134 Tote und etwa 180.000 Ausgewiesene gekostet und wurde ebenfalls von massiven Polizeikräften niedergeschlagen.28 Viele der Ausgewiesenen schlossen sich den „Rheinland-Schutztruppen“ der rheinischen Separatisten an. Die Bevölkerung im Rheinland demgegenüber war gegen die Bedrohung durch die militanten rheinischen Separatisten auf sich gestellt und ohne Hilfe von der bewaffnete Staatsmacht erfolgreich. Die französischen Besatzungstruppen wurden in der Einflusszone um Koblenz im November 1929 abgezogen, im Raum um Mainz erst am 30. Juni 1930. Die englischen Truppen im Raum Köln waren bereits im Januar 1926 abgerückt.
Familiengründung und Geldentwertung





























