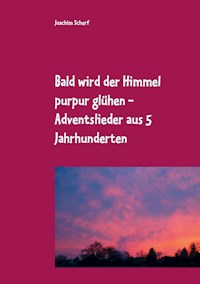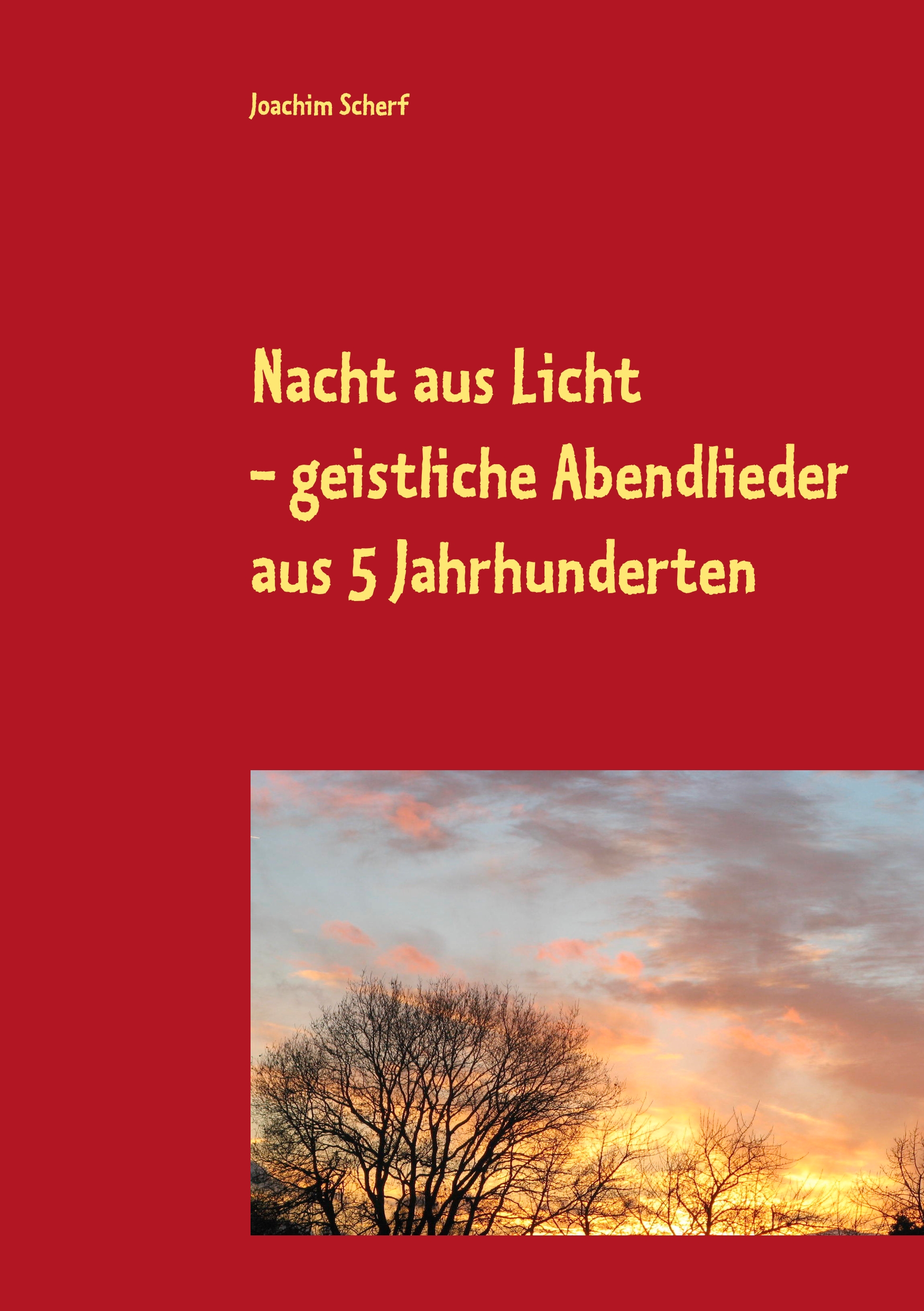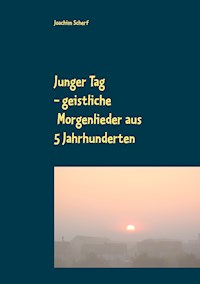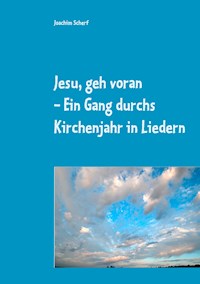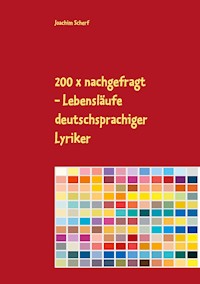
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wer steht hinter den Liedern des Gesangbuchs? Wer hat ist der unbekannte Übersetzer gängiger moderner Lieder aus Fremdsprachen? Wie sind die Lebensumstände und der Werdegang moderner Lyriker? In welcher Bibliothek konnte eine Liedsammlung aufgespürt werden, die alle Liedforscher kennen und bis zu ihrer Entdeckung noch keiner gesehen hatte? Dieses Buch beantwortet nicht alle Fragen, aber es trägt dazu bei, ein wenig mehr Licht in ein Forschungsgebiet zu tragen, das sich einem unverzichtbaren Bestandteil jedes Gottesdienstes widmet - dem Gemeindegesang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meiner Vaterstadt Wiesbaden in Dankbarkeit gewidmet
Vorwort
Die hiermit vorgelegte Sammlung von Lebensläufen geistlicher Lieddichter, Liedübersetzer, Lyriker sowie Textautoren des Neuen deutschen Lieds stellt eine Vorabveröffentlichung eines geplanten Lexikons deutscher geistlicher Lieddichter dar. Die Lebensbeschreibungen beruhen auf eigenen Recherchen, die – zumindest, soweit sie zeitgenössische Autoren betreffen – in der Regel unter Mitwirkung der beschriebenen Autoren entstanden sind.
Zusätzlich wurden einschlägige hymnologische Standardwerke, wie beispielsweise das Wer ist wer im Gesangbuch1 herangezogen und online verfügbare Quellen ausgeschöpft. Dass ich neben der Onlinepräsenz der Deutschen Biographie2 und dem Kalliope-Verbund3 auch WIKIPEDIA4 herangezogen habe, möchte ich kurz begründen.
Selbstredend sind die frei verfügbaren Lexikon-Einträge, seien sie aus dem 16. Jahrhundert oder aus der Jetztzeit stets - zumindest soweit sie urteilend sprechen - auch Ausdruck der Meinung und des Geschmacks ihrer Zeit und insofern mit großer Vorsicht zu behandeln. Auch sind die Artikel – gerade bei WIKIPEDIA - von sehr unterschiedlicher Güte, Länge, manchmal von einer Detailfreude bis zur Geschwätzigkeit und oft voll von Abirrungen in nichtrelevante Themen.
Auf der anderen Seite stellen aber die Mehrzahl der Artikel den aktuellen Forschungsstand weitestgehend korrekt dar und bietet einen umfangreichen Apparat an Quellhinweisen und weiterführenden Informationsquellen, sowie (oft direkt online abrufbare) Originaltexte. Diese habe ich in der Regel – parallel zu meinen eignen Quellen – eingesehen und deren Informations- und Wahrheitsgehalt weitestgehend geprüft. Einige der WIKIPEDIA-Artikel über deutsche geistliche Lieddichter habe ich selbst bei WIKIPEDIA angelegt oder ausgebaut.
Über die Jahre sind bis heute über 500 eigene Recherchen angefallen, in denen ich Kirchengemeinden, Meldebehörden, kirchliche Archive und Zeitzeugen befragt habe. Neben vielen Fällen, in denen ich keine Antwort erhielt und einigen wenigen, in denen eine Zusammenarbeit verweigert wurde, habe ich viele freundliche Reaktionen erleben dürfen und hierbei Menschen kennengelernt, die in selbstloser Hilfsbereitschaft Zeit und Kraft geopfert haben, um mein Vorhaben voranzubringen. Diesen Menschen sei mein herzlichster Dank ausgesprochen.
Was ich selbst demgegenüber in die Waagschale werfen darf und kann, ist, dass ich bisher zehn Jahre meines Lebens der Hymnologie – und hier besonders dem evangelischen geistlichen Lied – gewidmet habe.
Abschließend möchte ich noch die Frage beantworten, warum ich meine in diesem Bändchen versammelten Recherchen dem geplanten Autoren-Lexikon vorausschicke.
Ich halte es für meine Pflicht, die bisher gewonnen Erkenntnisse zu veröffentlichen, weil zum einen die Herausgabe des geplanten Autoren-Lexikons noch ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen wird und zum andern weil die gegenwärtige Gesundheitssituation in Deutschland eine Vorab-Sicherung dieser Art angeraten sein lässt; zumal ich den Abschluss dieser Arbeiten, d.h. die Herausgabe des mehrbändigen Autorenlexikons, bei bestem Optimismus und größtem Gottvertrauen nicht garantieren kann.
Wiesbaden, im Juni 2021
1 Herbst, Wolfgang (Hrsg.): Wer ist Wer im Gesangbuch, 2. durchgesehene und aktualisierte Auflage, Göttingen, 2001
2https://www.deutsche-biographie.de/home
3https://kalliope-verbund.info
4https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
Editorische Hinweise
Bei aller Sorgfalt und aufgewendeter Mühe ist es nicht auszuschließen, dass mir ggf. sachliche oder Tippfehler unterlaufen sind. Diese bitte ich zu entschuldigen. Was die Qualität der Quellangaben und Werkzuschreibungen aus der hymnologischen Literatur und aus Gesangbüchern betrifft, sind diese oft von sehr unterschiedlicher Qualität; ggf. konnte ich nicht alle Fehler aufdecken und berichtigen.
Die einzelnen Kapitel dieses Buches wurden mit Hilfe eines Programmes zusammengestellt und formatiert. Auch in diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass auch größtmögliche Sorgfalt beim Korrekturlesen nicht alle Fehler aufdecken kann.
Auswahl der Autoren
In diesem Buch wurden Autoren berücksichtigt,
die seit der Reformationszeit gelebt haben,
die einer christlichen Konfession angehören,
die geistliche Lieder oder Gedichte geschrieben oder aus einer Fremdsprache ins Deutsche übertragen oder Lieder des Neuen geistlichen Lieds verfasst haben,
die in deutscher oder niederdeutscher Sprache oder in einem deutschsprachlichen Schweizer Idiom geschrieben haben,
deren Lieder/Gedichte in Kirchengesangbüchern, Liedsammlungen oder in Buchform veröffentlicht wurden,
die bedeutende Liedsammlungen, hymnologische Werke oder Periodika mit geistlichen Liedern herausgegeben haben.
Eine kleine Gruppe stellen die Menschen dar, denen fälschlicherweise einzelne geistliche Lieder zugeschrieben wurden; sie werden wg. der Transparenz genannt.
Berücksichtigte Konfessionen
Derzeitig sind folgende christliche Konfessionen in dem Autorenlexikon berücksichtigt:
evangelische Christen (uniert)
evangelisch-lutherische Christen
evangelisch-reformierte Christen
evangelische-freikirchliche Christen
Herrnhuter, Böhmische und Mährische Brüder
Mitglieder der Brüdergemeinden,
Brethren
Römisch-katholische Christen
Altkatholische Christen
altkirchliche Lieddichter (vor 1500)
Deutsch-katholische Christen
Mitglieder der kath.-freikirchlichen Irvingianische Kirche
Anglikaner
Adventisten
Baptisten
Methodisten
Mennoniten
Mitglieder von Pfingstkirchen
Hussiten
Pietisten (kirchenfern,
radikal
)
Schwärmer/
Schwenckfelder
Unitarier
Wiedertäufer
Erläuterung der Abkürzungen
Die unter den Lexikon-Artikeln stehenden Abkürzungen bedeuten:
[K] Eduard Emil Koch: Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs 5
[B] Deutsche Biographie 6
[W] WIPIPDIA 6
[R] eigne Recherchen 6
[A] Selbstauskunft des Autors
[S] sonstige Hinweise (siehe Kapitel Quellenangaben - Seite →)
Die Kennzeichnungen mit den o. a. Kürzeln erfolgte in den beiden letzten Jahren nach Abruf der entsprechenden Internet-Seiten; möglicherweise haben sich hinsichtlich der Deutschen Biographie und WIKIPEDIA seit dem Änderungen ergeben.
Namensangaben hinter einem Pfeil →Name sind Querverweise auf einen anderen Artikel in diesem Lexikon.
Bildnachweise
Umschlagbild: O.T.. 2021 (Eigenes Werk)
Seite →: Evangelische Marktkirche, Wiesbaden mit Marktsäule (eigenes Photo)
5 Stuttgart, 1866 -1872
6 siehe Fußnoten auf Seite 5
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Editorische Hinweise
Bildnachweise
Ackermann, Max
Alexander, Hugh Edward
Angerer, Johann Georg
Arnold, Jochen
Aschenbach, Ludwig
Ascheraden, Wilhelm von
Autorenkollektiv Münsterschwarzach
Bailey, Judy
Baltes, Guido
Baumann, Michael
Bauschert, Hermann
Bellingroth, Paul
Berg, Klaus
Bernoulli, Hans
Beyling, Hans
Birenheide, Friedrich Wilhelm
Birkelbach, Hartmut
Bogdahn, Martin
Bollinger, Conrad
Bonacker, Matthäus
Bonhoeffer, Johann Friedrich
Börner, Caroline
Boscheinen, Walter
Böttcher, Jonathan
Brandt, Susanne
Braun, Caroline
Brodbeck, Ulrike
Buchner, Kurt Oskar
Büssing, Arndt
Christlein, Walter
Chuchra, Ulrike
Claus, Andreas
Cramm, Burghard von
Dankwerts, Ludwig Wilhelm Edmund
Degott, Matthias
Depuhl, Patrick
Dörnen, Birgit
Eck, Johann Gottfried
Eckelmann, Hermann
Eger, Thomas
Eidam, Rosa
Eltermann, Peter
Enders, Hildegard
Fabricius, Justus Friedrich Erdmann
Fabricius, Vorname unbekannt
Falkenroth, Christina
Fassbinder, Heinrich
Ferkinghoff, Bernhard
Fickert, George Friedrich
Flad, Christian Rudolf
Florenz, Hans
Franck, Gustav
Fritzsche, Gerhard
Gambs, Christoph Karl
Gamersfelder, Hans
Gassmann, Lothar
Gebhardt, Carl Martin Franz
Gere., Dan.
Gerloff, Peter
Goes, Siegfried
Gottschick, Friedemann
Gralle, Albrecht
Greiner, Jakob Friedrich
Groß, Carsten
Großmann, Barbara
Gutbrod, Gottlob
Haacker, Klaus
Haas, Robert
Hamp, Volkmar
Heisler, Helge
Heizmann, Klaus
Heizmann-Leucke, Dagmar
Heller, Adolf
Hemmann, Katharina
Hermann, Christiane
Hermann, Gottfried
Hesselbart, Johann Martin
Hettler, Konrad
Hildebrandt, Balthasar
Hirschmann, Otto Max Josef
Hoffmann, Gudrun Maria
Holst, Johann Gottlieb
Hügel, Johann Zacharias
Immendorf, Ruth
Jagode, Norbert
Jans, Armin
Janz, Ken
Jetter, Armin
Jöcker, Detlev
Josephson, Ludwig
K. v. Bl
Kalamala, Harald
Karow, A.
Kayser, Susanne
Keller, Ludwig
Kilzer, Johann Sebastian Wilhelm
Klaiber, Annegret
Klaiber, Christoph
Klaiber, Walter
Klapproth, Erich
Klare, Karl Gottlob August
Knöppel, Karl Heinz
Köhnlein, Johannes
Kremzow, Michael
Krenz, Friedhelm
Kretzer, Johann Thielmann
Küllmer-Vogt, Miriam
Kunert, Adrian
Lal, Uwe
Lazay, Ursula
Lehnert, Christian
Leonhardt, Jean Emil
Lübbers, Tobias
Lupin, Christoph Matthias
Lütkens, Johann Hinrich
Lutz, Meie
Macht, Siegfried
Magewirth, Julius
Mang, Hans-Jürgen
Martini, Franz
Merkel, Georg
Messerschmidt, Christof
Methfessel, Christian
Meyer, Karl Heinz
Meyer-Baltensweiler, Elsbeth
Michael, Curt Wilhelm
Michael, Gerhard Paul
Mitscha-Eibl, Claudia
Möller, Stephan
Montmollin, Rachel de
Morgenstern, Christine
Müller, Ernst
Müller, Johann Peter
Müller, Kai
Offele, Winfried
Peithmann, F.G.
Petri, Johann Michael
Petzold, Hiltrud
Petzold, Johannes
Pilgram-Diehl, Margaretha
Procopius, Melchior Dietrich
Puzberg, Günter
Randenborgh, Elisabet van
Rapsch, Ute
Reichenbacher, Stefan
Reinhart, Henrich
Reintgen, Frank
Remmers, Erich
Rhein, Matthias
Roloff, Michael
Roos, Johannes
Rossel, Hermann
Rößler, Martin
Rothacker, Friedrich
Rothaupt, Verena
Ruopp, Johann Friedrich
Ruwe, Franz-Josef
Sauer, Marie
Schaefer, Max
Schaible, Wilhelmine Brigitta
Schäl, Marion
Schenk, Ernst Karl Friedrich
Schmitz-Jeromin, Ilona
Schmock, Wolfgang
Schnitter, Gerhard
Schott, Bernhard
Schultz, Georg Friedrich Wilhelm
Schwarzien, Otto
Seibel, Christine
Simon, Klaus
Sinz, Kurt
Sommer, Sebastian Adam Karl
Sonka, Franz-Thomas
Spiekerkötter, Carl Gustav Heinrich
Sporleder, Christoph August
Steinert, Hanna
Steinert, Werner
Stolze, Hans Dieter
Sturm, Evie
Šurman, Bedrich
Syberberg, Rüdiger
Ufer, Albrecht
Uhlmann, Gustav Adolf
Traub, Friedrich
Vesper, Stefan
Vetter, Johann Jakob
Vetter-Baumann, Maria
Vinzelberg, Joachim
Vogt, Fabian
Volkmar, J. C.
Walter, Silja
Walther, Carl
Weber, Raymund
Weidinger, Norbert
Wenkemann, Tobias
Werner, Roland
Wichert, A.F. von
Wiegering, Kurt
Wild, Robert
Willenberg, Karl-Heinz
Winckler, Johann Peter Siegmund
Winkel, Helga
Wittig, Michael
Wolitz, Ulrike
Zeilinger, Johann
Zoller, Alfred Hans
Zutavern, Albert
Quellangaben
Veröffentlichungen
Ackermann, Max
Max Ackermann (* 1989 in Neuss/Nordrhein-Westfalen) ist ein zeitgenössischer Komponist moderner geistlicher Lieder. Ackermann ist römisch-katholischer Konfession, verheiratet und hat ein Kind. Er ist studierter Erziehungswissenschaftler, Musikpädagoge und Musiktherapeut sowie approbierter Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Sein Hauptinstrument ist Klavier. Des weiteren ist er als nebenamtlicher C-Kirchenmusiker und Chorleiter tätig. Seit 2012 engagiert er sich als Referent für das Neue geistliche Lied mit Band-und Chorworkshops im Erzbistum Bamberg. Von seinen Liedern ist das Heilig, heilig, heilig überregional bekannt geworden. Es ist veröffentlicht im Arrangementheft 2014 der Werkstatt NGL, der Liedsammlung Songs 2015 und wurde 2017 im Rahmen des Jubiläums der Werkstatt NGL auf Tonträger veröffentlicht. Weitere Stücke sind im Verlag Ferrimontana erschienen; zuletzt wurde die NGL-Messe Begegnungen im Strube Verlag publiziert. [R] [S] [A]
Alexander, Hugh Edward
Hugh Edward Alexander (* 10. Juli 1884 in Dumfries (Schottland); † 8. April 1957 in Genf/Schweiz) war ein schottischer Prediger, Lieddichter und -komponist der evangelischen Erweckungsbewegung, der in England und der Schweiz lebte und geistliche Lieder in englischer und deutscher Sprache verfasste. Alexander besuchte als Presbyterianer eine Bibelschule in Glasgow und wurde stark beeinflusst von den Erweckungspredigern Reuben A. Torrey, Dwight L. Moody und der Keswick-Bewegung, die auf ein überkonfessionelles Treffen evangelikal gesinnter Christen im englischen Ort Keswick in der nordenglischen Grafschaft Cumbria zurückgeht und die ihre Fortsetzung in der Walisischen Erweckungsbewegung von 1904/05 fand. Alexander lebte ab dem Jahr 1906 den größten Teil seines Lebens in Genf, wo er begann Kinder-und Erwachsenen-Evangelisation zu betreiben und u. a. der Mitbegründer der Genfer Bibelgesellschaft war. Im Jahr 1919 gründete er die Bibelschule Le Roc. Er verfasste über 500 geistliche Lieder und veröffentlichte zahlreiche Bücher und Broschüren, in denen er eine liberale Ausrichtung bekämpfte und für eine wortgetreue Schriftauslegung eintrat. Sein Andachtsbuch Manne du matin wurde in viele Sprachen übersetzt und erschien auf deutsch unter dem Titel Manna am Morgen. Das Buch enthält die Andachten Alexanders und wird bis heute aufgelegt. Das vom Diakonissenmutterhaus Aidlingen im Jahr 1986 in Stuttgart in dritter Auflage herausgegebene Gesangbuch Neue Lieder enthält sieben Lieder, zu denen Alexander den Text verfasst hat, zu weiteren hat er auch die Melodien komponiert. [R]
Angerer, Johann Georg
Johann Georg Angerer (* 2. September 1725 in Oettingen/Grafschaft Oettingen; † 12. März 1797 in Harburg) war ein deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer, Herausgeber und Lieddichter. Angerer wurde als Sohn von Johann Matthias Angerer (1696-1765) und seiner Frau Margaretha Barbara, geb. Maurer, (1694-1746) geboren. Sein Vater war ein Schneider und Bürgermeister; sein Sohn studierte ab dem Jahr 1744 an der Universität von Jena. Nach dem Studium zurückgekehrt, war er ab 1748 als Lehrer Konrektor am Seminar seiner Vaterstadt und wurde im Jahr 1754 Pfarrer in Balgheim. Vier Jahre später wechselte er die Gemeinde und übernahm die Pfarrstelle in Holzkirch. Im Jahr 1765 wurde er als Superintendent, Konsistorialrat und Pfarrer nach Harburg berufen, wo er auch seinen Lebensabend verbrachte. Neben Predigten liegen von Angerer geistliche Lieder, Gelegenheitsgedichte und Übersetzungen aus dem Französischen im Druck vor und er verfasste ein 1775 erschienenes Schulbuch, ein Buchstabier- bzw. Leselernbuch. Ab 1748 gab er am Verlagsort Oettingen eine Monatsschrift zur Pflege deutscher Sprache und Poesie unter dem Titel Versuche zur Beförderung des vernünftigen Vergnügens in Schwaben heraus, die aber nur drei Ausgaben erlebte. 1764 erschien eine von Angerer besorgte Sammlung geistlicher Lieder unter dem Titel Evangelische Lieder, die 20 eigene Gedichte enthält. [B][R]
Arnold, Jochen
Jochen Michael Arnold (* 1967 in Marbach am Neckar/Baden-Württemberg) ist ein evangelisch-lutherischer Pfarrer, Kirchenmusiker, Hochschullehrer, Organist, Chorleiter und Lieddichter. Arnold wurde als Sohn des Ehepaares Otto und Renate Arnold geboren und besuchte nach der Grundschule ab 1978 das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach, wo er 1987 das Abitur bestand. Bereits ein Jahr zuvor hatte er die kirchenmusikalische C-Prüfung abgelegt. Bis zum Jahr 1989 leistete er Zivildienst in einer Kirchengemeinde in Stuttgart und studierte anschließend bis 1996 Theologie in Tübingen sowie an der Waldenserfakultät in Rom. Dort übernahm er im Jahr 1991 das Kantorenamt an der evangelischen Christuskirche. Zwischen 1992 und 1998 studierte Arnold evangelische Kirchenmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, bestand das A-Examen und betreute zwischen 1993 und 1999 das Kantorenamt an der Kreuzkirche in Reutlingen. Von 1997 bis 1999 absolvierte er ein Aufbaustudium im Fach Popularmusik an der Hochschule für Kirchenmusik Esslingen bzw. Tübingen und promovierte im Jahr 2003 in Tübingen. Von 1999 bis 2001 war er Vikar an der Marienkirche Reutlingen, legte das Zweite Theologische Examen ab und wurde im Januar 2002 ordiniert. Hierauf lehrte er bis 2003 am Pfarrseminar der Evangelischen Landeskirche in Württemberg die Fächer Gottesdienst, Predigt und Pastoraltheologie. Er ist seit 2004 Direktor des Michaelisklosters Hildesheim, das als evangelisches Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik Bestandteil der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers ist. Im Jahr 2007 habilitierte er sich mit einer Arbeit über die Kantaten Johann Sebastian Bachs. Arnold lehrt Chorleitung und Theologie an der Universität Hildesheim, unterrichtet seit 2007 Theologie an der Fachhochschule Hannover und ist seit 2008 ehrenamtlicher Privatdozent an der Universität Leipzig. Seit dem Jahr 2014 ist er zudem Honorarprofessor für Musikvermittlung der Universität Hildesheim, seit 2012 Liturgiebeauftragter und Liturgieberater der Gemeinschaft Ev. Kirchen in Europa und seit 2019 Vorsitzender der Liturgischen Konferenz in Deutschland. Als Mitglied der Steuerungsgruppe berät er die Evangelische Kirche in Deutschland hinsichtlich der Vorbereitung für ein neues Gesangbuch. Darüber hinaus arbeitete er beim Deutschen Evangelischen Kirchentag und beim Lutherischen Weltbund mit und hat u. a. dessen Weltkonferenz in Windhuk im Jahr 2017 mitvorbereitet und -organisiert. Arnold war zwei verheiratet und hat zwei Kinder und zwei Stiefkinder; er ist seit dem Jahr 2020 verwitwet. Sein Lied Die Himmel erzählen die Schönheit Gottes steht in dem vom Gottesdienst-Institut der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern im Jahr 2012 in Nürnberg herausgegebenen Liederheft Kommt, atmet auf; für dieses Lied hat er sowohl den Text, nach Psalm 19, Vers 2, als auch die Melodie verfasst. Weitere Lieder finden sich in diversen Publikationen des Deutschen Evangelischen Kirchentags (Liederheft Köln: Wort-Laute: Schmecket und sehet; Ein feste Burg zum Text Lothar Veits; Liederheft Bremen: FundStücke: Kyrie, Gloria, Christe, Schmecket und sehet; Liederheft Hamburg: dto. und Gott segne dich; Liederheft Berlin: freiTöne: 10 Lieder, u.a.: Kyrie, Gloria, Kindercredo; Sanctus, Christe; Menschen gehen zu Gott (zu einem Text von Dietrich Bonhoeffer) und weitere). Eine Sammlung seiner Lieder erschien im Jahr 2009 im Strube-Verlag unter dem Titel Die Himmel erzählen; im genannten Verlag wurden darüber hinaus weitere Kasuallieder publiziert. [B][W][R][A]
Aschenbach, Ludwig
Ludwig Aschenbach (* 8. November 1798 in Lippoldsberg bei Karlshafen im Kurfürstentum Hessen; † 19. März 1856) war ein deutscher evangelisch-reformierter Pfarrer und Lieddichter. Er wurde als Sohn des Kantors Carl Friedrich Aschenbach und seiner Frau Elsabeth, geb. Schuchard, geboren und immatrikulierte sich nach dem Schulbesuch im Jahr 1816 an der Universität Marburg, wo er zwei Jahre lang Theologie studierte. Er arbeitete anschließend zunächst als Hauslehrer in Lorsch im Großherzogtum Hessen-Darmstadt und wurde im Jahr 1822 von der kurfürstlichen Regierung als Lehrer an das Schullehrer-Seminar in Kassel berufen. Drei Jahre später ernannte ihn die Reformierte Gemeinde seiner Vaterstadt zum Pfarrer. Er heiratete im Jahr 1826 Wilhelmine Caspari, die Tochter des Amtsmanns von Karlshafen, Johann Gottlieb Caspari. Im Jahr 1831 verließ Aschenbach seine Vaterstadt und wechselte an die Reformierte Gemeinde in Göttingen, wo er im Jahr 1853 die 100-Jahr-Feier des Kirchenbaus erlebte und mitgestaltete. Aschenbach hatte als Kanzelredner einen guten Ruf, sogar Mitglieder lutherischer Gemeinden kamen in seine Gottesdienste, um seine Predigten anzuhören, die er regelmäßig mit einem Gedicht abzuschließen pflegte. Aufgrund seiner Beliebtheit wurde ihm gestattet ab dem Jahr 1844/45 im Wechsel mit den lutherischen Pastoren die Gottesdienste an der Universität zu halten. Mit anderen formulierte Aschenbach eine neue Kirchenordnung der Reformierten Gemeinden, die im Jahr 1839 veröffentlicht wurde. Seine geistlichen Lieder sind in zwei Buchausgaben enthalten, wobei er als Gegenstand seiner Lyrik auch die Texte der Bibel wählte. Im Jahr 1835 erschien in Göttingen unter dem Titel Der Tempel des Herrn seine Sammlung Gebete auf alle Sonn= und Festtage des Kirchenjahres, die auch einige Lieder enthält. Unter dem Titel Hosianna - Geistliche Lieder nach Worten der heiligen Schrift zur christlichen Erbauung erschien im Jahr 1840 ein umfangreiches Buch mit der geistlichen Lyrik des Verfassers. [R]
Ascheraden, Wilhelm von
Wilhelm von Ascheraden (* 7. Januar 1946 in Dingelstädt/Thüringen) ist ein deutscher evangelischer Pfarrer und Lieddichter. Er wurde als Sohn von Albrecht von Ascheraden (1918-1977) und Elisabeth, geb. Berve (1922-2019), geboren und besuchte ab dem Jahr 1952 die Volksschule in Osterath, woran sich ab 1956 das Humboldt-Gymnasium in Düsseldorf anschloss. Er leistete die Dienstpflicht zwischen 1965 und 1967 in Sontra und Koblenz und verließ die Bundeswehr als Leutnant der Reserve. Ab 1967 studierte von Ascheraden an den Universitäten von Heidelberg und Mainz Theologie und schloss das Studium mit dem 1. Fakultätsexamen ab, absolvierte seine Vikariatszeit in der Rheinischen Landeskirche und legte das 2. Kirchliche Examen ab. Er war zunächst zwischen 1974 und 1977 als Studieninspektor am Predigerseminar in Bad Kreuznach tätig, übernahm dann eine Stelle als Gemeindepfarrer in Monzingen/Nahe, war dann ab 1983 in Todtmoos/Südbaden und schließlich von 1991 bis 2009 in der Auferstehungsgemeinde in Offenburg als Pfarrer eingesetzt. Von 1995 bis 2007 war er darüber hinaus Landesobmann der Badischen Posaunenchöre. Im Ruhestand engagiert er sich für neue Formen des Zusammenlebens, so für die bürgerschaftlich organisierte Wohngruppe Storchennest und das Projekt für gemeinschaftliches Wohnen im Alter. Darüber hinaus ist er Gründungsstifter für die Gertrud-von-Ortenberg-Bürgerstiftung. Die Gemeinde Ortenberg verlieh ihm im Jahr 2019 die Bürgermedaille. Er schrieb bis heute zehn geistliche Lieder; sein Lied Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder steht in dem vom Gottesdienst-Institut der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern im Jahr 2012 in Nürnberg herausgegebenen Liederheft für die Gemeinde Kommt, atmet auf und findet sich auch im 2018 erschienenen Anhang zum Gesangbuch der Evangelischen Landeskirche in Baden, wo Ascheradens Lied auch als Titel der Veröffentlichung gewählt worden ist. Wilhelm von Ascheraden ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. [R] [A]
Autorenkollektiv Münsterschwarzach
Die Autorenangabe Münsterschwarzach in Gesangbüchern bezeichnet eine Gruppe von Autoren, die in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts die Münsterschwarzacher Antiphonale abgefasst haben. Hierbei handelt es sich um zahlreiche Übertragungen aus dem Lateinischen. Die Autoren dieser Antiphonale waren Godehard Joppich (* 1932), Pater Roman Hofer (1942-2011) und Pater Rhabanus Erbacher (* 1937), die zum Teil auf bereits vorhandene Übersetzungen anderer Autoren zurückgegriffen haben. Die drei Genannten gaben die Titel ab 1975 gesammelt in den drei Bänden des Benediktinischen Antiphonale im eigenen Vier-Türme-Verlag der Abtei Münsterschwarzach heraus. [R]
Bailey, Judy
Judy Bailey, vollst. Judy Irene Bailey, verh. Bailey-Depuhl (* 20. Juli 1968 in London/Großbritannien) ist eine englisch-deutsche Psychotherapeutin, Sängerin, Komponistin und Lieddichterin christlicher Popmusik. Bailey verbrachte ihre Kindheit auf Barbados und lebt heute in Deutschland. Sie ist verheiratet mit dem Kommunikationswissenschaftler, Autor und Lieddichter Patrick Depuhl (* 1970) und hat mit ihm drei Söhne. Sie trat bisher in über 30 Ländern auf und spielt auf Festivals und Stadtfesten, in Kirchen und Clubs, an städtischen Verkehrsknotenpunkten und u.a. einem Jugendgefängnis, einem Kinderhospiz und in einer Friedhofskapelle. Darüber hinaus tritt sie regelmäßig bei christlichen Großveranstaltungen wie Kirchentagen auf. Sie ist seit 2002 Botschafterin der Hilfsorganisation World Vision Deutschland. Im Gesangbuch Feiern und Loben, das vom Bund Freier evangelischer Gemeinden und dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden im Jahr 2003 herausgegeben wurde, stehen zwei ihrer Lieder. Außerdem hat sie gemeinsam mit ihrem Mann zahlreiche Beiträge zum Liederbuch Feiert Jesus! Kids beigesteuert und an Übersetzungen ihrer Lieder aus dem Englischen mitgearbeitet. [W][R]
Baltes, Guido
Guido Baltes (* 1968 in Krefeld/Nordrhein-Westfalen) ist ein deutscher Pfarrer der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Dozent und Schriftsteller. Er besuchte die Schulen in seiner Geburtsstadt und studierte in den Jahren zwischen 1987 und 1994 Theologie in Oberursel und an der Philipps-Universität in Marburg. Er absolvierte anschließend bis 1996 das Vikariat in der Kreuzkirchengemeinde in Wetzlar. Hieran schloss sich ein einjähriges Sondervikariat im Johanniter-Hospiz in Jerusalem an. Im Jahr 1996 wurde Baltes ordiniert und leitete in den Jahren zwischen 1997 und 2002 das Ressort Jugend und junge Erwachsene ERF junge welle beim Evangeliumsrundfunk in Wetzlar. Zusammen mit seiner Frau betreute er ab dem Jahr 2003 den Christus-Treff im Johanniter-Hospiz in Jerusalem. Seit dem Jahr 2009 lehrt Baltes Neues Testament und Dogmatik im Bibelseminar in Marburg. Baltes promovierte im Jahr 2011 an der TU Dortmund. Er ist Pfarrer im Ehrenamt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. In den Jahren 2009 bis 2016 arbeitete er zudem als hauptamtlicher Mitarbeiter im Leitungsteam des Christus-Treff Marburg. Neben theologischen Werken und Erbauungsschriften verfasst Baltes auch geistliche Lieder; zwei Lieder finden sich beispielsweise im Gesangbuch Feiern und Loben, das im Jahr 2003 in Holzgerlingen erschienen ist. [R][A]
Baumann, Michael
Michael Baumann (* 14. Februar 1614 in Crailsheim/Markgraftum Brandenburg-Ansbach, † 3. Dezember 1668 in Pfedelbach) war ein deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer und Hymnologe. Sein Vater war der Kaufmann Bartholomäus Baumann und seine Frau Susanna, geb. Coller oder Cöler. Michael Baumann besuchte die Schulen in seiner Vaterstadt und in Heilbronn, worauf er sich im Jahr 1633 an der Universität von Altdorf immatrikulierte, um Theologie zu studieren. Noch im gleichen Jahr wechselte er an die Hochschule von Tübingen und beschloss seine Studien in Straßburg. Er leistete sein Vikariat ab dem Jahr 1636 an der Hofkirche von Waldenburg und wurde ein Jahr später als Pfarrer nach Gnadental berufen. Ab dem Jahr 1638 stand er als Diakon (Zweiter Pfarrer) in den Diensten der Gemeinde von Künzelsau und stieg im folgenden Jahr zum Ersten Pfarrer auf. Ab dem Jahr 1664 war er Gräflich-Hohenlohischer Hofprediger und Superintendent in Pfedelbach. Er war seit dem Jahr 1637 mit Maria Schneidemann (oder Schnaitmann) verheiratet, deren Vater Johann Jakob Schneidemann Schultheiß von Beringsweiler und Schlossverwalter war. Das Paar hatte sieben Kinder. Baumann veröffentlichte Predigten, in denen er bekanntere und nahezu unbekannte geistliche Lieder behandelte. Diese Erläuterungen erschienen in sieben Teilen unter dem Titel Sonderbare Predigten zwischen 1659 und 1666 in Frankfurt am Main. Die Titel der behandelten Lieder sind in Johann Caspar Wetzels 1752 am Verlagsort Gotha erschienenen hymnologischen Werk Analecta hymnica im ersten Band aufgelistet. [R]
Bauschert, Hermann
Hermann Friedrich Bauschert (* 25. April 1898 in Heilbronn-Neckargartach; † 10. Dezember 1988) war ein deutscher Laienprediger, Politiker und Lieddichter. Er wurde als neuntes Kind des Bäckermeisters Christian Bauschert (1859-1932) und Marie, geb. Schaal (1859-1943), geboren und hatte zehn Geschwister. Er wurde evangelisch getauft und besuchte den Konfirmationsunterricht der Landeskirche. Er ging vom 7. bis zum 14. Lebensjahr in die Volksschule Neckargartach. Zwischen April bis Dezember 1912 besuchte er die Zeichenschule in Heilbronn als Vorschule für den gewählten Beruf als Silberschmied und trat im Januar 1913 eine Ausbildung im Silberschmiedberuf bei der Firma Bruckmann in Heilbronn an, die bis Dezember 1916 dauerte. Im Jahr 1917 trat er zur evangelisch-methodistischen Kirche über. Er leistete von November 1917 bis Januar 1919 Kriegsdienst und kam 1918 mit Landsturmkompanie zur Fliegerabwehr in der Stadt Arlon. Er kehrte nach Kriegsende als Silberschmied in seine Ausbildungsfirma zurück, wo er bis 1931 arbeitete; worauf er das Bäckerhandwerk erlernte und die Bäckerei seines Vaters übernahm. Im Jahr 1925 heiratete Bauschert die Bäckerstochter Luise, geb. Michler (1900-1995), und hatte mit ihr in den folgenden Jahren vier Kinder, die zwischen 1926 und 1936 geboren wurden. Von August bis November 1939 leistete er wiederum Kriegsdienst, diesmal am Westwall, an der sog. Siegfriedlinie. Von dort wurde er in die Heimat entlassen, da Familienväter mit mindestens vier Kindern freigestellt wurden. Ab Frühjahr 1940 arbeitete er in der Bäckerei seines Schwiegervaters, weil dessen Sohn eingezogen worden war, wurde dann aber im April 1943 vom Arbeitsamt als Technischer Abnahmebeamter in der Munitionsherstellung bei den NSU-Werke Neckarsulm dienstverpflichtet. Im Zeitraum zwischen 1946 und 1953 saß Bauschert als Abgeordneter der CDU-Fraktion im Gemeinderat der Stadt Heilbronn. Die zu einem Gemischtwarengeschäft umgewandelte Bäckerei wurde 1962 aufgegeben. Im Jahr 1963 zog das Ehepaar zu einer Tochter und verbrachte dort den Ruhestand bis zum Lebensende. Bauschert betreute lange Jahre in der Methodistengemeinde die Sonntagsschule, war Laienprediger und besorgte den Besuchsdienst in der Gemeinde. Eines seiner Lieder steht in der dritten Auflage des vom Diakonissenmutterhaus Aidlingen im Jahr 1986 in Stuttgart herausgegebenen Gesangbuchs Neue Lieder. Es hat den Titel Er kann alles, er kann trösten. [R][A]
Bellingroth, Paul
Paul Bellingroth (* 1. August 1875 in Barmen-Wupperfeld, † 14. April 1951 in Schweicheln) war ein deutscher evangelischer Pfarrer und Lieddichter. Er besuchte das Gymnasium in Barmen, wo er im Jahr 1894 das Abitur ablegte. Anschließend studierte er in Straßburg, Halle/Saale, Greifswald und Bonn, wo er das Examen bestand. Anschließend lebte er als Hauslehrer in Koblenz und leistete das Vikariat in den Jahren zwischen 1900 bis 1901 in Wiehl im Rheinland. Als Hilfsprediger hatte er anschließend Stellen in der Stadtmission in Frankfurt/Main, in Rheydt, Laaken/Rheinland und Koblenz inne, wo er im Jahr 1902 ordiniert wurde, um danach für ein Jahr als Pfarrer einer Gemeinde in Dönberg/Rheinland zu wirken. Ab dem Jahr 1904 arbeitete er in dem 1852 in Schildesche bei Bielefeld gegründete Rettungshaus Schildesche, einer evangelischen Fürsorgeerziehungsanstalt. Im Jahr 1924 wechselte er als Direktor an die Evangelische Erziehungsanstalt Schweicheln, wo er im Jahr 1946 in den Ruhestand trat und fünf Jahre später verstarb. Bellingroth war seit dem Jahr 1912 mit Charlotte, geb. Kraemer, (1891-1968) verheiratet. Im Liederbuch des Deutschen Verbandes der Jugendbünde für entschiedenes Christentum (EC), das im Jahr 1954 in Kassel unter dem Titel Jugendbund-Lieder erschienen ist, steht das Wanderlied Es rauscht durch deutsche Wälder von Bellingroth, zu dem er auch die Melodie verfasste. [R]
Berg, Klaus
Klaus Berg (* 25.März 1912 in Bremen,† 2001) war ein deutscher Pfarrer und Lieddichter. Seine Großväter waren Pfarrer in Rheinhessen bzw. Pommern gewesen. Klaus Berg studierte an den Universitäten in Greifswald und Göttingen und legte die Theologischen Examensprüfungen in Stettin ab. Den Eintritt in den Gemeindedienst verhinderte die Einberufung zum Kriegsdient, der ihn nach Russland führte, wo er in Gefangenschaft geriet und fünf Jahre in einem Lager in Stalingrad zubrachte. Im Jahr 1950 konnte er in seine Vaterstadt zurückkehren, wo er für die nächsten 20 Jahre in den Gemeindedienst eintrat. Anschließend diente er 19 Jahre in der Krankenhausseelsorge im Diakonissenhaus und in den Friedehorster Anstalten. Von ihm stammen sechs Lieder, die in neueren Gesangbüchern eine weitere Verbreitung gefunden haben. In dem von der Evangelischen Kirche des Rheinlands herausgegebenen Beiheft zum Evangelischen Kirchengesangbuch, das im Jahr 1984 in Kassel unter dem Titel Singt und dankt - Lieder und Gebete erschienen ist, stehen zwei Lieder von Berg. [R]