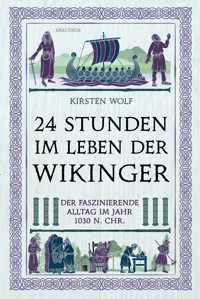
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hautnah den Alltag der Wikinger erleben
Nicht erst seit der Netflix-Serie Vikings sind die Wikinger ein beliebtes Thema der Medien- und Popkultur. Die Skandinavistin und Historikerin Kirsten Wolf zeichnet für uns ein lebendiges und authentisches Bild dieses Volkes, das wir heute als die Wikinger kennen, und das zwischen dem berüchtigten Lindisfarne-Überfall 793 n. Chr. und der normannischen Eroberung im Jahr 1066 zu einer der weitreichendsten und einflussreichsten Zivilisationen der Geschichte wurde. Sie beschreibt 24 Stunden im Alltagsleben der Wikinger, und beleuchtet dabei jede Stunde des Tages aus der Perspektive einer anderen Person. So erhalten wir einen fesselnden Einblick in die Welt von 24 Wikingern und erfahren, wie sie lebten, liebten, arbeiteten, kämpften und starben – vom Krieger bis zum Sklaven, vom Bauern bis zum Dichter.
- So waren sie wirklich!
- Die Wikinger sind eines der am meisten mit Mythen und Klischees umrankten mittelalterlichen Völker
- Wikingerexpertin Kirsten Wolf schildert im Laufe eines Tages jeweils eine Stunde aus dem Leben von 24 Personen der Wikingergesellschaft: Bauern, Krieger, Sklaven, Schiffsbauer oder Dichter
- Wie sie lebten, liebten, arbeiteten, kämpften und starben. Fesselnde, fundierte und greifbare Einblicke in das Leben dieser faszinierenden Menschen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kirsten Wolf
24 Stunden im Leben der Wikinger
Aus dem Englischen von Ilona Zuber
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und
enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte
Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie the Nutzung
durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung
oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in
elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und
zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlichgeschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke desText- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor.Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel»24 Hours in the Viking World. A Day in the Life of the Peoplewho Lived There« bei Michael O’Mara Books Limited, London 2024.
Die normalisierte Schreibweise vonPersonen- und Ortsnamen wurde übernommen.
Copyright © Kirsten Wolf 2024.
All maps drawn by David Woodroffe.
Original jacket design by Patrick Knowles.
Deutsche Erstausgabe
© 2025 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung nach dem Entwurf der Originalausgabe:Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bad Honnef
Umschlagmotive: © Patrick Knowles
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K.
ISBN 978-3-641-33207-5V001
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Dank
Einführung
Die siebte Stunde der Nacht
Ein Hofbesitzer wird in seinem Bett ermordet
Die achte Stunde der Nacht
Ein verwundeter Skalde wird von einer Heilerin behandelt
Die neunte Stunde der Nacht
Eine Frau bringt ein Kind zur Welt
Die zehnte Stunde der Nacht
Ein Bäcker beginnt sein Tagwerk
Die elfte Stunde der Nacht
Ein Kaufmann nimmt seine Waren an Bord
Die zwölfte Stunde der Nacht
Eine Frau verteidigt ihr Volk
Die erste Stunde des Tages
Ein Baby wird nicht ausgesetzt
Die zweite Stunde des Tages
Ein Mann rüstet für eine militärische Expedition
Die dritte Stunde des Tages
Ein Sohn begräbt seinen Vater, einen Wiedergänger
Die vierte Stunde des Tages
Ein Runenmeister enthüllt sein Kunstwerk
Die fünfte Stunde des Tages
Ein Gesetzessprecher verkündet ein neues Gesetz
Die sechste Stunde des Tages
Eine Sklavin bricht ihr Schweigen
Die siebte Stunde des Tages
Ein Mann wird der Homosexualität bezichtigt
Die achte Stunde des Tages
Ein Häuptling kehrt von einem Raubzug zurück
Die neunte Stunde des Tages
Ein Mann stellt sich einem Zweikampf
Die zehnte Stunde des Tages
Eine Frau lässt sich von ihrem Mann scheiden
Die elfte Stunde des Tages
Eine Hausfrau bereitet ein besonderes Mahl zu
Die zwölfte Stunde des Tages
Ein Mann wird für den Verlust seines Bruders entschädigt
Die erste Stunde der Nacht
Ein Bootsbauer baut ein Schiff
Die zweite Stunde der Nacht
Ein König besucht ein Opferfest
Die dritte Stunde der Nacht
Ein Häuptling wird in seinem Haus verbrannt
Die vierte Stunde der Nacht
Eine Frau greift zur Waffe
Die fünfte Stunde der Nacht
Eine Tochter bringt ihren Vater vom Selbstmord ab
Die sechste Stunde der Nacht
Ein Mann stillt ein Kind
Über die Autorin
Bildnachweise
Quellen
Literaturverzeichnis
Literaturempfehlungen
Namen
Register
Dank
Das Schönste am Abschluss eines Buchprojekts ist es wohl, all jenen Dank zu sagen, die zum Gelingen dieser Arbeit wertvolle Beiträge geleistet haben. Vor allem möchte ich Ross Hamilton dafür danken, dass er mich gebeten hat, dieses Projekt zu übernehmen, und auch dafür, dass ich mich stets mit allen Fragen an ihn wenden konnte. Mein Dank gilt außerdem Lucy Stewardson für ihr hervorragendes Lektorat, ferner meinem guten Freund Wayne Brabender, der nicht nur jedes Kapitel aufmerksam gelesen und redigiert hat, sondern sich auch immer wieder geduldig meine Klagen über die kniffligeren Stellen anhörte. Schließlich sind mir auch Laura Moquin und Emily Beyer, beides Doktorandinnen hier an der Universität von Wisconsin–Madison, bei den umfangreichen Recherchen zu den vielen in diesem Buch behandelten Themen eine enorme Hilfe gewesen.
Einführung
Die Handlung dieses Buches ist in der Wikingerzeit angesiedelt, die ungefähr den Zeitraum von 800 bis 1100 umfasst. Im Fokus stehen dabei hauptsächlich das skandinavische Festland (Dänemark, Norwegen, Schweden) sowie Island. Im Laufe der genannten drei Jahrhunderte wurde Island vollständig besiedelt und Skandinavien von fundamentalen Umwälzungen erfasst: Die modernen Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden nahmen Gestalt an, die ersten Städte wurden gegründet und die heidnischen Kulte allmählich zugunsten des Christentums aufgegeben. Außerdem vollzogen sich in der Wikingerzeit rasante technische Entwicklungen: Brücken und Festungen wurden gebaut, etwa die kreisförmigen Wikingerburgen (»Ringburgen«), deren berühmteste sich im dänischen Trelleborg befindet. Auch im Schiffbau und in der Navigation wurden immense Fortschritte erzielt, die es den Skandinaviern ermöglichten, enorme Strecken zurückzulegen und sich geografisch weiträumiger auszubreiten als jedes andere europäische Volk vor und nach ihnen. Übertroffen werden sollten sie erst durch die Expeditionen und Kolonialisierungen, die auf die Entdeckungen von Christoph Kolumbus folgten.
Im Laufe der Wikingerzeit dehnte die Welt der Skandinavier sich beträchtlich aus, und so kann das Bild, das in diesem Buch von ihnen präsentiert wird, zwangsläufig nur einen Bruchteil davon wiedergeben, denn natürlich unterschied sich das Leben eines plündernden Wikingers fundamental von dem eines Bäckers, eines Schiffbauers oder einer Hausfrau jener Zeit. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Lebensstile und Berufe auch von Region zu Region variieren konnten. Skandinavien – in der weiter gefassten Bedeutung des Begriffs – umfasst ein riesiges Gebiet, das sich vom 55. Breitengrad aus über 2000 Kilometer weit bis zum Nordpolarmeer erstreckt und vom Westzipfel Islands (24° westlich von Greenwich) bis zur Ostgrenze Norwegens und Finnlands (31° östlicher Länge) reicht.
Geografisch und klimatisch unterscheiden sich die Länder Skandinaviens erheblich voneinander. Dänemark ist sehr flach, ein Großteil des Landes gleicht einem Flickenteppich aus weißen Stränden, blauen Seen und grünen Feldern. Dagegen sind zwei Drittel der Fläche Norwegens von schroffen Gebirgslandschaften mit kahlen Felsen bedeckt. In Schweden ist der nördliche Teil ebenfalls gebirgig, während in Mittel- und Südschweden Ebenen und Hochland einander abwechseln. Island wiederum ist eine Vulkaninsel, ein von Berggipfeln und Eisfeldern durchsetztes Plateau. Das Landesinnere besteht aus Gletschern und Ödland.
Als Volk waren die Skandinavier zu Beginn der Wikingerzeit überwiegend homogen, doch durch die zahllosen Wikingerraubzüge und Handelsbeziehungen – die auch den Import von Sklaven, insbesondere aus Irland, einschlossen – muss es zu einer zunehmenden Vermischung von Ethnien und Kulturen gekommen sein. Die heutigen Skandinavierinnen und Skandinavier, die sich selbst als indigen wahrnehmen, sind nicht ausschließlich blond und blauäugig; es finden sich auch viele Dunkelhaarige und Menschen mit braunen Augen unter ihnen. Wichtig zu wissen: Skandinavier sind nicht mit Wikingern gleichzusetzen. Das Wort »Wikinger« bezieht sich keineswegs auf eine ethnische Identität, sondern auf eine Tätigkeit. Deswegen gibt es zum Beispiel auch weder Wikingerkinder noch Wikingerfrauen. Nur eine Minderheit der Männer, die in Skandinavien oder auf den nordischen Inseln lebten, waren an Wikingeraktivitäten beteiligt. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung bestand aus einfachen und friedlichen Bauern, Fischern, Jägern, Händlern, Handwerkern, Zimmerleuten, Schmieden oder Schiffbauern. Einige arbeiteten auch als Rechtsmänner, Friedensrichter, Dichter und Runenmeister. Darüber hinaus scheint das Wikingertum im Wesentlichen eine freiwillige Tätigkeit gewesen zu sein, die einem jungen Mann die Gelegenheit bot, aus der häuslichen Gebundenheit auszubrechen, etwas von der Welt zu sehen, Abenteuer zu erleben und eigenes Geld zu verdienen – in etwa so, wie wenn es heute junge Menschen zum Militärdienst zieht.
Dieser Globus zeigt, wie riesig das Gebiet der Wikinger war; es umfasste nicht nur Skandinavien, sondern auch den südlichen Teil Grönlands und das heutige Neufundland.
»24 Stunden im Leben der Wikinger« soll die Menschen im Skandinavien und Island jener Zeit in ihrem Alltag porträtieren, sie mithilfe von Informationen aus der Archäologie und der mittelalterlichen Literatur wieder zum Leben erwecken. Die einzelnen Kapitel springen zwischen Dänemark, Norwegen, Schweden, Island und den Orkney-Inseln hin und her, einige von ihnen streifen sogar Grönland und Nordamerika, die diese Nordeuropäer zu kolonisieren versuchten. Die meisten Episoden sind allerdings in Island angesiedelt, das über eine ungeheuer reiche mittelalterliche Literatur verfügt, in welcher auch der damalige Alltag beschrieben wird. Die Geschichten basieren auf wahren Begebenheiten und handeln meist von realen und bekannten Persönlichkeiten, etwa von König Håkon dem Guten von Norwegen, dem Geächteten Gisli Sursson, dem Dichter Egill Skallagrimsson oder dem Wikinger Svein Asleifarson. Einige der Figuren sind jedoch fiktiv, zum Beispiel der Bäcker Harald Jensson, die Hausfrau Sigrid Steingrimsdottir oder der Schiffbauer Grim Haraldsson; leider werden Angehörige dieser Berufsgruppen in der mittelalterlichen Literatur eher selten erwähnt. Um die häufig nur in Fragmenten vorhandenen archäologischen und literarischen Belege zu einer zusammenhängenden Erzählung zu verbinden, wurden die Lebensgeschichten mancher Personen gelegentlich durch zusätzliches Material ergänzt. Abschließend sei angemerkt, dass hier und da auch etwas kreative Freiheit walten durfte.
Die siebte Stunde der Nacht
(00.00 – 01.00 Uhr)
Ein Hofbesitzer wird in seinem Bett ermordet
Unter dem Vorwand, er habe vergessen, eines der Pferde seiner Gäste zu versorgen, geht Gisli Sursson spät am Abend noch einmal nach draußen. Seine Frau Aud weist er an, die Tür zu verriegeln und wach zu bleiben, damit sie ihm bei seiner Rückkehr öffnen könne. Dann nimmt er seinen Speer namens Graustahl aus der Truhe, zieht einen dunklen Umhang über sein Hemd und macht sich auf den Weg zum Bach, der seinen Hof Hol in den Westfjorden Islands von dem Hof Sæbol seines Schwagers Thorgrim trennt. Obwohl das Wasser des Baches eisig ist, watet er hindurch, bis er den Pfad nach Sæbol erreicht hat. Gisli ist nicht wohl bei seinem Vorhaben, doch er ist überzeugt, dass er seine Mission erfüllen muss. Sein Ehrgefühl lässt ihm keine andere Wahl.
Besondere Waffen trugen oft ausgefallene Namen, die sich auf ihre Herkunft oder ihre Eigenschaften bezogen. Beispiele aus der altnordisch-isländischen Literatur sind »Beinbeißer«, »Grettirs Geschenk«, »Schlachtenfeuer«, »Kettenhemdbeißer« und »Waffenstillstandsbrecher«.
Gisli denkt an die Zeit zurück, als er und die anderen Männer aus Haukadal in vollkommener Eintracht bei Trinkgelagen zusammensaßen, nach Herzenslust aßen und Bier tranken, miteinander sangen und lachten, sich Geschichten und Witze erzählten. Doch bereits in diesen einvernehmlichen und friedlichen Zeiten hatte ihn der Wahrsager Gest, ein weiser und von Gisli hochgeschätzter Mann, gewarnt: Schon in wenigen Jahren werde es mit der Harmonie in ihrer Gruppe vorbei sein. Auch Gisli waren gewisse Spannungen zwischen den Leuten von Haukadal nicht entgangen, doch, so sagte er sich, welche Familie ist schon frei davon? Er hätte nicht gedacht, dass die Unstimmigkeiten eine solch gefährliche Entwicklung nehmen würden.
Da die unheilvollen Vorahnungen des Wahrsagers sich bereits häufig als zutreffend erwiesen hatten, überlegte Gisli fieberhaft, wie er die Prophezeiung abwenden könnte. Fest entschlossen, alles in seiner Macht Stehende dafür zu tun, schlug er seinem Bruder Thorkel, ihrem gemeinsamen Schwager Thorgrim (dem Mann ihrer Schwester Thordis) sowie dem Bruder seiner Frau Aud, Vestein, vor, Blutsbrüderschaft zu schließen, um ihren Zusammenhalt zu bekräftigen und zu besiegeln. Gisli rief alle Götter als Zeugen an und schlug den vier Männern vor, einen Eid abzulegen, jedes Leid zu rächen, das einem Mitglied ihrer Bruderschaft angetan werden würde. Alle waren einverstanden, aber als sie einander die Hände reichen sollten, wies Thorgrim Vesteins Hand zurück und erklärte, er fühle sich nur den Brüdern seiner Ehefrau verpflichtet, nicht jedoch Vestein. Da zog auch Gisli seine Hand zurück und rief, dann wolle er es ebenso mit Thorgrim halten. Die Blutsbrüderschaft war gescheitert.
Wie Gest vorhergesagt hatte und sehr zu Gislis Verdruss begann die Kameradschaft, die einmal zwischen den vier Männern geherrscht hatte, alsbald zu schwinden. Gislis größte Sorge galt der Sicherheit seines geliebten Schwagers Vestein, der sich für eine Reise ins Ausland rüstete. Daher fertigte Gisli in seiner Schmiede eine metallene Scheibe an, die er in zwei Hälften schnitt, welche perfekt zu einer Art großer Münzen zusammengefügt werden konnten. Die eine Hälfte behielt er selbst, die andere gab er Vestein vor dessen Abreise. Sie vereinbarten, ihre jeweilige Hälfte nur dann dem anderen zukommen zu lassen, wenn einer von ihnen in Lebensgefahr sei. Tief im Innern fühlte Gisli, dass sie eines Tages davon Gebrauch machen würden.
Nachdem einige Zeit vergangen war, erzählte Aud ihrem Mann eines Abends von einem Gespräch, das sie mit Asgerd, der Frau seines Bruders Thorkel, geführt hatte. Gisli und Thorkel besaßen den Hof gemeinsam, und ihre Ehefrauen standen einander sehr nahe. Als die beiden Schwägerinnen eines Tages an ihren Webstühlen saßen und miteinander plauderten, fragte Aud Asgerd, ob sie früher einmal Vestein geliebt habe. Asgerd verneinte, gab aber bereitwillig zu, sich sehr zu Vestein hingezogen zu fühlen, sogar mehr als zu ihrem eigenen Mann. Zu ihrem Entsetzen bemerkte Aud, dass Thorkel dieses Gespräch belauscht hatte. Obwohl Gisli sehr bestürzt war, als er Auds Geschichte angehört hatte, gab er seiner Frau keine Schuld, sondern sagte: »Jemand musste die Schicksalsworte aussprechen. Was geschehen muss, wird geschehen.«
Bald darauf verlangte Thorkel, dass Gisli und er ihren gemeinsamen Hof aufteilen sollten. Auch wenn Gisli sehr wohl wusste, dass er derjenige sein würde, der von einem solchen Arrangement profitierte, da Thorkel nur selten auf dem Hof weilte und sich mehr als Nutznießer denn als Mitbesitzer hervortat, war er dagegen. Es widersprach seinem Familiensinn. Ohne die Bande des gemeinsamen Besitzes, so Gislis Befürchtung, würde der Zusammenhalt der Familie schwinden. Doch Thorkel setzte sich durch und fuhr auf den nahegelegenen Hof ihres Schwagers Thorgrim nach Sæbol. Mittlerweile war Gisli klar, dass Vestein sich ernsthaft in Gefahr befand. Zwar war Thorkel nach wie vor an seinen Schwur gebunden, doch niemand konnte Thorgrim daran hindern, im Namen seines Schwagers Rache zu üben. Als Gisli erfuhr, dass Vestein von seiner Reise zurückgekehrt war und sich wieder in Island befand, sandte er einen Boten mit seiner Hälfte der Münze aus, doch Vestein nahm nicht den üblichen Weg, und so konnte Gisli ihn nicht aufspüren.
In den beiden Nächten nach Vesteins Ankunft auf Hol fand Gisli kaum Schlaf. Wenn er schließlich doch einnickte, hatte er verstörende Träume, die er niemandem anvertrauen mochte, nicht einmal seiner Frau. In der dritten Nacht lag er als Einziger wach, als eine heftige Sturmbö das Haus so stark traf, dass auf der einen Seite das Dach vollständig abgerissen wurde, während draußen ein sintflutartiger Regen niederging. Gisli und seine Knechte stürzten aus den Betten, um das Heu auf den Feldern in Sicherheit zu bringen. Nur ein einziger Knecht, Thord der Feige genannt – ein Leibeigener –, blieb mit Vestein und Aud im Haus zurück. Vestein bot seine Hilfe an, doch Gisli bat ihn, bei der Schwester zu bleiben.
Schon bald regnete es so stark durch das undichte Dach, dass Vestein und Aud ihre Betten in trockenere Bereiche des Hauses schieben mussten. Kurz vor Tagesanbruch erwachte Aud von einem lauten Schrei. Entsetzt fuhr sie auf und rannte zu ihrem Bruder, doch sie sah nur noch, wie er neben seinem Bettpfosten tot zu Boden sank – ein Speer hatte seine Brust durchbohrt. Vollkommen schockiert schrie sie Thord den Feigen an, er solle die Waffe aus Vesteins Körper ziehen, doch Thord weigerte sich. Ihm war sehr wohl bewusst, dass jedermann in Island, der eine Waffe aus der Wunde eines Toten zieht, zur Rache verpflichtet ist. Er wusste auch, dass es als Totschlag und nicht als Mord gilt, wenn eine Waffe in einer tödlichen Wunde belassen wird. In diesem Augenblick stürzte Gisli herein, zog den Speer aus der Wunde und warf die von Blut besudelte Waffe in eine Truhe, sodass niemand sie mehr sehen konnte.
Gisli ließ sich auf dem Rand des Bettes nieder, um seine Gedanken zu ordnen. Schließlich beschloss er, seine Ziehtochter nach Sæbol zu schicken, um zu erfahren, was dort vor sich ging. Die Ziehtochter berichtete bei ihrer Rückkehr, sie sei kühl empfangen worden, und auf Sæbol habe sich niemand bekümmert oder überrascht gezeigt, als sie von dem Mord an Vestein berichtete. Thorgrim sei sogar in voller Rüstung gewesen, habe Helm und Schwert getragen, und auch Gislis Bruder Thorkel sei mit einem Schwert bewaffnet gewesen. Gisli war über diese Nachricht nicht verwundert. Unverzüglich schickte er sich an, auf der Sandbank jenseits des Weihers unterhalb von Sæbol ein Hügelgrab für Vestein anzulegen. Viele Menschen erschienen, um Vestein das letzte Geleit zu geben, auch Thorkel, der Gisli ermahnte, sich vor Rachegedanken für den Mord an Vestein zu hüten.
Gisli konnte die Angelegenheit jedoch nicht auf sich beruhen lassen. Er konnte seine brüderliche Pflicht und Schuldigkeit gegenüber Vestein nicht ignorieren, und auch nicht gegenüber Aud, die sich den Verlust ihres Bruders sehr zu Herzen nahm. Selbst wenn sie nicht oft weinte, kannte er seine Frau doch gut genug, um zu wissen, wie verzweifelt sie war. Auch konnte er nicht vergessen, dass er derjenige gewesen war, der den Speer aus der tödlichen Wunde gezogen hatte; er musste Vesteins Tod rächen, und er wusste, dass Thorgrim der Mörder war. Es war nun an Gisli, zurückzuschlagen.
Im Frühjahr beschlossen Gisli und Thorgrim, ein Fest auf ihren Höfen auszurichten, um das Ende des Winters zu feiern. Sie luden viele Gästen ein. Als Thorgrim sein Haus auf Sæbol schmückte, sandte er einen seiner Knechte, Geirmund, nach Hol, um dort einige Wandteppiche abzuholen, die Vestein einst Thorkel zum Geschenk machen wollte, was dieser jedoch abgelehnt hatte. Gisli erklärte sich sofort bereit, Geirmund die Teppiche zu überlassen und begleitete ihn bis zur Grundstücksgrenze. Nun bot sich Gisli die Gelegenheit, Vergeltung an Thorgrim zu üben. Er trug Geirmund auf, er solle als Gegenleistung für die Nutzung der Wandteppiche vor dem Zubettgehen drei der Türen auf Sæbol entriegeln. Geirmund willigte ein.
Ein rekonstruiertes isländisches Bauernhaus im Landesinnern bei Stöng im Tal Thjorsardalur.
Die Wände der Häuser aus der Wikingerzeit waren offenbar verkleidet, und in einigen Häusern waren die Verkleidungen mit Schnitzereien oder gewebten Wandbehängen oder Bildteppichen verziert – schmale Stoffstreifen mit eingestickten oder gewebten Mustern. Sie waren ein Privileg der wohlhabenderen Kreise der Gesellschaft und dienten sowohl zur Zierde als auch zur Wärmedämmung.
Gisli kennt das Gehöft auf Sæbol wie seine Westentasche, da er es selbst gebaut hat. Zunächst betritt er den Kuhstall, von dem aus eine Tür direkt ins Haus führt. An jeder Seite des Stalls stehen dreißig Kühe. Gisli bindet ihre Schwänze zusammen, um sie am Weglaufen zu hindern. Beim Hinausgehen verriegelt er die Tür, sodass sie von innen nicht geöffnet werden kann. Dann schleicht er weiter zum Wohnhaus und stellt fest, dass Geirmund Wort gehalten hat: Drei der Türen zum Haus sind offen. Leise schleicht Gisli hinein und schließt die Türen hinter sich. Einen Moment lang hält er inne und horcht, ob jemand aufgewacht ist. Als er sicher ist, dass alle schlafen, beschließt er, die drei Lichter zu löschen, die er im Gutshaus brennen sieht. Er hebt eine Handvoll Binsen vom Boden auf, ballt sie zu einem Knäuel und wirft dieses auf die erste Lampe, die erlischt. Als er sich anschickt, ein weiteres Knäuel für die zweite Lampe zu machen, erstarrt er plötzlich. In der spärlichen Beleuchtung sieht er, wie sich die Hand eines jungen Mannes aus einer Bettnische nach der dritten Lampe ausstreckt und den Halter herunterdreht; die Flamme erlischt. Eine Ewigkeit scheint zu vergehen, bis Gisli den Schreck überwunden hat und sich ein Herz fasst, um weiterzugehen.
In der Dunkelheit hat er Mühe, sich zu orientieren, doch schließlich findet er die Bettnische, in der er seine Schwester Thordis mit Thorgrim vermutet. Die Tür zu ihrer Bettnische ist geschlossen. Gisli schafft es, sie langsam zu öffnen, ohne dass jemand erwacht, und sieht, dass beide in ihrem Bett liegen. Vorsichtig nähert er sich und beginnt, unter den Decken nach Thorgrim zu tasten. Es ist so dunkel, dass er nicht bemerkt, dass es die an der äußeren Bettseite schlafende Thordis ist, die er an der Brust berührt. Seine Schwester erwacht und stößt ihren Mann in die Seite: »Warum ist deine Hand so kalt, Thorgrim?«, fragt sie ihn. Thorgrim brummt im Schlaf und dreht sich um.
Gisli befürchtet, sie könnten sein hämmerndes Herz hören, deshalb wartet er noch eine Weile und wärmt sich die Hände in seiner Tunika. Als er glaubt, dass beide wieder eingeschlafen sind, streckt er die Hand über Thordis hinweg nach Thorgrim aus, der sich wieder von seiner Frau weggedreht hat, und berührt ihn sachte. Thorgrim wacht auf, und als er sich wieder zu Thordis herumdreht, reißt Gisli schnell mit einer Hand die Decken herunter und rammt mit der anderen seinen Speer Graustahl so heftig in Thorgrims Leib, dass die Klinge in der Bettstatt stecken bleibt. Behände und lautlos eilt Gisli aus dem Haus und schließt auf seinem Weg die Türen hinter sich. Er hört Thordis’ Schreie, die entdeckt hat, dass ihr Mann getötet wurde.
Es hat zu schneien begonnen, als Gisli sich auf den Heimweg macht. Er nimmt denselben Weg, den er gekommen ist. Bald schon ist alles zugeschneit. Hinter sich hört er den Tumult der betrunkenen Männer, die kopflos durch den Schnee torkeln und dabei sämtliche Spuren zertrampeln, die er hinterlassen hat. Als er auf Hol ankommt, sperrt Aud die Tür auf. Sie stellt ihm keine Fragen. Gisli geht mit dem guten Gewissen zu Bett, seine brüderliche Pflicht und seinen Eid erfüllt zu haben. Im Nu schläft er ein.
Später dichtete Gisli eine Strophe, in der er sich selbst anklagte und die von seiner Schwester, der Frau des Mordopfers, zufällig mitangehört wurde:Ich sah die Triebe sprießenDurch den vom Eis befreiten Bodenauf dem Grab des grimmigen Mannes.Ich war’s, der diesen Krieger erschlug.Der Krieger hatteden anderen getötet und,gierig nach neuem Land,einem anderen einen Teil seines eigenenfür immer verschafft.Diese Enthüllung führte zu Gislis Ächtung und letztlich, als er sich gegen seine Feinde verteidigen musste, zu seinem Tod. Die Ächtung war in Island die höchste Strafe, die verhängt werden konnte. Es gab zwei grundlegende Arten von Ächtung: die »geringere Acht« und die »volle Acht«. Die geringere Acht war die Verurteilung zu einer dreijährigen Verbannung außer Landes. Bei der vollen Acht hingegen verlor der Geächtete sämtliche Rechte. Niemandem war es erlaubt, ihm in irgendeiner Weise Hilfe zu leisten oder ihn außer Landes zu bringen. Jeder durfte ihn straflos töten, ob in Island oder außerhalb.
Die achte Stunde der Nacht
(01.00 – 02.00 Uhr)
Ein verwundeter Skalde wird von einer Heilerin behandelt
Es war ein sehr langer und schwerer Tag für Thormod Bersason. Thormod ist ein isländischer Skalde, ein Dichter und Rezitator am Hofe des norwegischen Königs Olaf Haraldsson. Es ist spät am Abend, und Thormod ist zermürbt und erschöpft von der Schlacht – jener Schlacht, in der König Olaf starb und Thormod selbst schwer verwundet wurde.
Skalde ist die altnordisch-isländische Bezeichnung für einen Dichter. Der Begriff wird typischerweise für höfische Poeten verwendet, die die höchst kunstvolle skaldische Dichtung mit ihren komplizierten Versformen verfassten. Es bedurfte einer langen Ausbildung, um Skalde zu werden. Skalden wurden oft von skandinavischen Königen verpflichtet, um Gedichte über ihre Schlachten oder Siege zu verfassen und für Unterhaltung zu sorgen. Als Belohnung erhielten sie Kost und Logis sowie wertvolle Geschenke.
Wie viele andere auf der Seite der Besiegten war Thormod von dem Ort, an dem er und seine Gefährten die größte Gefahr vermuteten, zurückgewichen. Einige Krieger waren geflohen, doch der erschöpfte und im Kampf verwundete Thormod konnte nichts weiter tun, als in vermeintlich sicherer Entfernung bei seinen Kameraden auszuharren und zuzusehen, wie das Gemetzel seinen Lauf nahm. Da plötzlich wurde er von einem Pfeil in die linke Flanke getroffen. Mit einem unterdrückten Schrei hatte er den Schaft abgebrochen und war dann davongelaufen, um Obdach und Hilfe zu suchen.
Inzwischen ist es später Abend, Thormod schleppt sich mühsam dahin, dreckig und verschwitzt, mit blutgetränkten Kleidern, nur mit seinem Schwert in der Hand. Es ist nicht besonders kalt, doch es regnet, der Pfad ist schlammig, und Thormod kennt sich in dieser Gegend nicht aus. Auf Schritt und Tritt verfolgen ihn die Gräuel, die er an diesem Tag gesehen und erlebt hat. König Olaf konnte sich mit seinem viel zu kleinen Heer nicht behaupten, obwohl er sich tapfer geschlagen hat, denkt Thormod. Auf dem Höhepunkt der Schlacht hieb ein Mann namens Thorstein Knarresmed (»Schiffbauer«) dem König unterhalb des Knies seine Streitaxt ins linke Bein, sodass es beinahe abgetrennt wurde. Nach dieser Verwundung konnte sich Olaf nicht mehr aufrecht halten und lehnte sich an einen Felsen. Obwohl das Blut aus der Wunde auf seinen Fuß strömte, wankte er nicht. Doch ein anderer Mann namens Thorir der Hund nutzte die Gunst der Stunde, stieß dem verletzten und bewegungsunfähigen König seinen Speer in den Leib und durchbohrte ihm unter dem Kettenhemd den Bauch. Schließlich hieb ein gewisser Kalv dem König ein Messer in den Hals und schlitzte diesen an der linken Seite auf. Das war der Todesstoß, und die Männer des Königs schrien vor Entsetzen laut auf, als ihr Herrscher tot zusammenbrach. Trotzdem kämpften sie weiter.
Bestürzt lässt Thormod die Ereignisse Revue passieren, die diesem schrecklichen Moment vorausgegangen waren. König Olaf war kurz zuvor aus dem Exil im heutigen Russland zurückgekehrt, um den norwegischen Thron zu beanspruchen. Einige der mächtigen Häuptlinge zürnten ihm jedoch wegen seines brutalen Vorgehens. Sie hatten ein Bündnis mit dem dänischen König Knut dem Großen und dessen norwegischem Vasallen, dem Jarl1 Håkon Eiriksson, geschlossen und Olaf von seinem Hof verjagt. Der König floh ins Exil zum Großfürsten Jaroslaw von Nowgorod. Dort erreichte ihn die Nachricht, dass Jarl Håkon ertrunken war. Für Olaf bot sich damit die Gelegenheit, die Krone zurückzufordern, und er beschloss, sein Asyl zu verlassen. Da er mit Widerstand rechnete, scharte er auf seinem Rückweg durch Schweden ein Heer von circa 480 Mann um sich. In Norwegen fand er eine weitere etwa 3.000 Mann starke Gruppe von Unterstützern. Allerdings hatte Olaf nicht geahnt, dass er gegen die Übermacht eines 14.000 Mann starken Bauernheers würde kämpfen müssen, das von norwegischen Häuptlingen aufgestellt worden war.
1 »Jarl« war bis ins Hochmittelalter ein Adelstitel in den nordischen Ländern, entsprechend dem englischen Earl.
In der Nacht vor der Schlacht, unweit des Dorfes Stiklestad, schlief König Olaf im Kreise seiner Männer einen kurzen und unruhigen Schlaf. Bei Sonnenaufgang ließ er seinen Skalden Thormod rufen und bat ihn, ein Gedicht für die Kämpfer vorzutragen. Thormod ging in sich, schloss die Augen, holte tief Luft und rezitierte dann einige Verse aus dem »Bjarki-Lied«, das den Kampfgeist stärken sollte. Seine Stimme erklang so klar und vernehmlich, dass das gesamte Heer erwachte. Beeindruckt von diesem Gedicht hatten die Truppen beschlossen, es »Huskarla-hvöt« zu nennen, was so viel bedeutet wie »Die Anspornung des Gefolges«.
Während er sich weiterschleppt und sich immer weiter vom Ort der Schlacht entfernt, entdeckt Thormod plötzlich eine Scheune. Drinnen flackert ein Licht, und Stimmengewirr ist zu hören. Als Thormod hineingeht, tritt ihm sofort ein Mann in den Weg und beschwert sich über das Jammern und Wehklagen der verwundeten Männer, die hier überall auf dem Boden liegen. Wütend setzt er hinzu, König Olafs Männer hätten sich in der Schlacht zwar gut geschlagen, würden sich jetzt jedoch gehenlassen. Gekränkt fragt Thormod den Mann nach seinem Namen und will wissen, ob er selbst denn ebenfalls gekämpft habe. Der Mann stellt sich als Kimbi vor und antwortet, jawohl, er habe gekämpft, und zwar in dem Bauernheer. Dann fragt Kimbi, ob auch Thormod in der Schlacht war, und Thormod erwidert, er habe auf der anderen Seite gekämpft und König Olaf verteidigt. Die Atmosphäre zwischen den beiden Männern knistert vor Spannung, doch plötzlich bietet Kimbi Thormod an, ihn zu verstecken, wenn dieser ihm im Gegenzug seinen goldenen Armreif überließe – ein Geschenk von König Olaf –, denn andernfalls, so seine Warnung, würden die norwegischen Bauern ihn töten. Trotz seiner Erschöpfung behält Thormod einen klaren Kopf. Ein gewisses Funkeln in Kimbis Augen sagt ihm, dass sein angeblicher Retter keine guten Absichten hegt. Als Kimbi nach dem Armreif greifen will, weicht Thormod ihm aus, zieht sein Schwert und schlägt ihm die Hand ab. Kimbi taumelt rückwärts und heult auf, doch kaum jemand nimmt Notiz von ihm; der Fußboden ist übersät von Männern mit weit schwereren Verletzungen.
Aus dem Bjarki-Lied:Der Tag ist angebrochen,der Hahn schüttelt sein Gefieder,Zeit für die Mutigen, den Kampf zu beginnen.Wacht auf nun, Freunde, ihr Freunde, herbei,ihr vortrefflichen Gefährten des Adils.
Nach dieser Auseinandersetzung bahnt sich Thormod einen Weg hinein in die Halle. Schwer atmend lässt er sich in einer Ecke nieder und lauscht den Gesprächen über König Olaf und die Schlacht. Die Verwundeten unterhalten sich mit gedämpften Stimmen über ihre Erlebnisse und diskutieren, wie die Kämpfer sich geschlagen haben. Zu Thormods Verdruss äußern sich aber nicht alle nur lobend über König Olaf. Um seinen Herrn zu verteidigen, dichtet er spontan folgende Strophe:
Hart wie Eisen schritt Olaf
voran – blutgetränkter
Stahl drang tief in Stiklestad –
und trieb seine Männer an.
Der Mut vieler Krieger ward
im Gemetzel auf die Probe gestellt;
die Schilde schützten alle vor
dem Pfeilhagel – nur nicht den Anführer.
Da Thormod genug von ihren Gesprächen hat, geht er zu einem kleinen, freistehenden Gebäude auf dem Bauernhof hinüber. Bei seinem Eintritt nimmt er viele schwerverletzte Männer wahr, zwischen denen eine Frau hin- und hereilt, um ihnen die Wunden zu verbinden. Thormod fragt sich, woher sie stammen mag. Vom Aussehen her würde er sie für eine Samin halten; man sagt, samische Frauen seien geschickte Heilerinnen, wenn auch meist in der magischen Heilkunde. Doch nach dem Blutverlust und den Ereignissen des Tages ist er zu müde, um sich allzu viele Gedanken darüber zu machen. Dass hier eine Frau die Wunden versorgt, überrascht ihn jedoch keineswegs.
Die Behandlung von Kranken war damals typischerweise eine Domäne der Frauen. Sie griffen dabei nicht nur auf ihre eigenen Beobachtungen und Erfahrungen zurück, sondern auch auf umfangreiches Wissen, das von Generation zu Generation mündlich weitergegeben wurde, beispielsweise über Heilpflanzen, spezielle Ernährungsweisen, Dampfbäder, Abführmittel, Aderlass und chirurgische Eingriffe.
Aus seiner isländischen Heimat weiß Thormod, dass es früher auch Frauen gab, die Magie und Zaubersprüche für Heilungszwecke einsetzten, und dass auch Runen heilende Kräfte besitzen können. Ihm fällt eine Strophe aus dem »Lied von Sigrdrifa« ein, in dem die Walküre Sigrdrifa den Drachentöter Sigurd Runenzauber lehrt.
Hilfsrunen schneide, wenn du helfen willstund Kinder lösen aus dem Leib von Frauen,ritze sie in die hohle Hand und fest auf die Knöchel,und erbitte dann die Hilfe der Göttinnen.Astrunen kenne, wenn du Heiler willst seinund willst Wunden versorgen können.In die Rinde ritze sie, von Bäumen,deren Äste ostwärts sich biegen.
Tatsächlich erinnert er sich jetzt vage an eine Geschichte, die er einmal in Island gehört hat; ein Mann namens Egill Skallagrimsson hatte mithilfe von Runen eine »zehrende Krankheit« geheilt. Egill soll einen Bauern besucht haben, dessen Tochter an einer schweren Krankheit litt. Er ordnete an, das Mädchen von ihrem Bett zu heben und auf saubere Laken zu legen. Als er das Krankenlager untersuchte, fand er einen Walknochen mit Runen, die der Sohn des Bauern eingeritzt hatte in der Hoffnung, so das Mädchen zu heilen. Bei näherer Betrachtung stellte Egill jedoch fest, dass die Runen nicht korrekt ausgeführt worden waren. Er schabte die Runen ins Feuer, um sie unschädlich zu machen, und ließ das Bettzeug der Patientin lüften. Dann ritzte er neue Runen ein und schob diese dem Mädchen unter das Kopfkissen. Bald darauf war sie wieder gesund geworden.
Auf dem Fußboden lodert ein Feuer, über dem die Heilerin nun Wasser erhitzt, um die Wunden der Verletzten damit zu reinigen. Thormod beschließt, sich neben der Tür niederzulassen, wo er beobachten kann, wie andere Menschen ein- und ausgehen, um sich um die Verwundeten zu kümmern. Einer von ihnen bemerkt, wie blass Thormod ist, und fragt ihn, warum er die Heilerin nicht um Hilfe bittet. Thormod antwortet in Versen, er sei von einem Pfeil getroffen worden, und steht auf, um sich am Feuer zu wärmen. Kurz darauf bittet die Heilerin Thormod, nach draußen zu gehen und ihr etwas Feuerholz zu bringen, damit sie noch mehr Wasser heiß machen kann. Sie weiß nicht, wie schwer verwundet Thormod ist. Thormod tut dennoch, was ihm aufgetragen wurde. Als er zurückkommt, fällt auch ihr sein bleiches Gesicht auf, und sie fragt ihn nach seiner Verwundung. Wieder antwortet Thormod in Versen und versucht, ihr klarzumachen, dass ein Pfeil ihn nahe am Herzen getroffen hat:
Die Frau fragt, was dem Krieger
widerfahren ist.
Nur wenige werden von Wunden so blass;
die Pfeile haben mich getroffen.
Das eiskalte Eisen, Frau,
fuhr in meinen Leib.
Dicht bei meinem Herzen, so glaube ich,
traf mich die elende Waffe.
Die Frau will nun Thormods Verletzungen sehen, und er zieht seine Kleider aus, damit sie die klaffende Wunde in seiner Flanke gründlich untersuchen kann. Beunruhigt stellt sie fest, dass Metall darin steckt. Um nachvollziehen zu können, auf welchem Weg der Pfeil eingedrungen ist, macht sie sich rasch daran, eine Art »Test-Mahlzeit« zusammenzubrauen: In einem Steinkessel zerreibt sie Lauch und verschiedene Kräuter und kocht alles zusammen auf. Thormod weiß nicht, welche Kräuter sie verwendet, nimmt aber an, dass es eine Mischung aus Beifuß (Wegerich), Brunnenkresse, Kamille, Brennnessel, Holzapfel, Kerbel und Fenchel ist.
Diese Mischung bereiteten Heilerinnen häufig zu, um sie Verwundeten zu verabreichen. Auf diese Weise konnten sie feststellen, ob lebenswichtige Organe verletzt waren, denn der Geruch von Lauch und Kräutern konnte durch eine Wunde dringen, die in eine Körperhöhle hineinreichte. Das Wissen über diese Methode wurde von Großmüttern und Müttern an ihre Töchter weitergegeben.
Als sie Thormod etwas von dem Gebräu geben will, weigert er sich rundheraus und sagt, er brauche keine Schonkost. Er begreift, dass sie seine isländischen Verse wahrscheinlich nicht verstanden hat, denn er ist sich sicher, dass sein Herz getroffen wurde und nicht sein Magen. Der Skalde besteht darauf, dass die Heilerin ihm die Pfeilspitze mit einer Zange herauszieht, doch das Metall steckt fest und bewegt sich nicht von der Stelle. Das herausragende Stück der Pfeilspitze ist kaum zu sehen, weil die Wunde so stark geschwollen ist. Thormod bittet die Heilerin, einen Schnitt zu setzen, um besser mit der Zange an das Metall heranzukommen, doch sie hat damit keine Erfahrung und traut sich einen solchen Eingriff nicht zu.
Armreif aus der Wikingerzeit, wie ihn Thormod getragen haben könnte.
Thormod versteht, dass sie zumindest versucht, ihm zu helfen. Er rechnet ihr das hoch an und möchte sich erkenntlich zeigen, daher überlässt er ihr seinen goldenen Armreif – das einzig Wertvolle, das er bei sich hat – und sagt ihr, sie könne damit machen, was sie wolle. Die Heilerin ist ihm sehr dankbar, denn obwohl sie nicht reich ist und zu Hause eine große Familie zu versorgen hat, ist sie es nicht gewohnt, für ihre Dienste einen Lohn zu empfangen. Thormod, den plötzlich ein Gefühl großer Ruhe überkommt, nimmt die Zange selbst in die Hand und zieht mit einem Ruck die Pfeilspitze heraus. Er sieht, dass an ihren Stacheln Fasern seines Herzens hängen – manche sind rot, manche weiß, Letzteres, so stellt Thormod fest, ein Zeichen dafür, dass König Olaf seine Männer gut verköstigt habe, denn immer noch sei Fett an seinem Herzen. Ausgesöhnt mit der Unausweichlichkeit seines Schicksals lehnt sich Thormod zurück, und einen Augenblick später ist er tot.
Thormod würde nie erfahren, dass diese Schlacht, die Schlacht von Stiklestad vom 29. Juli 1030, einmal die berühmteste Landschlacht im Norwegen der Wikingerzeit sein würde. Auch konnte er nicht wissen, dass seine Strophen über seinen Tod hinaus weiterleben würden, weil zwei Jahrhunderte später der Geschichtsschreiber Snorri Sturluson einige von ihnen in seine Erzählung über die Schlacht von Stiklestad aufnehmen würde, die er in seinem bekannten Werk Heimskringla beschreibt.
Die neunte Stunde der Nacht
(02.00 – 03.00 Uhr)
Eine Frau bringt ein Kind zur Welt
Signy Valbrandsdottir liegt auf einem Lager aus Stroh auf dem Fußboden eines kleinen Nebengebäudes auf ihrem Hof in Reykjadal. Die Wehen haben ihre Sinne so verwirrt, dass sie nicht mehr weiß, ob sie sich im Stall oder in der Scheune befindet. Sie nimmt allerdings wahr, dass sie von mehreren Frauen umringt ist, sämtlich Mägde, darunter auch zwei von ihrem Hof. In Signy regt sich das Verlangen, nach ihrer Ziehmutter Thordis zu rufen, einer kundigen und patenten Frau. Die beiden haben sich von jeher nahegestanden. Unglücklicherweise ist Thordis vor wenigen Monaten gestorben, urplötzlich und ohne erkennbaren Grund. Doch jetzt nähert sich eine freundliche ältere Frau, die Signy für die Hebamme des Ortes hält. Die Frau drückt an verschiedenen Stellen auf Signys Bauch, um sich zu vergewissern, dass das Kind sich so weit gesenkt hat, dass sie mit einer inneren Untersuchung beginnen kann. Vorsichtig dringt sie mit ihrer Hand in Signys Scheide ein und versichert der Gebärenden, dass der Muttermund vollständig geöffnet sei, dass sie das Köpfchen des Babys fühlen könne und dass es sich trotz der starken Rückenschmerzen nicht um eine Steißlage handele.
»Das Kind wird sehr bald da sein«, sagt sie. »Du musst pressen und bei jeder Wehe tief atmen.«
Durch das kontrollierte Atmen kann Signy ihre Schmerzen etwas lindern. Eine der Frauen kühlt ihr die Stirn mit einem feuchten Tuch, das sie von Zeit zu Zeit in einen kleinen Kessel mit kaltem Wasser tunkt. Eine andere hält ihr die Hand, die Signy bei jeder erneuten Wehe zur Faust ballt. Die werdende Mutter presst und presst, doch das Kind will nicht kommen. Schon fürchtet sie, es könnte zu groß sein, da sie eigentlich schon vor einigen Wochen hätte gebären sollen.
»Hör auf zu pressen«, befiehlt die Hebamme plötzlich.
»Ich kann nicht aufhören«, jammert Signy. »Ich kann nicht.«





























