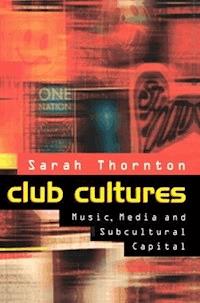14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
WAS IST EIN KÜNSTLER? – Ein einzigartiger Blick hinter die Kulissen der Kunstwelt Was bedeutet es heute ein Künstler zu sein? Ist man mehr Unternehmer oder Unterhalter? Und wie bleibt man authentisch? Die Kunstexpertin und Soziologin Sarah Thornton nimmt uns mit zu den Superstars der internationalen Kunstszene – wie z.B. Ai Weiwei, Jeff Koons, Marina Abramovic – sowie zu den »rising stars«. In drei Akten – Politik, Verwandtschaft und Handwerk – begibt sie sich in die Welt von 33 Künstlern: sie blickt nicht nur in deren Ateliers, sondern auch in Wohnzimmer und auf Bankkonten. Sie führt Hunderte von Gesprächen, ist dabei, wenn Ideen entstehen und große Werke Gestalt annehmen. Mit scharfem Blick analysiert sie die vielfältigen Antworten auf die Frage: Was ist ein Künstler? Mit Jeff Koons, Ai Weiwei, Gabriel Orozco, Eugenio Dittborn, Lu Qing, Zeng Fanzhi, Wangechi Mutu, Kutlug Ataman, Tammy Rae Carland, Larry Gagosian, Martha Rosler, Elmgreen and Dragset, Maurizio Cattelan, Laurie Simmons, Carroll Dunham, Francis Alÿs, Cindy Sherman, Jennifer Dalton, William Powhida, Francesco Bonami, Massimiliano Gioni, Rashid Johnson, Damien Hirst, Andrea Fraser, Christian Marclay, Marina Abramovic, Grayson Perry, Yayoi Kusama, Cady Noland, Beatriz Milhazes und Isaac Julien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Sarah Thornton
33 Künstler in 3 Akten
Über dieses Buch
WAS IST EIN KÜNSTLER? – Ein einzigartiger Blick hinter die Kulissen der Kunstwelt
Was bedeutet es heute ein Künstler zu sein? Ist man mehr Unternehmer oder Unterhalter? Und wie bleibt man authentisch? Die Kunstexpertin und Soziologin Sarah Thornton nimmt uns mit zu den Superstars der internationalen Kunstszene – wie z.B. Ai Weiwei, Jeff Koons, Marina Abramovic – sowie zu den »rising stars«. In drei Akten – Politik, Verwandtschaft und Handwerk – begibt sie sich in die Welt von 33 Künstlern: sie blickt nicht nur in deren Ateliers, sondern auch in Wohnzimmer und auf Bankkonten. Sie führt Hunderte von Gesprächen, ist dabei, wenn Ideen entstehen und große Werke Gestalt annehmen. Mit scharfem Blick analysiert sie die vielfältigen Antworten auf die Frage: Was ist ein Künstler?
Mit Jeff Koons, Ai Weiwei, Gabriel Orozco, Eugenio Dittborn, Lu Qing, Zeng Fanzhi, Wangechi Mutu, Kutlug Ataman, Tammy Rae Carland, Larry Gagosian, Martha Rosler, Elmgreen and Dragset, Maurizio Cattelan, Laurie Simmons, Carroll Dunham, Francis Alÿs, Cindy Sherman, Jennifer Dalton, William Powhida, Francesco Bonami, Massimiliano Gioni, Rashid Johnson, Damien Hirst, Andrea Fraser, Christian Marclay, Marina Abramovic, Grayson Perry, Yayoi Kusama, Cady Noland, Beatriz Milhazes und Isaac Julien.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Sarah Thornton studierte Kunstgeschichte und Soziologie, promovierte über die britische Technoszene und lehrte Soziologie an der University of Sussex und am Goldsmith College. Heute ist sie Autorin für internationale Magazine, u.a. für den »Economist« und artforum.com, für den »New Yorker« sowie für zahlreiche weitere Zeitungen, wie z.B. die »Süddeutsche Zeitung«. Im S. Fischer Verlag ist von ihr die hochgelobte Reportage ›Sieben Tage in der Kunstwelt‹ erschienen.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: © Dario Cantatore / Corbis
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel
›33 Artists in 3 Acts‹
im Verlag Granta Publications, London
© 2014 Sarah Thornton
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403319-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für Otto und Cora
[Karte]
Einleitung
Akt I Politik
Szene 1 Jeff Koons
Szene 2 Ai Weiwei
Szene 3 Jeff Koons
Szene 4 Ai Weiwei
Szene 5 Gabriel Orozco
Szene 6 Eugenio Dittborn
Szene 7 Lu Qing
Szene 8 Zeng Fanzhi
Szene 9 Wangechi Mutu
Szene 10 Kutluğ Ataman
Szene 11 Tammy Rae Carland
Szene 12 Jeff Koons
Szene 13 Ai Weiwei
Szene 14 Ai Weiwei und Jeff Koons
Szene 15 Martha Rosler
Szene 16 Jeff Koons
Szene 17 Ai Weiwei
Akt II Partnerschaften
Szene 1 Elmgreen & Dragset
Szene 2 Maurizio Cattelan
Szene 3 Laurie Simmons
Szene 4 Carroll Dunham
Szene 5 Maurizio Cattelan
Szene 6 Carroll Dunham und Laurie Simmons
Szene 7 Francis Alÿs
Szene 8 Cindy Sherman
Szene 9 Jennifer Dalton und William Powhida
Szene 10 Francesco Bonami
Szene 11 Grace Dunham
Szene 12 Maurizio Cattelan
Szene 13 Lena Dunham
Szene 14 Cindy Sherman
Szene 15 Rashid Johnson
Szene 16 Carroll Dunham
Szene 17 Massimiliano Gioni
Szene 18 Laurie Simmons
Szene 19 Francesco Bonami, Maurizio Cattelan, Carroll Dunham, Elmgreen & Dragset, Massimiliano Gioni, Cindy Sherman und Laurie Simmons
Akt III Handwerk
Szene 1 Damien Hirst
Szene 2 Andrea Fraser
Szene 3 Jack Bankowsky
Szene 4 Christian Marclay
Szene 5 Marina Abramović
Szene 6 Andrea Fraser
Szene 7 Grayson Perry
Szene 8 Yayoi Kusama
Szene 9 Damien Hirst
Szene 10 Cady Noland
Szene 11 Gabriel Orozco
Szene 12 Beatriz Milhazes
Szene 13 Andrea Fraser
Szene 14 Isaac Julien
Szene 15 Damien Hirst
Szene 16 Andrea Fraser
Dank
Ausgewählte Bibliographie
Bildnachweise
Für Otto und Cora
Einleitung
Gabriel OrozcoHorses Running Endlessly1995
Ich glaube nicht an die Kunst. Ich glaube an den Künstler.
Marcel Duchamp
Künstler machen nicht nur Kunst. Sie schaffen und bewahren Mythen, die ihrem Werk Gewicht verleihen. Während sich die Maler des 19. Jahrhunderts mit dem Problem der Glaubwürdigkeit konfrontiert sahen, machte Marcel Duchamp, der Ahnherr der zeitgenössischen Kunst, den Glaubensakt zu einem zentralen künstlerischen Thema. 1917 erklärte er ein auf den Kopf gestelltes Urinal zum Kunstwerk und gab ihm den Titel Fountain. Damit reklamierte er für den Künstler die gottgleiche Macht, zur Kunst zu erklären, was immer er will. So schwer es ist, sich diese Autorität zu bewahren, so grundlegend ist sie heute für den Erfolg eines Künstlers. Wenn alles Kunst sein kann, gibt es keinen objektiven Maßstab für Qualität, und daher muss ein ambitionierter Künstler seine eigenen Qualitätsmaßstäbe definieren. Er benötigt dafür allerdings nicht nur ein immenses Selbstvertrauen, sondern auch Überzeugungskraft. Heutige Künstler sind wie konkurrierende Gottheiten, die sich durch die Art und Weise ihres Auftretens eine treue Anhängerschaft sichern.
Paradoxerweise ist Kunst eine handwerkliche Tätigkeit. Als Duchamp das Handgemachte zugunsten des Vorgefertigten, des »Readymade«, verwarf, begann er nicht nur Identitäten, sondern auch Ideen zu gestalten. In etlichen seiner Arbeiten spielte er mit seiner sozialen Rolle und präsentierte sich in Frauenkleidern als Rrose Sélavy oder auch als Schwindler und Hochstapler. Nicht nur die Größe und der Aufbau eines Werks, sondern auch das, was ein Künstler tut oder sagt, muss überzeugen – nicht nur andere, sondern auch den Künstler selbst. Ob er sich nun als schillernde, imposante oder als eher bescheidene, zurückhaltende Persönlichkeit präsentiert: glaubwürdige Künstler sind immer Hauptdarsteller, niemals Nebenfiguren oder Verkörperungen stereotyper Charaktere. Daher betrachte ich das Künstleratelier als eine private Bühne für die tägliche Erprobung des Glaubens an sich selbst. Dies ist einer der Gründe, warum ich 33 Künstler in drei »Akte« unterteilt habe.
Das Buch geht der Frage nach, was es heißt, heute ein professioneller Künstler zu sein, und untersucht die Art und Weise, wie Künstler in der Welt agieren und sich selbst darstellen. Im Laufe von vier Jahren und mehreren hunderttausend Flugmeilen habe ich hundertdreißig Künstler interviewt. Einige berühmte und viele reflektierte, interessante Künstler wurden bei der Endmontage herausgenommen. Und meine Kriterien entsprachen in vielerlei Hinsicht tatsächlich denen eines Kurators oder auch eines Casting-Direktors. Mit anderen Worten: Das Werk des Künstlers musste bedeutsam sein, aber auch seine Persönlichkeit musste Faszinationskraft besitzen. Gelegentlich hatten die Interviews etwas von einem Vorsprechen für eine Filmrolle. Einem bekannten Fotografen zum Beispiel, der stets Wert darauf legte, als Künstler zu gelten, stellte ich die Kernfrage, die mich bei allen meinen Recherchen geleitet hat: »Was ist ein Künstler?« Er antwortete: »Ein Künstler macht Kunst.« Ich hätte am liebsten gerufen: »Der Nächste bitte!«, um einen neuen Bewerber aus der langen Reihe der wartenden Künstler-Persönlichkeiten hereinzubitten. Seine tautologische Argumentation war nicht zielführend. Sie demonstrierte vielmehr, dass die Kunstwelt, obwohl augenscheinlich ganz auf Dialog ausgerichtet, heiklen Fragen gern ausweicht und sich in ein Verwirrspiel flüchtet, wenn es opportun erscheint.
33 Künstler in 3 Akten bevorzugt Künstler, die aufgeschlossen, redegewandt und ehrlich sind – was nicht bedeutet, dass Unaufrichtigkeit in diesem Buch überhaupt nicht vorkommt. Um einen Kontrast und ein Element der befreienden Komik zu erzeugen, enthält es vielmehr durchaus zweifelhafte Statements. Manchmal stelle ich solche Äußerungen in Frage, manchmal bleiben sie unkommentiert, und ich überlasse es dem Leser, sich selbst ein Urteil zu bilden. Nachdem Gabriel Orozco, der einzige Künstler, der in zwei verschiedenen Akten vorkommt, das Manuskript gelesen hatte, sagte er: »Wir stehen alle in der Unterhose da. Aber zumindest einige von uns haben es geschafft, ihre Socken anzubehalten.«
Die Künstler in diesem Buch stammen aus vierzehn Ländern und fünf Kontinenten. Die meisten sind in den fünfziger und sechziger Jahren geboren. Um ein möglichst breites Feld abzudecken, betrachte ich Künstler, die sich in dem nachfolgend genannten Spektrum der Extreme an unterschiedlichen Punkten positionieren: als Entertainer oder Wissenschaftler, Materialist oder Idealist, Narzisst oder Altruist, Einzelgänger oder Teamworker. Die meisten hier vorgestellten Künstler genießen irgendwo auf der Welt große Anerkennung, dennoch enthält jeder Akt eine Szene mit einem Künstler, der eine Lehrtätigkeit ausübt und – wie die meisten seiner Kollegen – nicht vom Verkauf seiner Werke leben kann.
Die Themenschwerpunkte dieser drei Akte haben meine Auswahl der Künstler entscheidend beeinflusst. Politik, Partnerschaften und Handwerk sind Kriterien, die scheinbar in eine klassische anthropologische Studie gehören und für die Kunstkritik und die Kunstgeschichte eher untypisch sind. Im Zuge meiner Recherchen habe ich jedoch entdeckt, dass sie die ideologische Grenze markieren, die einen Künstler von einem Nichtkünstler beziehungsweise einen »echten« von einem weniger beeindruckenden Künstler trennt. Politik, Partnerschaften und Handwerk verweisen zugleich auf wichtige Dinge im Leben: die Möglichkeit, Einfluss auf das Weltgeschehen zu nehmen, sich auf sinnvolle Weise mit anderen auszutauschen sowie hart zu arbeiten, um etwas Bedeutsames zu schaffen. »Akt I: Politik« erkundet die ethischen Maßstäbe von Künstlern, ihre Einstellung zu Macht und Verantwortung unter besonderer Berücksichtigung der Themen Menschenrechte und Meinungsfreiheit. »Akt II: Partnerschaften« untersucht die Beziehung der Künstler zu ihren Kollegen, Musen und Förderern; hier liegt der Schwerpunkt auf Konkurrenz, Zusammenarbeit und letztlich Liebe. In »Akt III: Handwerk« geht es um die Fertigkeiten der Künstler und um sämtliche Aspekte der Herstellung eines Kunstwerks: von der Konzeption über die Ausführung bis zu Vermarktungsstrategien. Selbstverständlich ist das »Werk« eines Künstlers nicht das einzelne Objekt, sondern die Art und Weise, wie der Künstler sein Spiel inszeniert.
33 Künstler in 3 Akten ist auch insofern unkonventionell, als es Künstler miteinander vergleicht und einander gegenüberstellt. Die meisten Publikationen über Künstler sind Monographien, und wenn mehrere Künstler in einem Band behandelt werden, dann in unzusammenhängenden Porträts. Selbst wenn Künstler in Gruppenausstellungen auf spannende Art und Weise zusammengewürfelt werden, stellen die Aufsätze des Katalogs die Werke, nicht deren Schöpfer einander gegenüber. Dabei macht die Kunstwelt nichts lieber, als ein »Genie« zu entdecken.
Jeder Akt dieses Buches dreht sich um mehrfach auftretende Akteure, die sich deutlich voneinander abheben. In Akt I wird Ai Weiwei Jeff Koons und in Akt III die Performancekünstlerin Andrea Fraser Damien Hirst gegenübergestellt. Partnerschaften, das Thema von Akt II, verweist eher auf Gruppen als auf Paare. Es tritt eine ganze Kleinfamilie auf: Laurie Simmons (eine Fotografin) und Carroll Dunham (ein Maler) und ihre gemeinsamen Töchter Lena (Autorin, Regisseurin und Darstellerin der TV-Comedy-Serie Girls) und Grace (Studentin an der Brown University). Ihre Szenen sind denen von Maurizio Cattelan (einem Junggesellen im Sinne von Duchamp) und seinen Komplizen, den Kuratoren Francesco Bonami und Massimiliano Gioni, gegenübergestellt. Diese wiederum werden mehrfach in Relation zu Cindy Sherman gesetzt, die von Laurie Simmons einmal gesagt hat, sie sei ihre »künstlerische Seelenverwandte«.
Mein Buch Sieben Tage in der Kunstwelt war eine Chronik der aufregenden Jahre zwischen 2004 und 2007, 33 Künstler in 3 Akten ist eine Momentaufnahme der jüngsten Vergangenheit. Alle drei Akte beginnen im Sommer 2009 und entwickeln sich chronologisch bis 2013, als ich das Buch schrieb.
Der Status des Künstlers hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Künstler gelten heute nicht mehr als ewig kämpfende Außenseiter und arme Schlucker, sondern sind für Modedesigner, Popstars und sogar Köche ein Vorbild und der Inbegriff unerreichter Kreativität. Mit ihrer Fähigkeit, für ihre Arbeiten und Ideen einen Markt zu schaffen, inspirieren sie Unternehmer, Erfinder und Führungspersönlichkeiten aus allen möglichen Bereichen. Künstler ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Identität, die sich aus einem breiten Spektrum von Fähigkeiten zusammensetzt.
33 Künstler in 3 Akten möchte ein lebendiges und vielschichtiges Bild jener Berufsgruppe vermitteln, die von einer breiten Öffentlichkeit als die Verkörperung ultimativer Individualität und beneidenswerter Freiheit wahrgenommen wird. Einige meiner Freunde aus der Kunstszene meinten, Künstler seien derart einzigartig, dass es irreführend – um nicht zu sagen, respektlos – wäre, sie als Gruppe zu definieren und über sie als Gruppe zu schreiben. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Leser die zahlreichen Parallelen zwischen Künstlern erkennen werden, die heute als unvergleichbar wahrgenommen werden.
Akt IPolitik
Szene 1Jeff Koons
Jeff KoonsMade in Heaven1989
An einem schwülheißen Juliabend des Jahres 2009 betritt Jeff Koons die Bühne eines vollbesetzten Saals im Londoner Victoria & Albert Museum. Die Zuhörer – Kunststudenten in ironisch beschrifteten T-Shirts und Rentner in bequemen Schuhen – begrüßen ihn mit lautstarkem Beifall. Der Künstler, glattrasiert und leicht sonnengebräunt, trägt einen schwarzen Anzug von Gucci mit weißem Hemd und dunkler Krawatte. Zwanzig Jahre zuvor enttäuschte Koons die Erwartungen der New Yorker Kunstszene, als er im maßgeschneiderten Anzug auftrat statt in Jeans und Lederjacke, was damals die Norm war. Künstler trugen zwar keine Uniform, aber es gab eine feste Regel: Versuche, nicht wie ein Geschäftsmann auszusehen.
»Es ist eine große Ehre für mich, hier zu sein«, sagt Koons in ein Kugelkopfmikrophon. »Letztes Jahr hatte ich eine Ausstellung in Versailles und weitere Ausstellungen im Metropolitan Museum in New York, in der Neuen Nationalgalerie Berlin und im Museum of Contemporary Art in Chicago.« Wenn Künstler Reden halten, ist es oft ein Werben um Anerkennung, und es ist durchaus üblich, dass man die neuesten Glanzlichter seiner Karriere herausstreicht. »Nach diesem Programm ist die Serpentine Gallery der absolut perfekte Ort. Es war eine aufregende Erfahrung. Ich bin sehr dankbar«, erklärt er wie ein Rockstar, der auf jeder Station seiner Konzerttournee etwas Nettes zu sagen hat.[1]
»Ich fange am besten damit an, dass ich über meinen Werdegang spreche«, sagt Koons und beginnt mit seiner Diashow. Auf der großen Leinwand erscheint Dolphin (2002), eine Skulptur, die aussieht wie ein aufblasbares Spielzeug für den Swimmingpool und an gelben Ketten über einem Gestell aus Edelstahltöpfen und -pfannen hängt. Der Meeressäuger aus bemaltem Aluminium ist ein exaktes Replikat des Gummispielzeugs, aber die Ketten und die Küchengeräte sind »Readymades« – gekaufte Massenware, die in das Werk integriert ist. Koons erzählt, dass er 1955 in Pennsylvania geboren ist, dann deutet er auf eine der hinteren Saalreihen; dort sitzt seine Mutter Gloria, die viele seiner Kunstevents besucht. Augenblicke später beschreibt er Dolphin als »mütterliche Venus« mit Luftventilen wie »zwei kleine Brustwarzen«.
Koons spricht frei. Er erzählt von seinem Vater Henry, einem Innenarchitekten und Inhaber eines Möbelgeschäfts, und sagt, er sei also mit einem »Sinn für Ästhetik« aufgewachsen. Er habe schon als Kind erkannt, dass die Farben golden und türkisblau »andere Gefühle wecken« als braun und schwarz. Seine große Schwester Karen war in allem besser. Eines Tages machte Koons eine Zeichnung, in der seine Eltern ein gewisses Talent erkannten. »Das Lob gab mir Selbstbewusstsein«, sagt er. Es heißt, ein echter Künstler könne nichts anderes als Kunst machen. Koons’ Version dieser abgedroschenen Phrase lautet, dass Kunst der einzige Bereich war, in dem er sich als konkurrenzfähig erwies.
Der Künstler benennt weitere Schlüsselerlebnisse seiner Entwicklung. Kurz nach Beginn seines Studiums an der Kunstakademie besuchte seine Klasse das Museum of Art in Baltimore, dessen ausgestellte Künstler ihm zum größten Teil unbekannt waren. »Ich merkte, dass ich von Kunst keine Ahnung hatte«, sagt er, »aber ich habe es überlebt.« Für die Kunst, die er mache, brauche man »keine Voraussetzungen«. Die Menschen sollen sich nicht unbedeutend vorkommen, meint Koons, vielmehr müsse »der Betrachter das Gefühl haben, dass sein kultureller Hintergrund absolut perfekt ist«. Koons lächelt glückselig, dann zeigt er »Banality«, seine siebte Serie, die er 1988 begann. Diese Skulpturen aus bemaltem Holz und Porzellan – Teddybären, aufeinandergestapelte Tiere vom Bauernhof, der rosarote Panther und Michael Jackson – führten die Pop Art in die süßlichen Niederungen von Nippesfiguren. Die Kitschobjekte entstanden in dreifacher Auflage und konnten daher gleichzeitig in identischen Ausstellungen in New York, Chicago und Köln gezeigt werden.
Mit der Werkgruppe »Banality« verabschiedete sich Koons noch in einem anderen Sinn von den Normen der Kunstwelt. Er trat in Reklameanzeigen auf, die für seine Ausstellungen warben und sein Bild in der Öffentlichkeit nachhaltig prägten. Sie machten ihn in der Subkultur bekannt und begründeten seinen Ruhm. Koons konzipierte vier verschiedene Anzeigen für die damals wichtigsten Kunstzeitschriften. Im eher akademisch geprägten Artforum präsentierte er sich als Grundschullehrer mit Slogans wie »Beutet die Massen aus« und »Banalität als Rettung« auf der Kreidetafel hinter ihm. Für Art in America posierte er als etwas entkräfteter geiler Hengst neben zwei drallen Bikini-Schönen und in Art News als siegessicherer Playboy im Bademantel, umgeben von Blumenkränzen. Für die europäische Zeitschrift Flash Art schließlich ließ er sich in selbsterniedrigender Pose neben einer riesigen Sau und ihrem Ferkel ablichten. Koons’ Ausflug in die Werbung war wagemutig, aber nicht völlig neu. Die Anzeigen erinnerten vielmehr an eine Kampagne des schwulen Konzeptkunst-Trios General Idea, das sich als frisch aufgewachte Babys nebeneinander im Bett liegend und als schwarzäugige Pudel präsentiert hatte. General Idea und Koons spielten beide mit der Erwartung, dass Künstler Muster an Aufrichtigkeit seien, die Werbung dagegen eine Bastion windiger Meinungsmacher. Sie stellten die offizielle Position der Kunstwelt in Frage, das Werk sei wichtiger als der Künstler, und spielten mit der Gefahr, die eigene Glaubwürdigkeit durch rücksichtslose Selbstvermarktung zu zerstören.
Im Vortragssaal ist es so heiß, dass sich die Zuhörer mit Zeitungen, Notizheften und sogar Flipflops Luft zufächeln. Koons, der seine Krawatte nicht gelockert hat und eher glänzt als schwitzt, spielt ein neues Dia ein, das ihn nackt mit Ilona Staller alias La Cicciolina zeigt, einer Pornodarstellerin, mit der er kurzzeitig verheiratet war. Koons schuf dieses Werk 1989 für die Ausstellung »Image World: Art and Media Culture« im Whitney Museum of American Art, New York. Ursprünglich als Billboard an der Madison Avenue aufgehängt, ist es eine Reklame für einen fiktiven Film namens Made in Heaven mit Jeff Koons und La Cicciolina in den Hauptrollen. Es ist der erste Teil einer gleichnamigen Serie, zu der Skulpturen wie Dirty – Jeff on Top (1991) und Gemälde wie Ilona’s Asshole (1991) gehören. Trat die Geliebte eines Künstlers lange Zeit nur als liegender Akt in Erscheinung, so war Koons’ Darstellung des Liebesakts mit dem Mann obenauf etwas Neuartiges. »Der einfachste Weg, ein Filmstar zu werden, ist der Pornofilm«, sagte Koons später zu mir. »Es war meine Vorstellung einer Teilhabe an der amerikanischen Popkultur.«
Während Koons ein paar Dias der Serie »Made in Heaven« zeigt, erörtert er weder den Exhibitionismus der Bilder noch sinniert er über deren Einfluss auf seine Karriere. Vielmehr kommt er erneut auf sein Lieblingsthema zu sprechen, die Akzeptanz. »Meine Exfrau Ilona kam von der Pornographie, aber alles an ihr war absolut perfekt. Es war eine wunderbare Plattform für Transzendenz«, sagt er und streicht sich mit dem Zeigefinger über die Lippen. »Mir ging es darum zu vermitteln, wie wichtig es ist, die eigene Sexualität anzunehmen, ganz ohne Schuld und Scham.«
Koons kommt zur Serie »Popeye«, an der er seit 2002 arbeitet und deren Ausstellung in der Serpentine Gallery der Anlass für diesen Auftritt ist. Er betrachtet die »Popeye«-Arbeiten als »etwas eher Intimes« für das eigene Heim. Viele dieser Skulpturen sehen aus wie aufgeblasene Gummispielsachen. Als Kind hatte er eine Schwimmhilfe aus Styropor, so dass er sich selbständig über Wasser halten konnte. Das habe »etwas Befreiendes« für ihn gehabt, bekennt er. Er bewundert Gummitiere als lebensrettende Vorrichtungen, die »ein Gefühl des Gleichgewichts« schaffen. Für Koons haben sie auch etwas Anthropomorphes. »Wir sind aufblasbar«, sagt er mit leuchtenden Augen. »Wir holen Luft, und das ist ein Symbol des Optimismus. Wir atmen aus, und das ist ein Symbol des Todes.« Auch die erotische Komponente – das Anschwellen der Geschlechtsorgane bei der sexuellen Erregung – lässt er nicht unerwähnt. Die Zuhörer kichern. »Im Internet spielen Gummitiere als sexueller Fetisch eine wichtige Rolle.« Es sei immer ein wenig tragisch, scherzt er, wenn sie »wegen einer undichten Stelle erschlaffen«.
Bei jeder Arbeit der Serie benennt Koons, was ihn daran amüsiert. Dabei gibt es zwei Hauptkategorien: kunsthistorische Bezüge auf bedeutende moderne Künstler und Anspielungen auf Geschlechtsteile und Positionen beim Sex. Mit der bescheiden warnenden Bemerkung, er hoffe nicht, dass sich »der Betrachter in all meinen persönlichen Bezügen verliert«, verweist der Künstler auf Verbindungen zwischen seinen Arbeiten und Salvador Dalí, Paul Cézanne, Marcel Duchamp, Francis Picabia, Joan Miró, Alexander Calder, Robert Smithson, Donald Judd, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, James Rosenquist und Andy Warhol. Koons erwähnt auch Jim Nutt und Ed Paschke, mit denen er am Art Institute of Chicago studiert hatte. »Ed hat mich in Tattoostudios und Stripperbars mitgenommen«, sagt er, »und mir sein Quellenmaterial gezeigt.«
Parallel zur Chronik seiner künstlerischen Verwandtschaften deutet er freudianische Interpretationen an. Seine Lieblingsadjektive sind »weiblich« und »männlich«, »erigiert« und »erschlafft«, »feucht« und »trocken«. Wenn er eine Arbeit in zwei Versionen gestaltet, sagt er, es seien »zwei Positionen«. Die Formen seiner Skulpturen und Gemälde erinnern ihn an »Vaginallippen«, »Geschlechtsverkehr«, »gespreizte Beine«, »Kastration«, »ein Loch«, »einen Schoß« und »den Beckenbereich«. Selbstverständlich sind viele seiner aufblasbaren Objekte »penetriert«. Wunderbarerweise sagt der Künstler all dies in einem nüchtern sachlichen Ton und so naiv und gesittet, dass es kein bisschen anstößig wirkt.
Koons spult seinen Vortrag gekonnt ab wie ein Schauspieler, der in die Rolle des Künstlers geschlüpft ist. Der Mangel an Spontaneität wirkt synthetisch und aufgesetzt, nicht natürlich und aufrichtig. Andy Warhol kultivierte bekanntlich ein ausdrucksloses öffentliches Image. Er gab sich kühl und einsilbig und vermittelte den Eindruck, es existiere kein »wirklicher« Andy. »Ich glaube, wenn ich in den Spiegel schaue, werde ich nichts sehen«, schrieb er in Die Philosophie des Andy Warhol. »Man nennt mich immer einen Spiegel, und wenn ein Spiegel in einen Spiegel sieht, was ist dann zu sehen?« Nur wenige Künstler beherrschen das Warhol’sche Paradox der öffentlichen Selbstinszenierung so überzeugend wie Koons.
Mit der Fernbedienung auf den Bildschirm zielend, präsentiert Koons seine letzten Dias, darunter Sling Hook (2007–09), die Aluminiumskulptur zweier aufblasbarer Meerestiere – eines Delphins und eines Hummers –, die kopfüber an einer Kette baumeln. Entweder wurden sie geschlachtet, oder sie haben Spaß an Fesselspielen. »Ich stelle mir gern vor, dass sich im letzten Augenblick des Lebens alles klärt«, sagt Koons mit gleichförmiger, fast beruhigender Stimme. »Die Angst verschwindet, und an ihre Stelle treten Vision und Mission.« Der Künstler spricht oft von Versagensängsten. Manchmal scheint er sich auf das künstlerische Schaffen zu beziehen, manchmal auf die Sexualität. »Akzeptanz lässt die Angst verschwinden und macht alles möglich«, sagt Koons. »In der Kunst geht es für mich immer um Akzeptanz.«
Fußnoten
[1]
Die Serpentine Gallery zeigt eine Ausstellung von Jeff Koons’ »Popeye«-Serie. Da jedoch das Museum keinen eigenen Vortragsraum hat, weicht es in einen Saal des Victoria & Albert Museum aus, nur wenige Gehminuten entfernt.
Szene 2Ai Weiwei
Ai WeiweiDropping a Han Dynasty Urn1995
Ai Weiwei ist nicht bereit, den Status quo zu akzeptieren. Ein paar Wochen nach Koons’ Auftritt demonstriert er an der Akademie der Sozialwissenschaften in Shanghai seine Verachtung der Akzeptanz. Wenn Koons höflich ist, ist Ai grob. Wenn der Amerikaner sich resolut auf das Kunstwerk konzentriert und alles Politische ausklammert, lenkt der Chinese die Aufmerksamkeit immer wieder von seinem Werk auf dessen ethischen Kontext. Geboren 1957, ist Ai fast genauso alt wie Koons. Die beiden Künstler teilen zwar die Bewunderung für Duchamp und verstehen es, die Massenmedien für sich zu nutzen, aber ihre Reaktion auf die Macht fällt sehr unterschiedlich aus.
Ai sitzt auf einem Podium hinter einem Tisch. Seinen beachtlichen Bauch verdeckt ein pinkfarbenes T-Shirt. Er trägt ein locker sitzendes schwarzes Jackett und eine blaue Baumwollhose. Sein zotteliger, graumelierter Bart verleiht ihm die Aura eines Weisen. Bärte sind in China eher unüblich und werden mit Konfuzius oder auch mit Fidel Castro assoziiert.
»Ai Weiwei hat viele Kunstwerke geschaffen«, sagt Ackbar Abbas, Professor an der University of California in Irvine, der die Veranstaltung im Rahmen einer Tagung zum Thema »Designing China« leitet. Das Publikum besteht zur Hälfte aus Chinesen, der Rest sind Wissenschaftler aus Europa und amerikanische Doktoranden. »Weiwei war Berater beim Bau des Vogelnest-Olympiastadions in Peking und hat in Caochangdi bei Peking ein Künstlerdorf errichtet, wo ihn seine Freunde und manchmal auch die Polizei besuchen«, sagt er in seiner Einführung. Ai macht ein paar Fotos von Abbas und den vor ihm sitzenden Zuhörern. »Ich habe keine Ahnung, worüber er heute sprechen wird«, sagt der Professor. »Aber wir hoffen, er spricht über Ai Weiwei.«
Der Künstler schaut den Mann neben sich an, der für ihn übersetzen wird. Der Harvard-Absolvent und Kurator Philip Tinari, ein Hipster mit dickrandiger Brille, hat seine Finger auf der Tastatur seines MacBook Air, in das er eingibt, was der Künstler sagt, um es dann auf Englisch zu übermitteln. »Guten Morgen allerseits«, sagt Ai auf Chinesisch. »Ich habe keine Rede vorbereitet, weil ich nicht wusste, was das Thema ›Designing China‹ bedeutet. Ich fand, dass man genauso gut ›Fucking China‹ sagen könnte.« Die Zuhörer kichern nervös. Ai ist bekannt für seine Kritik an der menschenfeindlichen chinesischen Stadtplanung. Als Ai mit seinem Statement fertig ist, lehnt er sich zurück, verschränkt die Arme und wartet darauf, dass seine Sätze ins Englische übersetzt werden. »Immer wenn ich nach Shanghai komme, weiß ich wieder, warum ich es so hasse«, fährt der in Peking lebende Künstler fort. Die überflüssig anmutende Invektive steht im Raum. »Shanghai hält sich für offen und international, tatsächlich aber herrscht hier immer noch eine sehr feudale Mentalität.«
Ai verweist auf einen Fall von Menschenrechtsverletzung, über den er in mehreren Blogbeiträgen geschrieben hat, dann spricht er davon, wie er selbst von der Polizei in Sichuan misshandelt wurde. Eine Woche zuvor war Ai nach Chengdu gereist, die Hauptstadt der Provinz Sichuan, um bei Tan Zuorens Prozess auszusagen, einem Aktivisten, dem subversive Machenschaften vorgeworfen wurden. Am Tag der Verhandlung um drei Uhr morgens, so erzählt Ai, »drang die Polizei in mein Hotelzimmer ein. Als ich ihre Dienstausweise sehen wollte, griffen sie mich brutal an.« Man brachte den Künstler in Untersuchungshaft und verhinderte damit seine Aussage vor Gericht. »Wir haben eine totalitäre Regierung, die mit monopolistischen Methoden operiert«, sagt Ai. »China mag hell und strahlend aussehen, doch in Wirklichkeit ist es wild und dunkel.«
Ai hat von den Schlägen eine riesige Beule am Kopf. Er weiß noch nicht, dass er eine Hirnblutung erlitten hat und operiert werden muss. Ich frage mich, ob das körperliche Unbehagen und die Brutalität der Polizei ihn nicht noch streitlustiger gemacht haben als sonst. Tinari, der oft für den Künstler dolmetscht und ihn gut kennt, sagt mir später, der Auftritt in einer offiziellen chinesischen Bildungseinrichtung habe Ais verdrießliche Stimmung noch verstärkt. »Das Einzige, was Weiwei noch mehr hasst als den Beamtenapparat«, meint er, »ist die akademische Welt.«
Der Künstler liest etwas auf seinem Nokia-Handy, dann hebt er den Kopf. »Wenn wir davon sprechen, China zu gestalten«, erklärt er, »müssen wir, glaube ich, mit der Frage einer grundlegenden Fairness, mit Menschenrechten und Freiheiten anfangen. Das sind Prinzipien, für die in China trotz seiner wirtschaftlichen Erfolge nach wie vor jedes Grundverständnis fehlt.« Nach zehn Minuten unterbricht sich Ai und sagt: »Am besten eröffnen wir jetzt die Diskussion und geben Ihnen Gelegenheit, Fragen zu stellen.« Der Künstler, der den Austausch liebt, beugt sich über den Tisch, als fordere er die Zuschauer zu einem Showdown heraus. Nach einer langen, verwirrten Stille folgt zaghafter Applaus.
Ai schockiert gern. Sein bekanntestes Selbstporträt, mit dem er seinen Übergang vom Antiquitätenhändler zum Künstler vollzog, trägt den Titel Dropping a Han Dynasty Urn (1995). Es besteht aus drei Schwarzweißfotos, auf denen er eine 2000 Jahre alte Urne in der Hand hält und dann loslässt, so dass sie am Boden zerschellt. Wer Kulturgüter wertschätzt, zuckt unweigerlich zusammen. Ai verzieht auf den Fotos keine Miene, doch es wäre falsch anzunehmen, dass der Künstler die Vergangenheit missachtet. Im Gegenteil, Ai hat großen Respekt für die Handwerkskunst, die während der Kulturrevolution der Vernichtung anheimgegeben wurde. In den neunziger Jahren lebte er vom An- und Verkauf von Antiquitäten und etablierte schließlich eine neue Kunstkategorie, die Tinari das »antike Readymade« nennt. Ai malte westliche Markenzeichen wie den Coca-Cola-Schriftzug auf antike Vasen und ließ von traditionellen Kunsthandwerkern alte Hocker und Tische zu surrealen, vielbeinigen Skulpturen zusammenbauen.
Der Applaus verebbt, und Abbas steht auf. »Weiwei hat einige Themen angesprochen, denen wir bisher ausgewichen sind. Betrachten wir diese Dinge einmal direkt«, sagt er auffordernd. Abbas, ein erfahrener Lehrer, macht den Eindruck, als könne er ein ergiebiges Seminar im Schlaf leiten. »Was hier passiert, ist weder gesetzeskonform noch unrechtmäßig. Alles ist quasi-rechtmäßig«, sagt er. Ai trinkt einen Schluck Wasser aus einer Plastikflasche, während Tinari sagt, der Künstler nehme Fragen gern auch auf Englisch entgegen. Ai versteht Englisch, denn er hat zwischen 1981 und 1993 zwölf Jahre lang in New York gelebt.
Schließlich fragt ein älterer Amerikaner in der ersten Reihe: »Was sollten Leute aus dem Westen in China machen?« Ai murmelt leise »hmmm«, dann sagt er: »Ich mache mir keine Illusionen über die westliche Demokratie … mein Ratschlag lautet daher: Schaut euch um, macht Fotos, esst gutes chinesisches Essen und erzählt euren Freunden, wie toll es war.« Ai verabscheut Überheblichkeit und macht gern Spaß; er ist auch als Denker liberal. Seine Antwort auf die nächste Frage lautet: »Wir haben keine Demokratie im Sinne von Wahlen, Meinungs- oder Pressefreiheit. Wenn ihr diese Probleme ignoriert, könnt ihr genauso gut einen Furz lassen.«
Eine Frau mit einem leichten deutschen Akzent sagt: »Sie haben eine negative, kritische Einstellung, eine umstrittene, schockierende Haltung des Fuck off, aber Sie sind ein Künstler. Könnten Sie über Ihre kreative, produktive Tätigkeit sprechen?«
Ai zuckt zusammen, dann tauscht er sich kurz mit Tinari auf Chinesisch aus. »Kritik zu üben und auf Probleme zu verweisen ist im chinesischen Kontext ein positiver, kreativer Akt«, übersetzt Tinari. »Man riskiert dabei sein Leben.« Er nennt drei Aktivisten – Chen Guangcheng, Tan Zuoren und Liu Xiaobo –, die verhaftet oder eingesperrt wurden, und fügt hinzu: »Wer glaubt, meine politischen Interventionen seien negativ oder bedeuten nur ›Fuck off‹, der liegt falsch … Ich habe viele Architektur- und Museumsprojekte realisiert, zuletzt im vergangenen Monat im Mori-Kunstmuseum in Tokio, und im Oktober findet eine Ausstellung im Haus der Kunst in München statt. Ich habe einen großen produktiven Output; allerdings reden wir heute über etwas anderes.«
Eine Frau mit kurzen Haaren und Brille gibt einen endlos langen, mit Jargonausdrücken gespickten Kommentar ab, will aber eigentlich nur wissen, in welcher Weise Ai Weiweis »künstlerische Interventionen« zu mehr sozialer Gerechtigkeit und zu den Menschenrechten beitragen. Der Künstler hat die Hände in den Hosentaschen. »Ich bin niemand, der seine eigenen Arbeiten erklärt«, sagt er. »Wenn es Sie interessiert, können Sie sie sich anschauen. Jedes einzelne Werk, das ich mache, steht in engem Zusammenhang mit meinen grundlegenden Überzeugungen, und wenn dies nicht zum Ausdruck kommt, ist es nicht wert, dass es gemacht wurde.«
Ai hätte leicht eine Vielzahl von Arbeiten mit demokratischem oder freiheitlichem Anspruch aufzählen können. 2007 zum Beispiel schuf er die Performance Fairytale, bei der 1001 Chinesen, die noch nie zuvor in Europa gewesen waren, zur documenta nach Kassel kamen. Eine gängige Definition zeitgenössischer Kunst lautet, sie lasse einen die Welt mit neuen Augen sehen. Nach zehn Jahren in den Vereinigten Staaten hat Ai erkannt, dass ein Besuch im Ausland das Bewusstsein erweitert. Die Performance Fairytale wurde begleitet von einer eindrucksvollen Installation mit 1001 Holzstühlen aus der Qing-Dynastie, einen Stuhl für jeden nach Deutschland gereisten Chinesen. Nach dem Ende der documenta gingen die Teilnehmer des Kunstwerks ihrer Wege, und die Stühle wurden überall verstreut. Fairytale war die erste Arbeit, die Ai übers Internet realisierte. Über seinen Blog rekrutierte er Freiwillige, die bereit waren, die Reise anzutreten. Gebeten, auf die einzelnen Etappen seiner Karriere zurückzublicken, sagt Ai nur, es gebe die Kunst, die er gemacht habe, bevor er das Internet entdeckt habe, und die Kunst, die er danach geschaffen habe.
Das Publikum scheint gespalten. Die einen finden Ai ärgerlich, die anderen lauschen ihm ehrfürchtig. Ein aus Asien stammender amerikanischer Student meint, Gegenwartskunst sei in China »ein Alibi für Freiheit«, und bittet Ai, etwas zur »dunklen Seite« der Kunstwelt zu sagen. Mit Blick auf die letzten zehn Jahre, erwidert der Künstler, müsse man konstatieren, dass in China der Kunstmarkt – nicht die Kunst – floriert. »Das ist es, was die Aufmerksamkeit des Westens geweckt hat«, sagt er. »Der Kunstmarkt ist wie der Aktienmarkt, nur kleiner, und damit kann er von einer sehr kleinen Gruppe von Leuten beherrscht werden.«
Ein Australier, der sich als einer der Organisatoren der Tagung vorstellt, bringt die letzte Frage an. »Ich begrüße Ihr vorbehaltloses Engagement für Grundsätzliches«, sagt er, und fragt dann, ob Ai nicht »auf perverse Weise für China nützlich« sei. Seit vergangenem Jahr, besonders seitdem Ai in seinem Blog politisch angriffslustiger wurde, fragen sich viele, warum er mit dieser unverblümten Kritik durchkommt. Als man ihm vorwarf, er sei nur deshalb so mutig, weil er amerikanischer Staatsbürger sei, stellte er seinen chinesischen Pass ins Netz. Andere sagten, er genieße die Protektion durch einen hohen Parteifunktionär. Der Künstler antwortete, falls er einen Freund an der Spitze habe, kenne er ihn nicht.
Sollte er einmal nützlich gewesen sein, sei er es jetzt offenkundig nicht mehr, erklärte Ai abschließend. Vor wenigen Monaten schalteten die chinesischen Behörden seinen Blog ab. Seither haben sie im Internet alle Spuren von ihm getilgt. Wenn man drei Buchstaben des Namens Ai Weiwei bei Baidu eingibt, dem chinesischen Pendant zu Google, taucht kein einziger Eintrag auf. Dasselbe gelte für andere Begriffe, sagt Wei. »Freiheit«, »Menschenrechte«, »Demokratie« und »Fuck« seien im chinesischen Internet gleichfalls unauffindbar.
Szene 3Jeff Koons
Jeff KoonsLandscape (Cherry Tree)2009
Die meisten Künstler in New York sorgen sich weniger um die Zensur als um ihr Image. Wenn man lange genug im Fokus der Öffentlichkeit stehe, klagt Jeff Koons, sei »das unausweichliche Schicksal die Verbrennung auf dem Scheiterhaufen«. Die Analogie zwischen dem Künstler und dem Heiligen, der wegen Hochverrat oder Häresie hingerichtet wird, wirkt etwas leichtfertig, aber Koons greift regelmäßig darauf zurück.
Seit 2001 befindet sich sein Atelier in Chelsea, ein paar Straßen von der Gagosian Gallery entfernt, die den Künstler vertritt. Von außen macht es fast den Eindruck einer Kunstgalerie. Die weiß getünchten Backsteinmauern haben vier riesige Milchglasfenster. Das Innere ist ein Labyrinth mit Büros für Design und Verwaltung und Werkstätten für Gemälde und Skulpturen.
Der erste Stopp bei einem Besuch in Koons’ Atelier ist ein Großraumbüro voll mit jungen Leuten auf Drehstühlen, die auf große Apple-Bildschirme starren. Gary McCraw, der langjährige Werkstattleiter des Künstlers, hat hier einen Standort. Der zurückhaltende Mann mit glatten langen Haaren und langem Bart leitet Koons’ immer größer werdenden Stab von mehr als hundertzwanzig Vollzeitmitarbeitern. Er hat dieselbe höfliche, aber seltsam undurchdringliche Art wie sein Chef, der in einer Minute bei uns sein soll. Während ich warte, erhasche ich einen Blick auf eine neue Arbeit auf einem der Bildschirme: die glänzende Skulptur einer halbnackten Frau neben einem Übertopf mit Blumen.
Koons kommt herein, er trägt ein altes Polohemd, Jeans und Turnschuhe. »Diese Venus – sie wird 1,80 Meter groß sein«, sagt der Künstler, der meinem Blick gefolgt ist. »Wir verwenden viel Sorgfalt auf sie. Sehen Sie, wie das Kleid in ihrer Hand gerafft ist? Wie Vaginafalten.« Ohne große Umschweife führt mich Koons aus dem Büro in ein Malatelier. »Ich liebe dieses Gemeinschaftsgefühl. Ich möchte nicht den ganzen Tag allein in einem Raum sein, deshalb habe ich ein solches Atelier konzipiert«, sagt er und seine blauen Augen funkeln hinter seiner Drahtbrille. »Es gefällt mir, wenn ich etwas anbieten kann. In jüngeren Jahren war immer ich derjenige, der das Bier bezahlt hat.«
Atelierrundgänge für Sammler, Kuratoren, Kritiker, Autoren und Fernsehcrews finden häufig statt, und der Künstler folgt einer Art Drehbuch. Er sagt, er sei zur »Selbständigkeit« erzogen worden, und erzählt, wie er als Kind von Tür zu Tür ging und Schokolade und Geschenkpapier verkaufte. »Es gefiel mir, nicht zu wissen, wer mir die Tür öffnen würde. Ich wusste nie, wer mir da entgegentreten würde«, sagt er. »Ich wollte immer etwas machen. Als Künstler geht es mir genauso.« Ich habe viele Interviews mit Koons gelesen und gehört, und er vergisst nur selten, diesen Vergleich des Künstlers mit einem Verkäufer zu erwähnen, der von Tür zu Tür geht.
Wir betreten einen fensterlosen Raum mit sechs großen Leinwänden in unterschiedlichen Stadien der Vollendung. Unter der hohen Decke und den Reihen von Leuchtstoffröhren gibt es viele zweistöckige Gerüste auf Rollen. Es ist Mittagspause, und nur eine Frau arbeitet. Sie sitzt mit überkreuzten Beinen auf der oberen Gerüstetage, hört Musik aus ihrem iPod, die Nase ein paar Zentimeter von der Leinwand entfernt, in der linken Hand einen dünnen Pinsel, der keine sichtbaren Spuren hinterlässt. Koons entwirft seine Gemälde am Computer, seine Assistenten führen sie auf der Grundlage eines ausgeklügelten Systems des Malens nach Zahlen aus. Ein einziges Bild beschäftigt angeblich drei Mitarbeiter sechzehn bis achtzehn Monate lang, ehe es fertig ist.
In Koons’ Atelier herrscht eine stille und geschäftige Atmosphäre – ganz anders als in Warhols Factory mit ihren Drogenexzessen, wo die Leute zu Stars seiner Underground-Filme wurden. Koons sieht sich von Warhol nicht besonders stark beeinflusst, obwohl er sagt, »Andys Arbeiten« hätten »viel mit Akzeptanz zu tun«. Der Künstler bewundert auch Warhols Verwendung immer wieder derselben Bilder und die großformatigen Serien, was er mit dem kuriosen Gedanken verbindet, Kreativität – und Fruchtbarkeit – entstammten derselben Lebenskraft. »Die Beziehung Warhols, eines Schwulen, zur Fortpflanzung ist sehr interessant«, sagt er.
Von Anfang an hat Koons nicht einfach nur Kunstwerke, sondern Kunstschauen gemacht. Er hat ein Geschick dafür, ganze Werkgruppen zu erarbeiten, die mehr sind als die Summe ihrer Teile. Dabei ist er sehr darauf bedacht, ausreichend viele, aber nicht zu viele Exemplare herzustellen. Seine Serien beschränken sich auf Auflagen zwischen drei und fünf Skulpturen, was sie für Sammler attraktiv macht. Zu den gefragtesten Serien von Warhols Œuvre zählen die 1964 entstandenen Marilyn-Monroe-Porträts (101,6 × 101,6 cm) in fünf verschiedenen Farben: rot, blau, orange, türkis und graublau. Zufälligerweise gibt es Koons’ »Celebration«-Skulpturen, für die er höchste Auktionspreise erzielte, gleichfalls in fünf »einmaligen« Farbversionen.
Koons redet nicht gern über seinen Markt, weil er befürchtet, als »kommerziell« oder profitorientiert missverstanden zu werden. »Ich habe nichts gegen Erfolg«, erklärt er, »aber was mich interessiert ist das Begehren.« Als ich sage, dass man einem Künstler, der bei Auktionen hohe Preise erzielt, fast automatisch kommerzielle Motive unterstellt, gibt er prompt zurück: »Über Lucian Freud, Cy Twombly oder Richter sagt man das nicht.« Bei Fragen, die mit Geld zu tun haben, ist Koons vorsichtig mit einer Antwort. So definiert er seinen Markt als »eine Gruppe von Leuten, die erkennen, dass ich es mit meiner Arbeit sehr ernst meine«.
So sorgsam der Künstler Fragen zum Markt ausweicht, so stark ist seine Aversion, sich zu politischen Themen zu äußern. In einem Beitrag für das japanische Fernsehen erwischte Roland Hagenberg den Künstler in einem unbedachten Moment. »Für Sie scheint Politik in der Kunst keine Rolle zu spielen«, sagte der Dokumentarfilmer. »Ich versuche, das zu machen, was meinem Werk nicht schadet«, antwortete Koons. Tatsächlich könnten unverblümte politische Inhalte seinem Erfolg im Bemühen, »Begehren« zu wecken, einen Dämpfer verpassen.
Viele der hier entstehenden Arbeiten gehen aus älteren Serien hervor, doch drei Bilder dokumentieren den Beginn einer neuen, noch namenlosen Gruppe von Arbeiten. Konzipiert als weiblicher Kontrapunkt zu den Arbeiten seiner »testosterongesättigten« Serie »Hulk Elvis«, sind diese Gemälde von Gustave Courbets L’Origine du monde (Der Ursprung der Welt, 1866) inspiriert. Courbets äußerst realistisches Gemälde einer nackten, nur von den Brustwarzen bis zu den Oberschenkeln dargestellten Frau, die mit gespreizten Beinen auf einem weißen Bettlaken ausgestreckt liegt, zählt zu den bekanntesten Werken des 19. Jahrhunderts. Die oberste Ebene von Koons’ neuen Bildern zeigt weibliche Schamlippen in Silber, die mich weniger an Courbet erinnern als an die Teller von Judy Chicagos Dinner Party und an zahllose feministische »central core«-Bilder mit der Darstellung weiblicher Genitalien. Eine Ebene unterhalb dieser Strichzeichnungen gibt es Rasterpunkte in Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Diese Punktmuster wirken zunächst abstrakt, bilden, aus der Entfernung betrachtet, jedoch figurative Muster. Koons zieht mich auf die andere Seite des Raums, aber wir sind immer noch nicht weit genug entfernt, um die Figur zu erkennen, deshalb zeigt er mir Fotos der Arbeiten auf seinem iPhone. Auf einem sieht man einen Wasserfall, auf einem anderen einen Baum, auf einem dritten ein nacktes Paar, das etwas Intimes macht; ich bin mir nicht sicher, was genau. Viele seiner Bilder sind Derivate seiner Skulpturen, manche sehen sogar aus wie Werbeanzeigen für seine dreidimensionalen Arbeiten, aber diese Origine-Bilder scheinen eigenständige Arbeiten zu sein. Sie gefallen mir sehr.
»Künstlerische Eroberungen und sexuelle Eroberungen. Sie lassen sich sehr gut parallelisieren«, sagt Koons. Der Künstler hat eine ausgeklügelte persönliche Philosophie, die sich um »das biologische Narrativ« dreht, wie er es nennt, und viel Aufmunterung beinhaltet. »Du musst auf dich selbst bauen und deinen Interessen folgen. So findest du zur Kunst«, sagt er. Manchmal klingt Koons wie ein Motivationstrainer oder ein Selbsthilfe-Guru. »Meine Kunst hat nicht nur mit Spaß zu tun«, sagt er, während wir uns von den unfertigen Arbeiten entfernen. »Ich möchte, dass meine Arbeiten den Leuten helfen, ihre Parameter zu erweitern. Kunst ist ein Vehikel, um mit Archetypen in Verbindung zu treten, die uns helfen zu überleben.«
Koons führt mich durch mehrere Räume, in denen Skulpturen simuliert, modelliert, zusammengefügt oder bemalt werden. Die Mitarbeiter tragen weiße Anzüge, Masken und Gummihandschuhe. Mit seinen Stahlträgern, Gurten und allen möglichen Vorrichtungen aus glänzendem Metall wirkt das Atelier altertümlich und hochtechnisiert zugleich. Schließlich stehen wir vor dem zweidimensionalen Pappmodell von Hulk (Friends), einer Gummipuppe der grünen Comicfigur mit sechs kleinen aufblasbaren Gummitieren für den Swimmingpool auf der Schulter. Hulks Gesichtszüge haben eine gewisse Ähnlichkeit mit denen des Künstlers.
Für Koons gibt es keine Kehrseite des Ruhms. »Man steht, was die eigenen Ideen betrifft, nur entweder zu sehr oder zu wenig im Rampenlicht. Wenn man weiterhin informieren und aufklären kann …«, fügt er hinzu, ohne den Satz zu vollenden. »Wenn sich die Plattform für das eigene Werk vergrößert, so ist das großartig«, sagt er. Koons unterteilt sein Arbeitsleben in »Schaffen« und »Plattform« – andere Künstler würden vielleicht von Produktion und Promotion sprechen. »Ich möchte mich mit meinen Ideen beschäftigen, damit ich genau die Geste machen kann, die ich machen möchte. Gleichzeitig möchte ich eine Plattform für mein Werk schaffen, damit es nicht nur eine einsame Geste bleibt, die niemand wahrnimmt.«
Mitte der achtziger Jahre, als er seine »Equilibrium«-Serie promotete – am bekanntesten sind die in Salzwasserbecken schwimmenden Basketbälle –, sagte Koons, Künstler verbesserten ihre soziale Position durch Kunst auf dieselbe Weise wie Sportler, die durch den Sport reich werden. Ich frage ihn nach dem Status des Künstlers heute.
Koons macht ein erschrockenes Gesicht, als sei meine Frage ein ungehöriges Eindringen in seine Privatsphäre. Er dreht zuerst den Kopf und dann den ganzen Körper von mir weg. »Sie haben vorhin eine Frage gestellt«, sagt er und wechselt das Thema. Ich lasse ihn noch ein paar gut eintrainierte Sätze zum Besten geben, dann versuche ich es noch einmal, diesmal nachdrücklicher. Ich sage, dass Calvin Tomkins einmal im New Yorker schrieb, Koons sei entweder »unglaublich naiv« oder »ein gerissener Selbstdarsteller«. Tomkins war sich nicht sicher, ob er »mit dem wirklichen Jeff Koons« sprach oder »ob es einen solchen überhaupt gab«. Was, glauben Sie, hat er damit gemeint, frage ich.
»Wer hat das gesagt?«, erwidert Koons. Seine Antwort geht an der Frage vorbei. Anfang der achtziger Jahre, sagt er, habe er gelernt, es nicht persönlich zu nehmen, wenn die Leute seine Arbeiten nicht verstanden. »Ich bin ehrgeizig«, fügt er hinzu und schweift damit erneut ab. »Ich möchte in diesem Dialog mein Potential ausschöpfen. Mir gefällt es, mich mit Lichtenstein, Picabia, Dalí, Duchamp, Courbet und Fragonard verbunden zu fühlen.«
Ich sage ihm, dass mich die soziale Rolle fasziniert, die ein Künstler spielt. Der Schöpfer eines Kunstwerks ist Teil von dessen Bedeutung, nicht wahr?, frage ich. In der Vergangenheit hat Koons eingeräumt, dass er gern der ist, als den ihn die Leute sehen wollen. Einerseits bewundere ich die Vielseitigkeit dieses Heiligen, der seine Sachen an der Haustür verkauft und gleichzeitig ein Motivationstrainer ist, andererseits möchte ich ihm ein Bekenntnis entlocken – oder, wie Koons es vielleicht ausdrücken würde, etwas Festes und Explizites statt etwas Feuchtes und Glitschiges. Ich habe zweimal nach Ihrer öffentlichen Rolle als Künstler gefragt, sage ich, und Sie sind der Frage zweimal ausgewichen. Na los, dränge ich ihn und strahle ihn an, so gut ich kann.
»Meine öffentliche Rolle als Künstler?« Koons macht eine lange Pause. »Ich kann nicht sagen, dass ich mir bestimmter Dinge nicht bewusst bin, denn ich möchte nicht naiv sein. Aber ich versuche nicht, etwas zu kreieren. Ich habe immer aufrichtig versucht, das Werk zu schaffen, und ich versuche immer, es so darzustellen, wie ich es sehe.« Eine Unruhe im Raum nebenan ist eine willkommene Ablenkung – etwas Schweres wird bewegt –, dann wendet sich der Künstler wieder mir zu. »Ich bin nicht naiv«, wiederholt er und sagt einen seiner Lieblingssätze aus den späten achtziger Jahren: »Es gibt einen Unterschied zwischen Bedeutsamkeit und Bedeutung. Etwas, was die Medien ständig wiederholen, kann bedeutsam sein; wir sind uns dessen bewusst, weil es ständig wiederholt wird. Aber Bedeutung ist eine höhere Sphäre.« Zunächst ist mir nicht klar, was diese Unterscheidung mit meiner Frage zu tun hat. Dann geht mir auf, dass Koons vielleicht sagen will, seine öffentliche Rolle sei zwar bedeutsam, aber nicht bedeutungsvoll.
Szene 4Ai Weiwei
Ai WeiweiSunflower Seeds2010
Während Koons vorgefertigte Sätze spricht, wirken Ais Äußerungen alles andere als geschliffen. In China, wo die Öffentlichkeit von der Regierungspropaganda beherrscht wird und unabhängiges Denken über Generationen hinweg unterdrückt wurde, spricht Ai am liebsten spontan und lehnt inoffizielle Hintergrundgespräche ab. Sein Glaube an die Meinungsfreiheit schließt die Bereitschaft ein, sich grundsätzlich in aller Öffentlichkeit zu äußern. Der Künstler mit einem Talent zur Improvisationen liebt das Risiko.
Die Turbinenhalle in London stellt für jeden Künstler eine Herausforderung dar. Das Herzstück der Tate Modern Gallery ist 155 Meter lang, 23 Meter breit und spektakuläre fünf Stockwerke hoch. Als das Gebäude noch ein Kraftwerk war, standen hier die Stromgeneratoren, die das Licht für die Londoner Innenstadt lieferten. Heute ist es eine weltliche Kathedrale für Auftragswerke zeitgenössischer Kunst, die auf andere Weise erleuchten sollen. Ein Künstler braucht große Intelligenz und viel Ehrgeiz, um einen Raum dieser Größe mit Bedeutung zu füllen.
Der Inhalt von Ais Auftragsarbeit für die Turbinenhalle war bis zur Besichtigung am Vorabend der Eröffnung ein streng gehütetes Geheimnis. Als ich mich der Installation näherte, hörte ich das Knirschen unter den Sohlen der fünf, sechs Leute, die vor mir das Museum betreten hatten und bereits die Installation begingen. Ich betrat ein rechteckiges Meer aus grauem Schotter – oder waren es Kieselsteinchen? Erst als ich in der Mitte angelangt war, beugte ich mich hinunter und hob eine Handvoll von etwas auf, das aussah wie Sonnenblumenkerne. Sie waren so realistisch, dass ich erst eines mit den Lippen berühren musste, um mir zu bestätigen, dass sie aus Porzellan waren. Das Werk mit dem Titel Sunflower Seeds (2010) bestand aus 100 Millionen sorgfältig handgefertigter Miniaturskulpturen. Die Installation steht für das bevölkerungsreichste Land der Erde – ein Sonnenblumenkern für jeden dreizehnten Chinesen – und ist aus dem Material (Porzellan, englisch china) gefertigt, das dem Land seinen Namen gab.
Man kann diese Arbeit durchaus als monumental bezeichnen, doch der Künstler spricht weniger prätentiös von einer »Massenproduktion«, für die 1600 Leute zweieinhalb Jahre lang gearbeitet haben. Ai rettete ein Dorf von Porzellanmachern vor der Arbeitslosigkeit, bezahlte einen überdurchschnittlichen Lohn und drehte ein Video über den Herstellungsprozess. Er war sich des Problems der Ausbeutung bewusst, lenkte die Aufmerksamkeit auf die Mühsal der Produktion und machte sie zu einem expliziten Thema.
Ai erscheint mit dänischen und amerikanischen Dokumentarfilmern im Schlepptau, die ihn seit Monaten begleiten. Wir gehen ins Café, wo er englischen Frühstückstee bestellt; die Filmleute nehmen an einem benachbarten Tisch Platz. Der Künstler trägt, so scheint es, dasselbe ausgebeulte Jackett wie in Shanghai. Nach ein paar begeisterten Bemerkungen über die Sonnenblumenkerne und der Beteuerung, dass ich ihn gern in seinem Atelier in Peking besuchen würde, komme ich unumwunden zur Kernfrage meiner Recherchen, zu deren Beantwortung ich andere Interviewpartner nur mit viel Überredungskunst bewegen konnte.
Ai holt tief Luft, dann räuspert er sich. Er ist ein Vielschreiber und Vielredner. Seit 2005 hat er Tausende Blogs und Twitterbotschaften gepostet. (Im Chinesischen sind 140 Zeichen eine ganze Erzählung, sagt er.) Der Künstler gibt durchschnittlich drei Interviews pro Tag und hat im Vorfeld seiner Ausstellung in der Turbinenhalle mindestens ein Dutzend Pressekonferenzen gegeben. Doch auf diese Frage hat Ai keine schnelle Antwort. »Mein Vater war ein Künstler und hat in Paris studiert«, sagt er schließlich auf Englisch mit einem starken chinesischen Akzent. »Und im Gefängnis wurde er zum Dichter.« Weiweis Vater Ai Qing besuchte die Kunstakademie in Hangzhou und studierte dann in Frankreich Kunst, Literatur und Philosophie. Nach China zurückgekehrt, wurde er von Tschiang Kai-scheks nationalistischer Regierung für drei Jahre ins Gefängnis gesteckt, weil er die kommunistische Revolution Mao Zedongs offen unterstützte. Da er während der Haft keine Malutensilien hatte, schrieb er »Meine Amme Dayanhe«, das zu einem seiner berühmtesten Gedichte wurde. Kaum zehn Jahre nachdem Mao an die Macht gekommen war, wurde Ai Qing als politisch rechts eingestuft und zu Zwangsarbeit verurteilt. »Er wurde im selben Jahr ins Exil geschickt, in dem ich geboren wurde«, sagt Ai. »Ich wuchs also in dem Bewusstsein auf, dass er ein Staatsfeind ist.«
Ai Qings »Verbrechen« bestand darin, dass er die Fähigkeit verloren hatte, leidenschaftlich zu schreiben. »Sie fragten ihn, warum er nicht die Volksrevolution verherrliche«, erzählt Ai. »Er schrieb Gedichte über Gärten mit nur einer einzigen Blumensorte. Seiner Ansicht nach sollte es in einem Garten Vielfalt geben, alle möglichen Ideen und Ausdrucksformen und nicht nur eine einzige Art der Schönheit.« In der Kampagne gegen Rechtsabweichler, die der Kulturrevolution vorausging, verschwanden 500000 Intellektuelle. Jeder, dessen Meinung auch nur geringfügig von der politischen Linie der Kommunistischen Partei abwich, wurde bestraft.
Ai Qing musste in einem Dorf in der abgelegenen Provinz Xinjiang die öffentlichen Toiletten putzen. Er hörte auf zu schreiben und verbrannte seine Werke und seine Bücher aus Furcht, die Roten Garden könnten mitten in der Nacht kommen, etwas Belastendes finden und seine Familie noch härter bestrafen. »Solche Dinge kannte man nur aus dem Kino oder aus der Nazizeit. Es war sehr frustrierend, denn dieser Mann war kein Krimineller. Trotzdem bewarfen ihn die Leute mit Steinen. Die Kinder schlugen ihn mit Stöcken und schütteten ihm Tinte über den Kopf. All dies geschah im Namen der Gerechtigkeit und der Umerziehung«, sagt Ai. »Die Dorfbewohner wussten gar nicht, was mein Vater falsch gemacht hatte. Sie wussten nur, dass er der Feind war.«
Einen Großteil seiner Kindheit verbrachte Ai mit seiner Familie in einem Erdloch ohne Strom und fließendes Wasser. »Angesichts der damaligen politischen Umstände konnte das Leben unter der Erde ein unglaubliches Gefühl der Sicherheit vermitteln«, schrieb Ai in seinem Blog. »Im Winter war es warm, im Sommer kühl. Die Wände reichten bis nach Amerika.« Ais Vater erhöhte die Decke dieser Behausung, indem er die Erde einen Spatenstich tief aushob, und er baute ein Bücherregal, das der achtjährige Weiwei als das beste Bücherregal betrachtete, das je gebaut wurde.
Ai litt unter Mangelernährung und Krankheiten. »Ich wusste, was Sterblichkeit ist«, sagt er. »Ich spürte, wie der Wind an mir rüttelte. Wenn ich mitten in der Nacht aufwachte und aufs Klo ging, sah ich den Himmel mit seinen hellen Sternen. Ich hatte das Gefühl, von einer Sekunde auf die andere verschwinden zu können. Aber unverschämterweise bin ich immer noch hier, ein sehr dicker Mann, der jeden Tag viel isst und viel redet.«
Ais Vater war strikt dagegen, dass sein Sohn ein Künstler wird. »Er hat immer gesagt, vergiss Literatur und Kunst. Werde ein rechtschaffener Arbeiter.« Aber Ai sah in der Not und Entbehrung etwas anderes. »Ich wurde Künstler, weil mein Vater sich unter diesem Druck etwas bewahrt hatte, das niemand ihm nehmen konnte. Selbst als die ganze Welt dunkel war, gab es in seinem Herzen etwas Warmes.« Wenn sein Vater eine einfache Pinselzeichnung anfertigte oder laut eine lyrische Zeile formulierte, fiel dem jungen Ai auf, dass er »der Wirklichkeit enthoben war«.
Nach Maos Tod wurde Ai Qing rehabilitiert, und die Familie kehrte nach Peking zurück. Sein Vater wurde stellvertretender Vorsitzender des chinesischen Schriftstellerverbands und einer der literarischen Heroen des Landes. In den 1990er Jahren standen Ai Qings Gedichte in China auf dem Lehrplan der Mittelschulen.
Als Ai mit seiner Geschichte fertig ist, kehre ich zu der Frage zurück, die ihn dazu bewogen hat, sie zu erzählen. Dann ist also ein Künstler – oder zumindest ein bedeutender Künstler – ein Feind des Staates?
Ai hebt die Augenbrauen. »Der Künstler ist ein Feind des … ähm … des Allgemeinempfindens«, sagt er.
Szene 5Gabriel Orozco
Gabriel OrozcoBlack Kites1997
Ein paar Wochen später entdecke ich in Manhattan eine Handvoll Sonnenblumenkerne von Ai Weiwei in einem blauen Taschentuch auf dem Schreibtisch von Gabriel Orozco, einem der bekanntesten mexikanischen Künstler. Er war in der Tate Modern gewesen, um die Räumlichkeiten für seine bevorstehende Retrospektive ein paar Stockwerke über Ais Installation in der Turbinenhalle zu begutachten. »Ich habe ein paar dieser Kerne aufgehoben, um zu sehen, was es ist, und fand sie interessant. Ich wusste nicht, dass es nicht erlaubt war«, sagt er verlegen. Mit seinem Bart und seinen dunklen Augen sieht Orozco aus wie eine Kreuzung zwischen Karl Marx und Antonio Banderas. Ich sage ihm, dass ich gleichfalls eine Handvoll mitgenommen habe, da ich glaubte, Sunflower Seeds sei gedacht wie eine von Félix González-Torres’ Installationen mit aufgehäuften Bonbons (von denen die Besucher mitnehmen können, so viel sie wollen).
Wir befinden uns im Untergeschoss von Orozcos Haus, einem 1845 erbauten Backsteingebäude in Greenwich Village. Auf seinem Schreibtisch stapeln sich bunt zusammengewürfelt Bücher. Ein Stoß beginnt mit mehreren Bänden Jorge Luis Borges, gefolgt von Bernard Marcadés Marcel Duchamp und von Snakehead: An Epic Tale of the Chinatown Underworld and the American Dream. Daneben liegt ein dickes Notizbuch, prall gefüllt mit Zeichnungen, Fotos und Notaten in spanischer, französischer und englischer Sprache, das den Charakter eines Schwangerschaftsfetischs besitzt. Orozco hat seit 1992 achtzehn solcher Notizbücher gefüllt. In einer Zeit, da so viele Künstler nur noch am Computer arbeiten, bevorzugt Orozco analoge Tools. »Das Denken findet in den Notizbüchern, die Kommunikation am Computer statt«, sagt er in seinem schweren südamerikanischen Akzent. Der Künstler sieht am späten Nachmittag so verquollen aus, als wäre er gerade erst aufgestanden.
Auf dem Schreibtisch, neben den Sonnenblumenkernen, liegen die Pläne der Westseite von Ebene vier der Tate Modern. Darauf gekritzelte Pfeile und Kreise bekunden den Austausch zwischen dem Künstler und dem Kurator bezüglich der Platzierung der Arbeiten. Die Einzelausstellung gastierte zuerst in New York, dann in Basel und in Paris, und bald wird sie auch in London zu sehen sein. Sie präsentiert »assisted readymades«, Fundstücke, die der Künstler bearbeitet hat. Black Kites (1997) zum Beispiel ist ein menschlicher Schädel, den Orozco mit schwarzweißen Rauten aus Graphit überzogen hat. Das so entstandene Objekt verbindet die kunstgeschichtliche Tradition des Memento mori mit den vibrierenden Formmustern der Op Art. Ein anderer Klassiker Orozcos ist Four Bicycles (There is Always One Direction) (1994), in dem vier auf den Kopf gestellte Fahrräder zu einem ineinandergreifenden, akrobatischen Ensemble zusammengefügt sind. (Auch Ai Weiwei hat in vielen seiner Skulpturen Fahrräder verwendet, wenngleich erst in jüngerer Zeit und in sehr viel größerem Stil. Forever Bicycles von 2012 zum Beispiel besteht aus 1200 Fahrrädern, die zu einem spektakulären, 100 Meter hohen Gebilde aufgetürmt sind.) Neben Skulpturen hat Orozco zahlreiche Fotografien gemacht, die faszinierende geometrische Muster im Alltag aufspüren, sowie Gemälde mit reizvollen, der Phantasie entsprungenen Abstraktionen. Seine »Samurai Trees« (2004–06) sind eine Serie von Bildern mit Eitempera auf Eichenholztafeln in glänzenden Gold-, Rot-, Weiß- und Blauschattierungen. Der Künstler entwarf 677 dieser Bilder am Computer und übertrug die Ausführung zwei Freunden, einem in Paris, dem anderen in Mexico City. »Ich mache gern Dinge, die eine Entscheidung verlangen«, sagt Orozco. »Einfache Reproduktionsverfahren muss ich nicht selbst ausführen.«
Der Vater des Künstlers, Mario Orozco Rivera, war ein Murales-Maler in der großen Tradition des sozialistischen Realismus eines Diego Rivera, José Clemente Orozco (nicht verwandt) und David Alfaro Siqueiros. Der junge Gabriel Orozco wuchs in einem künstlerisch geprägten Umfeld auf und wollte selbst Künstler werden, doch sein Vater hielt nicht viel davon. »Er versuchte, mir die Idee auszureden. Für diese Generation war es sehr viel schwieriger, von der Kunst zu leben«, sagt er. Orozco studierte schließlich akademische Malerei an der Escuela Nacional de Artes Plásticas in Mexico City, wo er, wie er sagt, »Fresko, Tempera, Öl, Pastell, Radierung, alles« lernte. Eine Zeitlang half er seinem Vater bei seinen Wandbildern, um sich das Geld für ein eigenes Auto zu verdienen, entschied sich dann aber – zunächst jedenfalls – gegen ein Leben als Maler. Doch er übernahm nie den illustrativen Stil des sozialistischen Realismus, der politische Botschaften übermitteln will.
Anders als sein Vater möchte Orozco sich auch nicht auf eine bestimmte politische Richtung festlegen lassen. Mexiko hat wie Frankreich die Tendenz, Künstler als öffentliche Persönlichkeiten zu vereinnahmen. Sein Vater war ein »dezidiert linker Künstler«, Orozco dagegen möchte lieber kein »politischer Profi sein, der zu allem seine Ansicht äußert«. Dem Denken in solchen Kategorien begegnete er bei den Biennalen in einigen Ländern, wo man »vom Künstler erwartet, dass er so etwas wie ein Missionar oder Arzt ist, der gute Ideen, Rezepte, Lösungsvorschläge und soziale Hilfsbereitschaft in der Tasche hat. Man wird zu einer Art artiste sans frontières.« Orozco lehnt sich zurück, diese Vorstellung lässt ihn erschaudern. In Amerika, Großbritannien und anderen Ländern, in denen die Kunst vom Markt bestimmt wird, erwartet man vom Künstler kein politisches Engagement, und wenn er sich trotzdem politisch äußert, wird er zumeist ignoriert. »Die Rolle politischer Aktivisten wird von Celebrities wie Angelina Jolie gespielt«, sagt Orozco glucksend. »Sie erfüllt den Job, den in Frankreich Jacques Derrida oder in Mexiko Frida Kahlo innehatten.«
Orozcos politische Ansichten sind implizit in seiner Kunst enthalten. Horses Running Endlessly (1995) zum Beispiel besteht aus einem Schachbrett, das ausschließlich mit Springern besetzt ist. Die Arbeit beschreibt eine egalitäre Gesellschaft, in der es keine allmächtige Königin und kein untertäniges, auswechselbares Fußvolk gibt. Die Springer aus Holz sind in vier unterschiedlichen Farbnuancen lackiert und suggerieren Teams oder Stämme, doch auf dem Schachbrett vermischen sie sich, als spiele die Farbe keine Rolle. Überhaupt ähnelt sein Schachbrett weniger einem Schlachtfeld als einer Tanzfläche.
Orozco erklärt zwar, Kunst habe »nichts mit guten Absichten oder moralischen Werten zu tun«, dennoch verurteilt er einen Künstlerkollegen, wenn er andere übervorteilt. »Es gibt bei der Arbeit einige ethische Aspekte, die wirklich wichtig sind. Ich bin sehr sensibel, wenn es um Billiglohnarbeit geht«, sagt er. Er wirft einen Blick auf seinen Ameisenhaufen mit Ais Sonnenblumenkernen. »Es ist nicht leicht für einen Künstler«, räumt er ein, »all die kleinen Probleme von Politik und Ausbeutung im Auge zu behalten, die sich in der Praxis ergeben.«
Ich sage Orozco, dass auch Ai der Sohn eines Künstlers ist. Orozco entgegnet, sein Vater sei Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre wiederholt im Gefängnis gewesen. »Seine Bilder fielen der Zensur zum Opfer oder wurden aus Ausstellungen entfernt. Er war nie lange im Gefängnis, weil sie nichts gegen ihn in der Hand hatten. Aber im Grunde genommen, ja, mein Vater war ein Staatsfeind.« Zwischen 1929 und 2000 war Mexiko ein autokratischer Staat, regiert von Vertretern der Partei der Institutionalisierten Revolution, die nominell sozialistisch, in Wirklichkeit aber kapitalistisch ist. Orozcos Vater war Mitglied der Kommunistischen Partei.
Der junge Orozco führte jahrelang ein Nomadenleben mit Stationen in Madrid, Berlin, London, Bonn und San José, der Hauptstadt von Costa Rica. Noch heute, da er in New York lebt und arbeitet (sein sechsjähriger Sohn geht hier zur Schule), verbringt er mehrere Monate im Jahr in Mexiko und Frankreich. Auf einem Regal hinter dem Künstler liegen ein Fernglas und Bocciakugeln mit der Aufschrift bon voyage. »Manchmal kann ich im Urlaub besser arbeiten. Deswegen mache ich oft Urlaub«, witzelt er. »New York ist laut. Es gibt zu viel Bewusstsein.«