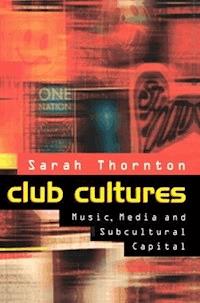9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was Robert Altmans Film »Prêt-à-Porter« für die Modewelt war, ist Sarah Thorntons Buch für die Welt des riesigen Boom-Marktes der Gegenwartskunst: Nach welchen Regeln funktioniert sie? Wer entscheidet, welcher Künstler einer der ganz großen (und ganz teuren) wird? Was treibt die Sammler, die Galeristen – und was bedeutet all das für die Kunst und die Künstler selbst? Mit dem Handwerkszeug einer Ethnologin erkundet Sarah Thornton diese einzigartige Welt aus Kreativität, Geschmack und Macht, aus Status, Hoffnung, Geld und Intrigen. Sie hat mit über 250 Insidern, Künstlern, Galeristen, Kritikern, Kuratoren und Sammlern gesprochen und ist als kritische Beobachterin für eine Zeit selbst Teil der Kunstwelt geworden. Ihr Buch schildert lebensprall und gespickt mit intelligentem Klatsch und Tratsch die Menschen und Instituitionen, die die Kunstgeschichte der Zukunft schreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Sarah Thornton
Sieben Tage in der Kunstwelt
Sachbuch
Aus dem Englischen von Rita Seuß
Fischer e-books
Für Glenda und Monte
JOHN BALDESSARIBeach Scene/Nuns/Nurse (with Choices),1991
Vorwort
Sieben Tage in der Kunstwelt ist eine Sozialgeschichte der jüngeren Vergangenheit. Das Buch beschreibt, eingebettet wie in eine Zeitkapsel, eine außergewöhnliche Periode der Kunstgeschichte. In den vergangenen acht Jahren boomte der Markt, die Besucherzahlen der Museen in vielen Ländern stiegen, und mehr Menschen als je zuvor gaben ihren Brotberuf auf und bezeichneten sich als Künstler. Die Kunstwelt expandierte, das Karussell drehte sich schneller und schneller. Kunst wurde immer heißer, hipper, teurer. Mit der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise war dieser ekstatische Augenblick vorbei, die zugrundeliegenden Strukturen und Dynamiken jedoch bestehen weiter.
Die zeitgenössische Kunstwelt ist ein lose verbundenes Netzwerk unterschiedlicher Subkulturen, die vom Glauben an die Kunst zusammengehalten werden. Diese Subkulturen umspannen den Globus, sind aber gleichzeitig in Kunstmetropolen wie New York, London und Berlin konzentriert. Zwar existiert auch in Glasgow, Vancouver und Mailand eine lebendige Kunstszene, sie ist aber so abseitig, dass Künstler sich oft ganz bewusst dafür entscheiden, in diesen Städten zu leben und zu arbeiten. Dennoch ist die Kunstwelt heute sehr viel polyzentrischer als im 20. Jahrhundert; damals war zuerst Paris und später New York führend. Dreißig Jahre lang galt Köln als die europäische Kunsthauptstadt, bis Künstler aus ganz Europa nach Berlin abwanderten, während der Markt sich nach London und (für die Dauer der Kunstmesse im Juni) nach Basel verlagerte. Nun, da zeitgenössische Künstler in Beijing, Moskau und Doha Unterstützung finden, wird sich auch die Kunstwelt auf neue geographische Schwerpunkte verlagern.
Die Akteure der Kunstwelt treten in der Regel in einer der folgenden Rollen auf: als Künstler, Händler, Kuratoren, Kritiker, Sammler oder Experten in einem Auktionshaus. Zwar gibt es Künstler, die gleichzeitig Kritiker und Händler, die gleichzeitig Sammler sind, aber diese Doppelrolle ist nach deren eigenem Bekunden schwierig auszufüllen, und die öffentliche Wahrnehmung ihrer Tätigkeit fokussiert sich jeweils nur auf eine der beiden Identitäten. Am schwierigsten zu spielen ist die Rolle des glaubwürdigen und erfolgreichen Künstlers, doch es sind die Händler, die die Schlüsselrolle besetzen, da bei ihnen die Fäden zusammenlaufen. Sie kanalisieren Macht und Einfluss aller anderen Akteure.
Man darf nicht vergessen, dass die Kunstwelt ungleich diversifizierter ist als der Kunstmarkt. Der Markt besteht aus denjenigen, die Kunst kaufen und verkaufen (Händler, Sammler und Auktionshäuser), doch viele Akteure der Kunstwelt (die Kritiker und Kuratoren sowie die Künstler selbst) sind in diese kommerziellen Aktivitäten in der Regel nicht direkt involviert. Die Kunstwelt dagegen ist eine Sphäre, in der viele Menschen nicht nur arbeiten, sondern leben. Es ist eine »symbolische Ökonomie«, wo Gedanken ausgetauscht und kulturelle Werte diskutiert werden, jenseits des reinen Kommerz.
Zwar wird die Kunstwelt häufig als eine klassenlose Sphäre beschrieben, in der Künstler aus niedrigen sozialen Schichten mit reichen Erben und Bankern, wissenschaftlich geschulten Kuratoren, Schriftstellern und anderen »Kreativen« Champagner trinken. Man sollte jedoch nicht meinen, dies fände in einer egalitären oder demokratischen Atmosphäre statt. Kunst hat mit Experiment und mit Ideen zu tun, aber auch mit Prominenz und Exklusivität. In einer Gesellschaft, in der jeder nach einem Mindestmaß an Anerkennung sucht, kann dies eine berauschende Mischung sein.
Die zeitgenössische Kunstwelt ist das, was Tom Wolfe wohl »Statusphäre« nennen würde. Sie formiert sich um nebulöse und oft widersprüchliche Hierarchien von Ruhm, Glaubwürdigkeit, imaginierter historischer Bedeutung, institutioneller Anbindung, Bildung, »gefühlter« Intelligenz, Reichtum und Attributen wie beispielsweise der Größe einer Sammlung. Bei meinen Streifzügen durch die Kunstszene war ich oft amüsiert über die Statusängste der Akteure. Händler, die um den Standort ihrer Koje bei einer Kunstmesse bangen, und Sammler, die bei einem neuen »Meisterwerk« als Erste zur Stelle sein wollen, sind vielleicht die signifikantesten Beispiele, frei davon ist niemand. John Baldessari, ein in Los Angeles lebender Künstler, der in diesem Buch mit klugen und geistreichen Äußerungen mehrfach zu Wort kommt, sagte zu mir: »Künstler haben ein riesiges Ego, das sich zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedliche Weise manifestiert. Ich finde es lästig, wenn mir die Leute die Höhepunkte ihres beruflichen Werdegangs vorbeten. Ich war schon immer der Ansicht, dass Schildchen oder Bändchen dieses Problem lösen würden. Man könnte sie beim Besuch der Documenta oder der Tate an sein Jackett heften. Künstler könnten Streifen tragen wie Generäle, dann wüsste jeder sofort über ihren Rang Bescheid.«
Wenn in der Kunstwelt ein Grundsatz hochgehalten wird, dann vermutlich der, dass nichts wichtiger ist als die Kunst selber. Manche glauben wirklich daran; andere wissen, dass sie zumindest so tun müssen, als würden sie daran glauben. So oder so, das gesellschaftliche Umfeld der Kunst wird oft als etwas Nachgeordnetes und Schmutziges abgetan, das die Reinheit der Kunst nur befleckt.
Während meines Studiums der Kunstgeschichte hatte ich das Glück, viele neuere Arbeiten sehen zu können. Allerdings hatte ich keine genaue Vorstellung davon, wie diese Kunstwerke zirkulierten, wie sie in den Blick der Kunstkritik gerieten oder womöglich Anstoß erregten, wie sie vermarktet, verkauft oder gesammelt wurden. Heute, da das Werk lebender Künstler auf den Studienplänen ganz oben steht, lohnt es sich mehr als je zuvor, die Bezugssysteme von Kunst durchsichtig zu machen, um zu verstehen, welchen Bewertungsprozessen ein Kunstwerk zwischen seiner Entstehung im Atelier und seinem Standort in der ständigen Sammlung eines Museums (oder im Müllcontainer oder einer der vielen möglichen Stationen dazwischen) unterliegt. Wie mir der Kurator Robert Storr sagte, der im Biennale-Kapitel zu Wort kommt: »Die Funktion eines Museums besteht darin, Kunst wieder wertlos zu machen. Ein Museum nimmt das Kunstwerk vom Markt und platziert es an einem Ort, wo es Teil des kollektiven Reichtums wird.« Meine Untersuchung zeigt, dass große Arbeiten nicht aus dem Nichts auftauchen. Sie werden gemacht, nicht nur von Künstlern und ihren Assistenten, sondern auch von Händlern, Kuratoren, Kritikern und Sammlern, die die Arbeit »unterstützen«. Das bedeutet nicht, dass diese Arbeiten nicht groß wären oder dass Kunst, die es bis ins Museum schafft, diesen Status nicht verdient hat. Keineswegs. Es besagt nur, dass der Prozess der kollektiven Meinungsbildung weder so simpel noch so geheimnisvoll verläuft, wie man gemeinhin denkt.
Dass zeitgenössische Kunst heute eine Art Religion für Atheisten geworden ist, zieht sich thematisch wie ein roter Faden durch alle Geschichten dieses Buches. Der Maler Francis Bacon sagte einmal, sobald der Mensch erkannt habe, dass er bloßer Zufall ist, müsse er sich ablenken. Und er fügte hinzu: »Malerei, alle Kunst ist ein Spiel geworden, mit dem der Mensch sich ablenkt … und wenn ein Künstler gut sein will, muss er dieses Spiel vertiefen.« Für viele Akteure der Kunstwelt und für viele Kunstbegeisterte ist konzeptuelle Kunst so etwas wie ein existenzieller Weg, um ihrem Leben Sinn und Bedeutung zu verleihen. Der Sprung in den Glauben ist erforderlich, doch der Gläubige wird mit Sinn belohnt. Mehr noch: Wie Kirchen oder andere rituelle Versammlungsorte eine soziale Funktion erfüllen, so schaffen auch Kunstevents ein Gemeinschaftsgefühl. Für den Autor und Herausgeber Eric Banks, der in Kapitel 5 auftaucht, hat der gesellige Charakter der Kunstwelt unerwartet positive Folgen. »Die Leute reden tatsächlich über die Kunst, die sie sich anschauen«, sagte er. »Wenn ich etwas von Roberto Bolaño lese, kann ich nur mit sehr wenigen Menschen darüber sprechen. Lesen ist ein langwieriger und einsamer Akt, Kunst dagegen fördert die Bildung imaginierter Gemeinschaften.«
Trotz ihrer Selbstbezogenheit und ähnlich einer Gemeinschaft gläubiger Adepten ist die Kunstwelt vom Konsens ebenso abhängig wie von individueller Analyse und kritischer Reflexion. Die Kunstwelt betet zwar das Unkonventionelle an, aber sie strotzt vor Konformität. Künstler schaffen Werke, die »aussehen wie Kunst«, und ihr Auftreten ist dazu angetan, stereotype Vorstellungen zu verstärken. Kuratoren erfüllen die Erwartungen ihrer Kollegen und Museumsvorstände. Sammler strömen in Scharen herbei, um die Werke einer Handvoll Künstler zu kaufen, die gerade en vogue sind. Kritiker halten den Finger in die Luft, um zu erspüren, woher der Wind weht. Originalität wird nicht immer belohnt, doch die Risikobereitschaft und Innovationskraft einiger weniger verschafft dem Rest eine Daseinsberechtigung.
Der Boom des Kunstmarkts bildet den Hintergrund dieses Buches. Die Frage, warum es mit diesem Markt in den vergangenen zehn Jahren so steil nach oben ging, ließe sich mit einer Gegenfrage beantworten: Warum ist Kunst heute so populär? Die Geschichten, die in diesem Buch erzählt werden, suggerieren immer wieder Antworten. An dieser Stelle jedoch möchte ich ein paar knappe Thesen wagen. Erstens sind wir heute gebildeter als je zuvor und haben einen gesteigerten Appetit auf kulturell komplexere Güter entwickelt. Im Idealfall regt Kunst zum genussvollen Nachdenken an. Je mehr kulturelle Bereiche der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, desto größer ist das Publikum für jene Segmente, die ausgelaugte, konventionelle Sicht- und Denkweisen in Frage zu stellen suchen. Zweitens: Wir sind zwar gebildeter, aber wir lesen immer weniger. Unsere Kultur wird heute in weiten Teilen vom Fernsehen oder von YouTube bestimmt. Die einen beklagen diese neue, zweite Mündlichkeit (»secondary orality«), die anderen verweisen auf den damit verbundenen Zugewinn an visueller Kompetenz, die ein größeres intellektuelles Vergnügen am Visuellen ermöglicht. Drittens ist Kunst in einer zunehmend globaleren Welt wahrhaft grenzüberschreitend. Sie wird zu einer lingua franca und kommt einem gemeinsamen Anliegen auf einer Weise entgegen, wie es an Sprache gebundenen kulturellen Äußerungen niemals möglich wäre.
Ein weiterer Grund für die gewachsene Popularität von Kunst ist paradoxerweise die Tatsache, dass sie so teuer ist. Hochpreisige Kunstwerke produzieren Schlagzeilen in den Medien, die wiederum die Vorstellung von Kunst als Luxusgut und Statussymbol popularisiert haben. In den vergangenen zehn Jahren wurden global gesehen die Reichsten noch reicher, einige wurden Milliardäre. Wie Amy Cappellazzo von Christie’s meinte: »Wenn man vier Häuser und einen Privatjet hat, was kann es dann noch geben? Kunst bereichert das Leben auf einzigartige Weise. Warum sollten sich die Leute nicht auf Ideen einlassen wollen?« Gewiss, die Zahl der Menschen, die Kunst nicht nur sammeln, sondern horten, ist von ein paar hundert auf ein paar tausend gestiegen. Im Jahr 2007 verkaufte Christie’s 793 Kunstwerke für jeweils mehr als eine Million Dollar. In einer digitalen Welt klonierbarer kultureller Güter gewinnen singuläre Kunstwerke die Bedeutung von Immobilien. Sie erhalten den Status solider Vermögenswerte, die sich nicht einfach in Luft auflösen. Auktionshäuser haben zudem Menschen umworben, die sich bis dahin vom Kunstkauf ausgeschlossen fühlten. Und die Möglichkeit des Wiederverkaufs hat die relativ neuartige Idee nach sich gezogen, dass zeitgenössische Kunst eine gute Geldanlage sei und dem Markt »mehr Liquidität« gebracht habe.
Wie stark der Markt geworden war, zeigte sich nicht nur daran, dass Sammler über die exorbitanten Preise klagten und die Ausstellungsfläche vieler Galerien immer größer wurde. Der Reichtum hat sich nach unten ausgebreitet. Mehr und mehr Künstler gehören zu den Besserverdienern, einige sind so reich geworden wie Popstars. Kritiker haben mit ihren Texten über Kunst zusätzliche Zeitungs- und Zeitschriftenseiten gefüllt. Kuratoren sind aus den Museen zu besser bezahlten Jobs in den Galerien abgewandert. Doch der boomende Markt hat auch die Wahrnehmung verändert. Viele sind besorgt, die Bewertung von Kunst entsprechend ihrem Marktpreis habe andere Formen der Wertschätzung wie positive Kritiken, Kunstpreise und Museumsausstellungen in den Hintergrund gedrängt. Sie verweisen auf Künstler, die durch den ungezügelten Wunsch zu verkaufen vom Kurs abgekommen sind. Noch der am stärksten kommerziell orientierte Händler wird jedoch sagen, Geldverdienen dürfe nur ein Nebeneffekt von Kunst, nicht das Hauptziel eines Künstlers sein. Kunst verlange tiefgründigere Motive als Profit, um sich von anderen kulturellen Formen abzugrenzen und über sie zu erheben.
Die Vielgestaltigkeit, Undurchsichtigkeit und regelrechte Geheimniskrämerei der Kunstwelt macht es schwierig, allgemeingültige Aussagen zu treffen, und nahezu unmöglich, alles zu ergründen. Zudem ist es schwierig, zu dieser Welt Zugang zu erhalten. Ich habe versucht, diese Probleme dadurch zu lösen, dass ich sieben Geschichten aus sechs Städten in fünf Ländern erzähle. Jedes Kapitel umfasst zeitlich das Geschehen eines einzigen Tages, und dadurch bekommt, wie ich hoffe, der Leser das Gefühl, ganz nah dabei zu sein. Jede Geschichte basiert auf dreißig bis vierzig Tiefeninterviews und vielen Stunden »teilnehmender Beobachtung« hinter den Kulissen. Statt »Fliege an der Wand«, wie man diese Forschungsmethode beschrieben hat, wäre die treffendere Metapher die einer »streunenden Katze«. Sie ist neugierig und offen, aber nicht bedrohlich; gelegentlich aufdringlich, aber auch leicht zu ignorieren.
Die beiden ersten Kapitel stecken extreme Gegensätze ab. Die Auktion beschreibt eine Abendversteigerung bei Christie’s im Rockefeller Center von New York und folgt dem Takt der Hammerschläge des Auktionators. Eine Auktion ist in der Regel eine künstlerfreie Zone und eine Endstation für Kunstwerke, manche sagen, deren Leichenhaus. Das Crit-Seminar wiederum erkundet, wie es in einer legendären Veranstaltung am California Institute of the Arts zugeht: Hier verwandeln sich Studenten in Künstler und erlernen die Sprache ihres Gewerbes. Der Auktionssaal, wo in schneller Folge mit Millionenbeträgen gehandelt wird, könnte von der Kunsthochschule mit ihrer Bedächtigkeit und ihren bescheidenen finanziellen Mitteln nicht weiter entfernt sein, beide vermitteln jedoch einen Einblick in die Funktionsweise der Kunstwelt.
Die Kapitel Die Messe und Der Atelierbesuch stehen in einer ähnlichen Wechselbeziehung: Hier geht es um Produktion, dort um Konsumtion. Ist das Atelier ein optimaler Ort, um das Werk eines einzelnen Künstlers zu verstehen, dann ist die Kunstmesse eine schicke Verkaufsschau, wo die Menschenmassen und die Unmengen ausgestellter Kunst den Blick auf das einzelne Werk erschweren. Das Messe-Kapitel spielt in der Schweiz am Eröffnungstag der Art Basel, ein Event, das zur Internationalisierung und saisonalen Ausrichtung der Kunstwelt beigetragen hat. Der Künstler Takashi Murakami, der in Basel nur einen kurzen Auftritt hat, ist Protagonist des Kapitels Der Atelierbesuch, das in den drei Produktionsstätten des Künstlers und in einer Gießerei in Japan spielt. Murakamis Firma, die größer ist als Andy Warhols Factory, verfügt über drei Ateliers, in denen nicht einfach nur Kunstwerke produziert werden; sie sind eine Plattform zur Inszenierung seiner künstlerischen Absichten und Bühne für seine Verhandlungen mit Kuratoren und Händlern.
Kapitel 4 und 5, Der Preis und Die Zeitschrift, erzählen Geschichten über Debatten, Werturteile und die öffentliche Präsentation von Kunst. Der Preis spielt am Tag der Bekanntgabe der Jury-Entscheidung, wer von den vier Künstlern auf der Shortlist des Turner-Preises das Siegerpodest besteigen wird, um im Rahmen einer vom Fernsehen übertragenen Preisverleihung einen Scheck im Wert von 25 000 Pfund entgegenzunehmen. Im Jahr 2006 war es die in Kiel geborene Malerin Tomma Abts. Das Kapitel thematisiert den Wettbewerb zwischen den Künstlern, die Bedeutung des Preises für ihre Karriere sowie die Beziehung zwischen den Medien und dem Museum.
Im Kapitel Die Zeitschrift untersuche ich verschiedene Aspekte der Kunstkritik, vor allem ihre Funktion und Fragen ihrer Integrität. Ich lasse die Herausgeber von Artforum International zu Wort kommen, der führenden Kunstzeitschrift, spreche mit einflussreichen Kritikern wie Roberta Smith von der New York Times und besuche einen kunsthistorischen Kongress. Und ich gehe der Frage nach, in welcher Weise die Titelseite einer Zeitschrift und die Rezensionen in Zeitungen und Zeitschriften die kunstgeschichtliche Einordnung zeitgenössischer Kunst beeinflussen.
Das letzte Kapitel, Die Biennale, führt auf die Biennale von Venedig, die älteste internationale Kunstausstellung ihrer Art. Venedig ist hier keine idyllische Urlaubskulisse, sondern Hintergrund eines Kunstevents, dessen spektakuläre gesellschaftliche Bedeutung den Blick auf die Kunst selbst verstellt. Mein Augenmerk richtet sich hier auf die Kuratoren, die derartige Veranstaltungen organisieren, sowie auf das Moment der Erinnerung – entscheidet doch erst der Rückblick, welche zeitgenössischen Kunstwerke tatsächlich große Kunst sind.
Die Kunstwelt ist kein »System«, das wie geschmiert funktioniert, sondern ein Gefüge sozialer bzw. halbprofessioneller Gruppen, die Kunst in ganz unterschiedlicher Weise definieren. Fast alle, die in diesem Buch zu Wort kommen, sind der Ansicht, Kunst müsse Denkanstöße geben. Im Auktions-Kapitel jedoch fungiert Kunst vorrangig als Geldanlage und Luxusgut. Im Crit-Kapitel ist Kunst ein intellektuelles Wagnis, Lebensstil und Brotberuf zugleich, im Messe-Kapitel Fetisch und Freizeitbeschäftigung – eine Ware mit einem etwas anderen Stellenwert als bei der Auktion. Im Kapitel Der Preis ist Kunst eine Museumsattraktion, eine Story für die Medien und Beleg für den Wert eines Künstlers, in Die Zeitschrift ein Vorwand für Worte, etwas, das debattiert und gefördert werden muss. Und in Der Atelierbesuch ist Kunst all das gleichzeitig; hier liegt einer der Gründe, warum Murakami aus soziologischer Perspektive so faszinierend ist. Im Biennale-Kapitel schließlich wird Kunst zum Alibi für das mediale Miteinander, eine internationale Sensation und eine touristische Aktivität.
Die Geschichten des vorliegenden Buches fegen wie ein Wirbelsturm durch eine einzige Woche, für mich jedoch war es ein langes und langwieriges Unterfangen. Für andere ethnographische Projekte bin ich in die nächtliche Londoner Clubszene eingetaucht oder habe undercover als »Markenplanerin« in einer Werbeagentur gearbeitet. Doch sosehr ich darauf brannte, das jeweilige Milieu genauer kennenzulernen, am Ende war ich der Sache überdrüssig. Die Kunstwelt dagegen hat trotz meiner intensiven Recherchen ihre Faszinationskraft für mich nicht verloren. Ein Grund dafür ist zweifellos, dass man sich auf so vergnügliche Weise paradox verhalten kann, materialistisch und idealistisch, elitär und doch eigentümlich aufgeschlossen. Sicher hat es auch damit zu tun, dass sich in der Kunstwelt die Grenzen zwischen Arbeit und Spiel, lokaler Gültigkeit und Internationalität, Kultur und Ökonomie verwischen – was auf die Charakteristika zukünftiger sozialer Sphären verweist. Viele Insider verabscheuen die Kunstwelt, ich aber stimme Charles Guarino zu, einem der Herausgeber von Artforum. Im Milieu der Kunst, meinte er einmal, »habe ich die meisten Gleichgesinnten gefunden – jede Menge schräge Vögel, überqualifizierte, anachronistische und anarchische Typen, unter denen ich mich wohl fühle«. Und wenn das Gerede verstummt ist und alle nach Hause gehen, ist es einfach wunderbar, in einem Raum mit guter Kunst zu stehen.
MARLENE DUMASJule-die Vrou,1985
Kapitel 1Die Auktion
Ein Novembernachmittag in New York, 16.45 Uhr. Christopher Burge, Chefauktionator von Christie’s, macht einen Soundcheck. Fünf Leute, am Boden kniend, messen mit dem Zollstock die Entfernung zwischen den Stühlen ab, um den Saal mit möglichst vielen zahlungskräftigen Kunden vollzupacken. Bilder von »Blue-Chip«-Künstlern wie Cy Twombly und Ed Ruscha hängen an den mit beigefarbenem Stoff bespannten Stellwänden. Böse Zungen lästern, das Interieur erinnere an ein »nobles Beerdigungsinstitut«, andere mögen den Retro-Touch der fünfziger Jahre.
Burge beugt sich über die dunkle Holzbrüstung seines Pults und ruft mit unverkrampft englischem Akzent Preise in den leeren Saal: »Eine Million eins. Eine Million zwei. Eine Million drei. Für Amys Bieter am Telefon. Nicht für Sie, Sir. Und auch nicht für Sie, Madam.« Er lächelt. »Eine Million vierhunderttausend Dollar für die Dame hinten … Eine Million fünf. Danke, Sir.« Er wirft einen Blick auf die Reihe Telefone, die in zwei Stunden mit Mitarbeitern von Christie’s besetzt sein werden, und überlegt, ob er mit einem weiteren Gebot rechnen kann. Er wartet ruhig, nickt zur Bestätigung, dass der Telefonbieter nicht höher gehen wird, und richtet seine Aufmerksamkeit wieder in den Saal, um eine letzte psychologische Einschätzung seiner beiden anderen imaginären Käufer vorzunehmen. »Sind wir fertig?«, erkundigt er sich freundlich. »Ich verkaufe … für eine Million fünfhunderttausend Dollar an den Herrn am Gang«, und er lässt den Hammer mit einem so kurzen heftigen Schlag niedergehen, dass ich zusammenzucke.
Der Hammer knallt aufs Pult, das Urteil ist gesprochen. Ein solcher Schlag setzt einen Schlussstrich unter jedes Los, ist aber auch eine kleine Strafe für alle, die nicht hoch genug geboten haben. Und Burge macht ihnen die Sache auf äußerst subtile Art und Weise schmackhaft … dieses einzigartige Kunstwerk könnte Ihnen gehören, ist es nicht schön? Sehen Sie, wie viele es haben wollen, bieten Sie mit, geben Sie sich einen Ruck, Geld ist das geringste Problem … um im nächsten Moment alle mit Ausnahme des höchsten Bieters niederzuknüppeln, als läge die ganze Verführung und Brutalität des Kunstmarkts im Fortgang der Versteigerung dieses einen Loses.
Ein leerer Saal ist eine Angstkulisse, für einen Auktionator ebenso wie für einen Schauspieler. Beide träumen auch, dass sie vor dem Publikum splitternackt dastehen. In dem Albtraum jedoch, den Burge am häufigsten hat, kann er die Versteigerung nicht durchführen, weil seine Auktionsnotizen ein unentzifferbarer Wirrwarr sind. »Hier gibt es Hunderte von Leuten, die schnell unruhig werden«, sagt er. »Bei einem Schauspieler ist es so, dass sein Stichwort fällt, er aber einfach nicht auf die Bühne kann. Ich dagegen kann nicht anfangen, weil ich aus meinem Buch nicht schlau werde.«
Manch einer würde alles dafür geben, um Burges streng vertrauliches Auktionatorenbuch in die Finger zu bekommen. Es ist gewissermaßen das Drehbuch für die Versteigerung. An jenem Abend besteht es aus vierundsechzig Seiten, eine für jedes Los. Auf jeder Seite ist vermerkt, wer wo sitzt, wer mit hoher Wahrscheinlichkeit bieten wird und ob es einen aggressiven Käufer gibt oder einen »Aasgeier«, der ein Schnäppchen machen will. Burge hat sich auch die einzelnen Summen notiert, die abwesende Bieter angegeben haben, außerdem das »Limit« (den Mindestverkaufspreis eines Werks) und bei fast vierzig Prozent der Lose die »Garantie« oder Mindestsumme, die einem Einlieferer zugesichert wird, ob das Werk nun verkauft wird oder nicht.
Zweimal jährlich (im Mai und November) in New York und dreimal jährlich (im Februar, Juni und Oktober) in London führen Christie’s und Sotheby’s ihre großen Versteigerungen zeitgenössischer Kunst durch. Gemeinsam kontrollieren diese beiden Häuser 98 Prozent des weltweiten Auktionsmarkts für Kunst. Bei Verkauf denkt man normalerweise an Rabatte und Schnäppchen, doch Auktionshäuser wollen Höchstpreise erzielen. Ja, es sind gerade diese ungewöhnlich hohen Summen, die Auktionen zu Sportevents für die High Society machen. Die Schätzungen an diesem Tag reichen von 90 000 Dollar bis zu Summen, die so hoch sind, dass sie nur »auf Anfrage« genannt werden.
»Wenn die Versteigerung näher rückt«, sagt Burge, »geht es mit Volldampf voraus. Ich habe das Ganze bereits fünfzigmal geprobt, ich mache mich selbst verrückt und spiele alle Möglichkeiten des Ablaufs durch.« Burge rückt seine Krawatte zurecht und streicht sich die dunkelgraue Anzugjacke glatt. Sein Haarschnitt ist so normal, dass man ihn gar nicht beschreiben kann. Seine Diktion ist tadellos, die Gestik zurückhaltend. »Bei diesen Abendauktionen«, fährt er fort, »ist das Publikum potenziell feindselig. Es ist wie im Kolosseum, wo die Zuschauer nur darauf warten, den Daumen zu heben oder zu senken. Sie wollen ein Fiasko. Sie wollen Blut sehen und ›Raus mit ihm‹ brüllen. Oder aber Rekordpreise, eine Riesenaufregung, großes Gelächter – einen unterhaltsamen Theaterabend.«
Burge gilt als der beste Auktionator der Branche. Er steht im Ruf, aufrichtig liebenswürdig zu sein und das Geschehen im Saal fest im Griff zu haben. Für mich ist er ein selbstbewusster Orchesterdirigent oder ein gebieterisch strenger Zeremonienmeister, nicht das Opfer eines Gladiatorenkampfes. »Wenn Sie wüssten, was für eine Angst ich habe«, sagt er. »Eine Auktion ist die langweiligste Sache der Welt. Die Leute sitzen zwei Stunden da und hören sich dieses idiotische Geleiere an. Es ist heiß. Es ist unbequem. Einige schlafen ein. Für unsere Mitarbeiter ist es sehr stressig, und für mich ist es der reinste Horror.«
»Sie erwecken aber den Eindruck, als würde es Ihnen Spaß machen«, halte ich ihm entgegen.
»Das ist der Scotch«, seufzt er.
Burges Phantasie beschränkt sich keineswegs auf die Preise, die er ansagt. Selbst in diesem knallharten Segment des Kunstbetriebs haben die Akteure Charakter. Burge wirkt ausgesprochen konventionell, aber wie sich herausstellt, ist diese Normalität im äußeren Erscheinungsbild zumindest teilweise gewollt.
»Meine Sorge ist es, affektiert zu wirken und zu einer Karikatur meiner selbst zu werden. Ein kleiner Stab von Trainern und Stimmbildnern beobachtet uns. Wir machen einen Videomitschnitt und Manöverkritik, um sprachliche Ticks, allzu heftiges Gestikulieren und andere Eigenheiten besser in den Griff zu bekommen.«
Im Handel mit zeitgenössischer Kunst ist der Druck der Öffentlichkeit ein relativ neues Phänomen. Werke lebender Künstler werden mit einem solchen öffentlichen Tamtam erst seit Ende der fünfziger Jahre versteigert. Maler wie Picasso wurden durch Privatverkäufe zu erfolgreichen Künstlern. Zwar wussten die Leute, dass Picasso ein berühmter Künstler war, und sagten: »Das kann mein Kind auch malen«, aber die Preise, die seine Arbeiten erzielten, schockierten niemanden, denn man kannte sie nicht. Heute schafft es ein Maler auf die Titelseite einer großen Tageszeitung, nur weil seine Arbeit bei einer Auktion einen Rekordpreis erzielt hat. Die zeitlichen Abstände von dem Moment, da ein Werk das Atelier verlässt, bis zum Wiederverkauf auf dem Sekundärmarkt werden zudem immer kürzer. Die Nachfrage nach neuer, frischer, junger Kunst war nie so groß wie heute. Aber das, sagt Burge, ist auch ein Problem des Angebots: »Wir können immer weniger älteres Material anbieten, deshalb verlagert sich der Markt mehr und mehr in Richtung Gegenwart. Vom Großhandel mit Waren aus zweiter Hand entwickeln wir uns immer mehr zu einem echten Einzelhandel. Durch den Mangel an älterer Ware rücken diese neueren Arbeiten stärker ins Rampenlicht.«
Burge verabschiedet sich, er muss zu der wichtigen letzten Besprechung unmittelbar vor der Auktion, wo er jede Summe bestätigen und letzte Details in sein streng geheimes Drehbuch eintragen wird. »Kurz vor Auktionsbeginn wissen wir gewöhnlich sehr genau, wie sich der Verkauf gestalten wird«, sagt ein Mitarbeiter von Christie’s. »Wir sind sämtlichen Bitten um einen Zustandsbericht bezüglich Reparatur und Restauration der Werke nachgekommen. Die meisten unserer Käufer kennen wir persönlich. Wir wissen zwar nicht, wie weit sie mitgehen werden, aber wir wissen recht genau, wer wofür bietet.«
Früher gab es ein ungeschriebenes Gesetz, dem zufolge Auktionshäuser »versuchten«, keine Kunst zu verkaufen, die nicht mindestens zwei Jahre alt war. Sie wollten den Händlern nicht auf die Füße treten, weil sie selbst nicht über die Zeit und Expertise verfügten, einen Künstler von Anfang an zu vermarkten. Bis auf wenige bedeutende Ausnahmen wie Damien Hirst gelten lebende Künstler zudem als unberechenbar und unbequem. Wie mir ein Mitarbeiter von Sotheby’s in einem Anflug von Freimütigkeit erklärte: »Wir handeln nicht mit Künstlern, sondern mit Kunstwerken, und das ist auch gut so. Ich hatte viel mit Künstlern zu tun, sie gehen einem wirklich massiv auf den Keks.« Folglich kann der Tod eines Künstlers sehr gelegen kommen, weil dann das Angebot begrenzt ist. Es liegt ein abgeschlossenes Œuvre vor, und damit ist der Weg offen für einen klar definierten Markt.
Die meisten Künstler haben nie eine Kunstauktion besucht und verspüren auch gar nicht den Wunsch, dies zu tun. Sie sind enttäuscht, dass Auktionshäuser Kunst wie eine x-beliebige Ware behandeln. In der Sprache der Auktionsbranche spielen Begriffe wie »Properties«, »Assets« und »Lose« keine geringere Rolle als Gemälde, Skulpturen und Fotografien. Es werden »Evaluierungen« vorgenommen, keine Kritiken geschrieben. Ein »guter Basquiat« beispielsweise muss aus dem Jahr 1982 oder 1983 stammen und einen Kopf, eine Krone und die Farbe Rot aufweisen. Entscheidend ist nicht die Bedeutung eines Kunstwerks, entscheidend sind seine Alleinstellungsmerkmale und die Fetischierung der frühesten Spuren einer künstlerischen Marke, eines Stils. Paradoxerweise sind die Mitarbeiter von Auktionshäusern zugleich diejenigen Akteure der Kunstwelt, in deren Verkaufsrhetorik romantische Begriffe wie »Genie« oder »Meisterwerk« eine Schlüsselrolle spielen.
Primärhändler, die einen Künstler vertreten, Ausstellungen atelierfrischer Werke veranstalten, den Künstler auf seinem Weg begleiten und versuchen, ihm zum Erfolg zu verhelfen, betrachten Auktionen oft als etwas Amoralisches, ja als das Böse schlechthin. »Es gibt nur zwei Berufsgruppen, die den Ort, wo die Transaktionen stattfinden, als Haus bezeichnen«, sagte einer von ihnen. Sekundärmarkthändler dagegen haben mit den Künstlern selbst kaum etwas zu tun. Sie arbeiten eng mit den Auktionshäusern zusammen und betreiben ein sorgfältig geplantes Verkaufsspiel.
Um über die Preise ihrer Künstler nicht die Kontrolle zu verlieren, verkaufen Primärhändler in der Regel nicht an Leute, die Kunstwerke an eine Auktion weiterreichen. Wird das Werk eines von ihnen vertretenen Künstlers bei einer Versteigerung teuer verkauft, können zwar auch die Galeristen für aktuelle Arbeiten dieses Künstlers mehr verlangen, aber ein solches Ranking entsprechend dem Marktwert kann der Karriere eines Künstlers auch durchaus schaden. Viele betrachten die Auktionen als das Barometer des Kunstmarkts. Ein Künstler ist nachgefragt, wenn er eine große Museumsausstellung hat, drei Jahre später jedoch erreicht sein Werk bei einer Ausstellung vielleicht nicht einmal mehr den Mindestverkaufspreis, und er sieht sich der Schmach ausgesetzt, dass seine Arbeiten »zurückgehen« (ein Ausdruck, der besagt, dass ein Werk nicht verkauft werden konnte). Auktionen machen öffentlich bekannt, dass ein Käufer in einem Jahr eine halbe Million Dollar für ein Kunstwerk hinlegt, im Jahr darauf aber für ein ähnliches Werk desselben Künstlers nicht einmal mehr die Hälfte zu zahlen bereit ist, und damit verschärfen sie die abrupten Geschmacksschwankungen. Ein Rekordpreis bei einer Auktion belebt die Aufmerksamkeit für das Œuvre eines Künstlers, ein Rückgang ist wie der Besuch von Gevatter Tod.
Es ist 17.30 Uhr. Ich bin einen halben Häuserblock entfernt mit dem Kunstberater Philippe Ségalot zum Interview verabredet. Ich eile an Gil vorbei, dem allseits geliebten Pförtner von Christie’s, trete durch die Drehtür auf die 49. Straße West und schaffe es, dreißig Sekunden früher als mein Gesprächspartner im Café zu sein. Ségalot war früher bei Christie’s, jetzt ist er Teilhaber der einflussreichen Beratungsagentur Giraud, Pissarro, Ségalot. Er zählt zu jenen Akteuren, die, gestützt auf die Kaufkraft seiner Klienten, einem Künstler einen Markt erschließen können.
Wir entscheiden uns beide für Fisch-Carpaccio und Mineralwasser. Ségalot trägt zwar einen konventionellen dunkelblauen Anzug, aber seine stark gegelten Haare stehen kerzengerade nach oben, und damit ist er weder »in« noch wirklich »out«, sondern pflegt einen ganz eigenen Stil. Ségalot hat nicht Kunst studiert, sondern Management, bevor er in die Marketing-Abteilung von L'Oréal in Paris kam. »Dass ich von der Kosmetik zur Kunst gewechselt bin, ist kein Zufall. Hier wie dort haben wir es mit Schönheit zu tun, mit Dingen, die keinen praktischen Zweck erfüllen, mit Abstraktionen.«
Ségalot spricht sehr schnell und leidenschaftlich und in einem stark französisch gefärbten Englisch. Er ist seit langem Berater des Selfmade-Milliardärs François Pinault [1], der als Besitzer von Christie’s und als einer der führenden Sammler auf dem Kunstmarkt gleich zwei Trümpfe in der Hand hält. Wenn Pinault bei Christie’s für ein Kunstwerk eine Garantiesumme gewährt, verdient er entweder mit dem Verkauf oder fügt seiner Sammlung ein weiteres Stück hinzu, falls das Werk zurückgeht. »François Pinault ist mein Lieblingssammler«, gesteht Ségalot. »Er hat eine echte Leidenschaft für zeitgenössische Kunst und einen untrüglichen Instinkt für Meisterwerke. Er weiß, was Qualität ist. Und er hat ein unglaubliches Auge.« Die Sammlungen, an denen man arbeitet, mit einem Nimbus zu umgeben zählt zu den Hauptaufgaben eines Kunstberaters. Jedes Kunstwerk, das Pinault erwirbt, erhält den wertsteigernden Stempel seiner – Pinaults – Provenienz. Ohne den Künstler gibt es kein Werk, aber durch welche Hände das Werk geht, ist entscheidend für dessen Wertzuwachs. Und selbstverständlich streicht jeder Akteur des Kunstmarkts die Provenienz der Werke heraus, die ihm am Herzen liegen.
Pinault ist einer von zwanzig Sammlern, für die Ségalot und seine Partner regelmäßig tätig sind. »Als Sammler ist man in der Kunstwelt in der mit Abstand besten Situation«, sagt Ségalot. »Das Zweitbeste ist das, was wir machen. Wir bringen die Leute dazu, dass sie die Werke kaufen, die wir selbst kaufen würden, wenn wir es uns leisten könnten. Wir leben ein paar Tage oder Wochen mit diesen Werken, aber am Ende verlassen sie uns, und das verschafft eine enorme Befriedigung. Manchmal sind wir furchtbar eifersüchtig, aber es ist unser Job, das richtige Werk mit dem richtigen Sammler zusammenzubringen.«
Woher weiß Ségalot, dass er das richtige Werk gefunden hat? »Das spürt man einfach«, sagt er emphatisch. »Ich lese keine Artikel über Kunst. Mich interessieren diese Texte nicht. Ich bekomme zwar alle diese Kunstzeitschriften, aber ich lese sie nicht. Ich möchte mich nicht von den Kritiken beeinflussen lassen. Ich schaue. Für mich zählen die visuellen Eindrücke. Man muss über Kunst gar nicht so viel reden. Ein großes Werk spricht für sich selbst, davon bin ich überzeugt.« Die meisten Sammler, Berater und Händler verlassen sich auf ihren Instinkt und reden auch gern darüber. Kaum ein Kunstprofi dagegen ist bereit zuzugeben, dass er nichts über Kunst liest. Das erfordert Chuzpe. Die meisten Abonnenten von Kunstzeitschriften sehen sich nur die Bilder an, und viele Sammler klagen, dass die Kunstkritiken, insbesondere die des führenden Branchenblatts Artforum, unlesbar sind. Die meisten Kunstberater dagegen rühmen sich ihrer gründlichen Recherche.
Leute, die bei Auktionen kaufen, sagen, das sei etwas Unvergleichliches. »Das Herz schlägt schneller. Der Adrenalinspiegel steigt. Selbst der gelassenste Käufer bekommt Schweißausbrüche.« Wer im Saal mitbietet, ist Teil der Show, und wer kauft, erlebt einen öffentlichen Triumph. Ségalot behauptet von sich, nie nervös zu werden, kennt aber durchaus das Gefühl einer erotischen Eroberung. »Kaufen ist sehr einfach. Viel schwieriger ist es, der Versuchung zu kaufen zu widerstehen. Man muss wählerisch und anspruchsvoll sein, denn kaufen ist ein durch und durch befriedigender, machistischer Akt.«
Die Psychologie des Kaufens ist kompliziert, wenn nicht pervers. Seinen Klienten sagt Ségalot: »Die teuersten Käufe – die, bei denen man am meisten blutet – stellen sich am Ende als die besten heraus.« Ob es am intensiven Bietwettbewerb liegt oder am finanziellen Einsatz: Kunst, die schwer zu kriegen ist, hat etwas Unwiderstehliches und steigert die Begehrlichkeit, wie bei der Liebe. »Beauftragen Sie mich mit einem Gebot, aber rechnen Sie damit, dass ich es überschreite«, warnt Ségalot seine Klienten. »Manchmal hatte ich nach einem Kauf Bedenken, mit dem Sammler zu sprechen, weil ich doppelt so viel Geld ausgegeben hatte, als wir für größere Käufe vereinbart hatten.«
Ich würde ihn gern fragen, welcher Zusammenhang zwischen seinem Verdienst als Kunstberater und überpreisten Kunstwerken besteht. Arbeitet ein Berater nämlich auf Provisionsbasis, verdient er erst dann, wenn er ein Werk kauft. Arbeitet er dagegen auf Vorschussbasis, gibt es einen solchen Interessenkonflikt nicht. Aber während ich noch nach den richtigen Worten suche, um dieses heikle Thema anzuschneiden, wirft Ségalot einen Blick auf die Uhr. Er macht ein erschrockenes Gesicht, dann entschuldigt er sich, steht auf, bezahlt die Rechnung und sagt: »Es war mir ein Vergnügen.«
Ich bleibe noch sitzen, trinke mein Wasser aus und ordne die Gedanken in meinem Kopf. Ségalots Begeisterung ist ansteckend. Wir saßen fast eine Stunde zusammen, und er redete die ganze Zeit mit absoluter Überzeugungskraft. Dieses Talent ist eine Grundvoraussetzung für seinen Job. Denn einerseits geht es auch auf dem Kunstmarkt um die Regulierung von Angebot und Nachfrage, andererseits ist dieser Kunstmarkt eine Ökonomie des Glaubens. »Kunst ist nur so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen«, lautet das gängige Klischee. Das könnte die Beziehung eines Betrügers zu seinem Opfer beschreiben, doch die Leute, die auf dem Kunstmarkt erfolgreich sind, glauben jedes Wort, das sie sagen, zumindest in dem Moment, in dem sie es sagen. Bei Auktionen geht es um Vertrauen auf allen Ebenen: Vertrauen in die gegenwärtige und zukünftige kulturelle Bedeutung des Künstlers; Vertrauen in das Werk und seine Qualität und schließlich das Vertrauen darauf, dass andere sich nicht aus ihrem finanziellen Engagement zurückziehen.
18.35 Uhr. Die Türen der zweigeschossigen Glaswand im Foyer von Christie’s drehen sich im steten Strom der Ticketbesitzer. Viele Händler und Kunstberater sind bereits eingetroffen, denn die Abendversteigerung ist eine gute Gelegenheit, »das Geld« zu treffen und zu begrüßen. In der Garderobenschlange wie auch in der Warteschlange für die Ausgabe der Bieternummer – eine Tafel, die aussieht wie ein Paddel – wird darüber spekuliert, welche Objekte gut laufen werden und wer was kaufen wird. Jeder weiß irgendetwas. Man senkt die Stimme, wenn es um einen Namen oder eine Losnummer geht, nur das Urteil soll jeder hören können: »Das wird weggehen wie nichts« oder: »Dieser Schätzwert liegt völlig daneben.« Im Weggehen, um ihre Plätze einzunehmen, wünschen die Sammler einander »viel Glück« und verabreden sich »bis dann in Miami«. Überall nur lächelnde Gesichter.
Das Publikum ist international. Man hört viel Französisch mit belgischem, Schweizer und Pariser Akzent. Belgien und die Schweiz halten wahrscheinlich den höchsten Bevölkerungsanteil an Sammlern zeitgenössischer Kunst. Bis zum Zweiten Weltkrieg galt Frankreich als wichtigster Kunsthandelsplatz. Nach dem Krieg war bis Anfang der achtziger Jahre London die Hauptstadt der Kunstauktionen, heute jedoch, da meist telefonisch geboten wird, ist die britische Hauptstadt als Handelsplatz zweitrangig geworden. Betrachtet man diese vitale Szene, kann man kaum glauben, dass New York bis in die späten siebziger Jahre nur ein provinzieller Nebenschauplatz des Kunsthandels war. Christie’s hält in New York zwar erst seit 1977 Auktionen ab, aber heute ist »der Markt lebendig«, wie es ein Experte von Christie’s formuliert. »Alle wichtigen Akteure sind im Saal.«
Ich entdecke David Teiger, einen New Yorker Sammler Ende siebzig. Er spricht mit einer Dame gleichen Alters, die sich gut gehalten hat.
»Welche Epoche sammeln Sie?«, erkundigt sie sich.
»Die taufrische«, antwortet er.
»Dann mögen Sie also die Kunst junger Künstler?«, fragt sie ernst.
»Nicht unbedingt, aber ich kaufe sie«, scherzt er.
»Und … werden Sie heute Abend bieten?«
»Nein … ich komme nicht hierher, um zu kaufen. Ich komme, um die Luft zu schnuppern – das Aroma dessen, was im Ofen ist – und zu sehen, wohin das Publikum tendiert. Was nichts mit dem zu tun hat, wohin ich tendiere. Mich interessiert das, was übersehen oder unterschätzt wird.«
Teiger ist sehr stolz auf seine Unabhängigkeit. Auktionen haben für ihn zu viel mit Herdentrieb zu tun. Bereits 1963 hat er in einer Ausstellung der Stable Gallery Andy Warhol gekauft. »Wissen Sie, wie viel ich dafür bezahlt habe?«, fragt er. »720 Dollar! Und wissen Sie, wann das MoMA seinen ersten Warhol gekauft hat? … 1982!« Warum also sollte er heute zehn Millionen für einen unbedeutenderen Warhol ausgeben? Das widerspräche seinem Selbstbild als risikobereiter Abenteurer. Er ist kein solcher Sammler.
Wer also kauft bei einer Auktion? Viele »ernsthafte« Sammler zeitgenössischer Kunst kaufen direkt beim Primärhändler. Es ist sehr viel billiger, wenngleich auch sehr viel riskanter, den anderen voraus zu sein. Der Sekundär- oder Wiederverkaufsmarkt birgt ein geringeres Wagnis, weil das Werk bereits markterprobt ist. Kunst ist immer »preislos«, aber Sicherheit kostet. Ein kleiner Prozentsatz der Sammler kauft ausschließlich bei Auktionen. »Sie schätzen es, an einen festen Zeitrahmen gebunden zu sein«, sagt ein Direktor von Sotheby’s. »Sie sind vielbeschäftigt, und die Versteigerung zwingt sie dazu, sich zu organisieren. Auch der offene Charakter einer Auktion sagt ihnen zu, vor allem, wenn es erkennbar einen Unterbieter gibt, der bereit ist, einen ähnlichen Preis zu bezahlen. Und dann schätzen sie die Gewissheit, an einem bestimmten Ort an einem bestimmten Tag einen Marktpreis bezahlt zu haben.«
Auktionskäufe ersparen es einem Sammler zudem, das zeitraubende Spiel mitzuspielen, jenes Taktieren, wie es Primärhändler erwarten, die im Interesse der Karriere der von ihnen vertretenen Künstler nur an Sammler verkaufen wollen, die eine bestimmte Reputation haben. Die Schlange derer, die Kunstwerke kaufen wollen, insbesonders von Malern, die pro Jahr nur eine begrenzte Zahl von Werken liefern, kann lang sein – so lang, dass viele Sammler nie als elitär oder kultiviert genug eingestuft werden, um »ein Werk angeboten zu bekommen«. Manche Auktionshäuser beklagen »den völligen Mangel an Material auf dem Markt« und das »undemokratische« Geschäftsgebaren der Primärhändler. »Offen gestanden«, erklärt ein Experte bei Sotheby’s, »empfinde ich Wartelisten als unanständig. Bei einer Auktion gibt es solche hierarchischen Listen nicht. Jeder kann sich hier aus dem Nichts heraus an die Spitze setzen, einfach nur indem er als Letzter die Hand hebt.«
Um 18.50 Uhr laufe ich die Treppe zum Auktionssaal hoch. Der uns Presseleuten zugewiesene Stehplatzbereich liegt hinter einem roten Absperrseil. Diese räumliche Anordnung will die Presse in ihre Schranken verweisen. Bei einer Auktion von Werken Alter Meister bei Sotheby’s mussten wir uns demütigend große weiße Schildchen mit der Aufschrift »Presse« anstecken. In der Hierarchie dieser Welt von Geld und Macht sind die Journalisten eindeutig ganz unten angesiedelt. Wie ein Sammler mit Blick auf einen bestimmten Journalisten bemerkte: »Offenbar wird er nicht besonders gut bezahlt. Er hat nicht wirklich Zugang zu wichtigen Leuten und ist auf das angewiesen, was nebenbei abfällt, um seine Artikel zu schreiben. Es ist nicht besonders lustig, sich am großen Tisch rumzudrücken, wenn man dort unerwünscht ist.«
Eine Journalistin bildet die Ausnahme von der Regel, denn sie schreibt für die New York Times. Carol Vogel hat einen Sitzplatz jenseits des roten Seils, was es ihr ermöglicht, aufzustehen und mit ihren hochhackigen Stiefeln und dem grauen Bob vor dem Pressepulk auf und ab zu staksen. Sie ist die stolze Verkörperung der Macht ihrer Zeitung. Ich sehe Ms. Vogel mit wichtigen Händlern und Sammlern sprechen. Sie erhält Zugang, weil alle versuchen, auf ihre Berichterstattung Einfluss zu nehmen, auch wenn sie mit ihren Tipps und Erkenntnissen nicht viel mehr als PR-Verlautbarungen abgibt.
Im dichten Gedränge des Pressepferchs entdecke ich Josh Baer. Eigentlich ist er kein Journalist, aber er veröffentlicht seit mehr als zehn Jahren einen elektronischen Newsletter, The Baer Faxt, in dem er unter anderem berichtet, wer bei den Auktionen kauft und unterbietet. Baer sieht ein bisschen aus wie Richard Gere. Ein echter New Yorker, cool, mit vollem silbergrauem Haar und einer Brille mit schwarzem Gestell. Seine Mutter ist eine recht angesehene minimalistische Malerin, er selbst hat zehn Jahre lang eine Galerie geleitet, kennt das Milieu also bestens. »Der Newsletter verstärkt die Illusion von Transparenz«, sagt er. »Die Leute sind überinformiert, aber sie wissen zu wenig. Sie bilden sich ein, sie wüssten Bescheid. Sie betrachten ein Gemälde, und dann sehen sie den Preis und denken, der einzige Wert sei der Auktionswert.« Die Kunstszene im Allgemeinen und der Kunstmarkt im Besonderen sind zwar schwer zu durchschauen, dennoch lüftet sich ein wenig der Schleier, wenn man zum vertraulichen innersten Kreis gehört. Wie Baer sagt: »Die Leute reden gern über sich selbst, um zu zeigen, wie viel sie wissen. Dagegen kämpfe ich gerade an … ich muss dem Impuls widerstehen, andere zu beeindrucken, indem ich zeige, wie wichtig ich bin.«
Das Interesse der meisten Journalisten hier begrenzt sich auf ein paar wenige Informationen. Sie notieren sich die Preise und versuchen mitzuverfolgen, wer bietet und wer kauft. Keiner von ihnen ist ein Kritiker. Sie schreiben nicht über Kunst, sondern machen sich das hier erworbene Insiderwissen zunutze. Ein Journalist schreibt sich die Nummern der Tafeln auf, die die potenziellen Bieter beim Betreten des Saals in der Hand halten, damit er später weiß, wer das Werk gekauft hat, wenn der Auktionator die Bieternummer laut bestätigt. Andere versuchen zu checken, wer wo sitzt. Die Journalisten grummeln über die räumliche Enge und die schlechte Sicht. Sie lachen über den wichtigtuerischen Sammler, der einen »schlechten Platz« bekommen hat, und witzeln über einen Herrn, der gerade seinem Platz zustrebt. »Unverwechselbar«, sagt der zurückhaltende britische Korrespondent. »Ordinär«, sagt Baer. »Ein Clown«, sagt jemand aus den hinteren Reihen des Pressepulks mit Nachdruck.
Der Auktionssaal fasst tausend Besucher, wirkt aber sehr viel intimer. Der Sitzplatz ist Statussymbol und liefert einen Grund, stolz zu sein. Ziemlich genau in der Saalmitte entdecke ich Jack und Juliette Gold (Namen geändert), ein eifriges Sammlerpaar Ende vierzig, kinderlos. Jedes Jahr im Mai und November fliegen sie nach New York, wohnen in ihrem Lieblingszimmer im Four Seasons und treffen sich zum Abendessen mit Freunden im Sette Mezzo und im Balthazar. »Die Wahrheit ist«, vertraut Juliette mir später an, »es gibt Stehplätze, schlechte Sitzplätze, gute Sitzplätze, sehr gute Sitzplätze und Sitzplätze am Gang … die sind die besten. Die großen, kaufbereiten Sammler sitzen ganz vorn, etwas rechts. Ernsthafte Sammler, die nicht kaufen, sind weiter hinten. Und dann gibt es natürlich die Einlieferer, die sich in die privaten Skyboxen zurückgezogen haben. Es ist ein richtiges Zeremoniell. Bis auf wenige Ausnahmen sitzen alle auf exakt denselben Plätzen wie in der letzten Saison.« Ein anderer Sammler sagte mir, die Abendauktion sei für ihn so, »als ginge man an einem hohen Feiertag in die Synagoge. Jeder kennt jeden, aber man sieht sich nur dreimal im Jahr, und deshalb hat man sich viel zu erzählen.« Es kursiert die Geschichte von namentlich nicht genannten Sammlern, die so sehr mit Klatsch und Tratsch beschäftigt waren, dass sie zu bieten vergaßen.
Zum Vergnüglichen einer Auktion gehört es auch, gesehen zu werden. Juliette trägt ein Kleid von Missoni und keinen Schmuck – bis auf einen riesigen erlesenen Diamantring von Cartier (»Prada zu tragen ist gefährlich«, meint sie warnend. »Es könnte einem passieren, dass man im selben Outfit daherkommt wie drei Mitarbeiter von Christie’s«). Jack trägt einen feinen Nadelstreifenanzug von Zegna, dazu eine kobaltblaue Krawatte von Hermès. Manchmal kaufen Jack und Juliette, manchmal verkaufen sie, aber meistens kommen sie, weil sie die Versteigerungen einfach lieben. Juliette ist eine Romantikerin, deren aus Europa stammende Eltern Kunst sammelten, Jack ist Pragmatiker, dessen Aktien- und Immobiliengeschäfte seine Sicht der Dinge beeinflussen. Juliette sagte mir, eine Auktion sei »wie eine Oper in einer Sprache, die man erst nach und nach versteht«. Jack scheint ihr zuzustimmen, beschreibt aber schließlich ein völlig anderes Geschehen: »Selbst wenn man nicht unmittelbar an der Auktion interessiert ist, so ist man doch emotional involviert, weil man ähnliche Werke von zehn der angebotenen Künstler besitzt. Eine Auktion ist ein Instrument der Qualitätssicherung, eine Evaluation.«
Die Auktion dieses Abends ist mehr als nur eine Abfolge von 64 knallharten Geschäftsabschlüssen. Sie ist ein Kaleidoskop widerstreitender Interpretationen und Finanzpläne. Als ich das Sammlerpaar fragte, warum es seiner Ansicht nach in den letzten Jahren so populär geworden sei, Kunst zu sammeln, erwiderte Juliette, heute würden sehr viel mehr Leute begreifen, dass Kunst ihr Leben bereichern könne. Jack dagegen meinte, Kunst sei heutzutage eine anerkannte Möglichkeit, »ein Anlageportfolio zu diversifizieren«. Auch wenn es die Sensibilität der älteren, klassischen Sammler beleidige, sagte er, suchten »die neuen Sammler, die mit Hedgefonds reich geworden sind, nach alternativen Anlagestrategien. Die Rendite für ein reines Gelddepot ist heute so gering, dass es keine schlechte Idee zu sein scheint, in Kunst zu investieren. Deshalb ist der Kunstmarkt so stark: weil es kaum bessere Optionen gibt. Wenn der Aktienmarkt zwei, drei Quartale in Folge ein hohes Wachstum aufweisen würde, dann hätte womöglich der Kunstmarkt ein Problem.«
Die Kunstszene ist so klein und in sich geschlossen, dass sie von politischen Ereignissen nahezu unberührt bleibt. »Die Auktionen nach dem 11.September 2001«, sagt Juliette, »hatten mit der realen Welt da draußen nichts zu tun. Absolut gar nichts. Ich weiß noch, dass ich im November jenes Jahres bei der Versteigerung zu Jack sagte: ›Wenn wir hier rausgehen, werden wir feststellen, dass die Zwillingstürme noch stehen und die Welt in Ordnung ist.‹«
Größere Katastrophen mögen ohne Auswirkungen bleiben, aber beiläufiger Klatsch und Tratsch besitzt die Macht, ein Kunstwerk zu machen oder zu vernichten. Jack erzählte mir die Geschichte von Freunden, die die Sammlung ihrer Großmutter verkauften. »Sie hatten ein schönes Gemälde von Agnes Martin, aber dann machte das Gerücht die Runde, dass man Schäden entdecken würde, wenn man es in einem bestimmten Licht verkehrt herum betrachtete. Das wurde für die gesamte Kunstwelt plötzlich zum Evangelium. Und hatte wahrscheinlich einen Preisabschlag von einer halben Million Dollar zur Folge … nur weil irgendein Idiot ein Gerücht in die Welt gesetzt hatte. Wenn umgekehrt gemunkelt wird, ein Künstler wechsle zu Larry, will jeder noch schnell ein Werk dieses Künstlers kaufen, bevor die Preise in astronomische Höhen schießen.« Er meinte Larry Gagosian, einen der mächtigsten Kunsthändler der Welt mit Galerien in New York, Los Angeles, London und Rom. Wenn er für einen Künstler die Vertretung übernimmt, geht der Preis für dessen Werke um fünfzig Prozent nach oben.
Die meisten geben zu, dass sie das Intrigenspiel genießen. Doch einige finden den unterschwelligen Konkurrenzgeist unerträglich. Ein Londoner Händler, der den Auktionen lieber fernbleiben würde, meinte: »Unter uns gesagt, alle labern nur Scheiße. Einer läuft dem anderen hinterher. Die Gespräche sind scheinheilig, voller List und Tücke und anrüchiger Geschichten aus der Kunstszene. Das schönste Bild von Anmaßung und Gier. Alle tun so, als freuten sie sich, einen zu sehen, obwohl sie einen nur abzocken wollen.«
Um 19.01 Uhr, während noch ein paar Nachzügler auf ihre Plätze hasten, schwingt Christopher Burge den Auktionshammer. »Guten Abend, Ladys and Gentlemen. Willkommen bei Christie’s und seiner Abendauktion von Nachkriegs- und Gegenwartskunst.« Er verliest die Versteigerungsbedingungen, die Regeln zu Vermittlungsgebühren und Taxen. Er ruft »Los Nummer eins« auf und beginnt mit der Versteigerung, »Vierundvierzigtausend Dollar, achtundvierzigtausend, fünfzigtausend, fünfundfünfzigtausend.« Er wirkt entspannter als zuvor im leeren Saal. Auf der großen elektronischen Tafel zu seiner Linken, dem Währungsumrechner, wird die Summe in US-Dollar, Euro, Pfund Sterling, japanischen Yen, Schweizer Franken und Hongkong-Dollar angezeigt. Auf einem Bildschirm zu seiner Rechten erstrahlt ein Farbdia, damit das Publikum auch wirklich sicher sein kann, welches Werk gerade »auf dem Block« ist. Beiderseits von Burge sitzen die Mitarbeiter von Christie’s in zwei hölzernen Kabinenreihen, die aussehen wie Geschworenenbänke. Viele von ihnen telefonieren mit Leuten, die momentan bieten oder demnächst bieten werden. Einige Käufer sind nicht in der Stadt, andere wollen ihre Anonymität wahren. Der ehemalige Werbemogul und heutige Sekundärmarkthändler Charles Saatchi beispielsweise ist nie persönlich vor Ort. Er ist sich seiner Öffentlichkeitswirkung sehr wohl bewusst, bietet aber entweder telefonisch oder hat jemanden im Saal, der für ihn bietet. Wenn er für ein Werk den Zuschlag erhält, noch dazu zu einem Rekordpreis, kann er das später immer noch an die Öffentlichkeit bringen. Wenn nicht, wird niemand es erfahren, und er wahrt sein Gesicht.
Los Nummer eins wird für » 240 000 Dollar Hammerpreis« verkauft. Hinzu kommt das Aufgeld (eine Vermittlungsgebühr von 19,5 Prozent für die ersten 100 000 Dollar und von 12 Prozent für alles, was darüber liegt), so dass der Endpreis 276 300