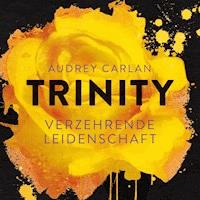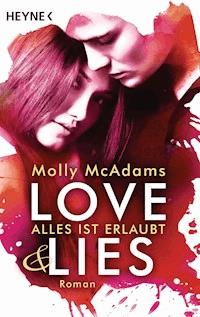9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Laura & Massimo
- Sprache: Deutsch
Die aufregendste Lovestory des Jahres geht weiter – Massimo Torricelli & Laura Biel, bekannt aus dem internationalen NETFLIX-Blockbuster »365 Tage«!
Als Ehefrau von Don Massimo Torricelli, einem der gefährlichsten Mafiabosse Siziliens, ist Lauras Leben alles andere als geruhsam. Denn Massimo hat Feinde, die keine Skrupel kennen. Nach einem Anschlag auf Lauras Leben liegen dunkle Schatten auf ihrer von Leidenschaft geprägten Beziehung. Die große Anziehungskraft, die sie und Massimo füreinander empfinden, gerät in Gefahr, als der attraktive Marcelo Matos, ein Mitglied der spanischen Unterwelt, ihren Weg kreuzt, und Laura muss sich entscheiden: Ist ihre Liebe zu Massimo stark genug, um alle Widrigkeiten zu überwinden?
Eine Leidenschaft ohne Maß in einer Welt, in der es keine Grenzen und keine Gnade gibt.
Die Geschichte von Laura & Massimo:
Band 1: 365 Tage
Band 2: 365 Tage - Dieser Tag
Band 3: 365 Tage mehr
Spice-Level: 3 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Als Ehefrau von Don Massimo Torricelli, einem der gefährlichsten Mafiabosse Siziliens, ist Lauras Leben alles andere als geruhsam. Denn Massimo hat Feinde, die keine Skrupel kennen. Nach einem Anschlag auf Lauras Leben liegen dunkle Schatten auf ihrer von Leidenschaft geprägten Beziehung. Die große Anziehungskraft, die sie und Massimo füreinander empfinden, gerät in Gefahr, als der attraktive Marcelo Matos, ein Mitglied der spanischen Unterwelt, ihren Weg kreuzt, und Laura muss sich entscheiden: Ist ihre Liebe zu Massimo stark genug, um alle Widrigkeiten zu überwinden?
Autorin
Blanka Lipińska ist eine der beliebtesten Autorinnen und einflussreichsten Frauen in Polen. Schriftstellerin ist sie aus Leidenschaft, nicht aus Notwendigkeit, sie liebt Tätowierungen, legt Wert auf Ehrlichkeit und schätzt selbstloses Denken und Handeln. Genervt vom Mangel an Offenheit in Bezug auf Sex hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, die vielen verschiedenen Seiten der Liebe ins Gespräch zu bringen. Sie sagt, über Sex zu sprechen, ist genauso einfach, wie ein Abendessen vorzubereiten.Ihre Bestseller-Trilogie verkaufte sich in Polen über 1,5 Millionen Mal. 2020 wurde sie vom Magazin »Wprost« in die Liste der einflussreichsten Frauen Polens aufgenommen, und »Forbes Women« zählte sie zu den persönlichen weiblichen Top-Marken. Ihr Bestseller »365 Tage« ist die Romanvorlage für einen der weltweit erfolgreichsten Filme auf Netflix im Jahr 2020. Der Film stand zehn Tage lang auf Platz 1, die zweitbeste Platzierung in der Geschichte der Netflix-Charts.
Von Blanka Lipińska erschienenDie Geschichte von Laura & Massimo:Band 1: 365 TageBand 2: 365 Tage – Dieser Tag
Band 3: 365 Tage mehr
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
365 Tagemehr
ROMAN
Deutsch von Marlena Breuer und Saskia Herklotz
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Kolejne 365 dni« bei Agora, Warschau.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2019 Blanka Lipińska
Published by Arrangement with BLANKA LIPIŃSKA
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Susann Rehlein
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de nach einer Originalvorlage von Agora
Umschlagmotiv: Dragosh Co/Shutterstock.com; SHIRYU
WR · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28162-5V001
www.blanvalet.de
KAPITEL 1
Der heiße Wind wehte mir ins Gesicht und spielte in meinem Haar, als ich im Cabrio die Strandpromenade entlangfuhr. Aus den Boxen dröhnte Break Free von Ariana Grande – auf der ganzen Welt gab es keinen Song, der in diesem Moment besser gepasst hätte. If you want it, take it, sang Ariana, und ich nickte und drehte die Lautstärke noch höher.
Heute war mein Geburtstag, heute wurde ich wieder ein Jahr älter und hätte eigentlich in tiefste Depressionen versinken müssen, aber die Wahrheit war: Noch nie in meinem Leben hatte ich mich so lebendig gefühlt. Gerade als ich an einer roten Ampel hielt, begann der Refrain. Die Bässe explodierten um mich herum.
This is … the part … when I say I don’t want ya … I’m stronger than I’ve been before sang ich laut und schwenkte die Arme durch die Luft. Der junge Mann im Auto neben meinem grinste anzüglich und trommelte im Rhythmus des Songs auf sein Lenkrad. Vermutlich hatte nicht nur die Musik seine Aufmerksamkeit erregt, sondern auch mein Outfit – denn sonderlich viel trug ich an diesem Tag nicht. Der schwarze Bikini passte ideal zu meinem violetten Plymouth Prowler, und dieses wunderschöne, außergewöhnliche Auto hatte ich zum Geburtstag bekommen.
Vor genau einem Monat hatte es angefangen – seitdem bekam ich jeden Tag ein Geschenk. Ich wurde dreißig, also bekam ich dreißig Geschenke – so machte meine große Liebe das nämlich. Bei dem Gedanken daran verdrehte ich die Augen, dann schaltete die Ampel auf Grün, und ich gab Gas.
Ich parkte, schnappte mir meine Tasche und ging an den Strand. Es war ein heißer Sommertag, und ich war entschlossen, so viel Sonne zu tanken wie möglich. Ich trank einen Schluck Eistee und grub meine Füße in den warmen Sand.
»Alles Gute, du alte Schachtel!«, rief der Mann meines Lebens hinter mir, und als ich mich umdrehte, schoss mir eine Fontäne Moët Rosé ins Gesicht.
»Hilfe!«, kreischte ich lachend und versuchte, aus der Schusslinie zu gelangen – leider erfolglos. Präzise wie mit einem Feuerwehrschlauch wurde ich von allen Seiten komplett durchnässt. Als die Flasche leer war, warf sich mein Lieblingsmann auf mich, und wir fielen zusammen in den Sand.
»Alles, alles Gute!«, flüsterte er. »Ich liebe dich.«
Nach diesen Worten schob sich seine Zunge zwischen meine Lippen und begann dort einen gemächlichen Tanz. Dann drängte er sich mit kreisenden Hüften zwischen meine weit gespreizten Beine. Ich stöhnte und verschränkte die Hände in seinem Nacken. Seine Hände ergriffen meine, schoben sie über meinen Kopf und pressten sie in den weichen Sand. Er hob den Kopf und schaute mir tief in die Augen.
»Ich hab was für dich.« Mit diesen Worten stand er auf und zog mich hinter sich her.
»Was denn nun schon wieder …«, murmelte ich.
Sein Gesicht war plötzlich ernst. »Ich wollte … ich möchte … ich würde …«, stotterte er, und ich schaute ihn belustigt an. Da holte er tief Luft, sank auf ein Knie und streckte mir ein kleines Schächtelchen entgegen. »Heirate mich!«, sagte Marcelo mit einem breiten Lächeln, das seine weißen Zähne zeigte. »Ich würde ja gern was Schlaues oder was Romantisches sagen, aber eigentlich will ich ganz einfach nur das Richtige sagen, damit du meinen Antrag annimmst.«
Ich holte Luft, doch er hob die Hand.
»Warte kurz, Laura. Ein Antrag ist noch keine Hochzeit, und eine Hochzeit heißt nicht unbedingt für immer und ewig.« Er stupste mir mit dem Schächtelchen an den Bauch. »Denk dran, ich werde dich zu nichts zwingen, ich werde dir nichts befehlen. Du sagst nur dann Ja, wenn du es willst.«
Er schwieg einen Moment und wartete, doch als er keine Antwort bekam, schüttelte er den Kopf und fuhr fort: »Aber wenn du Nein sagst, dann hetze ich Amelia auf dich, und sie wird dich zu Tode plaudern.«
Ich schaute ihn an, ergriffen, erschrocken und glücklich zugleich.
Wenn mir an Silvester jemand vorhergesagt hätte, dass ich heute, wenige Monate später, freiwillig hier sein würde, ich hätte ihm einen Vogel gezeigt. Und hätte mir vor einem Jahr, als Massimo mich auf Sizilien entführt hatte, jemand vorhergesagt, dass ein Jahr später am Strand von Teneriffa ein ganzkörpertätowierter Surfweltmeister vor mir knien würde, ich hätte ihn einen Psycho genannt und meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass dieser Fall niemals eintrat. Da hätte ich mir aber gehörig die Finger verbrannt! Bei dem Gedanken an das, was vor acht Monaten passiert war, gefror mir noch immer das Blut in den Adern, doch Gott und meinem Therapeuten sei Dank schlief ich inzwischen wieder viel besser. Mit solcher Gesellschaft im Bett war alles andere auch ausgeschlossen.
KAPITEL 2
Als ich das erste Mal wieder die Augen öffnete, nachdem ich im Schloss von Fernando Matos bewusstlos zusammengebrochen war, standen Dutzende Geräte und mehrere Bildschirme mit Kurven und Zahlen drauf neben meinem Bett. Es piepste und summte unablässig. Mein Körper war von einem Gewirr aus Schläuchen und Kabeln umgeben. Ich versuchte zu schlucken, aber selbst in der Kehle hatte ich einen Schlauch. Ich hatte Angst, mich zu übergeben. Nebel verschleierte meinen Blick, und ich fühlte Panik in mir aufsteigen. In diesem Moment begann eine der Maschinen durchdringend zu piepsen. Die Tür ging auf, und Massimo stürzte atemlos ins Zimmer, setzte sich neben mein Bett und griff meine Hand. »Liebling«, seine Augen wurden feucht. »Gott sei Dank!«
Massimos Gesicht war müde und eingefallen, und er war viel dünner, als ich ihn in Erinnerung hatte. Er holte tief Luft und streichelte meine Wange. Sein Anblick machte den Schlauch in meiner Kehle sofort vergessen. Tränen liefen mir aus den Augen, und er wischte mir jede einzelne von der Wange. Plötzlich stand eine Krankenschwester im Zimmer und schaltete die unerträglich piepsende Maschine aus, hinter ihr traten mehrere Ärzte ein.
»Herr Torricelli, bitte verlassen Sie für eine Weile das Zimmer. Wir kümmern uns um Ihre Frau«, sagte einer. Als Massimo nicht reagierte, wiederholte er seine Anweisung lauter.
Massimo erhob sich und überragte den Mann nun deutlich. Er setzte die allerfinsterste Miene auf, die man sich nur vorstellen konnte, und presste mit zusammengebissenen Zähnen auf Englisch hervor: »Meine Frau hat gerade zum ersten Mal seit zwei Wochen die Augen geöffnet, und wenn Sie denken, dass ich in diesem Moment das Zimmer verlasse, dann irren Sie sich gewaltig.« Der Arzt winkte bloß ab.
Nachdem mir die Krankenschwestern den Schlauch, der dick war wie ein Staubsaugerrohr, aus der Kehle gezogen hatten, war sogar ich der Meinung, es wäre besser gewesen, Massimo hätte das Zimmer verlassen, damit er mich nicht in diesem Zustand sah. Aber das war nun nicht mehr zu ändern. Schon kurze Zeit später zogen Ärztekarawanen unterschiedlichster Fachrichtungen durch mein Zimmer, und ich ließ unzählige endlose Untersuchungen über mich ergehen.
Nicht eine Sekunde lang wich Massimo von meiner Seite, und die ganze Zeit hielt er meine Hand. Mehrere Male wäre es mir lieber gewesen, er wäre nicht im Zimmer gewesen, doch selbst ich war nicht in der Lage, ihn wegzuschicken oder ihn auch nur dazu zu bewegen, einen Zentimeter zur Seite zu rücken und den Medizinern ein wenig Platz zu machen. Irgendwann ließen die Ärzte uns allein, und ich wollte Massimo fragen, was geschehen war. Doch in dem Bemühen, etwas zu sagen, schnappte ich nur nach Luft und röchelte unverständlich vor mich hin.
»Sag nichts!«, seufzte Massimo und presste meine Hand an seine Lippen. »Bevor du anfängst zu fragen …« Er seufzte und zwinkerte nervös, versuchte, die Tränen zurückzuhalten. »Du hast mich gerettet, Laura«, stöhnte er, und mir wurde heiß. »Es war alles ganz genau so wie in meinen Visionen: Du hast mich gerettet, Liebling. Aber …« Massimo versuchte weiterzusprechen, mehrmals setzte er an, doch er brachte kein Wort heraus. Da erst wurde mir klar, was er meinen könnte. Mit zitternden Händen schob ich die Bettdecke zur Seite. Massimo versuchte, meine Hände festzuhalten, schließlich gab er nach und ließ meine Handgelenke los.
»Luca …«, flüsterte ich tonlos, als ich die Verbände an meinem Körper sah. »Wo ist unser Sohn?«
Meine Stimme war kaum hörbar, und jedes Wort tat mir weh. Ich wollte schreien, aufspringen und diese eine Frage herausschreien, wollte Massimo zwingen, mir endlich die Wahrheit zu sagen. Er erhob sich, griff nach der Bettdecke und zog sie langsam wieder über meinen geschundenen Körper. Seine Augen waren wie tot, und je länger ich ihn anschaute, desto unaufhaltsamer machten sich Erschrecken und Verzweiflung in mir breit.
»Er ist gestorben«, sagte Massimo, atmete tief ein und drehte sich zum Fenster um. »Der Einschuss war zu nah … Er war zu klein … Er hatte keine Chance …« Massimos Stimme brach.
Es gab keine Worte für das, was ich fühlte. Mir war, als hätte mir jemand bei lebendigem Leib das Herz herausgerissen. Die Weinkrämpfe, die im Sekundentakt meinen Körper schüttelten, brachten mich in Atemnot. Ich schloss die Augen und versuchte, die bittere Galle hinunterzuschlucken, die mir die Kehle hochstieg. Mein Kind, mein Glück, Zeugnis der Liebe zwischen mir und meinem geliebten Mann – es war fort.
Unbeweglich wie eine Statue stand Massimo am Fenster. Dann rieb er sich die Augen und drehte sich zu mir um.
»Aber du bist Gott sei Dank am Leben.« Er versuchte zu lächeln. »Schlaf jetzt, die Ärzte sagen, du brauchst viel Ruhe.« Er trat zu mir, strich mir über den Kopf und wischte mir die nassen Wangen trocken. »Wir werden sehr viele Kinder haben, versprochen.«
Als ich das hörte, schüttelte mich ein noch stärkerer Weinkrampf. Resigniert stand Massimo neben dem Bett. Dann verließ er, ohne mich noch einmal anzuschauen, das Zimmer. Kurz darauf kam er mit einem Arzt zurück.
»Frau Torricelli, ich gebe Ihnen ein Beruhigungsmittel.« Sprechen konnte ich nicht, schüttelte aber den Kopf. »Doch, doch, Sie müssen es langsam angehen. Für heute ist es genug.« Er warf Massimo einen missbilligenden Blick zu, dann leerte er eine Spritze in einen der Infusionsbehälter neben meinem Bett, und ich fühlte, wie mein Körper bleischwer wurde und versank.
»Ich werde hier sein.« Massimo setzte sich wieder auf den Stuhl neben dem Bett und hielt meine Hand. »Ich werde hier sein, wenn du aufwachst.«
Er war da, als ich aufwachte, am nächsten Tag und auch an jedem weiteren Tag – jedes Mal, wenn ich einschlief, und jedes Mal, wenn ich die Augen öffnete. Er wich mir nicht von der Seite. Er las mir vor, er brachte mir Filme, er kämmte mir die Haare, er wusch mich. Zu meinem Schrecken fand ich heraus, dass er mich auch gewaschen hatte, als ich bewusstlos gewesen war, er hatte den Krankenschwestern nicht gestattet, mir nahezukommen. Ich fragte mich, wie er es hatte ertragen können, dass die Ärzte, die mich operiert hatten, Männer gewesen waren.
Offenbar hatte der Schuss meinen unteren Rücken getroffen. Eine Niere war nicht zu retten gewesen, aber Gott sei Dank hat der Mensch ja zwei davon, und auch mit einer alleine lässt es sich lange leben – vorausgesetzt, die Niere ist gesund. Während der Operation hatte mein Herz ausgesetzt, aber das verwunderte mich kaum – eher schon die Tatsache, dass die Ärzte es hatten reparieren können. Schließlich war ich lange Jahre herzkrank gewesen. Sie hatten eine Verengung beseitigt, hier etwas eingenäht und dort etwas weggeschnitten – und angeblich funktionierte das nun. Etwa eine Stunde lang erzählte mir der Arzt, der die Operation vorgenommen hatte, bis ins kleinste Detail, was er gemacht hatte, zeigte mir auf einem Tablet Tabellen, Grafiken und Kurven. Aber so gut war mein Englisch dann doch nicht, dass ich ihm in allen Einzelheiten hätte folgen können – und in meiner Verfassung war mir sowieso alles egal. Immerhin würde ich in Kürze das Krankenhaus verlassen können. Und tatsächlich fühlte ich mich von Tag zu Tag besser, mein Körper wurde erstaunlich schnell gesund. Nur meine Seele war wie tot. In unserem Wortschatz war das Wort »Baby« nicht mehr enthalten, und den Namen »Luca« hatte es nie gegeben. Schon die beiläufige Erwähnung eines Kindes, und sei es im Fernsehen oder im Internet, reichte aus, um mich in Tränen ausbrechen zu lassen.
Massimo öffnete sich mir in dieser Zeit mehr als jemals zuvor. Aber um keinen Preis wollte er auf Silvester zu sprechen kommen. Das machte mich zunehmend wütend, und zwei Tage vor meiner geplanten Entlassung aus dem Krankenhaus hielt ich es nicht mehr aus.
Massimo hatte gerade ein Tablett mit Essen vor mir abgestellt und krempelte sich die Ärmel hoch. »Ich esse nicht einen Bissen«, fauchte ich und verschränkte die Arme auf der Bettdecke. »Irgendwann müssen wir darüber sprechen. Und du kannst dich nicht bis in alle Ewigkeit mit meinem Gesundheitszustand herausreden – ich fühle mich wunderbar!« Ich verdrehte die Augen. »Verdammt noch mal, Massimo, ich habe ein Recht zu wissen, was im Schloss von Fernando Matos passiert ist!«
Unwirsch ließ Massimo den Löffel, den er in der Hand hielt, auf den Teller sinken, holte tief Luft und stand dann hastig auf.
»Himmelherrgott, Laura, warum bist du nur so stur?« Er barg das Gesicht in den Händen und seufzte. »Also gut. An was kannst du dich erinnern?«
Ich durchwühlte die dunkelsten Ecken meines Gedächtnisses, bis mir plötzlich Marcelo vor Augen stand. Ich erstarrte, schluckte laut und atmete dann langsam aus.
»Ich weiß noch, wie Flavio, dieser Hurensohn, mich verprügelt hat.« Massimo biss die Zähne zusammen, während ich sprach, seine Kiefermuskeln traten hervor. »Dann warst du plötzlich da.« Ich schloss die Augen, in der Hoffnung, vor meinem inneren Auge die Geschehnisse zu sehen. »Es gab ein großes Durcheinander, dann sind alle gegangen und haben uns allein gelassen.« Ich machte eine Pause, unsicher, ob ich meinen Erinnerungen trauen konnte. »Ich bin zu dir gegangen … und ich weiß noch, dass mein Kopf fürchterlich wehtat … das ist alles.« Entschuldigend zuckte ich mit den Schultern und schaute Massimo an. Offenbar bereitete ihm die Erinnerung an diese Ereignisse Schuldgefühle, mit denen er überhaupt nicht umgehen konnte. Wutschnaubend lief er im Zimmer auf und ab und ballte immer wieder die Hände zu Fäusten.
»Flavio, dieser … Er hat Fernando getötet, und dann hat er auf Marcelo geschossen.« Bei diesen Worten blieb mir die Luft weg. »Aber er hat ihn nicht getroffen«, fuhr Massimo fort, und ich stöhnte erleichtert auf. Als ich Massimos überraschten Blick bemerkte, rieb ich mir die Rippen auf der linken Seite, in Höhe des Herzens, und gab meinem Mann ein Zeichen fortzufahren.
»Dann hat der Glatzkopf seinen Schwager erschossen – oder zumindest hat er gedacht, dass er ihn erschossen hat, denn Flavio ist hinter dem Schreibtisch in einer riesigen Blutlache zusammengesackt. Du drohtest ohnmächtig zu werden.« Er brach ab, die Finger in seinen geballten Fäusten waren blutleer und weiß.
»Ich wollte dich stützen, da hat er noch einmal geschossen, diesmal auf dich.«
Ich riss die Augen auf, mein Atem stockte, und ich brachte kein Wort heraus. Offenbar sah ich furchtbar aus, denn Massimo eilte zu mir, strich mir über den Kopf und prüfte die Werte auf einem der Monitore. Ich war schockiert. Wie hatte Marcelo auf mich schießen können? Das war mir absolut unverständlich.
»Das regt dich zu sehr auf«, murmelte Massimo, als eine der Maschinen zu piepsen begann. Im nächsten Moment kamen eine Krankenschwester und mehrere Ärzte ins Zimmer geeilt und drängten sich um mein Bett, aber eine weitere Spritze in einen der zahlreichen Zugänge an meinem Arm löste die Aufregung alsbald in Wohlgefallen auf. Diesmal wurde ich ruhiger, schlief aber nicht ein. Mein Kopf war wie Watte. Zwar bekam ich weiterhin alles mit, was um mich herum geschah, aber nur aus der Ferne. Ich bin eine Seerose auf der silbernen Wasseroberfläche – dieser Vergleich ging mir durch den Kopf, während ich im Bett lag und zuschaute, wie Massimo dem Arzt wild gestikulierend erklärte, was vorgefallen war. Ach, du kleiner Halbgott in Weiß, wenn du wüsstest, wer mein Mann ist, du würdest drei Meter Sicherheitsabstand halten, dachte ich und lächelte selig. Die Männer diskutierten weiter, bis Massimo irgendwann nachgab, nickte und schuldbewusst den Kopf senkte. Kurz darauf waren wir wieder allein.
»Und dann?«, fragte ich ein wenig lallend.
Massimo schwieg einen Moment und musterte mich aufmerksam, und als ich ihm ein leicht narkotisiertes Lächeln schenkte, schüttelte er den Kopf. »Flavio war doch nicht tot und hat noch einmal auf dich geschossen.«
Flavio, wiederholte ich in Gedanken, und eine unkontrollierbare Erleichterung tanzte auf meinem Gesicht. Offenbar schob Massimo das auf die Wirkung der Medikamente, denn er fuhr unbeeindruckt fort.
»Marcelo hat ihn kaltgemacht, er hat ihm das gesamte Magazin in den Körper gejagt und ihn regelrecht massakriert.« Massimo schnaubte verächtlich und schüttelte den Kopf. »Ich hab mich dann um dich gekümmert. Domenico hat Hilfe geholt, denn der Raum, in dem wir uns befanden, war schallisoliert, und niemand hatte etwas von der Schießerei mitbekommen. Marcelo hat einen Verbandskasten gefunden, dann ist endlich der Rettungswagen gekommen. Du hast sehr viel Blut verloren.« Er erhob sich erneut.
»Und jetzt? Was wird jetzt?«, fragte ich und blinzelte müde.
»Jetzt fahren wir nach Hause.« Zum ersten Mal an diesem Tag erschien ein Lächeln auf Massimos Gesicht.
»Ich meine die Spanier … eure Geschäfte«, murmelte ich und ließ mich in mein Kissen sinken.
Massimo schaute mich argwöhnisch an, und ich suchte in Gedanken bereits nach einer guten Rechtfertigung für meine Frage. Als Massimo beharrlich schwieg, schaute ich ihm direkt in die Augen.
»Bin ich sicher, oder wird mich wieder jemand entführen?«, fragte ich und tat, als wäre ich ängstlich.
»Sagen wir es mal so: Ich habe mich mit Marcelo geeinigt. Das Haus seines Vaters ist bis unters Dach vollgestopft mit Elektronik, genau wie unseres. Es gibt Überwachungskameras und Abhörsysteme.« Er schloss die Augen und senkte den Kopf. »Ich habe mir die Aufnahmen angesehen und habe gehört, was Flavio gesagt hat. Er hat die Familie Matos gegen deren Willen in die Sache reingezogen, das weiß ich jetzt, Fernando Matos hatte keine Ahnung von Flavios wahren Absichten. Marcelo hat einen furchtbaren Fehler gemacht, als er dich entführte.« Wut blitzte in Massimos Augen auf. »Aber ich weiß auch, dass er sich um dich gekümmert und dir das Leben gerettet hat.« Unvermittelt begann er zu zittern und zu keuchen. »Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass …«, er brach ab. »Es wird niemals Frieden zwischen uns geben!«, rief Massimo aus, stand auf und schleuderte seinen Stuhl an die Wand. »Dieser Mann ist schuld daran, dass mein Sohn tot ist und das Leben meiner Frau am seidenen Faden hing.« Sein Atem ging schnell und flach. »Ich habe die Aufnahmen gesehen, wie dieser Hurensohn dich misshandelt hat, und ich schwöre dir, wenn ich könnte, würde ich ihn jeden Tag, den ich lebe, aufs Neue umbringen!« Mitten im Zimmer fiel Massimo auf die Knie. »Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich dich nicht beschützt habe, dass ich zugelassen habe, dass dieser glatzköpfige Hurensohn dich entführt und an den Ort gebracht hat, wo dieser verfickte Psychopath dich in die Finger gekriegt hat!«
»Aber er hatte keine Ahnung«, flüsterte ich unter Tränen. »Marcelo wusste nicht, warum er mich entführen sollte.«
»Verteidigst du ihn etwa?« Massimo riss sich vom Boden hoch und kam die drei Schritte bis zu meinem Bett. »Nach all dem, was du seinetwegen durchgemacht hast, verteidigst du ihn noch?« Schwer atmend stand er über mir, und mit den geweiteten Pupillen wirkten seine Augen komplett schwarz. Ich schaute ihn an und stellte zu meiner Überraschung fest, dass ich überhaupt nichts fühlte: weder Wut noch Ärger. Die Beruhigungsmittel, die ich bekommen hatte, hatten sämtliche Gefühle aus meinem Körper geschwemmt, deshalb erstaunten mich die Tränen, die mir über die Wangen rannen.
»Ich will ganz einfach nicht, dass du Feinde hast, das wirkt sich nämlich auch auf mich aus«, sagte ich leise und bereute meine Worte sofort. Dieser Satz war ein indirekter Vorwurf. Ohne es zu wollen, hatte ich Massimo die Verantwortung für meinen Zustand gegeben.
Massimo seufzte. Er grub die Zähne so fest in seine Unterlippe, dass schon das Zusehen wehtat. Dann erhob er sich und ging langsam zur Tür. »Ich kümmere mich um deine Entlassungsunterlagen«, flüsterte er und verließ mit gesenktem Kopf das Zimmer.
Ich wollte ihn zurückrufen, ihn bitten zu bleiben, wollte mich entschuldigen und erklären, dass ich ihm keine Vorwürfe hatte machen wollen – aber die Worte blieben mir in der Kehle stecken. Als die Tür leise ins Schloss fiel, blieb ich auf dem Rücken liegen und starrte die Decke an, bis ich irgendwann einschlief.
Meine Blase weckte mich. Erst seit Kurzem wusste ich dieses Gefühl wieder zu schätzen, ebenso wie die Tatsache, dass ich inzwischen allein auf die Toilette gehen konnte. Ich genoss jeden Ausflug ins Bad. Nur wenige Tage zuvor war mir endlich der Blasenkatheter entfernt worden, außerdem hatte der Arzt gesagt, dass ich anfangen sollte zu laufen. Seit einigen Tagen machte ich also in ständiger Begleitung meines Infusionsständers kurze Spaziergänge auf dem Stationsflur.
Für meinen Toilettengang brauchte ich eine ganze Weile, pinkeln mit Infusionsständer bedurfte einiger Geschicklichkeit. Zumal ich heute auf mich allein gestellt war, denn zu meiner Überraschung hatte ich feststellen müssen, dass Massimo nicht wie sonst immer an meinem Bett saß, als ich erwachte. Noch am ersten Tag meines Krankenhausaufenthalts hatte er ein zweites Bett in meinem Zimmer aufstellen lassen und schlief seitdem neben mir. Geld vollbrachte bekanntlich Wunder. Wenn Massimo antike Möbel und einen Zimmerspringbrunnen gewollt hätte, die Ärzte wären auch diesem Wunsch nachgekommen. Doch Massimos Bett war unberührt, was nur bedeuten konnte, dass er vergangene Nacht Wichtigeres zu tun hatte, als auf mich aufzupassen.
Nachdem ich den ganzen Tag verschlafen hatte, war ich kein bisschen müde und beschloss, mir ein kleines Abenteuer zu gönnen. Ich trat auf den Korridor hinaus, hielt mich mit einer Hand am Laufgriff an der Wand fest und beobachtete belustigt, wie zwei mächtige Securitytypen bei meinem Anblick von ihren Stühlen aufsprangen. Ich gab ihnen ein Zeichen, sitzen zu bleiben, und ging, meinen Infusionsständer hinter mir herziehend, langsam den Gang entlang. Natürlich folgten mir die beiden. Als ich mir vor Augen führte, was für ein Bild wir abgaben, musste ich wider Willen lachen. Da schlich ich, in meinem hellen Bademantel und mit rosa Emu-Stiefeln an den Füßen, mit zerzaustem Haar und auf den Metallständer gestützt, an der Wand entlang, verfolgt von zwei Gorillas in schwarzen Anzügen und mit gegelten Frisuren. Da ich nicht unbedingt in Lichtgeschwindigkeit unterwegs war, kam unser kleiner Umzug nur im Schneckentempo vorwärts.
Mein Körper war solche Anstrengungen noch nicht wieder gewohnt, zwischendurch musste ich eine Pause machen und mich kurz hinsetzen. Meine Bewacher blieben in einigen Metern Entfernung ebenfalls stehen und scannten die Umgebung. Als sie nichts Bedrohliches finden konnten, fingen sie an, sich zu unterhalten. Selbst jetzt, um kurz vor Mitternacht, war auf den Krankenhausfluren noch ziemlich Betrieb. Eine Schwester kam zu mir und fragte, ob alles okay sei, ich sagte, dass ich mich nur ein wenig ausruhte, und sie eilte weiter.
Schließlich stand ich auf und wollte schon in mein Zimmer zurückkehren, da entdeckte ich plötzlich am anderen Ende des Flurs vor einer großen Glasscheibe eine bekannte Gestalt.
»Unmöglich«, flüsterte ich und zerrte meinen Infusionsständer in ihre Richtung. »Amelia?«
Sie drehte sich zu mir um, und ein Lächeln flog über ihr Gesicht.
»Was machst du denn hier?«, fragte ich verwundert.
»Ich warte«, antwortete Amelia und wies mit dem Kopf auf etwas hinter der Scheibe. Ich folgte ihrem Blick und sah einen Saal mit Inkubatoren, in denen, von Schläuchen und Kabeln umgeben, winzige Babys lagen. Sie sahen aus wie Puppen, manche waren kaum größer als eine Packung Zucker. Bei diesem Anblick war mir ganz elend zumute. Luca war noch so klein gewesen. Tränen traten mir in die Augen, und ich hatte einen Kloß in der Kehle. Fest presste ich die Lider zusammen, und als ich sie wieder öffnete, schaute ich Amelia aufmerksamer an. Sie trug einen Bademantel, sie war also ebenfalls Patientin.
»Pablo ist zu früh gekommen«, erklärte sie und wischte sich mit dem Ärmel die Nase ab. Tränenspuren glitzerten auf ihren Wangen. »Als ich erfahren habe, was passiert ist, dass mein Vater und …« Sie brach ab, und ich wusste, was sie mir zu sagen versuchte. Ich streckte die Hand aus und zog sie in meine Arme. In diesem Moment wusste ich selbst nicht, ob ich eher ihr Trost spenden wollte oder vielmehr selbst welchen suchte. Meine beiden Bewacher traten ein paar Schritte zurück, um uns nicht zu stören. Amelia ließ ihren Kopf gegen meine Schulter sinken und schluchzte. Ich konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob sie wusste, dass der Vater ihres Kindes versucht hatte, mich umzubringen, aber vermutlich hatte ihr Bruder ihr eine geschönte Version mitgeteilt.
»Es tut mir leid, was mit deinem Mann passiert ist.« Diese Worte kamen mir nur schwer über die Lippen. Schließlich tat es mir um Flavio überhaupt nicht leid, im Gegenteil, ich war froh, dass Marcelo ihn erschossen hatte.
»In Wahrheit war er gar nicht mein Ehemann«, flüsterte Amelia. »Ich habe ihn nur immer so genannt. Ich hätte ihn gerne geheiratet.« Sie schniefte und richtete sich auf. »Aber wie geht es dir?« Sie schaute an mir herunter und auf meinen Bauch, ihr Blick war warm und voller Fürsorge.
»Laura!« Der alarmierte Aufschrei in meinem Rücken verhieß nichts Gutes. Ich schaute hinter mich und sah Massimo wutentbrannt in langen Sätzen den Korridor herunter auf mich zueilen.
»Ich muss los, ich finde dich«, flüsterte ich, drehte mich um und ging meinem Mann entgegen.
»Was machst du hier, was soll das?«, fragte Massimo verärgert und setzte mich umstandslos in einen an der Wand stehenden Rollstuhl. An die beiden Gorillas gerichtet, presste er durch die zusammengebissenen Zähne mehrere Sätze auf Italienisch hervor; offenbar wusch er ihnen ordentlich den Kopf. Dann schob er mich behutsam zu meinem Zimmer zurück.
Dort angekommen, hob er mich aus dem Rollstuhl, legte mich ins Bett und zog mir die Decke bis zum Kinn. Massimo wäre nicht Massimo gewesen, wenn er mir nicht den ganzen Weg Vorhaltungen über meinen Leichtsinn und mein unverantwortliches Verhalten gemacht hätte.
»Wer war die Frau?«, fragte er und hängte sein Jackett über die Stuhllehne.
»Die Mutter von einem der Frühgeborenen«, wisperte ich und wandte den Kopf ab. »Die Ärzte wissen noch nicht, ob es durchkommt.« Ich wusste genau, dieses Thema würde Massimo nicht weiter verfolgen.
»Ich verstehe nicht, was du überhaupt auf dieser Station zu suchen hattest«, sagte er vorwurfsvoll. Eine bedrohliche Stille trat ein, in der nur Massimos tiefe Atemzüge zu hören waren.
»Du musst dich ausruhen«, sagte er dann. »Morgen fahren wir nach Hause.«
In dieser Nacht schlief ich schlecht. Ich träumte von Babys, Brutkästen und schwangeren Frauen und wachte ständig auf; aber ich hoffte, diesen quälenden Gedanken zu Hause auf Sizilien endlich entkommen zu können. Am nächsten Morgen wartete ich ungeduldig darauf, dass Massimo mich endlich für einen Moment allein ließ. Er hatte einen Termin mit dem medizinischen Konsilium, das angesichts meiner bevorstehenden Entlassung einberufen worden war. Meine behandelnden Ärzte waren ganz und gar nicht einverstanden damit, dass ich das Krankenhaus verließ; ihrer Meinung nach war ich weiterhin behandlungsbedürftig. Da sie meiner Entlassung nur unter der Bedingung zugestimmt hatten, dass ihre umfangreichen und ausführlichen Therapieanweisungen genauestens eingehalten würden, hatte Massimo mehrere Ärzte aus Sizilien einfliegen lassen.
Ich war bei diesem wichtigen Termin nicht dabei und wollte die Gelegenheit nutzen, um Amelia zu besuchen. Ich zog einen Jogginganzug an, schlüpfte in meine Schuhe, streckte vorsichtig den Kopf durch die Tür und schaute mich um. Meine beiden Bodyguards waren nirgendwo zu sehen. Im ersten Moment war ich geradezu erschrocken – ich war überzeugt, irgendjemand hätte sie ausgeschaltet und würde im nächsten Augenblick zurückkommen, um sich mit mir zu befassen. Aber dann fiel mir wieder ein, dass mir keine Gefahr mehr drohte, und ich ging langsam den Korridor entlang.
»Ich suche meine Schwester«, sagte ich zu der Frau hinter dem Empfangstresen der Neugeborenenstation. Die ältere Krankenschwester blaffte ein paar Worte auf Spanisch und verdrehte die Augen, dann stand sie auf und ging los, um eine Kollegin zu holen, die Englisch sprach. Wenige Minuten später kam sie in Begleitung einer lächelnden jungen Frau zurück.
»Wie kann ich helfen?«
»Ich suche meine Schwester, Amelia Matos. Sie liegt bei Ihnen auf der Station, sie hatte eine Frühgeburt.«
Die Frau tippte einige Daten in den Computer und schaute auf dem Monitor nach, dann nannte sie mir die Zimmernummer und wies mir die Richtung.
Vor der Tür hatte ich die Hand schon erhoben und wollte eben anklopfen, als ich plötzlich erstarrte. Was zum Teufel mache ich hier?, fragte ich mich. Ich gehe zur Schwester des Auftragsmörders, der mich entführt hat, und will sie fragen, wie es ihr nach dem Tod ihres Mannes geht, wobei ihr Mann mich wohlgemerkt fast zu Tode geprügelt hat. Die ganze Situation war so surreal, dass ich selbst kaum glauben konnte, was ich da tat.
»Laura?«, hörte ich plötzlich eine Stimme hinter meinem Rücken und drehte mich um. Neben mir stand Amelia, eine Wasserflasche in der Hand. »Ich wollte sehen, wie es dir geht«, brachte ich mühsam hervor.
Amelia öffnete die Tür und zog mich hinter sich her ins Zimmer. Ihr Zimmer war noch größer als meines und bestand aus einem Wohnbereich und einem abgetrennten Schlafzimmer. Überall standen Liliensträuße, ihr schwerer Duft erfüllte den Raum.
»Mein Bruder kommt jeden Tag und bringt mir einen frischen Strauß«, seufzte Amelia und setzte sich aufs Sofa. Ich erstarrte. Panisch schaute ich mich um und zog mich langsam in Richtung Tür zurück.
»Keine Sorge, heute kommt er nicht, er musste wegfahren«, sie schaute mich an, als könnte sie meine Gedanken lesen. »Er hat mir alles erzählt.«
»Was genau?«, fragte ich und ließ mich in einen Sessel sinken.
Amelia senkte den Kopf und rang die Hände. Sie war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Von der atemberaubend schönen, offenherzigen Frau, die ich kennengelernt hatte, war nichts geblieben.
»Ich weiß, dass ihr kein Paar wart, dass mein Vater deine Entführung befohlen hat und dass Marcelo den Auftrag hatte, sich um dich zu kümmern.« Sie rückte näher an mich heran. »Laura, ich bin nicht dumm. Ich weiß, in was für eine Familie ich hineingeboren bin und womit Fernando Matos sein Geld verdient hat.« Sie seufzte. »Aber dass Flavio hinter all dem stand …« Sie brach ab, als ihr Blick auf meinen Bauch fiel. »Wie geht es deinem …« Sie schwieg, als sie sah, dass ich mechanisch den Kopf schüttelte und mir die Tränen übers Gesicht liefen. Sie schloss die Augen, und Sekunden später kullerten auch über ihre Wangen dicke Tropfen. »Es tut mir so leid«, flüsterte sie. »Wegen meiner Familie hast du dein Kind verloren.«
»Es ist nicht deine Schuld, Amelia. Du musst dich für nichts entschuldigen«, sagte ich so fest wie möglich; meine Stimme zitterte nur ganz leicht. »Dafür haben wir den Männern zu danken, mit denen das Schicksal uns zusammengeführt hat. Du kannst deinem Mann dafür danken, dass Pablo um sein Leben kämpft, und ich meinem dafür, dass ich überhaupt jemals einen Fuß auf diese Insel gesetzt habe.« Es war das erste Mal, dass ich diesen Gedanken laut aussprach, und beim Klang meiner Worte fühlte ich einen Stich im Herzen. Nie zuvor hatte ich meine Vorwürfe an Massimo so eindeutig formuliert. Dabei war ich Amelia gegenüber nicht vollkommen ehrlich, schließlich war Flavio der Hauptschuldige … aber ich wollte sie schonen.
»Wie geht es deinem Sohn?«, fragte ich und unterdrückte ein Schluchzen. Ich wünschte dem Kleinen und seiner Mutter von Herzen alles Gute, aber trotzdem kamen mir diese Worte nur schwer über die Lippen.
»Besser, glaube ich.« Sie lächelte schwach. »Wie du siehst, kümmert sich mein Bruder um alles.« Mit der Hand wies sie in den Raum. »Entweder hat er die Ärzte bestochen oder fürchterlich terrorisiert, jedenfalls behandeln mich alle wie eine Königin. Pablo bekommt die bestmögliche Betreuung, er macht Fortschritte.« Wir sprachen noch ein paar Minuten, dann fiel mir siedend heiß ein, dass ich in echte Schwierigkeiten kommen würde, wenn Massimo mich bei seiner Rückkehr nicht im Zimmer antraf.
»Amelia, ich muss los. Heute kehre ich nach Sizilien zurück.«
Leise stöhnend erhob ich mich und stützte mich auf der Rückenlehne des Sessels ab.
»Laura, warte. Da ist noch eine Sache …« Fragend schaute ich Amelia an. »Marcelo … Ich wollte mit dir über meinen Bruder reden.« Amelia senkte verlegen den Blick, dann begann sie stockend zu sprechen. »Ich möchte nicht, dass du meinen Bruder hasst, vor allem, weil er dich, glaube ich …«
»Ich mache deinem Bruder keinen Vorwurf«, unterbrach ich sie, denn ich hatte Angst vor dem, was sie sagen wollte. »Ehrlich, grüß ihn von mir. Ich muss jetzt los«, warf ich noch über die Schulter, küsste Amelia auf beide Wangen und umarmte sie sanft, dann eilte ich, so schnell ich konnte, aus dem Zimmer.
Auf dem Korridor lehnte ich mich mit dem Rücken gegen die Wand und atmete tief durch. Mir war ein wenig übel, und ich verspürte ein leichtes Brennen hinter dem Brustbein, aber eigenartigerweise hörte ich mein eigenes Herz nicht. Das unerträgliche Dröhnen, das sonst bei jeder Panik-Attacke meinen Kopf zum Bersten gebrachte hatte, war einfach weg. Kurz überlegte ich, ins Zimmer zurückzugehen und Amelia zu bitten, ihren Satz zu Ende zu bringen, aber dann besann ich mich eines Besseren und trat den Rückweg an.
KAPITEL 3
»Aufstehen!«, schrie Olga, als sie in mein Schlafzimmer kam. »Raus aus den Federn. Wie lange willst du mich denn noch warten lassen, du Miststück?«
Sie wollte mich umarmen, aber auf halbem Wege fiel ihr ein, dass an allen Ecken und Enden meines Körpers frische Nähte und Narben waren, und sie ließ von ihrem Vorhaben ab. Schließlich kniete sie neben dem Bett, Tränen stiegen ihr in die Augen.
»Ich hatte solche Angst um dich, Laura!«, brach es aus ihr heraus, und sie tat mir furchtbar leid. »Als du entführt worden bist, da wollte ich … Ich wusste nicht …«, stotterte sie und verschluckte sich vor lauter Aufregung.
Ich strich ihr über die Haare, aber mit an meinem Hals vergrabenem Kopf heulte sie immer noch wie ein kleines Kind.
»Und dabei sollte ich dich jetzt aufmuntern und nicht du mich.« Sie wischte sich die Nase ab und schaute mich an. »Du bist dünn geworden«, stellte sie erschrocken fest. »Geht es dir gut?«
»Wenn man die Wundschmerzen nach der Operation beiseitelässt und von der Tatsache absieht, dass ich fast einen Monat fort war und mein Kind verloren habe, geht es mir hervorragend«, seufzte ich. Der sarkastische Unterton in meiner Stimme konnte Olga nicht entgangen sein, denn sie schwieg und ließ den Kopf hängen.
»Massimo hat deinen Eltern nichts gesagt.« Sie verzog das Gesicht. »Deine Mutter wird bald wahnsinnig. Als sich deine Eltern am Tag ihrer Abreise von dir verabschieden wollten, hat er mich angewiesen, ihnen irgendeinen Schwachsinn zu erzählen, damit sie sich keine Sorgen machen. Also habe ich gesagt, Massimo hätte einen Überraschungstrip für dich vorbereitet und das Ganze wie eine Entführung aussehen lassen. Grotesk, oder? Er hätte dich in die Dominikanische Republik entführt, sozusagen als Weihnachtsgeschenk. Das ist weit weg, und das Mobilfunknetz da ist richtig scheiße. Und diese Lüge habe ich deiner Mutter die ganzen drei Wochen lang aufgetischt, wieder und wieder, jedes Mal, wenn sie angerufen hat. So richtig wollte sie mir nicht glauben, deshalb habe ich ihr auf Facebook geschrieben – also von deinem Konto.« Olga zuckte die Schultern. »Allerdings ist Klara Biel nicht auf den Kopf gefallen.« Olga legte sich neben mir auf die Bettdecke und schlug die Hände vors Gesicht. »Weißt du, was ich durchgemacht habe? Jede Lüge zog eine weitere nach sich, und mit jeder neuen Wendung wurde die ganze Geschichte immer unglaubwürdiger.«
»Was ist der letzte Stand?«, fragte ich so ruhig wie möglich.
»Dass ihr geschäftlich auf Teneriffa seid und dass dir dein Telefon in die Toilette gefallen ist.«
Ich drehte den Kopf und schaute Olga an. Also muss ich meine Mutter schon wieder anlügen, dachte ich. »Gib mir dein Telefon. Massimo hat mir meins nicht zurückgegeben.«
»Ich hatte dein Telefon.« Olga zog mein iPhone aus der Schublade des Nachtschränkchens neben dem Bett. »Ich habe es nach deiner Entführung im Hotel gefunden.« Sie stand auf und ging zur Tür. »Okay, Laura, dann lass ich dich besser allein.«
Ich nickte, griff nach dem Telefon und suchte den Eintrag »Mama« in meinem Adressbuch. Dann schaute ich starr auf das Display und wusste nicht, ob ich endlich ehrlich mit ihr sein oder sie weiter anlügen sollte. Und wenn ich ihr nicht die Wahrheit sagte, was sollte ich ihr dann erzählen? Nach wenigen Sekunden wurde mir bewusst, wie grausam die Wahrheit für meine Mutter sein musste – ausgerechnet jetzt, wo endlich alles in geordneten Bahnen lief und sie meinem Ehemann geradezu aus der Hand fraß. Ich atmete tief ein, wählte und hielt mir das Telefon ans Ohr.
»Laura!« Der spitze Schrei meiner Mutter sprengte mir geradezu die Schädeldecke. »Warum um Himmels willen hast du dich so lange nicht gemeldet? Weißt du, was ich durchgemacht habe? Dein Vater ist ganz krank vor Sorge …«
»Mir geht es gut.« Ich starrte die Decke an und spürte, wie mir die Tränen in die Augen traten. »Heute bin ich zurückgekommen. Mein Telefon war kaputt, es ist ins Wasser gefallen.«
»Was soll das, Laura? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Was ist los, Kindchen?«
Ich wusste, meine Mutter durchschaute mich, und ich musste zumindest einen Teil der Wahrheit sagen.
»Als wir auf den Kanaren waren, hatte ich einen Unfall …« Ich seufzte, Stille breitete sich zwischen uns aus. »Das Auto, in dem ich saß, ist mit einem anderen zusammengestoßen, und …« Ich hatte einen Kloß in der Kehle und schluckte krampfhaft, Tränen liefen mir über die Schläfen ins Haar. »Und …«, setzte ich erneut an, aber dann konnte ich mein Schluchzen nicht mehr unterdrücken. »Ich habe das Baby verloren, Mama.« Ich konnte hören, dass auch meine Mutter weinte.
»Mein Liebling«, flüsterte sie, und ich wusste, das war alles, was sie mir in diesem Moment sagen konnte.
»Mama, ich …«
Keine von uns beiden brachte ein weiteres Wort heraus, und wir schwiegen und weinten zusammen. Und obwohl uns mehrere Tausend Kilometer voneinander trennten, waren wir uns in diesem Moment ganz nah.
»Ich komme zu dir«, sagte meine Mutter nach einer ganzen Weile, »und kümmere mich um dich.«
»Das ist lieb gemeint, Mama, aber das bringt nichts, damit muss ich … damit müssen wir alleine zurechtkommen. Massimo braucht mich in diesem Moment so sehr wie nie zuvor. Und ich ihn. Ich komme zu euch, wenn es mir besser geht.«
Es dauerte eine Weile, bis ich meine Mutter überzeugt hatte, dass ich inzwischen erwachsen war und einen Ehemann hatte, mit dem gemeinsam ich diese schwierige Phase durchmachen und den Verlust verarbeiten musste. Aber schließlich gab meine Mutter nach.
Das Gespräch mit ihr hatte eine reinigende und heilende Wirkung, trotzdem – oder gerade deshalb – war ich danach so erschöpft, dass ich wieder einschlief. Irgendwann wurde ich wach, weil vom Erdgeschoss Lärm heraufdrang. Ich sah den rötlichen Schein des Kaminfeuers, stand auf und ging zur Treppe. Als ich die Stufen hinunterging, erblickte ich Massimo, der Holzscheite ins Feuer warf.
Ich hielt mich am Geländer fest und ging langsam, Stufe für Stufe, zu ihm hinunter. Er trug eine Anzughose und ein schwarzes, aufgeknöpftes Hemd. Als ich auf der letzten Stufe stand, hob er den Blick und schaute mich an.
»Warum bist du aufgestanden?«, blaffte er, ließ sich aufs Sofa fallen und starrte stumpf in die Flammen. »Du darfst dich nicht anstrengen, geh wieder ins Bett.«
»Ohne dich hat das keinen Sinn«, entgegnete ich und setzte mich neben ihn.
»Ich kann nicht mit dir schlafen.« Er griff nach der fast leeren Whiskeyflasche und schenkte sich ein Glas ein. »Ich könnte dir wehtun, ohne es zu wollen, und du hast durch mich schon genug gelitten.«
Ich seufzte schwer, hob seinen Arm und wollte mich unter seine Achsel schmiegen, aber er zog sich zurück.
»Was ist auf Teneriffa passiert?« In seiner Stimme schwang ein anklagender Unterton mit und noch etwas, das ich nie zuvor gehört hatte.
»Bist du betrunken?« Ich wandte ihm das Gesicht zu. Seine Miene war unbewegt, aber in seinen Augen glomm Wut.
»Du hast mir nicht geantwortet.« Seine Stimme war lauter geworden. Tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf, vor allem einer: Ob er es wusste? Ich fragte mich, ob Massimo wusste, was im Strandhaus geschehen war, und ob er irgendwie herausgefunden hatte, dass ich eine Schwäche für Marcelo hatte.
»Du hast mir auch nicht geantwortet.« Ein wenig zu schnell stand ich auf, Schmerz schoss mir in die Seite, und ich musste mich am Sofa festhalten. »Aber das brauchst du auch nicht mehr. Du bist hackedicht, und so werde ich nicht mit dir reden.«
»Und ob du mit mir reden wirst!«, schrie Massimo hinter mir und sprang vom Sofa hoch. »Du bist meine Frau, verdammt noch mal, und wenn ich dich was frage, hast du mir gefälligst zu antworten.«
Er feuerte sein Glas auf den Boden, und die Splitter spritzten in alle Richtungen. Barfuß stand ich da und krümmte mich vor Schmerzen, während er sich drohend vor mir aufbaute. Er presste die Kiefer so fest zusammen, dass die Muskeln hervortraten, und ballte die Hände zu Fäusten. Dieser Anblick entsetzte mich. Massimo wartete einen Moment, aber als ich beharrlich schwieg, drehte er sich um und verließ das Zimmer.
Ich hatte Angst, mich an einem der Glassplitter zu verletzen, also setzte ich mich wieder aufs Sofa und legte meine Füße auf ein weiches Kissen. Vor meinem inneren Auge sah ich, wie Marcelo in der Küche seines Apartments auf Teneriffa die Scherben des Tellers zusammengesammelt hatte, damit ich mich nicht verletzte. Dann hatte er mich hochgehoben und zur Seite getragen, um die Splitter aufzufegen.
»Bitte nicht!«, wisperte ich, erschrocken von dem wohligen Schauer, der mich bei diesen Erinnerungen durchrieselte. Ich rollte mich auf dem Sofa zusammen, wickelte mich in eine weiche Decke und schaute ins Feuer, bis ich einschlief.
Die nächsten Tage, oder vielmehr die nächsten Wochen, sahen kaum anders aus. Ich lag im Bett, weinte, dachte nach, erinnerte mich, dann weinte ich wieder. Massimo arbeitete, aber eigentlich wusste ich gar nicht genau, was er machte, denn ich bekam ihn nur äußerst selten zu Gesicht – meistens dann, wenn die Ärzte ins Haus kamen, um mich zu untersuchen oder zu behandeln. Die Nächte verbrachte ich allein, ich wusste nicht einmal, wo Massimo schlief. Das Castello war so groß und hatte so viele Zimmer, dass ich Massimo nicht gefunden hätte, selbst wenn ich ihn gesucht hätte.
»Laura, so geht das nicht weiter«, sagte Olga eines Tages, als wir zusammen auf einer Bank im Garten saßen. »Es geht dir wieder gut, aber du verhältst dich so, als wärst du immer noch schwer krank.« Sie bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. »Und ich habe die Nase so was von gestrichen voll! Massimo hat jeden Tag die gleiche furchtbare Laune und schleppt Domenico ständig irgendwo hin. Und du heulst stundenlang oder liegst im Bett rum. Denkst du auch mal an mich?«
»Ach komm, Olga, lass gut sein«, murmelte ich.
»Vergiss es!« Olga sprang auf und streckte mir die Hand hin. »Los, zieh dich an, wir gehen aus.«
»Olga, ich sag das so höflich wie möglich: Verpiss dich!«
Mein Blick wanderte zurück auf das ruhige Meer. Olga kochte vor Wut, das konnte ich geradezu körperlich spüren.
»Du gottverdammte Egoistin!« Sie stand auf, sodass sie mir die Aussicht versperrte, und schrie dann los: »Du hast mich hierhergeholt, du hast zugelassen, dass ich mich hier verliebe – mehr noch: Ich habe mich verlobt! Und jetzt lässt du mich hier alleine!« Sie klang elend und verzweifelt, und ich bekam Schuldgefühle.
Ich weiß nicht, wie sie es schaffte, aber irgendwie steckte sie mich in einen Jogginganzug und lud mich ins Auto. Wir hielten vor einem kleinen, typisch sizilianischen Häuschen in Taormina. Olga stieg aus, und ich schaute sie verständnislos an.
»Hoch mit dem Hintern«, schimpfte Olga, als ich nach mehreren Minuten immer noch bewegungslos auf dem Beifahrersitz saß, aber inzwischen schwang in ihrer Stimme mehr Sorge als Ärger mit.
»Kannst du mir bitte sagen, was wir hier machen?«, fragte ich, als der Securitymann die Autotür hinter mir schloss.
»Wir lassen uns behandeln.« Mit der Hand wies Olga auf das Haus. »Genauer gesagt, wir lassen uns den Kopf richten. Angeblich ist Marco Garbi der beste Therapeut auf ganz Sizilien.«
Als ich das hörte, wollte ich sofort wieder ins Auto steigen, aber Olga zog mich in Richtung Haus.
»Entweder du besorgst dir selbst einen Therapeuten, oder dein Ehemann sucht dir in seinem Kontrollwahn einen verfickten Psychodoktor, der ihm nach jedem deiner Termine haarklein alles berichtet. Allein schaffst du das nicht.«
Resigniert lehnte ich mich an den Gartenzaun. Ich hatte keine Ahnung, ob ich mir eigentlich helfen lassen wollte und wobei überhaupt.
»Warum zur Hölle bin ich nur mitgefahren«, seufzte ich, ging dann aber durchs Gartentor und die kleine Treppe hinauf und klopfte.
Der Arzt war eine mehr als außergewöhnliche Erscheinung. Ich hatte einen hundertjährigen Sizilianer mit zurückgegeltem grauem Haar und Brille erwartet, vor dem ich mich à la Freud auf die Liege legen musste. Aber nichts dergleichen. Marco Garbi sah überhaupt nicht wie ein typischer Therapeut aus. Er war nur etwa zehn Jahre älter als ich und trug ausgeblichene Jeans, ein Tanktop und Sneakers. Sein langes, lockiges Haar war zu einem Dutt gebunden. Das Anamnese-Gespräch führten wir am Küchentisch, und Marcos erste Frage war, was ich trinken wollte. Das alles erschien mir wenig professionell, aber Marco war ja hier der Spezialist, nicht ich.
Als wir uns setzten, gab Marco mir zu verstehen, dass er genau wusste, wessen Ehefrau ich war, aber auch, dass ihm das nicht das Geringste ausmachte. In seinem Haus, versicherte er mir, hatte Massimo nichts zu sagen, und von unseren Gesprächen würde er nie erfahren.
Dann bat er mich, ihm das letzte Jahr meines Lebens in allen Einzelheiten zu schildern. Aber als ich auf den Überfall zu sprechen kam, unterbrach er mich, denn er sah ja, dass ich vor Schluchzen kaum noch sprechen konnte und keine Luft bekam. Stattdessen wollte er wissen, was mir Freude machte, was ich mir für das neue Jahr gewünscht und welche Pläne ich vor Silvester gehabt hatte. Im Grunde war es eine ganz normale Unterhaltung mit einem Fremden, und danach ging es mir weder besser noch schlechter.
»Und?« Olga sprang vom Sessel im Vorzimmer auf, wo sie auf mich gewartet hatte. »Wie war es?«
»Keine Ahnung«, erwiderte ich schulterzuckend. »Keine Ahnung, ob Reden hilft.«
Wir stiegen ins Auto.
»Außerdem hat er gesagt, dass ich nicht krank bin, aber dass ich die Therapie brauche, um alles zu verstehen.« Ich verdrehte die Augen. »Und er meint, wenn ich will, kann ich weiter rumliegen.« Ich streckte Olga die Zunge heraus. »Ich weiß nur nicht, ob ich will«, fuhr ich fort. »Denn nach diesem Gespräch bin ich zu dem Schluss gekommen, dass mein größtes Problem ist, dass ich mich langweile. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, will Marco, dass ich mir eine Aufgabe suche. Dass ich etwas anderes mache als warten, dass mein altes Leben zurückkommt.« Ich ließ den Kopf an die Scheibe sinken.
»Na, das klingt doch alles wunderbar.« Olga klatschte in die Hände und hüpfte auf ihrem Sitz auf und ab. »Dann suchen wir uns mal eine schöne Aufgabe. Ich krieg dich zurück, du wirst sehen.« Sie umarmte mich, und dann klopfte sie dem Fahrer auf die Schulter. »Nach Hause.«
Als wir am Castello ankamen, parkten an die zehn Autos in der Einfahrt. Hatten wir etwa Gäste, von denen ich nichts wusste? Ich schaute an mir herab. Mein beiger Jogginganzug von Victoria’s Secret war zwar wirklich hübsch, aber definitiv nicht die Art von Kleidung, in der ich anderen Menschen gegenübertreten wollte. Normalen Menschen vielleicht schon, nicht aber den Menschen, mit denen mein Mann Umgang pflegte, sprich Gangstern aus aller Herren Länder.
Eilig durchquerten Olga und ich die endlosen Korridore, in der inständigen Hoffnung, dass sich keine der hundert Türen plötzlich öffnen und jemand herauskommen würde. Dankenswerterweise begegneten wir niemandem. Erleichtert ließ ich mich im Schlafzimmer aufs Bett fallen und wollte mich gerade wieder in den Kissen vergraben, als Olga mir die Decke wegzog und sie auf den Fußboden warf.
»Du glaubst doch selber nicht, dass ich gerade eine geschlagene Stunde bei diesem Psychotyp auf dich gewartet habe, nur um jetzt zuzusehen, wie du weiter zwischen den Daunen verrottest. Jetzt ziehen wir dir erst mal was an und renovieren dich ein bisschen.«
Sie griff mein rechtes Bein und zog mich Richtung Fußende des Bettes. Verzweifelt hielt ich mich am Kopfende fest und kämpfte mit aller Macht gegen sie an. Ich schrie, dass ich mehrere Operationen gehabt hatte und es mir nicht gut ging, aber das machte auf Olga keinerlei Eindruck. Als ich schon kurz davor war aufzugeben, ließ Olga mich plötzlich los. Kurz dachte ich, sie hätte aufgegeben, da packte sie meine beiden Füße und begann, mich durchzukitzeln. Das war ein ganz gemeines Foul, ich hatte keine Chance. Sekunden später wand ich mich kichernd auf dem Teppich, und Olga schleifte mich in Richtung Ankleidezimmer.
»Du gemeines, boshaftes, hinterhältiges Ekel!«, schrie ich.
»Ja, ja, schon gut, ich liebe dich auch«, erwiderte Olga und schnaufte vor Anstrengung. »Und jetzt rein da, anziehen«, rief sie aus, als wir die Garderobe erreicht hatten.
Schmollend und mit verschränkten Armen lag ich auf dem Teppich und schaute zu Olga hoch. Einerseits hatte ich überhaupt keine Lust, mich umzuziehen, denn nach mehreren Wochen im Pyjama hielt ich Schlafanzüge für eine absolut alltagstaugliche Kleidung, andererseits war mir klar, dass Olga nicht so ohne Weiteres aufgeben würde.
»Bitte!«, flüsterte sie und sank neben mir auf die Knie. »Du fehlst mir, Laura.«
Das reichte, um mir die Tränen in die Augen zu treiben. Ich nahm sie in die Arme und drückte sie an mich.
»Also gut, ich gebe mir Mühe. Aber erwarte keine übermäßige Begeisterung von mir.«
Olga sprang auf, tanzte um mich herum und flötete unzusammenhängendes Zeug, dann rannte sie zum Schuhregal.
»Stiefel von Givenchy«, sagte sie und hob meine beigen Lieblingsschuhe in die Höhe. »Da noch nicht Hochsommer ist, sind die perfekt, und jetzt wählst du den Rest aus.«
Ich schüttelte den Kopf, stand aber auf und ging zur Kleiderstange mit Hunderten Bügeln daran. Ich hatte keine Idee, was ich anziehen sollte, aber Olga hatte recht, das waren meine Lieblingsstiefel, dazu trug ich nicht irgendwas.
»Warum kompliziert, wenn’s auch einfach geht«, murmelte ich und nahm ein kurzes Trapezkleid mit langen Ärmeln im Beige der Stiefel vom Haken. Dann holte ich eine Garnitur aus der Wäscheschublade und ging ins Bad.
Zum ersten Mal seit Wochen stand ich vor dem Spiegel und schaute mich an. Ich sah fürchterlich aus. Ich war blass, schrecklich dünn und hatte einen widerlichen Ansatz von zwei Zentimetern Länge im Haar. Schnell wandte ich mich vom Spiegel ab.
Ich trat unter die Dusche, wusch mir die Haare, rasierte mir die Achseln, die Beine und alles andere, dann setzte ich mich in ein Handtuch gewickelt vor die Schminkkommode. Für all das brauchte ich wesentlich länger als normalerweise, aber nach zwei Stunden war ich endlich so weit. Zwar sah ich bei Weitem noch nicht wieder aus wie das blühende Leben, aber zumindest hatte ich das Bild von Elend und Verzweiflung, das ich bot, nun ein wenig übertüncht.
Als ich ins Schlafzimmer zurückkam, lag Olga auf dem Bett und schaute fern.
»Wahnsinn! Gut schaust du aus«, stellte sie fest und legte die Fernbedienung zur Seite. »Ich hatte schon fast vergessen, was du für eine heiße Braut bist. Aber setz bitte einen Hut auf, sonst siehst du aus wie eine von diesen Provinzschönheiten, die es einfach nicht draufhaben.«
Ich verdrehte die Augen, ging aber gehorsam noch einmal ins Ankleidezimmer und suchte eine passende Kopfbedeckung. Zehn Minuten später hatte ich einen Hut auf dem Kopf, eine helle Handtasche von Prada über dem Arm und eine Sonnenbrille von Valentino auf der Nase, und wir gingen zur Einfahrt. Ich bat darum, meinen Wagen aus der Garage zu holen, aber offenbar hatte Massimo verboten, dass ich alleine das Castello verließ. Also mussten wir notgedrungen mit einem schwarzen SUV und den üblichen zwei Bodyguards vorliebnehmen.
»Wohin fahren wir?«, fragte ich, als wir im Wagen saßen.
»Lass dich überraschen«, erwiderte Olga belustigt, klopfte dem Fahrer auf die Schulter, und wir fuhren los.
Eine knappe Stunde später hielten wir vor dem Hotel, in dem ich schon einmal mit Olga gewesen war. Damals hatte ich mich, unbemerkt von der Security, davongeschlichen, um meinen frischgebackenen Ehemann zu überraschen – und dann hatte ich auf dem Schreibtisch in der Bibliothek Massimos Ex-Freundin Anna mit seinem Zwillingsbruder Adriano in flagranti erwischt, Adriano aber blöderweise für Massimo gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass mir diese Erinnerung einmal ein wehmütiges Lächeln auf die Lippen zaubern würde, aber genau so war es. Lieber wollte ich noch einmal das Gefühlschaos von damals durchleben als die endlose Leere zu fühlen, die jetzt in mir war.
Die ganze folgende Aktion erinnerte ein wenig an ein amerikanisches B-Movie aus den Achtzigern, in dem Forscher im ewigen Eis einen Höhlenmenschen finden, ihn wieder zum Leben erwecken und dann halbwegs ansehnlich herrichten. Zuerst hatte ich einen Termin zur Narbenbehandlung bei einem Schönheitschirurgen. Mein Körper war nicht mehr so makellos wie früher, und auch das hatte Auswirkungen auf meine psychische Verfassung. Für radikale Eingriffe sei es noch zu früh, sagte der Arzt, zunächst sollten wir mit Kosmetika und sanften Behandlungsmethoden beginnen, und den Rest würde dann der Laser erledigen.
Danach wurde es angenehmer und netter: Wellnessanwendungen, Peelings, Masken, Massagen, dann kam die Maniküre und am Ende das unausweichliche Finale: der Friseur. Mehrere lange Minuten stand mein Friseur hinter mir, murmelte auf Italienisch vor sich hin und strich fassungslos immer wieder über meinen strohigen Haarschopf. Er schüttelte den Kopf und schnalzte mit der Zunge, schließlich brachte er auf Englisch hervor: »Was ist denn mit dir passiert? So viele Monate haben wir zusammen dafür gesorgt, dass wir schöne glatte blonde Haare haben, und nun das! Wo warst du? Auf einer einsamen Insel? Denn überall sonst wären die Leute beim Anblick deines Ansatzes schreiend davongelaufen.« Er nahm eine Strähne zwischen zwei Finger und ließ sie angewidert wieder fallen.
»Ich war in der Tat ziemlich weit weg. Und ziemlich lange – das letzte Mal haben wir uns an Weihnachten gesehen, richtig?«
Er nickte vorwurfsvoll.
»Und jetzt schau mal, wie die in drei Monaten gewachsen sind!«
Aber er reagierte nicht auf meinen Scherz, sondern verdrehte nur die Augen und ließ sich auf seinen Drehstuhl fallen. »Also, Spitzen schneiden und aufhellen?« Ich schüttelte entschieden den Kopf.
»Ich sterbe«, stöhnte er, griff sich theatralisch an die Brust und sank langsam zur Seite, als hätte er soeben einen Herzinfarkt erlitten. Aber ich hatte die Worte meines Therapeuten im Kopf, der gesagt hatte, Veränderungen sind etwas Positives.
»Jetzt werden sie lang und dunkel! Kannst du mir Extensions machen?«
Erst schüttelte er den Kopf, aber dann sprang er plötzlich wie von der Tarantel gestochen auf.
»Ja!«, schrie er. »Natürlich, das ist es! Lang, dunkelbraun und mit einem Pony!« Er klatschte in die Hände. »Elena, waschen!«
Ich schaute zur Seite, wo Olga mit offenem Mund auf ihrem Stuhl an der Wand saß und mich anstarrte.
»Du machst mich fertig, Laura«, stieß sie hervor und trank einen Schluck Wasser. »Ich warte nur darauf, dass du eines Tages in diesem Stuhl sitzt und sagst: Und jetzt rasieren wir alles ab.«
Ich weiß nicht, wie viele Stunden später ich mich mit schmerzendem Kopf und erschöpft wie nach einem Marathon von meinem Friseurstuhl erhob. Aber auch Olga musste zugeben: Ich sah wieder umwerfend aus. Wie hypnotisiert stand ich vor dem Spiegel und bewunderte meine wunderbaren langen Haare und mein perfektes Make-up unter dem gerade geschnittenen Pony, der bis an die Augenbrauen reichte. Ich konnte nicht fassen, wie gut ich aussah – vor allem nach den letzten Monaten.
Ich zog mein beiges Trapezkleid wieder an und hielt den Hut in der Hand, den ich nun gar nicht mehr brauchte.
»Ich habe einen Vorschlag, und weil Wochenende ist, kannst du einfach nicht Nein sagen.« Gouvernantenmäßig streckte Olga den Zeigefinger hoch. »Und wenn du doch ablehnst, dann findest du einen Pferdekopf in deinem Bett.«
»Ich glaube, ich weiß, was du vorschlagen willst …«
»Party!!«, schrie Olga und zerrte mich in Richtung Parkplatz. »Du siehst umwerfend aus, jung, schön, schlank …«
»… und ich habe seit Monaten nicht getrunken«, seufzte ich.
»Eben, Laura. Es wird Zeit.« Sie zog mich zum Wagen. Im ersten Moment erkannten mich die Securitytypen gar nicht und starrten mich dann verblüfft an. Ich zuckte die Achseln, ging an ihnen vorbei und stieg ein. Ich fühlte mich großartig – attraktiv, sexy und sehr weiblich. Das letzte Mal, dass ich mich so gefühlt hatte, war … auf Teneriffa gewesen, mit Marcelo.
Bei diesem Gedanken hatte ich das Gefühl, jemand hätte mir mit voller Kraft in den Magen geboxt. Ich schluckte mehrmals, aber trotzdem hatte ich einen Kloß in der Kehle. Vor meinem inneren Auge sah ich den bunt tätowierten Mann mit seinem breiten Lächeln. Ich erstarrte.
»Was ist los, Laura? Fühlst du dich nicht gut?« Olga zog an meinem Arm, während ich immer noch stocksteif dasaß und die Kopfstütze vor mir anstarrte.
»Alles gut«, murmelte ich und zwinkerte nervös. In meinem Kopf drehte sich alles.
»Vielleicht lassen wir das heute doch besser mit der Party …«
»Was? Jetzt? Wo ich schön und gestylt bin? Bei dir hackt’s wohl?« Ich schenkte Olga ein gekünsteltes Lächeln. Sie sollte auf keinen Fall erfahren, was gerade in mir vorging. Ich war nicht bereit dazu, irgendjemandem auch nur ein Sterbenswörtchen von dem zu erzählen, was in mir vorging. Ich bin verheiratet, und ich liebe meinen Mann – stauchte ich mich innerlich zusammen, als mein Unterbewusstsein mir ein weiteres Mal ungewünscht ganz andere Bilder vor Augen führte.
»Wann soll denn die Hochzeit sein?«, fragte ich Olga, um das Thema zu wechseln und mich abzulenken.
»Ach, keine Ahnung. Erst dachten wir im Mai, aber vielleicht wird es auch Juni. Das ist alles nicht so einfach …«
Olga redete ohne Punkt und Komma, und ich stellte ihr immer weitere Fragen und freute mich über ihr Glück.