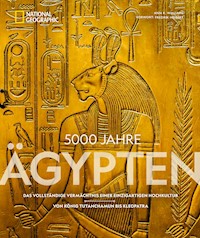
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: National Geographic Deutschland
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schon als 1922 die Nachricht von der Entdeckung des Grabs von Tutanchamun um die Welt ging, berichtete National Geographic aus erster Hand. Ein Jahrhundert später wird nun mit diesem allumfassenden Werk erneut Geschichte geschrieben. Mehr als ein opulenter Bildband, nämlich eine wahre Schatzkammer voll ägyptischer Geschichte: uralte Fundstücke, spannende Archivbilder und umfassendes Wissen über ein Volk, um das sich Mythen ranken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Auf einem Relief aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. bringt König Echnaton dem Aton, den er zum Gott über alle Götter Ägyptens erhoben hat, Opfergaben dar und erwirbt dafür göttlichen Segen und ewiges Leben.
5000 JAHRE
ÄGYPTEN
DAS VOLLSTÄNDIGE VERMÄCHTNIS EINER EINZIGARTIGEN HOCHKULTUR
VON KÖNIG TUTANCHAMUN BIS KLEOPATRA
An der weltberühmten Stätte der Pyramiden von Gizeh beschwören die Silhouetten der Sphinx und eines hoch aufragenden Grabdenkmals die Prachtentfaltung der frühen ägyptischen Könige herauf. Noch heute faszinieren die von ihnen hinterlassenen Monumente alle Betrachter.
Auf der Empore im zweiten Stock des 1902 eröffneten Ägyptischen Museums in Kairo wartet eine Porträtbüste von König Tutanchamun (um 1332–1322 v. Chr.) auf ihre Überführung in das Große Ägyptische Museum (GEM), den hochmodernen Neubau auf dem Gizeh-Plateau.
Die Königsgräber in Meroe (um 720–300 v. Chr.) im Norden des heutigen Sudan verbinden eine örtliche Interpretation der ägyptischen Pyramide mit Stilelementen aus Griechenland und Rom.
Schmuckstücke aus dem mehr als 200 Fundstücke umfassenden Schatz im Grab von König Tutanchamun (um 1332–1322 v. Chr.). Der Skarabäus-Käfer aus Lapislazuli symbolisiert Chepre, die Gottheit des Sonnenaufgangs und der Morgendämmerung und damit der Auferstehung.
Der Ruhm von König Ramses II. überdauert, eingemeißelt in die Wände seines Felsentempels in Abu Simbel, bis heute. Zum Zeitpunkt seines Todes 1213 v. Chr. war der Herrscher zum Synonym des Reichsgedankens geworden. Neun spätere Könige nahmen seinen Namen an.
Der heute legendäre König Tutanchamun wurde um 1322 v. Chr. als junger Mann beigesetzt, umgeben von unvorstellbarem Reichtum, darunter dieses Meisterwerk der Goldschmiedekunst: eine Maske aus Gold, Karneol, Quarz, Obsidian, Türkis und Glas mit einem Gewicht von mehr als elf Kilogramm.
Zu den persönlichen Gegenständen, die Tutanchamun mit ins Jenseits nehmen sollte, gehörte ein Spiegel in einem vergoldeten, mit Halbedelsteinen und Glas besetzten Holzkästchen aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. Als das Kästchen entdeckt wurde, war es allerdings leer; der Spiegel, wahrscheinlich aus Edelmetall gefertigt, war gestohlen worden. Das Gehäuse ist jedoch erhalten geblieben und trägt die Namen und Titel des Königs. Die Ikonografie verweist auf die Vorstellung der Erneuerung.
INHALT
VORWORTDR. FREDRIK HIEBERT
EINFÜHRUNGANN R. WILLIAMS
KAPITEL 1ABYDOS UND HIERAKONPOLIS
Die Wiege des Königtums
KAPITEL 2DER NIL
Wasser der Ewigkeit
KAPITEL 3MEMPHIS
Königliche Stadt der Pyramiden
KAPITEL 4ARABISCHE UND LIBYSCHE WÜSTE
Land aus Sand und Stein
KAPITEL 5LUXOR UND SEINE GRÄBER
Das Goldene Zeitalter
KAPITEL 6AMARNA
Ein radikales Experiment
KAPITEL 7DIE LEVANTE UND KUSCH
Eroberte Länder
KAPITEL 8ALEXANDRIA UND DAS DELTA
Das Tor zur Welt
REGISTER
BILDNACHWEIS
Dieses Foto einer der kolossalen Statuen von Ramses II. in Abu Simbel machte der französische Schriftsteller und Fotograf Maxime Du Camp im Jahr 1850. Er grub die Monumente teilweise aus dem Sand aus und platzierte seinen Assistenten als eine Art menschlicher Maßstab auf die Skulptur. Du Camps Reisebegleiter Gustave Flaubert schrieb: »Die ägyptischen Tempel haben mich zutiefst gelangweilt.«
VORWORT
DR. FREDRIK HIEBERT
EINIGE EXPERTEN SCHÄTZEN, dass bisher erst 30 Prozent der ägyptischen Vergangenheit durch Ausgrabungen erschlossen wurden. Andere setzen diesen Prozentsatz sogar noch niedriger an. So oder so: Es gibt noch viel zu entdecken.
Für mich als Archäologe bei der National Geographic Society ist Ägypten eine Herzenssache. Wie Howard Carter, der nach beharrlicher Vorarbeit im November 1922 das weitgehend intakte Grab des jugendlichen Königs Tutanchamun ausgrub, wurde auch ich zunächst zum Künstler ausgebildet. Beide kamen wir als Teenager nach Ägypten und hielten bei Ausgrabungen die Artefakte und architektonischen Schätze des Landes akribisch zeichnerisch fest. Beide verliebten wir uns in seine Pracht – und beide wurden wir Archäologen.
Hier enden die Parallelen bereits, denn Carters Fund im Tal der Könige war die wohl spektakulärste archäologische Entdeckung in Ägypten. Ich dagegen legte nur ein Lagerhaus aus Lehmziegeln an Ägyptens ausgedörrter Rotmeerküste frei. An unserem letzten Grabungstag stieß ich auf eine noch intakte Schilfmatte. Im Sand steckte der Schlüssel eines Händlers, der ihn vor 1500 Jahren vergraben hatte, in der Gewissheit, eines Tages zurückzukehren. In diesem Moment fühlte ich mich zutiefst mit der Vergangenheit verbunden – so wie Carter beim ersten Blick in Tutanchamuns Grabkammer. Solche Momente kommen in diesem Buch häufig vor. Kaum etwas bringt uns der Vergangenheit näher als die verlockende Aussicht auf Neuentdeckungen. Die Schönheit und die Mysterien des alten Ägypten wirken auf eine einzigartige Weise attraktiv. Faszinierende neue Funde dort versetzen uns nicht nur in die Vergangenheit zurück, sondern eröffnen uns auch die Aussicht auf weitere Rätsel, die es zu lösen gilt.
Wenn Ägypten seine neuen hochmodernen Museen eröffnet und der hundertste Jahrestag der Entdeckung von Tutanchamuns letzter Ruhestätte begangen wird, darf die Welt einmal mehr von der geradezu überwältigenden Vielfalt an Kunst, unerzählten Geschichten und neuen Geheimnissen träumen, die in diesem faszinierenden Land noch zu entdecken sind. Bis es so weit ist, wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit diesem Buch, das einen faszinierend neuen Zugang zu den Schätzen Ägyptens eröffnet.
EINFÜHRUNG
ANN R. WILLIAMS
VOR EINEM JAHRHUNDERT, als die Nachricht der Entdeckung von König Tutanchamuns Grab um die Welt ging, berichtete National Geographic Ende 1922 aus erster Hand über die Arbeit des Archäologen Howard Carter. »Am 17. Februar kam ich in Luxor an, überquerte den Fluss und machte mich zu Fuß auf den Weg zu den Gräbern der Könige«, schrieb der Korrespondent Maynard Owen Williams in der Ausgabe des Magazins vom Mai 1923. »Ich hatte es nicht eilig, mein Ziel zu erreichen. Ich wollte mich zu Fuß fortbewegen …, die afrikanische Sonne auf meinem Rücken spüren und die Kamele auf ihrem Weg zu den Zuckerrohrfeldern beobachten.«
Williams’ Interesse galt zwar vornehmlich den spektakulären archäologischen Ausgrabungen. Aber mit dem Blick des Geografen stellte er die noch junge archäologische Wissenschaft, die sich methodisch der Erforschung längst vergangener Epochen widmet, in den Kontext jenes lebendigen Landes, in dem sie betrieben wurde.
Im Tal der Könige beobachtete Williams das Gedränge von Reportern und Fotografen, die Visiten vermögender Touristen und die Ankunft von Würdenträgern – von Königin Elisabeth von Belgien bis zu Lord Allenby, dem britischen Hochkommissar für Ägypten und den Sudan. Alle wollten die sagenhaften Reichtümer sehen, die dem jugendlichen Pharao um 1322 v. Chr. auf seinem letzten Weg beigegeben wurden.
Die Fotos zum 31-seitigen Bericht nahm Williams selbst auf oder entlieh sie der New York Times und anderen Quellen. Er ermöglichte dem Publikum einen Blick in die mit Kunstgegenständen gefüllte Vorkammer des Grabs und zeigte, wie die Objekte aus dem Grab getragen und zu Carters nahe gelegenem Arbeitsplatz im bereits geräumten Grab von König Sethos II. transportiert wurden.
Für National Geographic war die Geschichte ein Coup – eine der besten Veröffentlichungen zu diesem sensationellen Fund. Der Schmuck, die vergoldeten Statuen und die mit merkwürdigen Tierfiguren verzierten Grabmäler weckten eine anhaltende Faszination für das alte Ägypten. Als Carter tiefer in die Grablege vordrang, um ein intaktes Grab zu finden, und dann das nächste Jahrzehnt damit verbrachte, die mehr als 5000 persönlichen Gegenstände des Königs zu katalogisieren, riss der Nachrichtenstrom nicht mehr ab. Tutanchamun ist für Millionen von Menschen der Schlüssel zu den Wundern des alten Ägypten. Als ausgewählte Stücke aus seinem Grab in den 1970er-Jahren in einer Wanderausstellung gezeigt wurden, bildeten sich vor den Museen lange Warteschlangen. Noch heute erinnern sich viele ehrfurchtsvoll an die prächtige Goldmaske des Pharaos. Diese und weitere legendäre Kunstgegenstände werden Ägypten wohl nie wieder verlassen. Die Versicherungssummen für solche Meisterwerke, die den fast unvorstellbaren Reichtum und die Macht des Pharaonenreichs symbolisieren, sind zu hoch.
Im Inneren des Tempels von Ramses II. in Abu Simbel stehen Statuen des Pharaos vor den Säulen, die das Dach tragen. An den Wänden der Kammer zeigen Reliefs den König in den vielen Schlachten, die er während seiner langen Herrschaft (um 1279–1213 v. Chr.) schlug.
Zeitleiste
Die Pracht des alten Ägypten hielt mehrere Jahrtausende an – eine der beständigsten Zivilisationen der Welt. Begriffe wie »Altes Reich« gab es in der Antike allerdings noch nicht. Die Bezeichnungen auf dieser Zeitleiste sind moderne Begrifflichkeiten, die der Übersichtlichkeit dienen. Die Datierung folgt derjenigen in der englischsprachigen Ausgabe dieses Buchs.
Das Jahr 2022 markiert einen weiteren epochalen Jahrestag für Ägyptologen und Ägyptophile: Im September 1822 wurde der Durchbruch des französischen Sprachwissenschaftlers Jean-François Champollion bei der Entzifferung altägyptischer Hieroglyphen gemeldet. Die Systematik der Schrift war bis dahin längst vergessen. Niemand konnte die Zeichen auf Tempeln und Gräbern, Steinobelisken und zarten Papyri mehr entziffern.
»Die Hieroglyphenschrift ist ein komplexes System, gleichzeitig figürlich, symbolisch und phonetisch, in ein und demselben Text, in ein und demselben Satz – und ich wage zu behaupten, sogar in ein und demselben Wort«, erklärte Champollion. Eine Hieroglyphe kann genau das bedeuten, was sie darstellt, einen Stier zum Beispiel. Aber dasselbe Zeichen kann auch eine Rinderherde bezeichnen. Es kann auch den Laut »ka« in einem zusammengesetzten Wort anzeigen. Der Kontext ist wesentlich, um herauszufinden, was genau ein antiker Schreiber ausdrücken wollte.
Die Entzifferung eröffnete einen neuen Zugang zum Leben der alten Ägypter. Plötzlich kommunizierten Menschen aus der Vergangenheit in ihren eigenen Worten mit modernen Lesern. Könige prahlten mit ihren Eroberungen und erteilten ihre Befehle. Gut vernetzte Beamte wurden mit detaillierten Anweisungen, wie man ins Jenseits gelangt, begraben. Chuini-Anup verlangt in den Klagen des Bauern Gerechtigkeit, nachdem ihm ein Landbesitzer seinen Esel und die auf diesem transportierten Waren gestohlen hatte.
In dem Maße, wie es Experten gelang, die Details der 3000-jährigen ägyptischen Pharaonengeschichte – Aufstieg und Fall von Dynastien, siegreiche und verlorene Schlachten – zusammenzusetzen, entstand ein faszinierendes Bild dieser vergangenen Zivilisation. Wir kennen jetzt die Namen der Könige, ihrer Gemahlinnen und ihrer Kinder, von Höflingen und Priestern, von Städten und Dörfern und von vielen weiblichen und männlichen Gottheiten, die über jeden Aspekt des ägyptischen Lebens wachten. Wir staunen über die raffinierten Erfindungen – den Pflug, den Kalender, die majestätischen Pyramiden und das Schreibmaterial, das aus den Fasern der Papyruspflanze hergestellt wurde, die auch am Ursprung des Worts »Papier« steht. Die Geschichte bekommt eine zeitliche und räumliche Dimension, die mit jeder neuen Entdeckung wächst. Alle, die die Faszination dieser großen, weit zurückreichenden Geschichte spüren, warten jedes Jahr im Oktober gespannt auf den Beginn der Ausgrabungssaison – und auf die Nachrichten über die Objekte, die die Archäologen zutage fördern.
Land der Gegensätze
Reichtum inmitten von Unfruchtbarkeit – ein Stückchen Schwemmland beherbergte mehr als 3000 Jahre lang die antike Zivilisation entlang des Nils. Auf einer Länge von 1450 Kilometern von der Grenze zum Sudan im Süden bis zur Mittelmeerstadt Alexandria im Norden prägte der längste Fluss der Erde Ägypten in der Antike – und tut es noch heute.
Seit seiner Gründung 1888 berichtet National Geographic über große Entdeckungen und archäologische Forschungsleistungen in Ägypten: William Matthew Flinders Petries Arbeit in Abydos, der ersten Begräbnisstätte der Könige, um 1900; die Auffindung einer in Gizeh bestatteten, 4500 Jahre alten Sonnenbarke aus libanesischem Zedernholz 1954; die technische Meisterleistung der Abtragung und Versetzung des Ramses-Tempels beim Bau des Assuan-Staudamms ab 1963; die Ausgrabung von Wohnräumen der Pyramidenbauer in Gizeh Ende der 1990er-Jahre; und der bahnbrechende CT-Scan von Tutanchamuns Mumie im Tal der Könige 2005.
Dieses Buch bündelt zahlreiche Funde in einer lebendigen Darstellung und bebildert eindrucksvoll die bemerkenswerte Geschichte des alten Ägypten. Dazu gehören seltene frühe Fotografien, aufgenommen noch vor Ausgrabungen und Restaurierungen, sowie wenig bekannte Bilder von Schätzen wie den Gold- und Silbergegenständen aus dem Grab von König Psusennes I. um 995 v. Chr. in Tanis, deren Entdeckung vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs überschattet wurde.
Lassen Sie sich beim Durchblättern von dem einzigartigen Fluidum und der Geschichte der verschiedenen Regionen des alten Ägypten anregen. Lernen Sie prominente Persönlichkeiten der Ägyptologie, ihre abenteuerlichen Forschungsreisen und die Entwicklung der Archäologie zu einer modernen Wissenschaft kennen. Entdecken Sie einige der Geheimnisse der altägyptischen Kultur, von den Kartuschen, die die Namen der Könige einfassen, bis hin zum Backen des Brots, von dem sich die Erbauer der großen Pyramiden ernährten.
Nicht nur unser Wissen verändert sich, auch die Art, wie wir es erwerben. Mäzene wie Lord Carnarvon, der sechs Jahre lang die Suche nach Tutanchamuns Grab finanzierte, gibt es nicht mehr. Heute werden weit weniger ägyptische Ausgrabungen von Ausländern geleitet; früher besaßen sie praktisch ein Monopol auf Entdeckungen. Ägypten bildet nun selbst Fachleute aus, die mit ihren Funden Schlagzeilen machen.
Der Wandel erfasst auch die Museen. Ein Objekt nach dem anderen verlässt die ehrwürdigen Galerien des Ägyptischen Museums in der Nähe des Tahrir-Platzes in der Kairoer Innenstadt und wird an anderen Orten auf moderne Weise präsentiert. Der aufwendige Transport der königlichen Mumien ins Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation Anfang 2022 wurde im Fernsehen übertragen.
Weitere Artefakte werden in das Große Ägyptische Museum (GEM) gebracht, das mitsamt Galerien, Konservierungslabors und Konferenzsälen mit Milliardenaufwand auf einem großen Platz mit Palmen in Sichtweite der Pyramiden von Gizeh errichtet wird. Eine kolossale Statue von König Ramses II., die 50 Jahre lang vor dem Kairoer Hauptbahnhof stand, wurde 2018 in das GEM verlegt und thront nun über einem sonnendurchfluteten Atrium.
Die Eröffnung des Museums ist pünktlich zur Hundertjahrfeier 2022 von Carters Entdeckung vorgesehen. Tutanchamuns Grabbeigaben wurden bereits in das GEM transportiert. Von den 50 000 unschätzbaren Besitztümern des jugendlichen Pharaos werden alle – einschließlich seiner Goldmaske – in einer von der Anordnung der Grabkammern inspirierten Raumfolge zu sehen sein. Eine kuratorische Meisterleistung führt sie an diesem einen Ort zusammen, zum ersten Mal, seit sie in einem längst vergessenen, inzwischen legendären Grab gefunden wurden.
Ungeachtet ständiger Veränderungen mit Problemen und Krisen gibt es auf unserer Erde noch beruhigende Gewissheiten. Mit fast jeder Schaufel Sand, die in Ägypten bewegt wird, kommt ein weiteres Fundstück zum Vorschein. Diese wertvollen Spuren der Vergangenheit erinnern an die Kreativität, den Erfindungsreichtum und die Ausdauer, die die alten Ägypter über Jahrtausende hinweg durch gute und schlechte Zeiten getragen haben. Ihre hoffnungsvolle Botschaft lautet, dass uns – solange der menschliche Geist neue Ideen hervorbringt – diese Tugenden weiterhin begleiten werden.
In einem der zahlreichen Hightech-Konservierungslabors des Großen Ägyptischen Museums inspiziert der technische Direktor Hussein Kamal den äußeren Sarg Tutanchamuns, nachdem dieser vorsichtig aus dem Ägyptischen Museum in der Kairoer Innenstadt hierher überführt wurde. Dieser erste von drei ineinandergefügten Särgen, in denen die Mumie des Königs aufbewahrt wurde, entstand etwa 1322 v. Chr. aus stuckiertem und vergoldetem Holz.
KAPITEL 1
ABYDOS UND HIERAKONPOLIS
Die Wiege des Königtums
Traditionsgemäß ließ Sesostris III. aus der 12. Dynastie (um 1836–1818 v. Chr.) sein Bildnis in Granit verewigen. Solche Denkmäler zeugen vom Wunsch der Könige, ein ewiges Vermächtnis zu hinterlassen.
AM ENDE der letzten Eiszeit, etwa 10 000 v. Chr., war das heutige Ägypten eine riesige Savanne. Sommerliche Regenfälle speisten Seen und ließen Gräser wachsen. Das entstehende Ökosystem bot Giraffen-, Nashorn- und Elefantenherden sowie nomadischen Hirten und ihrem Vieh Lebensraum. Um 5000 v. Chr. veränderte sich das Klima. Das Land wurde trockener und die Völker der Sahara wandten sich Oasen wie Dachla und Charga und dem Nil, der einzigen konstanten großen Wasserquelle, zu.
In Dörfern und Städten lenkten lokale Herrscher die gemeinschaftliche Arbeit, um die jährlichen Überschwemmungen des Flusses für die Bewässerung der Felder zu nutzen. Um 3500 v. Chr. bestanden entlang des Stroms kleine Königreiche (siehe Karte, Seiten 24–25). Die Städte im Süden gewannen bald die politische Oberhand. Das antike Nechen, etwa 80 Kilometer südlich des heutigen Luxor, zählte dazu. Damals breitete sich die vermutlich größte Stadt im alten Ägypten etwa fünf Kilometer entlang der westlichen Flussniederung aus. Ihre Verbindung mit dem Gott Horus inspirierte den späteren griechischen Namen Hierakonpolis, »Falkenstadt«.
Archäologen konnten in der Gemeinde industrielle Strukturen nachweisen. Am Stadtrand wurden mehrere Brauereien mit riesigen Bottichen gefunden, von denen selbst die kleinste täglich mehr als 1100 Liter Weizenbier produzieren konnte. In einem anderen Viertel, in dem mehr als ein Dutzend Kunsthandwerker Töpferwaren herstellten, brannte durch falsche Bedienung des Brennofens ein Haus nieder, wie verkohlte Dachbalken verraten, die 5500 Jahre später freigelegt wurden.
Ausgrabungen legten auch Spuren eines großen ummauerten Hofes frei, der durch ein monumentales Tor betreten und in dem wilde Tiere geopfert wurden. Krokodile, Nilpferde, Gazellen und Mähnenspringerschafe fanden dort ihr Ende – wahrscheinlich in Zeremonien, die den Herrscher darstellten, wie er die Ordnung der Zivilisation über das Chaos der Natur stellte, eine der grundlegenden Vorstellungen des altägyptischen Königtums. Bestattungen weisen außerdem auf eine sich verfestigende Kultur hin: frühe Versuche mit der Mumifizierung. Aus einigen Arbeitergräbern wissen wir, dass die inneren Organe der Verstorbenen entfernt, in harzgetränkten Stoff eingewickelt und in den Körper zurückgelegt wurden.
Das große Angebot von Kunstgegenständen auf regionalen Märkten veranlasste 1897 offizielle Ausgrabungen an der Stätte. Zwei Objekte aus der ersten Grabungssaison deuten auf eine Schlüsselrolle von Nechen bei der Entstehung des altägyptischen Königtums hin. Ein zeremonieller Keulenkopf aus Stein trägt den Namen von König Skorpion. Eingemeißelte Szenen weisen darauf hin, dass dieser frühe Herrscher andere Städte eroberte und seine Macht festigte. Das zweite Stück ist eine Prunkpalette für Narmer mit einer Krone auf der einen Seite, die dem nördlichen Ägypten zugeordnet ist, und einer weiteren auf der anderen Seite, die das südliche Ägypten darstellt. Die Reliefs zeigen den König, wie er einen Feind erschlägt und an den enthaupteten Körpern seiner Feinde vorbei an einer Siegesparade teilnimmt, was darauf hindeutet, dass er jener Kriegerkönig war, dem es gelang, Ägypten zu vereinen.
Ein grimmiger Falkenkopf aus Gold und Obsidian stellt den Gott Horus, den Beschützer des Königs, dar. Das Kunstwerk stammt aus der 6. Dynastie (etwa 2325 v. Chr.) und wurde in Hierakonpolis gefunden.
Vor zwei Jahrtausenden wurde diese kunstvolle Votivgabe in Abydos deponiert. Die Hülle täuscht: Sie suggeriert einen mumifizierten Ibis als Inhalt, aber im Inneren befinden sich nur Federn.
Etwa 95 Kilometer nordwestlich von Luxor liegen in Abydos die Gräber jener frühen Könige, die die politischen und kulturellen Grundlagen für die nächsten drei Jahrtausende schufen. Die Grabkomplexe bestehen aus zwei getrennten Elementen: eine große Anlage aus Lehmziegeln in der Nähe des Überschwemmungsgebiets westlich des Nils, wo die Begräbnisrituale stattfanden, und eineinhalb Kilometer entfernt ein unterirdisches Grab am Rand der Wüste, die die alten Ägypter als Reich der Toten betrachteten. Vor Baubeginn mussten die Bauarbeiter die rituelle Anlage des vorherigen Herrschers abreißen. Nur das Bauwerk von Chasechemui, dem letzten König der 2. Dynastie, existiert noch. Die massiven Mauern sind 4600 Jahre alt, drei Stockwerke hoch und fassen noch immer fast 8000 Quadratmeter Sand ein.





























