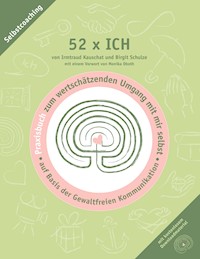
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Willst du deine beste Freundin oder dein bester Freund werden? In diesem Buch findest du anregende, abwechslungsreiche und erfahrungsintensive Übungen auf Basis der Gewaltfreien Kommunikation. Diese ermöglichen dir, mit dir selbst eine tiefe und liebevolle Verbindung zu erleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Die Kürzel hinter den Übungstiteln verweisen auf folgendes:
Vorwort
Einleitung
Wertschätzung
Die Autorinnen
Unsere Intention
Zum Aufbau des Buches und wie du es nutzen kannst
Die Übungen und Methoden
Verwendete Methoden
Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation
Marshall B. Rosenberg, Begründer der Gewaltfreien Kommunikation
Zum Begriff der Gewaltfreien Kommunikation
Bewusstsein und Methode
Die drei Wege der Gewaltfreien Kommunikation
Zur Geschichte von Wolf und Giraffe
Vorbereitung
Mein sicherer Platz
Übungen
Ü 01 Das große Los
Ü 02 Bedürfnisspaziergang
Ü 03 Bedürfnis-Check
Ü 04 Bedürfnisse und Werte
Ü 05 Bedürfnisse und Wege sie zu erfüllen – OPAZO
Ü 06 Bedürfnis und Gefühl 1
Ü 07 Bedürfnis und Gefühl 2
Ü 08 Bedürfnisse als Ursache für Gefühle erkennen
Ü 09 Was macht mich glücklich?
Ü 10 Heute: 12 Uhr Erholung
Ü 11 Bedürfnis – Strategie
Ü 12 Mit einem Bedürfnis durch den Tag
Ü 13 Bedürfnis und Gefühl 3
Ü 14 Lieblingslied
Ü 15 Selbstwertschätzung
Ü 16 Verantwortung übernehmen für „müssen“ und „sollen“
Ü 17 Von Herzen bitten
Ü 18 Was habe ich getan? Was brauche ich?
Ü 19 Morgen, morgen nur nicht heute
Ü 20 Termine und Bedürfnisse
Ü 21 Ungeliebte Tätigkeit
Ü 22 Du bist mir sympathisch (Wertschätzung)
Ü 23 Stille Selbsteinfühlung im Alltag
Ü 24 Selbsteinfühlungstanz
Ü 25 Finde deine persönlichen Schutzstrategien
Ü 26 Meine Triggersätze 1
Ü 27 Beobachtung/Bewertung über mich selbst (SE)
Ü 28 Mutter (SE / SP)
Ü 29 Eine neue Balance finden (SE)
Ü 30 Mit dem Rücken an der Wand (SE / SP)
Ü 31 Wiederkehrender Konflikt in mir (Immer ich) (SE)
Ü 32 Der gute Grund – Triggersätze 2 (SE / SP)
Ü 33 Gemeinsam schaffen wir das - Ich hole mir Unterstützung!
Ü 34 Wiederkehrender Konflikt mit anderen (SE / SP)
Ü 35 Fremdschämen (SE / SP)
Ü 36 Du bist mir unsympathisch (SE / SP)
Ü 37 Geliebter Feind (SE / SP)
Ü 38 Ich bin mein/e beste/r Freund/in
Ü 39 Ich liebe meine „Problemzonen“
Ü 40 Selbstcoaching (SE)
Ü 41 Kontakt zur Vergangenheit (SE / SP)
Ü 42 Was ist los, wenn ich nicht mit mir verbunden bin?
Ü 43 Was mag ich an mir? (Radikale Selbstakzeptanz) (SE)
Ü 44 Die Kosten, wenn ich „ja“ sage, obwohl ich „nein“ meine. (SE / SP)
Ü 45 Meine Angst und ich (SE / SP)
Ü 46 Radikale Selbstliebe 1 (SE / SP)
Ü 47 Was hindert mich am Bitten? (SE / SP)
Ü 48 „Besser sein“ oder „Sein“ (SE)
Ü 49 Radikale Selbstliebe 2 (SE / SP)
Ü 50 Meine Glaubenssätze zum Geld (SE)
Ü 51 Visionen
Ü 52 Standing Ovations
Schlüsselunterscheidungen
Schlüsselunterscheidungen zu den vier Schritten
S 01 Beobachtung / Wahrnehmung – Gedanken / moralische Bewertungen
S 02 Werturteil – Moralisches Urteil
S 03 Gefühle – Gefühle vermischt mit Gedanken / Pseudogefühle
S 04 Auslöser für Gefühle – Ursache für Gefühle
S 05 Bedürfnis – Weg (Strategie)
S 06 Liebe als Bedürfnis – Liebe als Gefühl
S 07 Bedürfnis – Werte
S 08 Bedürfnis – Bitte
S 09 Bitte – Wunsch
S 10 Bitte – Forderung
S 11 Nicht aufgeben / beharrlich dranbleiben – Fordern / durchsetzen
S 12 Idiomatische vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation – Formale vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation
Schlüsselunterscheidungen zu Selbstempathie
S 13 Selbstempathie – Ausagieren, unterdrücken oder schwelgen in Gefühlen
S 14 Schmerz – Leiden
S 15 Selbstakzeptanz – Scham
S 16 Überlebende – Opfer
Schlüsselunterscheidungen zu Empathie
S 17 Einfühlung (Empathie / Verstehen auf Herzensebene) – Einverstanden sein
S 18 Einfühlung (Empathie) – Sympathie
S 19 Einfühlung (Empathie) – Trösten
S 20 Einfühlung (Empathie) – Toleranz
S 21 Empathisches Erraten / Vermuten / Ahnen – Wissen / intellektuelles Herumraten
S 22 Empathisches Verstehen – Intellektuelles Verstehen
S 23 Mit dem Herzen hören – Mit den Ohren hören
S 24 Empathisches Zuhören – Zuhören, um zu antworten
Schlüsselunterscheidungen zu Selbstausdruck
S 25 GFK-Ehrlichkeit (Selbstausdruck) – Alltags-Ehrlichkeit
S 26 Selbstausdruck – Meine Meinung mitteilen
S 27 Nein sagen in GFK-Haltung – Nein sagen in Alltagssprache
S 28 Wut / Ärger empathisch ausdrücken – Wut / Ärger moralisch ausdrücken
S 29 Selbstausdruck – Jammern, klagen
S 30 Besorgt sein – Drohen
S 31 Verletzlichkeit / Stärke – Schwäche
S 32 Begeistert sein – Missionieren
Schlüsselunterscheidung zu Wertschätzung
S 33 Wertschätzung – Zustimmung, Lob, Komplimente
S 34 Feedback – Lob, Tadel und Kritik
Schlüsselunterscheidung zu Verantwortung
S 35 Verantwortung – Müssen / sollen
S 36 Verantwortung übernehmen – Anderen die Schuld geben
S 37 Perspektivenwechsel (shift) – Kompromiss
S 38 Selbstbestimmte Wahl (Selbstermächtigung) – Unterwerfung oder Rebellion
S 39 Achtung (Respekt) vor Autorität – Angst vor Autorität
S 40 Selbstdisziplin – Gehorsam
S 41 Verantwortung / Opfer, Täter
S 42 Verantwortung für meine Handlung übernehmen – Um Entschuldigung bitten
Schlüsselunterscheidung zur inneren Haltung
S 43 GFK-Bewusstsein leben – GFK mechanisch anwenden
S 44 GFK-Bewusstsein – Richtig- und Falsch-Bewusstsein
S 45 Mit dem Leben verbunden – Dem Leben entfremdet
S 46 Natürlich – Gewohnt
S 47 Gegenseitige Abhängigkeit (Interdependenz) – Abhängigkeit / Unabhängigkeit
S 48 Macht mit – Macht über
S 49 Gebrauch von schützender Macht – Gebrauch von strafender Macht
S 50 Wissen teilen – Wissen (be)lehren
S 51 Versöhnung – Vergebung
S 52 Achtsamer Umgang mit Sprache – Mechanische Political Correctness – Herrschaftssprache
Anhang
Meditation zur Vorbereitung: Mein sicherer Platz
Meditation zur Übung 18: Was habe ich getan? Was brauche ich?
Meditation zur Übung 52: Standing Ovations
Beispiel zur Übung 40: Selbstcoaching
Beispiel zur Übung 48: „Besser sein“ oder „Sein“
Beispiel zur Übung 50: Meine Glaubenssätze zum Geld
Literaturliste und Impressum
Hinweise
Vorwort
Marshall B. Rosenberg (1937 – 2015), der Begründer der Gewaltfreien Kommunikation, sprach immer wieder davon, dass Menschen, die selbst in ihren Bedürfnissen genährt sind, Freude daran haben, zum Wohle anderer beizutragen. Er verglich es mit einer wohlgenährten Mutter, die ihr Baby stillen könne, wohingegen Mütter aus Bürgerkriegsgebieten in unversorgten Flüchtlingslagern oft keine eigenen Milch mehr hätten, um ihren Säugling zu nähren. Ein existenzielles, ein dramatisches Bild.
Und so existenziell verhält es sich auch mit den psychischen Bedürfnissen nach Zugehörigkeit, Berücksichtigung, Achtsamkeit, Respekt, Schutz usw. Ich las neulich in Rosenbergs Buch: „Was deine Wut dir sagen will. Überraschende Einsichten“. (Junfermann 2006): „Jeder Mensch, der es genießt, andere zu verletzen, war selbst einmal einer großen Gewalt ausgesetzt, psychologisch oder auf eine andere Art und Weise. Und diese Menschen brauchen Einfühlung für unglaubliche Schmerzen, die sie empfinden.“ Rosenberg wusste, wovon er sprach; er arbeitete jahrzehntelang immer wieder mit Häftlingen.
Man könnte daraus umgekehrt folgern: Jeder Mensch, der es genießt, zum Wohle anderer beizutragen, hat selbst einmal nährende Fürsorge und Schutz genossen, die Erfüllung seiner geistigen und seelischen Bedürfnisse. Nur ein gefülltes Gefäß kann an andere ausschenken!
Sprache stellt in diesem Bild einen Teil des Gefäßes dar. Das Getränk darin symbolisiert den Inhalt der jeweiligen Aussage und die innere Haltung, die darin zum Ausdruck kommt: ein nährendes oder giftiges Getränk, ein erfrischendes, wärmendes, Übelkeit erzeugendes, stark gezuckertes, prickelndes, ein narkotisierendes oder wach machendes Getränk…
Natürlich brauchen wir das „Gefäß“ der Sprache, damit wir unsere Botschaften weiter geben können. Gleichzeitig „schmeckt“ unser Gegenüber sofort, aus welchen Inhalten das „Getränk“ besteht. Da kann das Gefäß der Worte noch so schön, perfekt geformt und wasserdicht sein, die Inhaltsstoffe sind entscheidend.
Mir gefällt auch die Metapher des „Bahnhofs“ mit seinen Zügen, Gleisen und Weichen: Wenn die innere Einstellung – die Weiche – auf Rechthaben, d.h. richtig – falsch – Denken steht, kann unser Zug noch so schön und perfekt eingerichtet sowie auf technisch tadellosem Stand sein; der Lokführer viele Jahre ausgebildet und zertifiziert werden. Auch die Lautsprecheransagen in diesem Zug können noch so geschliffen und freundlich formuliert klingen. Die Steuerung der Weichen, d.h. deren Einstellung entscheidet letztlich, wohin der Zug fährt. Und auf solche Weichen trifft unser Lebenszug immer wieder.
Wenn wir z.B. feststellen, dass uns in einem Konflikt Gedanken unterkommen wie: „Es ist nicht in Ordnung, das der Trainerkollege Ärger ausdrückt, das ist ja kein richtiges Gefühl! Da steckt ja noch ein Urteil über die Handlung des anderen drin, und Urteile sind laut GFK nicht in Ordnung!!“, dann können wir herzlich über uns selbst lachen, liebevoll die Ironie der Situation erfassen: Uups! Vielleicht möchte hier noch eine Weichen-Einstellung betrachtet werden. Ein interessanter und lohnenswerter Anlass für eine Selbstklärung!
Irmtraud und Birgit haben zur Unterstützung dieser immer wieder fruchtbaren Selbsterklärung und –empathie das vorliegende Buch verfasst. Ich habe das Manuskript mit großem Genuss gelesen und mit der Praxis einiger Übungen daraus begonnen. Dabei geht es auch um das vollumfassende „Wertschätzen“ der großen inneren „Weicheneinstellungen“, d.h. der Glaubenssätze, die unsere Wege und Handlungsrichtungen bisher beeinflusst haben und die wir jetzt möglicherweise verändern oder liebevoll verabschieden möchten. Das Anerkennen alter Gewohnheitsmuster unseres Denkens, Sprechens und Handelns – als Helfer unserer Kindheitsjahre, die mittlerweile in die Jahre gekommen sind – ist dabei heilsamer als das ablehnende Weg-machen-wollen der jetzt blockierenden Überzeugungen („Weichenstellungen“).
Mit meinem Lebenszug fahre ich durch verschiedene Landschaften, Knotenpunkte und Bahnhöfe, manchmal sogar Sackbahnhöfe, in denen ich umkehre. Mal werden Waggons hinzukommen, mal abgekoppelt. Menschen kommen und gehen an Bord. Ich stelle fest, dass es in jeder Lebensphase neue Weichen anzuschauen und auf Einstellung und möglicherweise Veränderung zu überprüfen gilt. Wer sollte da ausgelernt haben? Mit 30 Jahren hatte ich nicht dieselben Fragen und Herausforderungen des Lebens wie mit 50! Eine frische Liebesbeziehung ebenso wie eine gereifte Partnerschaft fordern immer neue Weichen heraus; eine Elternschaft offenbart ungeahnte neue Einstellungsfragen, existenzielle Ängste beruflicher Art sind Auslöser für Weichenstellungen und damit Entwicklungs-Katalysatoren. Manchmal fährt unser Zug in unbekannte Gebiete, in die wir bisher nicht den Mut hatten, einzureisen. Oder ein langer Tunnel bringt uns an unsere Grenzen und lädt wiederum zur inneren Weiterentwicklung ein.
Das A und O im Wachsen an der Gewaltfreien Kommunikation ist meiner Erfahrung nach also nicht primär das Trainieren der „richtigen Ausdrucksweise in 4 Schritten“, sozusagen „für alle Zeiten und für jede Gelegenheit“. Sondern es geht um die eigene Persönlichkeitsentwicklung durch jede Lebensphase in die gewaltfreie Haltung hinein: Jedes Mal eine Einladung zu befreiender Selbstempathie, zum Loslassen von Annahmen, Meinungen und Konzepten, zur Entfaltung innerer Großzügigkeit, zur Vorurteilslosigkeit und Lebendigkeit statt blockierender Glaubenssätze.
Dabei schenkt uns Selbstempathie und Persönlichkeitsentwicklung vor allem: die Befreiung bisher unwillkommen scheinender Wesenszüge, Gefühle und Bedürfnisse. Sie bedeuten die Öffnung wahrer Schatztruhen unseres großen Herzens, die Erhellung noch unbekannter Räume unserer Persönlichkeit, die im Schatten lagen. Sie ermöglichen Selbstempathie und Versöhnung mit uns selbst und die Entwicklung ureigener Talente, die bis dato „innerlich verboten“ waren – weil familiär oder gesellschaftlich abgewertet.
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit geschieht dabei auf jeder Wegstrecke im Wechsel mit dem FÜHLEN alltäglicher Geschehnisse: Pannen, Freuden und Krisen, dem Dialog oder Krach mit Menschen, egal wie gelungen und unperfekt wir uns darin äußern. Es geht ums FÜHLEN im Prozess des Lernens und Wachsens, nicht um das starre Wiederholen „richtiger“ Schritte, Vokabeln und Redeweisen, die angeblich GFK definieren. GFK ist ja keine Methode, sondern eine innere Haltung, eine Lebenseinstellung mit daraus möglichen Handlungsprinzipien z.B. auch Sprachweisen.
Worte und Sätze machen dabei allerdings nur ca. 20% der Wirksamkeit in der Kommunikation aus! Die restlichen 80% der menschlichen Kommunikation übertragen sich durch – nicht steuerbare – Mimik, Augenausdruck und Körpersprache, geprägt durch unsere innere Haltung als Sprechende. Die innere Einstellung zur zuhörenden Person und Verhaltensweise überträgt sich so oder so. Von daher bin ich wirklich sehr froh und dankbar, dass Birgit und Irmtraud nicht ein weiteres Buch zu „Redeweisen“ der GFK geschrieben haben, sondern uns eine Fülle von Übungen zur Erforschung innerer Weichen, Selbstempathie und inneren Entwicklung schenken!
Es geht um die Grundhaltung der Offenheit, des Fühlens im aktuellen Augenblick, der Aufrichtigkeit, der inneren Beweglichkeit, des Mutes zur Unsicherheit mit bewusstem Verzicht auf feste Meinungen. Für die Entwicklung einer tiefen Kontaktfähigkeit brauchen wir die Fähigkeit des vollumfassenden Fühlens (statt Abspalten aus Angst vor Schmerzen) und des vorurteilsfreien Kontakts wie ein Kind sie hat (statt Bewerten aus Angst vor Orientierungsverlust). Um die Frische des gegenwärtigen Augenblicks – darum geht es!
Genau dies ist aber auch eine Herausforderung: In einer Kultur, die „Bildung“ mit kognitivem, denkorientiertem Lernen gleichsetzt, und in einer Gesellschaft, die auf Stärke und Erfolg setzt, scheint das Ausdrücken von Verletzlichkeit riskant. Das Nicht-Wissen auszuhalten, die Begegnung mit eigenen Ängsten, Zartheit, Scheitern, Schwäche, Unsicherheit und Bodenlosigkeit zu wagen, den Schmerz in uns und anderen nicht zuzukleistern mit Reden, Texten, diskursivem Denken, Ratschlägen – das erfordert Mut.
Diesen Mut zu entwickeln, bedeutet möglicherweise erst einmal, dass ich meine in meiner Biographie ungenährten Bedürfnisse „nachnähre“: Dass ich überhaupt wieder Zutrauen gewinne zu Selbstwertschätzung, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Respekt und Schutz. Denn viele von uns sind in ihrer Biographie so tief und dauerhaft verletzt worden, dass es Zeit und Übungen braucht, den einstmals wertvollen Schutzpanzer des Misstrauens, der Urteile und Überzeugungen aufzuweichen und Mut zu neuen „Abenteuerfahrten“ zu entwickeln.
Mangelnde Bedürfniserfüllungen in unserer – vor allem vorsprachlichen – Kindheit sind erfahrungsgemäß nicht durch kognitive Übungen „in den Griff“ zu bekommen! Der denkende Teil des Gehirns – Neokortex – ist bei unangenehmen Gefühlen, vor allem Erschrecken und Angst, nicht vorrangig aktiviert. Um unser – in unangenehmen und emotional bewegenden Situationen – wirklich wirksames Areal im Gehirn zu erreichen, braucht es Übungen, die das „limbische System“ ansprechen. Dies geschieht durch (innere) Bilder, Fantasiereisen, Handlungen, Übungen, Ausprobieren, gute Erfahrung u.v.m., die uns FÜHLEN lassen.
Dazu ein drittes Bild, welches mich zur Selbstfürsorge ermutigt: Stellen Sie sich eine Topfpflanze mit Namen „Selbstwertschätzung“ vor. Sie hat bisher im Schatten gestanden, sie ist vernachlässigt worden. Sie wurde selten gegossen und verfügt über wenig Erde und Nährstoffe. Die Wurzeln liegen teilweise frei und sind vertrocknet. Wenn ich mit mir selbst in derselben Weise wie mit dieser Pflanze umgehe, z.B. mit einer starken inneren Kritikerin, dann wird jeder Tadel von außen bzw. jede noch so gut gemeinte, wie achtsam formulierte Kritik in mir eine weitere Kränkung auslösen und meine Enttäuschung und meinen Unwillen gegenüber anderen Menschen nähren. Parallel zum Lernen, wie ich mit gewaltfreien Worten und Redeweisen auf andere Menschen zugehe, geht es also um die Heilung meiner eigenen Selbstwertschätzungs-„Pflanze“. Dies braucht Zeit und immer neue „Pflege“, sprich konkrete Übungen. Es braucht Kontakt mit mir selbst, Aufmerksamkeit für mich selbst, Zeit für mich selbst. Wie bei einer Pflanze geschieht dann das Natürliche: Ich blühe auf, werde kräftig, entwickle mich, richte mich auf und bringe Früchte. Ich kann dann etwas weitergeben.





























