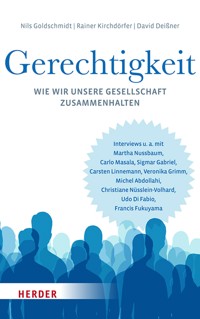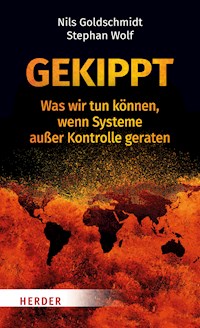Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
75 Jahre nach der Währungsreform, dem Beginn der Sozialen Marktwirtschaft, führen Nils Goldschmidt und Stefan Kolev erzählerisch und unterhaltsam in Geschichte und Gegenwart der Sozialen Marktwirtschaft ein. Anhand zahlreicher Beispiele vermitteln sie ein Verständnis dafür, was dieses Wirtschaftsmodell auszeichnet und wie aktuell die Versöhnung von wirtschaftlicher Effizienz und gesellschaftlicher Akzeptanz ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 89
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nils Goldschmidt/Stefan Kolev
75 Jahre Soziale Marktwirtschaft in 7,5 Kapiteln
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2023
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: wunderlichundweigand, Stefan Weigand
Umschlagmotiv: © Wilhelm Beestermöller
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft SRL, Timișoara
ISBN Print: 978-3-451-07234-5
ISBN E-Book (EPUB): 978-3-451-84998-5
ISBN E-Book (PDF): 978-3-451-84997-8
Inhalt
Kapitel 1 Anfang Dezember 1946 – Der Heureka-Moment
Kapitel 2 20. Juni 1948 – Der Sprung ins Ungewisse
Kapitel 3 7. September 1944 – Akademischer Mut
Kapitel 4 20. Februar 1967 – Die Kunst des Kompromisses
Kapitel 5 1. Juli 1990 – Die Zäsur
Kapitel 6 14. März 2003 – Der Umbau
Kapitel 7 31. August 2015 – Wir schaffen das!
Kapitel 7,5 24. Februar 2022 – Zeitenwende
Zum Abschluss
Anmerkungen
Über die Autoren
Die Verwaltung für Wirtschaft hat bereits am gestrigen Tage von dieser Stelle aus Freigaben von verschiedenen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern aus der Bewirtschaftung verkündet, und es sind alle Vorbereitungen getroffen, die Zügel der Bewirtschaftung noch lockerer zu gestalten. Die Resonanz, die dieser Übergang zu freieren Formen der Wirtschaft in unserem Volke gefunden hat, beweist nur, wie gründlich satt es dieser staatlichen Bevormundung ist und wie befreiend unser Volk die ihm zurückgegebene Möglichkeit der selbstverantwortlichen Gestaltung seines Schicksals empfindet.
Ludwig Erhard,
Rundfunkansprache, 21. Juni 1948
Ein Tag nach der Währungsreform – dem Beginn der Sozialen Marktwirtschaft
Kapitel 1Anfang Dezember 1946 – Der Heureka-Moment
Es ist wenige Wochen her, dass der eine Autor dieses Buches über den Marktplatz in Siegen lief und im Vorübergehen einen kurzen Gesprächsfaden zweier Studierender aufschnappte. Studentin: „Na ja, die Soziale Marktwirtschaft ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes.“ Student: „Hm, wenn überhaupt, war da bei Ludwig Erhard noch ein Konzept dahinter.“ Diese Begegnung hatte zwei Wirkungen auf Nils. Zum einen konnte er ein freudiges Schmunzeln nicht unterdrücken: „Ja! Es gibt sie doch noch, junge Menschen, die sich für die Soziale Marktwirtschaft interessieren.“ Zum anderen machte sich zugleich Betrübnis breit: „Oje, Soziale Marktwirtschaft wird bestenfalls noch als Windbeutel wahrgenommen: inhaltlich hohl, mit viel Platz für Schaumschlägerei.“
Der andere Autor, Stefan, machte in den vergangenen Monaten ähnliche Erfahrungen in den USA während seines Forschungsaufenthaltes an der Princeton University. Wenn es bei Vorträgen um die Soziale Marktwirtschaft ging, kam bei liberalen amerikanischen Ökonomen oft Skepsis auf: „Nach der reinen Lehre des Liberalismus klingt das alles nicht.“ Oder: „Bist du dir sicher, dass man das alles vom ‚muddle of the middle‘ der Sozial- und Christdemokratie – diesem kompasslosen Durchwurschteln der Parteien der Mitte – klar unterscheiden kann?“
Aber fangen wir vorne an: Vermutlich Anfang Dezember 1946, mitten im „Hungerwinter“, der im kriegszerstörten Deutschland und bei eisiger Kälte für entsetzliches Leid in der Bevölkerung sorgte, eilte Alfred Müller-Armack das zugige Treppenhaus im Herz-Jesu-Kloster in Vreden-Ellewick herunter und rief dabei: „Nun weiß ich, wie es heißen muss. ‚Soziale Marktwirtschaft‘ muss es heißen! ‚Sozial‘ mit großem ‚S‘!“ Der Heureka-Moment für die Soziale Marktwirtschaft! Und ein Hoffnungsschimmer in verzweifelter Zeit.
Eigentlich lehrte und forschte Müller-Armack seit 1940 als Professor für Nationalökonomie und Kultursoziologie an der Universität Münster, wo er auch die Forschungsstelle für allgemeine und textile Marktwirtschaft leitete. Zu Beginn der nationalsozialistischen Diktatur stand er den neuen Machthabern durchaus mit einer gewissen Sympathie gegenüber. Aber bald wurde ihm klar, auf welche unmenschliche, unchristliche und rassistische Politik das neue Regime hinauslaufen würde, ohne dass er in die aktive Opposition ging.
Kriegsbedingt wurde im Jahr 1943 seine Forschungsstelle in das nahe der holländischen Grenze gelegene Kloster in Vreden ausgelagert. Dort entstanden die wesentlichen Partien seines Buches Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, das er in ebendiesem Dezember 1946 abschloss und das im folgenden Jahr erschien. Das Buch enthält erstmals den Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ und zeigt in Grundzügen Müller-Armacks Vorstellungen von dieser Wirtschafts- und Sozialordnung. Funfact am Rande: In einem maschinenschriftlichen Typoskript, das kurz vor der Drucklegung des Buches getippt wurde und das bis heute im Archiv für Christlich-Demokratische Politik in Sankt Augustin aufbewahrt wird, findet sich noch der Begriff „Gesteuerte Marktwirtschaft“. Müller-Armacks „Heureka!“ wurde zum Glücksfall für das Programm der Sozialen Marktwirtschaft: Nicht die technische Umsetzung soll die neue Wirtschafts- und Sozialordnung in Westdeutschland prägen („steuern“), sondern ihr Ziel. Es geht um das soziale Miteinander, es geht um eine Wirtschaft für den Menschen.
Mit dieser kurzen Erzählung haben wir schon zwei wesentliche Charakteristika der Sozialen Marktwirtschaft umrissen. Erstens – und ganz pragmatisch – handelt es sich bei der Sozialen Marktwirtschaft um die wirtschaftliche und soziale Ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland etabliert wurde. Zweitens – und das ist schon weniger offensichtlich – ist der Maßstab für die Güte der Sozialen Marktwirtschaft nicht allein die wirtschaftliche Effizienz, sondern ebenso das Wohlergehen der Menschen, die in ihr leben. Drei weitere Elemente kommen hinzu: Die Soziale Marktwirtschaft lässt sich als eine regelgeleitete Wirtschaftspolitik charakterisieren, die mittels einer rechtlichen Rahmenordnung sicherstellt, dass der Wettbewerb auf den Märkten zu gesellschaftlich wünschenswerten Ergebnissen führt – die dritte Eigenschaft. Viertens: Der Staat garantiert diese Rahmenordnung (Wirtschaftsverfassung), um einen fairen und entmachtenden Wettbewerb hervorzubringen. Und fünftens: Es ist nicht die Aufgabe des Staates, selbst aktiv in den Markt einzugreifen.
Die zuletzt genannten drei Eigenschaften der Sozialen Marktwirtschaft als geordnete, nicht aber staatlich gelenkte Marktwirtschaft ähneln im Grundgedanken einem Fußballspiel: Wie beim Fußball wird auch den wirtschaftlichen Akteuren, die sich im Wettbewerb messen, in der Sozialen Marktwirtschaft ein verbindlicher Ordnungsrahmen (Spielregeln) vorgegeben. Innerhalb dieser Spielregeln können sich Produzenten und Konsumenten (Spieler) frei bewegen und solche wirtschaftlichen Aktivitäten (Spielzüge) suchen, die in ihrem Interesse sind. Die Rahmenbedingungen (Spielregeln) sind so zu gestalten, dass man einen fairen Wettbewerb (Spiel) erwarten kann. Die Aufgabe des Staates bzw. der Politik (im Sinne eines Schiedsrichters) ist es, für den regelgerechten Ablauf zu sorgen.
Ludwig Erhard, der als erster Bundeswirtschaftsminister die junge Soziale Marktwirtschaft gemeinsam mit Alfred Müller-Armack kongenial prägte, war offensichtlich auch Fußballfan. In seinem Bestseller Wohlstand für Alle von 1957 schreibt er: „Ich möchte hierbei das vielleicht etwas banal erscheinende Bild eines Fußballspiels gebrauchen dürfen. Da bin ich der Meinung, dass ebenso wie der Schiedsrichter nicht mitspielen darf, auch der Staat nicht mitzuspielen hat. Eines ist bei einem guten Fußballspiel als wesentliches Merkmal zu erkennen: Das Fußballspiel folgt bestimmten Regeln, und diese stehen von vornherein fest. Was ich mit einer marktwirtschaftlichen Politik anstrebe, das ist – um im genannten Beispiel zu bleiben – die Ordnung des Spiels und die für dieses Spiel geltenden Regeln aufzustellen.“1
Die Bezeichnung Soziale Marktwirtschaft war womöglich ein göttlich inspirierter Gedanke, der sich hinter Klostermauern Bahn brach, das Konzept selbst hingegen fiel nicht vom Himmel. Im Hintergrund stehen die Ideen der sogenannten Historischen Schule, ein deutscher Sonderweg in den Wirtschaftswissenschaften – auch wenn diese Tradition heute weitgehend vergessen ist. Diese wissenschaftliche Richtung, die zwischen 1870 und 1920 das ökonomische Denken in Deutschland dominierte, hatte keinen fest umrissenen einheitlichen Kanon, aber ihre Vertreter einte die Überzeugung, dass die Ansichten der klassischen Nationalökonomie im Gefolge von Adam Smith und David Ricardo ergänzt werden sollten. Eine Politische Ökonomie habe nicht vordringlich nach allgemeinen Wirtschaftsgesetzen zu suchen, sondern es gelte vielmehr, die jeweiligen historischen Besonderheiten einzelner Länder im Laufe der Zeit aufzudecken und zu berücksichtigen. Ziel der historischen Beschreibung ist die konkrete, praktische Umsetzung in wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen. Insbesondere Gustav Schmoller, der Starökonom jener Jahre, betonte die Notwendigkeit, die Prozesse der Industrialisierung durch eine staatliche Sozialreform abzufedern und den „Wirtschaftsstil“ eines Landes zu gestalten. Schmoller prägte mit seinem Ansatz maßgeblich die Wissenschaft, aber auch die politische Praxis seiner Zeit und unterstützte die Einführung der drei ersten Säulen der Sozialversicherung – Krankenversicherung 1883, Unfallversicherung 1884 und Rentenversicherung 1889 – unter Otto von Bismarck. Wir sind uns sicher: Schmoller wäre, hätte es damals schon Markus Lanz oder Maybrit Illner gegeben, Dauergast dort gewesen.
Diese gesamtgesellschaftliche Sicht der Historischen Schule auf ökonomische Zusammenhänge spiegelt sich in der Vorstellung wider, dass die Soziale Marktwirtschaft ein „der Ausgestaltung harrender, progressiver Stilgedanke“ sei – wie es Müller-Armack formulierte.2 Ebenso stimmen beide Richtungen darin überein, dass es nicht primär die Verwirklichung wirtschaftlicher Effizienz, sondern die Ermöglichung von Gerechtigkeit ist, auf die Wissenschaft und Politik letztlich zielen sollten. Entsprechend kann die Wirtschaft nicht dem Prinzip des Laissez-faire überlassen werden, sondern es bedarf eines starken, wirkmächtigen Staates, der dem wirtschaftlichen Geschehen klare Leitplanken setzt. Freilich gibt es auch markante Unterschiede zwischen beiden Denkschulen, zum Beispiel bei Kartellfragen, aber die Kontinuitäten sind nicht zu leugnen.
Immer wieder gibt es die Diskussion, ob Deutschland mit seiner Traditionslinie von Historischer Schule und Sozialer Marktwirtschaft einen Sonderweg beschritten hat, der sich bis heute fortsetzt. Insbesondere während der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise ab 2008 wurde Stimmen laut, die die rigorose Sparpolitik und die Forderungen nach einer restriktiven Finanzpolitik des damaligen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble gerade gegenüber Griechenland auf diese Weise erklären wollten. Austerität, verstanden als Disziplin und Entbehrung, war das Modewort jener Debatten und wurde von nicht wenigen als typisch deutsche Tugend angesehen, mit der die Bundesregierung gerade in Südeuropa nicht nur Sympathiepunkte sammelte. In ihrem bis heute lesenswerten Buch Euro. Der Kampf der Wirtschaftskulturen (2016)3 machen die beiden Professoren an der Princeton University Markus Brunnermeier und Harold James gemeinsam mit dem ehemaligen Vizepräsidenten der Französischen Nationalbank Jean-Pierre Landau die unterschiedlichen Wirtschaftsphilosophien insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich als Grund dafür aus, dass die europäische Geld- und Finanzpolitik zwischen (deutscher) Prinzipientreue sowie fiskalischer Strenge und (französischem) Pragmatismus hin und her schlingere. Sicherlich nicht die einzige Erklärung für manche Verwerfungen im Euroraum seit der Einführung der gemeinsamen Währung. Aber ein wichtiger Hinweis darauf, dass wirtschaftspolitische Positionen auch mit nationalen Traditionen und historischen sowie kulturellen Entwicklungspfaden verbunden sind.
Zurück zu Müller-Armack: Er war ein begeisterter Europäer. Die Ausgestaltung der politischen und wirtschaftlichen Ordnung in Europa war in Deutschland in den 1950er Jahren umstritten. Etwas vereinfacht zusammengefasst: Bundeskanzler Konrad Adenauer sprach sich für eine Integration Westeuropas aus, die in kleinen Schritten vollzogen werden müsse. Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard forderte hingegen eine große transatlantische Freihandelszone, in der die einzelnen Staaten im Wettbewerb zueinanderstehen sollten. Müller-Armacks Ziel war die europäische Integration, für die er sich mit Leidenschaft einsetzte. So war für ihn die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), wie sie dann am 25. März 1957 durch die Römischen Verträge mit den Staaten Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande gegründet wurde, nur ein erster Schritt. Gleichwohl gestaltete er den schwierigen, aber letztlich erfolgreichen Abschluss der Verträge mit, häufig in Vertretung für Ludwig Erhard. Ab 1958 wirkte Müller-Armack als Staatssekretär für Europäische Angelegenheiten und wusste sich vielfach als konstruktiver Vermittler einzubringen. Auch aufgrund des Scheiterns der Beitrittsverhandlungen Großbritanniens zur EWG am Veto des französischen Präsidenten Charles de Gaulle trat Müller-Armack 1963 als Staatssekretär zurück.
Aussöhnung und Versöhnung war nicht nur Müller-Armacks Antrieb für die europäische Integration, sondern es war zugleich die „Grundmelodie“ in seinem Verständnis von Sozialer Marktwirtschaft. Denn: Sie ist nicht nur ein Wirtschaftsmodell, sondern ebenso ein Gesellschaftsmodell. Das erfordert in seinem Verständnis ein gesellschaftliches Miteinander, in dem sich unterschiedliche Vorstellungen mit Respekt begegnen und in dem der politische Kompromiss der Normalfall ist. Dies zu ermöglichen – auch hierin liegt ein Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft. Müller-Armack sprach in diesem Zusammenhang von „sozialer Irenik“. Abgeleitet vom griechischen Begriff eirēnē