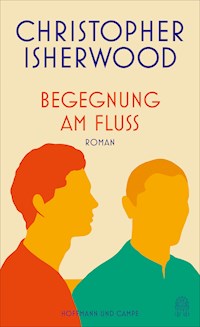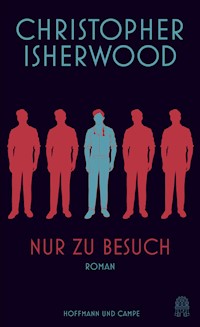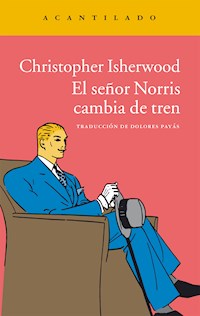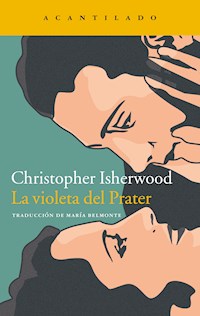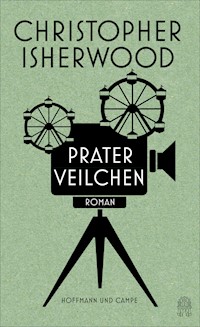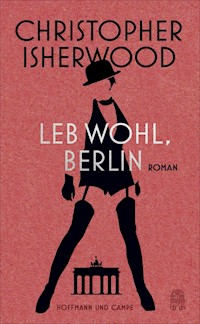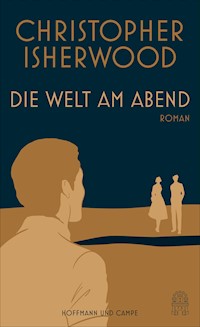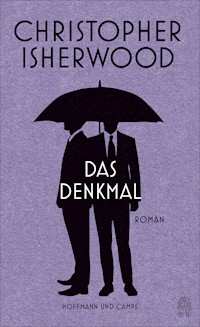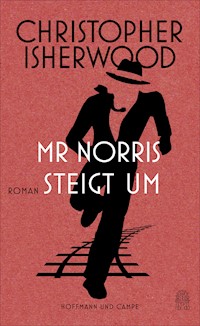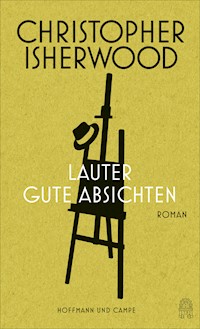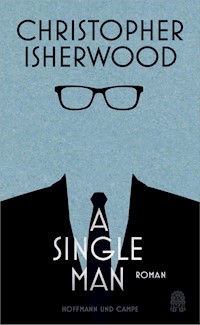
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Tag im November 1962. In einem Vorort von Los Angeles lebt George. Seit Jim, sein Freund, ums Leben gekommen ist, ist ihm "das amerikanische Utopia" die Hölle auf Erden. Mühsam schleppt er sich durch den Tag: Er gibt einen Kurs an der Uni, besucht seine beste Freundin, fährt durch die Gegend - vor allem aber seziert er in einem unaufhaltsamen Gedankenstrom seine Umwelt. Auch dieser Tag scheint vorüberzugehen wie all die anderen zuvor, bis George nachts am Strand einem Studenten begegnet... Ein zutiefst berührender Roman, der von bitterer Einsamkeit und der Furcht vor dem Anderssein erzählt, dem Scheitern zwischenmenschlicher Kommunikation und einer Gesellschaft, die vor all dem die Augen verschließt. - 2009 kongenial von Tom Ford verfilmt, mit Colin Firth und Julianne Moore.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Christopher Isherwood
A Single Man
Roman
Aus dem Englischen von Thomas Melle
Hoffmann und Campe
Für Gore Vidal
Vorwort
Einmal bin ich Christopher Isherwood begegnet. Als ich zwanzig Jahre alt und gerade nach Los Angeles gezogen war, wohnte einer meiner engsten Freunde mit David Hockney zusammen, der wiederum mit Isherwood befreundet war. Damals, um 1980 herum, verbrachte ich viel Zeit in Hockneys Haus in den Hollywood Hills, das gleich um die Ecke von meinem lag. Ich hatte meinen Freund oft angefleht, mich mit Isherwood bekanntzumachen.
Isherwood war einer der berühmtesten Schriftsteller seiner Generation, ein Renegat der zwanziger Jahre, der seine privilegierte Herkunft hinter sich gelassen hatte, um in die Berliner Halbwelt der frühen dreißiger Jahre abzutauchen und in den sechziger Jahren zu einer schwulen Ikone der Literatur und der Bürgerrechtsbewegung zu werden. Er war ein brillanter Künstler, der sein privates Glück anscheinend in einer Langzeitbeziehung mit einem Haus in Santa Monica gefunden hatte. Er repräsentierte die Möglichkeit, Kunst und Liebe zu vereinen, subversiv zu wirken und dennoch Stabilität zu erlangen.
Ein Jahr zuvor hatte ich als Neunzehnjähriger A Single Man gelesen, Isherwoods Roman aus dem Jahr 1964, in welchem er den Schmerz und die Schönheit zwischenmenschlicher Bindungen auslotet. Ich war noch nicht alt genug, um zu begreifen, wie tief Isherwoods Verständnis der menschlichen Psyche nach zwei Jahrzehnten spiritueller Praxis war. Ich glaube, dass ich mich damals vor allem in den Protagonisten George verliebt habe, einen stoischen, intellektuellen Engländer, der ein gebrochenes Herz verbergen muss.
Eines Tages fragte David Hockney meinen Freund und mich, ob wir ihn nicht auf eine Galerie-Eröffnung in West Hollywood begleiten wollten. Er erwähnte beiläufig, dass er sich dort mit »Chris und Don« treffen werde – womit er Christopher Isherwood und seinen sehr viel jüngeren Partner, den amerikanischen Maler Don Bachardy, meinte. Ich packte die Gelegenheit beim Schopfe. Ich wusste, dass Isherwood einen Schwäche für junge, attraktive Männer hatte, und war mir sicher, dass ich großen Eindruck auf ihn machen würde und wir Freunde fürs Leben sein würden. Als wir bei der Galerie ankamen, beobachtete ich Isherwood aus der Ferne. Er strahlte mit seinen siebenundsechzig Jahren eine faszinierende Energie aus – schuljungenhafte Ausgelassenheit wechselte sich mit mönchischer Besinnlichkeit ab. Ich war gelähmt vor Ehrfurcht.
Als ich ihm schließlich vorgestellt wurde, war Isherwood keineswegs angetan von mir. Ich hatte meinen Charme offensichtlich stark überschätzt. Wir schüttelten einander die Hände, ich sagte, dass ich ein großer Fan sei, und dann wandte er sich ab und begann ein Gespräch mit dem Schauspieler Vincent Price, der mit seiner Frau da war. Das Gespräch mit Don Bachardy gelang mir ein wenig besser. Ihn lernte ich Jahre später näher kennen, als ich Isherwoods Roman A Single Man fürs Kino adaptierte und inszenierte, doch Bachardy schien keinerlei Erinnerung daran zu haben, mich vorher je getroffen zu haben.
Obwohl es mir nicht gelang, Eindruck auf Isherwood zu machen, hatte sein Werk einen umso tieferen Eindruck auf mich gemacht. Nach unserer ereignislosen Begegnung wurde ich nur noch besessener von seinen Schriften und las nahezu alles, was er je geschrieben hatte, um dann meine Lieblingstexte von ihm erneut zu lesen. Ehrlich gesagt, hatte ich mich nicht nur in seinen Protagonisten George, sondern auch in Isherwood selbst verliebt. Seine Stimme, die von Erkenntnis durchdrungen schien und so deutlich in seinen Schriften widerhallt, sie spricht auch heute noch zu mir.
Als ich mit Ende vierzig erneut zu A Single Man griff, berührte es mich viel tiefer als mit neunzehn. Ich hatte eine innere Krise durchlebt und wie George die Perspektive auf die Zukunft verloren. Das Buch, in dem, wie Isherwood selbst in einem Tagebucheintrag vom 7. September 1964 bemerkte, »ich die Wahrheit gesagt habe«, und das weithin als sein Meisterwerk gilt, sprach mich zutiefst persönlich an. Ich wusste, dass dies die Geschichte war, die ich für meinen ersten Spielfilm gesucht hatte.
Und so unterhielt ich für dreieinhalb Jahre eine ungewöhnliche Beziehung mit dem Schriftsteller, dem ich vor langer Zeit ganz kurz begegnet war. Isherwood starb im Jahr 1986, aber in meinem Bewusstsein lebte er fort, als ich versuchte, das Buch A Single Man in den Film A Single Man zu übersetzen. Heimlich warb ich um Isherwoods Segen, indem ich seine Besitztümer in die Szenerie wob. Kunstwerke aus seinem und Don Bachardys Haus wurden zu Kunst an Georges Wänden. Bachardy selbst tritt in einer Szene auf und trägt dort die für Isherwood typischen scharlachroten Socken – teils als Talisman, teils als Hommage. Manchmal fragte ich mich, nachdem ich dieselbe Szene eine Woche lang auf hundert verschiedene Weisen geschnitten hatte, ob der Autor mich bei der schweißtreibenden Arbeit beobachtete. Ich weiß, dass Isherwoods Sternzeichen die Jungfrau war – genau wie meines: unsere Geburtstage liegen nur einen Tag auseinander – und er also detailbesessen war. Ich stellte mir vor, dass wenigstens mein Perfektionsstreben ihn glücklich gemacht hätte.
A Single Man rang mir erneut Bewunderung für Isherwoods Pionierarbeit und sein unorthodoxes Leben ab. Es ist sein Hunger nach Leben, nach Schreiben und nach Liebe, der seine Prosa so luzide und unverbraucht sein lässt.
Tom Ford, London 2012
A Single Man
Das Aufwachen fängt an mit bin und jetzt. Was wachgeworden ist, liegt eine Weile da, starrt hoch zur Decke und tief in sich hinein, bis es sich erkannt und daraus ich bin geschlossen hat, ich bin jetzt. Hier folgt als Nächstes, was, wenn auch auf unangenehme Weise, beruhigt; denn hier ist heute Morgen genau dort, wo es erwartet hatte, sich wiederzufinden; man nennt es auch zu Hause.
Aber jetzt ist nicht bloß jetzt. Jetzt ist auch ein grauer Mahnbescheid; ein ganzer Tag später als gestern, ein Jahr später als letztes Jahr. Jedes Jetzt ist mit seinem Datum versehen, das alle vergangenen Jetzt-Momente gegenstandslos macht, bis später oder früher, vielleicht, nein, nicht vielleicht, ganz gewiss: das Ende kommt.
Angst zwickt am Vagusnerv. Ein kränkliches Zurückschrecken vor dem, was draußen wartet, gleich da vorne.
Doch inzwischen hat der Kortex, dieser unerbittliche Vorarbeiter, seinen Platz an den zentralen Schalthebeln eingenommen und ihre Funktionen eine nach der anderen geprüft; die Beine strecken sich, das Kreuz wird gekrümmt, die Hand wird zur Faust geballt und entspannt sich wieder. Und dann erfolgt aus der internen Gegensprechanlage der erste Befehl des Tages: AUF.
Gehorsam wuchtet sich der Körper aus dem Bett – durchzuckt von Stichen in den arthritischen Daumen und im linken Knie, mit leichter Übelkeit wegen eines Krampfes im Pylorus – und schlurft nackt ins Badezimmer, wo die Blase entleert wird und das Gewicht gemessen: noch immer knapp über fünfundsiebzig Kilo, trotz all der Plackerei im Studio! Dann zum Spiegel.
Was es dort erblickt, ist weniger ein Gesicht als vielmehr der Ausdruck einer Notlage. Hier sieht man, was es sich angetan hat, hier ist der Schlamassel, in den es sich hineinmanövriert hat, in seinen achtundfünfzig Jahren; Ausdruck davon sind ein stumpfer, gequälter Blick, eine vergröberte Nase, ein Mund, der an den Winkeln zur Grimasse hinabgezogen wird, als wäre er von der Säure der eigenen Gifte zersetzt, Wangen, die von den Muskelverankerungen herabhängen, ein schlaffer Hals, der in viele verästelte Fältchen abgesackt ist. Der gequälte Blick ist der eines furchtbar erschöpften Schwimmers oder Läufers; Aufgeben kommt jedoch nicht infrage. Das Geschöpf, das wir hier beobachten, wird bis zum Umfallen weiterkämpfen. Nicht, weil es so heldenhaft wäre. Es kann sich nur keine Alternative vorstellen.
Wie es so in den Spiegel starrt und starrt, sieht es viele Gesichter in seinem Gesicht – das Kind, den Jungen, den jungen Mann, den nicht mehr ganz so jungen Mann – allesamt noch anwesend, in übereinander liegenden Schichten konserviert, wie Fossilien, und ebenso tot wie diese. Ihre Botschaft für dieses bei lebendigem Leib absterbende Geschöpf ist: Schau uns an, auch wir sind gestorben – wovor hast du eigentlich Angst?
Es antwortet ihnen: Aber das ging so langsam vor sich, so leicht. Ich habe Angst davor, gehetzt zu werden.
Es starrt und starrt. Seine Lippen öffnen sich. Nun atmet es durch den Mund. Bis der Kortex ihm ungeduldig befiehlt, sich zu waschen, zu rasieren, zu kämmen. Seine Nacktheit muss bedeckt werden. Es muss sich anziehen, denn es will ja hinaus, in die Welt der anderen Menschen; und diese anderen müssen es identifizieren können. Sein Auftreten muss annehmbar sein.
Gehorsam wäscht, rasiert, kämmt es sich, denn es kennt seine Pflichten den anderen gegenüber. Es ist sogar froh, einen Platz unter ihnen einzunehmen. Es weiß, was von ihm erwartet wird.
Es kennt seinen Namen. Es heißt George.
Sobald es angezogen ist, ist es er geworden, ist es mehr oder weniger George geworden, wenn auch nicht ganz der George, den sie wollen und wiederzuerkennen imstande sind. Die, die ihn zu dieser morgendlichen Stunde anrufen, wären wohl fassungslos, vielleicht sogar verängstigt, wenn sie mitbekämen, was für ein dreiviertelmenschliches Ding hier mit ihnen redet. Aber sie können es gar nicht merken – seine Nachahmung der Stimme ihres George ist nahezu perfekt. Selbst Charlotte fällt darauf herein. Nur zwei- oder dreimal hat sie gespürt, dass etwas nicht stimmt, und gefragt: »Geo – ist alles in Ordnung?«
Er durchquert das vordere Zimmer, das er sein Arbeitszimmer nennt, und steigt die Treppe hinab. Die Treppe geht einmal um die Ecke; sie ist schmal und steil. Man kann beide Geländer mit den Ellbogen berühren und muss den Kopf einziehen, selbst wenn man, wie George, nur einssiebzig groß ist. Es ist ein knapp bemessenes, kleines Haus. Meist fühlt er sich von der Enge geschützt; hier ist so wenig Platz, dass man sich kaum einsam fühlen kann.
Und doch –
Stellen Sie sich zwei Menschen vor, die auf diesem engen Raum Tag für Tag, Jahr für Jahr zusammenleben, am selben kleinen Herd stehen, Ellbogen an Ellbogen, und kochen, sich auf der schmalen Treppe aneinander vorbeidrängeln, sich gemeinsam vor dem kleinen Spiegel rasieren, ständig den Körper des anderen berühren, rempeln, stoßen, ungewollt oder absichtlich, lustvoll, aggressiv, ungeschickt, ungeduldig, liebevoll oder aufgebracht – stellen Sie sich vor, welche tiefen und doch unsichtbaren Spuren diese beiden überall hinterlassen müssen! Der Durchgang zur Küche ist zu schmal. Zwei Menschen in Eile, mit vollen Tellern in den Händen, können gar nicht anders, als hier ständig zusammenzustoßen. Und es ist genau hier, am Treppenabsatz, wo George fast jeden Morgen die Empfindung hat, plötzlich auf einer jäh abfallenden Klippe zu stehen – als sei sein Weg von einem Erdrutsch weggerissen worden. Hier ist es, wo er kurz innehält und es ihn aufs neue trifft, fast so, als ob es das erste Mal wäre: Jim ist tot. Ist tot.
Er steht ganz still, schweigt oder stößt höchstens ein tierisches Grunzen aus, während er auf das Abklingen der Lähmung wartet. Dann geht er in die Küche. Diese Lähmungen am Morgen sind so schmerzhaft, dass Sentimentalität nicht hilft. Sind sie vorbei, spürt er nichts als Erleichterung, wie nach dem Überwinden einer schweren Krampfattacke.
Heute schlängeln sich weit mehr Ameisen als sonst in einer Kolonne über den Boden, klettern zum Waschbecken hinauf und kommen dem Schrank bedrohlich nahe, in welchem er Marmelade und Honig aufbewahrt. Unerbittlich vernichtet er sie mit dem Pumpzerstäuber und sieht sich einen Moment selbst dabei zu – ein stures, böswilliges, altes Ding, das diesen erstaunlichen und eindrucksvollen Insekten seinen Willen aufzwingt. Leben, das Leben vernichtet, vor einem Publikum aus toten Gegenständen – Töpfen und Pfannen, Messern und Gabeln, Dosen und Flaschen –, die keine Rolle im Königreich der Evolution spielen. Und warum? Ja, warum? Wirkt hier ein kosmischer Feind, irgendein archetypischer Tyrann, der uns über seine wahre Existenz täuschen will, indem er uns auf unsere natürlichen Verbündeten hetzt, auch sie Opfer seiner Tyrannei? Selbst wenn – als George diesen Gedanken zu Ende gedacht hat, sind die Ameisen schon tot, feucht aufgewischt und den Abfluss hinuntergespült.
Er macht sich einen Teller pochierte Eier, mit Speck und Toast und Kaffee, und setzt sich zum Essen an den Küchentisch. Dabei geht ihm unablässig ein Kinderreim durch den Kopf, den ihm sein Kindermädchen in England beigebracht hat – wie lange ist das schon her:
Ein Ei auf Toast, ja bittesehr –
(Er sieht sie noch immer so klar vor sich – grauhaarig mit maushellen Augen, ihr fülliger kleiner Körper –, wie sie, noch ganz außer Atem vom Treppensteigen, das Frühstückstabletthereinträgt. Sie meckerte oft über die steile Treppe und nannte sie »das hölzerne Gebirge« – einer der magischen Ausdrücke seiner Kindheit.)
Ein Ei auf Toast, ja bittesehr –
Hast du erst eins, willst du noch mehr!
Ach, die Geborgenheit dieser Kinderzimmerwonnen, ein quälendes Trugbild! Master George, der seine Eier genießt; und das Kindermädchen, das darüber wacht und ihm mit einem Lächeln bedeutet, dass es keine Gefahr in dieser feinen, kleinen, todgeweihten Welt gibt!
Das Frühstück mit Jim war einer der Höhepunkte des Tages. Wenn sie ihren zweiten und dritten Kaffee tranken, führten sie die besten Gespräche. Sie sprachen über alles, was ihnen durch den Kopf ging – natürlich auch über den Tod, und ob es ein Leben danach gibt, und wenn ja, was überlebt. Sie diskutierten sogar die Vor- und Nachteile eines plötzlichen Todes einerseits und eines vorbereiteten Todes andererseits. Nur kann George sich beim besten Willen nicht mehr erinnern, was Jims Ansichten dazu waren. Wer nimmt solche Überlegungen schon ernst? Sie wirken so theoretisch.
Nehmen wir einmal an, die Toten könnten die Lebenden besuchen und eine Art Jim käme zurück, um nach George zu schauen. Wäre das denn befriedigend? Würde es den Aufwand lohnen? Im besten Fall wäre es der flüchtige Besuch eines Beobachters aus einem fremden Land, dem für einen Moment ein kurzer Blick aus den unendlichen Weiten seiner Freiheit gewährt wird, ein Blick aus der Ferne, wie durch Glas, auf diese einsame Figur hier, die an dem kleinen Tisch im kleinen Zimmer sitzt und so demütig wie lustlos ihre pochierten Eier isst, ein Gefangener auf Lebenszeit.
Das Wohnzimmer ist düster und niedrig, Bücherregale verstellen die ganze Wand gegenüber dem Fenster. Diese Bücher haben George nicht edler gemacht, oder besser und weiser. Aber er lauscht gern ihren Stimmen, je nach Laune der einen oder anderen. Er missbraucht sie recht unverfroren – ungeachtet der Hochachtung, die er ihnen in der Öffentlichkeit entgegenbringen muss – zum Einschlafen, um die Zeit totzuschlagen, um die Magenkrämpfe zu lindern, um seine Schwermut zu zerstreuen, um seinen Verdauungsapparat anzuregen.
Jetzt zieht er eines von ihnen heraus, und John Ruskin spricht zu ihm:
Ihr spieltet gern mit Knallbüchsen als Schulknaben, und Musketen und Armstrongs sind dasselbe, nur besseres Fabrikat: Das Ärgste daran ist aber, dass, was für euch Knaben damals Spiel gewesen ist, kein Spiel war für die Spatzen, und dass auch das Spiel, das ihr jetzt treibt, kein Spiel ist für die kleinen Vögel unter den Staaten, und was die schwarzen Adler anbetrifft, so hegt ihr eine gewisse Scheu, nach ihnen zu zielen, wenn ich nicht irre.
Unerträglich, der alte Ruskin mit seinem Backenbart, immer im Recht, überspannt und mürrisch, wie er da die Engländer rügt – heute der perfekte Gefährte für die fünf Minuten auf der Toilette. George spürt, wie mit angenehmer Dringlichkeit ein Stuhlgang herannaht, und mit dem Buch in der Hand geht er rasch die Treppe hoch.
Vom Klo aus kann er aus dem Fenster schauen. (Die draußen können wohl seinen Kopf und seine Schultern sehen, aber nicht, was er gerade macht.) Es ist ein grauer, lauwarmer Wintermorgen in Kalifornien; der Himmel hängt tief und matt im Pazifiknebel. Unten am Strand werden sich Himmel und Meer später zu einem traurigen Grau vereinen. Die Palmen stehen ungerührt, und Tau tröpfelt von den Blättern der Oleanderbüsche.
Die Straße heißt Camphor Tree Lane. Vielleicht wuchsen hier früher Kampferbäume, heute jedenfalls gibt es keine mehr. Wahrscheinlicher aber ist, dass der Name seines malerischen Klangs wegen von den ersten Aussteigern gewählt wurde, die in den frühen Zwanzigern aus dem schmuddeligen Zentrum von Los Angeles und dem spießig-protzigen Pasadena kamen, um diese Kolonie zu gründen. Sie bezeichneten ihre Bungalows und Baracken als cottages und gaben ihnen so reizende Namen wie Das Vorschifflein und Hi Nuff. Ihre Straßen nannten sie Wege, Pfade oder Schneisen, um die waldige Atmosphäre zu beschwören, die ihnen vorschwebte. Sie träumten von einem subtropischen englischen Dorf mit der Etikette eines Montmartre: ein lauschiges Plätzchen, an dem man ein wenig malen, ein wenig schreiben und jede Menge trinken konnte. Sie sahen sich als Nachhut von Individualisten, die zum letzten Gefecht gegen das zwanzigste Jahrhundert bliesen. Von morgens bis abends jubelten sie darüber, dem demoralisierenden Kommerz der Stadt entronnen zu sein. Sie waren ungehobelt und vergnügt, streitbare Bohémiens, maßlos neugierig und grenzenlos tolerant. Immerhin lösten sie ihre Konflikte mit Fäusten und Flaschen und Möbeln und nicht mit Rechtsanwälten. Die meisten von ihnen hatten Glück und starben vor der großen Wende.
Es begann in den späten Vierzigern, als die Kriegsveteranen aus dem Osten einfielen, mit ihren frisch angetrauten Ehefrauen, auf der Suche nach neuen und besseren Brutplätzen im sonnigen Süden, dem letzten Stück Heimat, das sie gesehen hatten, als sie im Krieg in den Pazifik stachen. Und konnte es einen besseren Brutplatz geben als diesen hügeligen Stadtteil, mit nur fünf Minuten Gehweg zum Strand, ohne jeden Durchgangsverkehr, der den künftigen Nachwuchs hätte dezimieren können? Und so wurden die cottages, die einst nach Badewannengin gestunken und von der Lyrik Hart Cranes vibriert hatten, eines nach dem anderen von dieser Armee colatrinkender Fernsehfanatiker in Beschlag genommen.
Die Veteranen selbst hätten sich recht gut in die Bohème-Utopie eingefügt; manch einer hätte vielleicht auch am Schreiben und Malen Gefallen gefunden. Doch ihre Frauen machten ihnen sofort und unmissverständlich klar, dass das Aufziehen von Kindern und ein Leben als Bohémien sich nicht miteinander vertrügen. Zum Kinderaufziehen braucht man einen festen Job, man braucht eine Hypothek, man braucht ein Darlehen, man braucht eine Versicherung. Und wage es ja nicht zu sterben, bevor die Zukunft der Familie gesichert ist.
Dann kam der Nachwuchs, Wurf um Wurf um Wurf. Und aus dem kleinen alten Schulhaus wurde eine Anlage mit großen lichten Gebäuden. Und der schäbige Laden am Strand wurde zu einem Supermarkt aufgeblasen. Und auf der Camphor Tree Lane wurden zwei Schilder aufgestellt. Das eine warnte davor, die Brunnenkresse zu essen, die entlang des Bachbetts wuchs, da das Wasser verschmutzt sei. (Die ehemaligen Kolonisten hatten sie jahrelang gegessen; auch George und Jim hatten sie probiert, und es hatte vorzüglich geschmeckt, und nichts war passiert.) Auf dem anderen Schild – finstere, schwarze Figuren auf gelbem Grund – stand: HIERSPIELENKINDER.
George und Jim sahen das gelbe Schild natürlich sofort, gleich beim ersten Mal, als sie auf Häusersuche hier waren. Aber sie beachteten es nicht weiter, weil sie schon in das Haus verliebt waren. Sie mochten es, weil man es nur über eine Brücke erreichen konnte, die über den Bach führte; die Bäume rundum und die steile, mit Büschen überwucherte Klippe dahinter schnitten es von der Umgebung ab, ganz wie ein Haus auf einer Waldlichtung. »Als wäre es unsere eigene Insel«, meinte George. Knöcheltief staksten sie durch das Laub der Platane (später eine chronische Plage) und waren nun fest entschlossen, alles hier zu mögen. Beim Blick in das niedrige, klamme, dunkle Wohnzimmer waren sie sich einig, dass es abends vor dem Kamin sehr gemütlich sein würde. Die Garage hatte einen gewaltigen Buckel aus teils frischem, teils verdorrtem Efeu, der sie doppelt so groß erscheinen ließ, als sie in Wirklichkeit war; innen war die Garage winzig, stammte sie doch aus der Zeit des Ford Modells T. Jim wollte die Tiere dort unterbringen. Ihre beiden Autos waren jedenfalls zu groß für die Garage, aber die könnte man ja auf der Brücke abstellen. Allerdings hing die schon ziemlich durch. »Na ja, sie wird schon halten, solange wir hier sind«, sagte Jim.
Zweifellos sehen die Nachbarskinder das Haus genau so, wie George und Jim es an diesem ersten Nachmittag gesehen haben. Zottelig vor lauter Efeu, düster und geheimnisvoll, gäbe es die perfekte Höhle für ein gemeines Monster aus einem Märchenbuch ab. Und eben diese Rolle, das weiß George, spielt er, seit er alleine lebt, und das von Tag zu Tag mit größerer Vehemenz. Dabei zeigt sich eine Seite seines Wesens, die er ängstlich vor Jim verborgen hat. Was würde Jim wohl sagen, wenn er sehen könnte, wie George wild herumfuchtelnd aus dem Fenster brüllt, weil Mrs. Strunks Benny und Mrs. Garfeins Joe aus reinem Übermut auf der Brücke toben? (Jim kam immer gut mit ihnen aus. Er ließ sie die Stinktiere und den Waschbären streicheln und mit dem Beo reden, und trotzdem hätten sie nie ohne seine Erlaubnis die Brücke betreten.)
Mrs. Strunk, die gegenüber wohnt, ist so pflichtbewusst, ihre Kinder von Zeit zu Zeit zurechtzuweisen, dass sie George in Ruhe lassen sollen, als Professor müsse er sehr hart arbeiten. Aber so liebenswürdig Mrs. Strunk auch ist – milder geworden und müde durch die Schufterei im Haus, wehmütig ihrer Tätigkeit als Sängerin beim Radio hinterhertrauernd, die sie aufgegeben hat, um Mr. Strunk fünf Jungen und zwei Mädchen zu gebären –, kann sie doch nicht anders, als George mit einem Lächeln, in dem sich Nachsicht und Solidarität paaren, mitzuteilen, dass Benny (ihr Jüngster) ihn nur noch »den Mann da« nennt, seit George ihn aus dem Garten, über die Brücke und weiter die Straße hinunter gejagt hat. Benny hatte mit einem Hammer auf die Haustür eingeschlagen.
George schämt sich für seine Ausbrüche, denn sie sind nicht gespielt. Er verliert tatsächlich die Fassung, und danach wird ihm ganz schlecht vor Scham. Er weiß jedoch, dass die Kinder genau dieses Verhalten von ihm erwarten. Sie ermuntern ihn sogar dazu. Falls er sich plötzlich weigern sollte, das Monster zu spielen, und sie ihn nicht mehr provozieren könnten, müssten sie sich nach einem Ersatz umsehen. Die Frage aber – tut er bloß so, oder hasst er uns wirklich? – stellt sich ihnen nicht. Sie stehen ihm völlig gleichgültig gegenüber und brauchen ihn lediglich als Figur für ihre Mythen. Einzig George macht sich darüber Gedanken. Umso mehr beschämt ihn jener Moment der Schwäche vor etwa einem Monat, als er Süßigkeiten gekauft hatte, um sie ihnen zu schenken. Sie nahmen sie, ohne zu danken, und musterten ihn neugierig und irritiert. Wer weiß, vielleicht haben sie in diesem Augenblick zum ersten Mal erfahren, was Verachtung bedeutet.
Inzwischen hat es Ruskin die Perücke komplett vom Kopf gefegt. »Geschmack ist die EINZIGE Sittlichkeit!«, brüllt er mit erhobenem Zeigefinger in Georges Richtung. Dem reicht es, also würgt er Ruskin mitten im Satz ab und klappt das Buch zu. Immer noch auf dem Klo sitzend, schaut George zum Fenster hinaus.
Ein ruhiger Morgen. Die meisten Kinder sind in der Schule; die Weihnachtsferien beginnen erst in ein paar Wochen. (Beim Gedanken an Weihnachten schaudert es ihn. Vielleicht wird er etwas Drastisches tun, ein Flugzeug nach Mexiko-Stadt nehmen und eine Woche lang von einer Bar zur nächsten ziehen und sich hemmungslos betrinken. Das machst du ja eh nicht, niemals, sagt eine Stimme, ungerührt und gelangweilt.)
Aha, da ist er ja, Benny, mit dem Hammer in der Hand. Er wühlt in den Mülltonnen herum, die auf dem Bürgersteig zur Leerung bereitstehen, und zieht eine kaputte Waage hervor. Während George ihn beobachtet, fängt Benny an, mit dem Hammer auf die Waage einzuschlagen und dabei kleine Schreie auszustoßen; er tut so, als sei es die Maschine, die vor Schmerzen aufschreit. Kaum zu glauben, dass Mrs. Strunk, die stolze Mutter dieser Kreatur, immer wieder angewidert fragte, wie Jim die kleinen, völlig harmlosen Königsnattern bloß anfassen könne!
Und da betritt Mrs. Strunk auch schon die Veranda, gerade als Benny seinen Mord an der Waage vollendet hat, und sieht die verstreuten Einzelteile. »Tu sie zurück!«, sagt sie ihm. »Zurück in die Tonne! Tu sie zurück, jetzt! Zurück! Tu sie zurück! Zurück in die Tonne!« Ihre Stimme hebt und senkt sich, in einem betont lieblichen Singsang. Sie schreit ihre Kinder nie an, dazu hat sie zu viele Psychologiebücher gelesen. Benny ist gerade in seiner aggressiven Phase, ganz nach Plan, also alles in bester Ordnung. Natürlich weiß sie, dass man sie bis auf die Straße hört. Es ist ihr gutes Recht, gehört zu werden, denn dies ist die Stunde der Mütter. Als Benny schließlich ein paar kaputte Teile zurück in die Mülltonne wirft, trällert sie »Braver Junge!« und geht lächelnd ins Haus zurück.
Also macht sich Benny davon, um bei den anderen, viel kleineren Kindern mitzumischen, zwei Jungen und einem Mädchen, die auf dem unbebauten Grundstück zwischen den Strunks und den Garfeins ein Loch zu graben versuchen. (Ihre Häuser öffnen sich frontal zur Straße, ganz im Gegensatz zu Georges beschaulich abseitiger Höhle.)
Auf dem unbebauten Grundstück unter dem riesigen alten Eukalyptusbaum hat Benny jetzt das Graben übernommen. Er zieht seinen Anorak aus und wirft ihn dem kleinen Mädchen in die Arme; dann spuckt er in die Hände und nimmt sich den Spaten. Er macht irgendjemanden aus dem Fernsehen nach, der einen Schatz bergen muss. Das Leben dieser Kinder heute ist nichts als ein Wust von Imitationen. Kaum können sie sprechen, singen sie schon Werbejingles.
Aber nun setzt sich einer der Jungs ab – vielleicht, weil er von Bennys Ausgrabungen genauso gelangweilt ist wie der von den Pfadfinderplänen seiner Mutter – und feuert mit einer Karbidkanone in die Luft. George war schon ein paar Mal drüben bei Mrs. Strunk, um über diese Kanone zu reden, er hat sie angefleht, der Mutter des Jungen auszurichten, dass ihn die Kanone langsam in den Wahnsinn treibe. Doch Mrs. Strunk hat nicht die Absicht, das anarchische Treiben der Natur zu stören. Ausweichend lächelnd erklärte sie George: »Ich höre den Lärm von Kindern nicht – solange es fröhlicher Lärm ist.«