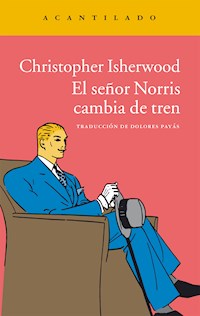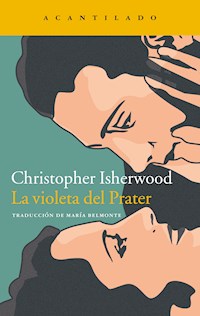22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Isherwoods letztes und persönlichstes Buch: Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs reist der überzeugte Pazifist Isherwood nach Kalifornien, um die überkommenen linksintellektuellen Überzeugungen, die die Welt an den Rand des Abgrunds geführt haben, hinter sich zu lassen und ein neues Mindset zu finden. Er trifft auf Swami Prabhavananda, einen hinduistischen Mönch, der von nun an sein spiritueller Begleiter sein wird. Es folgt ein Leben zwischen den Extremen: Nächtliche Trinkgelage, freie Liebe und Hollywoods Glamour-Welt wechseln sich ab mit Meditation und Abstinenz – ein beständiges Ringen von Weltlichkeit und Religiosität, von dem Mein Guru und sein Schüler virtuos erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Christopher Isherwood
Mein Guru und sein Schüler
Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser
Hoffmann und Campe
Für Don Bachardy
Dies ist weder eine vollständige Biographie Swami Prabhavanandas noch ein vollständiger Bericht über mein eigenes Leben zwischen 1939 und 1976. Es ist die einseitige, höchst subjektive Geschichte unserer Guru-Schüler-Beziehung. Viele Menschen, die in dieser Zeit eng mit Prabhavananda oder mit mir verbunden waren, haben an dieser speziellen Geschichte wenig oder gar keinen Anteil und tauchen daher nur kurz oder überhaupt nicht darin auf.
C. I., Juni 1979
1
Gegen Ende Januar 1939 kamen Wystan Auden und ich mit dem Schiff aus England in New York an. Die Ereignisse und Entscheidungen, die zu dieser Reise führten, habe ich in meinem Buch Christopher und die Seinen beschrieben. Es war unser zweiter Besuch in New York. Bereits im Sommer 1938 hatten wir, als wir aus China nach England zurückkehrten, einige Tage dort verbracht. Jetzt schien es so, als würden wir für längere Zeit, vielleicht sogar für immer bleiben, auch wenn unsere Pläne noch nicht endgültig feststanden.
Unser erster Besuch war touristischer Natur gewesen und hatte einen einzigartigen Zauber ausgeübt. Was mich betraf, so würde sich dieser nicht wiederholen lassen. Dank der zeitlichen Begrenzung war das Leben in New York von prickelnder Spannung gewesen. Jetzt begann es mich zu demoralisieren. Weniger als zwei Monate nach unserer Ankunft schrieb ich in mein Tagebuch:
Für mich eine schlimme, unfruchtbare Zeit. Ich habe praktisch nichts getan. Jeden Tag denke ich: Ich brauche Beschäftigung, ich muss anfangen zu arbeiten. Aber woran? Mein Geld geht zur Neige. Wystan hat die Aussicht auf einen Lehrauftrag, später. Mein ganzer Instinkt wehrt sich dagegen, Vorlesungen zu halten oder mir auf irgendeine Weise mein Ansehen zunutze zu machen. Ich hätte gern eine regelmäßige bescheidene Anstellung. Berlin habe ich kennengelernt, weil ich dort eine Arbeit verrichtete, die mich auf anonyme, unprätentiöse Weise mit meinem sozialen Umfeld in Verbindung brachte: als Ausländer, der seine Muttersprache unterrichtet. Ich muss anonym bleiben, bis ich hier ein neues Ich entdecke, ein amerikanisches Ich. Wystan ist so energiegeladen, wie ich träge bin. Er schreibt viel, nach seiner besten Art – Gedichte, Artikel und Rezensionen –, er hält Reden, geht auf Partys und zu Gesellschaften, ist unglaublich gesprächig. Es ist, als hätten er und ich die Rollen vertauscht. Jetzt ist er der Selbstbewusste. Er fühlt sich bereits heimisch.
So verzweifelte ich und tat nichts. Für meine Nervosität machte ich New York verantwortlich. Heute begreife ich, dass sie weder von New York noch von meinen Geldsorgen, ja nicht einmal von der Wahrscheinlichkeit eines Krieges in Europa ausgelöst wurde, sondern von einer inneren Leere, die mir damals noch nicht ganz bewusst war.
Ich war innerlich leer, weil ich meinen politischen Glauben verloren hatte – die linken Parolen, die ich in den letzten Jahren von mir gegeben hatte, konnte ich nicht mehr hören. Es war nicht so, dass ich nicht mehr an das glaubte, wofür sie standen, aber ich war nicht mehr mit dem Herzen dabei. Mein Selbstverständnis als Linker war ins Wanken geraten durch das zunehmend aggressive Bewusstsein meiner Homosexualität und die kürzlich gemachte Entdeckung, dass ich Pazifist war – damit gehörte ich gleich zwei Minderheiten an, was mich immer wieder in Konflikt mit der linken Mehrheitsideologie brachte.
Ich nannte mich Pazifist, weil Heinz, der junge Deutsche, mit dem ich in den dreißiger Jahren fünf Jahre lang zusammengelebt hatte, kurz vor der Einberufung in die Nazi-Wehrmacht stand und mir der Gedanke unerträglich war, jemals etwas zu seinem Tod beitragen zu sollen, und sei es noch so indirekt. Daher hatte ich beschlossen, sollte es zum Krieg kommen, jede Beteiligung an den Kriegsanstrengungen zu verweigern. Dies war jedoch nur eine negative Entscheidung. Was ich nunmehr lernen musste, waren positive pazifistische Werte, eine pazifistische Lebensweise, ein Ja, um mein Nein zu bekräftigen. Es war der Mangel an Werten, der dazu geführt hatte, dass ich mich so unsicher fühlte. Die Stärke, die Wystan im Gegensatz zu meiner Schwäche zeigte, beruhte auf den christlichen Werten, die er als Kind von seiner Mutter empfangen und nie ganz aufgegeben hatte. Damals sprach er mit mir nicht darüber, denn er wusste, welch heftige Vorurteile ich gegen die bloße Idee von Religion hegte, so wie ich sie damals verstand.
Der Pazifismus war die Grundlage einer Freundschaft, die ich mit John van Druten schloss. John war locker, witzig und charmant, durch und durch ein Mann des Theaters, aber er war auch Moralist, darauf bedacht, seinem Leben und seinen Stücken ethische Normen aufzuerlegen, selbst wenn es sich um die leichtesten Komödien handelte. Nach eingehender Diskussion erstellten wir eine Liste von Fragen zur Rolle des Pazifisten in Kriegszeiten und schickten sie an drei prominente Pazifisten: George Lansbury, Rudolph Messel und Runham Brown. Sie alle machten sich die Mühe, uns zu antworten.
Messel war der Radikalste der drei. Er wollte, dass die Pazifisten die Kriegsmaschinerie sabotierten, und forderte vollständige, notfalls auch einseitige Abrüstung. Er hoffte, der Krieg werde in eine Revolution umschlagen. Der Nazi-Aggressor müsse in ein Land einmarschieren können, ohne dass Widerstand geleistet werde. Ein unblutiger Sieg, fügte Messel hinzu, wäre ohnehin keine Werbung für den Nazismus.
Brown schrieb, ein Pazifist solle stets versuchen, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu sein. In Kriegszeiten solle er härter denn je an einer Art sozialem Hilfsprogramm arbeiten, unabhängig von staatlicher Kontrolle und ohne jede Verbindung mit den Kriegsanstrengungen. Ohne Rücksicht auf die Folgen solle er gegenüber dem Aggressor zivilen Ungehorsam üben.
Lansburys Brief stimmte im Wesentlichen mit Browns Auffassung überein. Sein Tonfall berührte John und mich zutiefst. Man konnte fast die Stimme dieses sanften, furchtlos aufrichtigen achtzigjährigen Kriegers für den Frieden hören: »Wie viele andere finden Sie es äußerst schwierig, Ihren Idealismus inmitten der Welt, in der wir leben, zu verwirklichen. Dennoch, Genosse: Die Wahrheit von gestern ist auch die Wahrheit von heute. Wenn Sie und Millionen anderer junger Männer aller Nationalitäten ein weiteres Mal in die Hölle des Krieges gestürzt werden, wird nichts anderes dabei herauskommen als mehr und mehr Unordnung. Unsere Methode des passiven Widerstands ist noch nie erprobt worden, Krieg dagegen ist durch alle Jahrhunderte hindurch erprobt worden und hat völlig versagt.«
Das Engagement und der Mut dieser drei Männer waren inspirierend, doch in meiner jetzigen Lage waren sie nicht sonderlich hilfreich. Sie lebten in England und bereiteten sich darauf vor, ihre Rolle in der bevorstehenden Kriegskrise zu spielen. Selbst wenn ich zurückkehrte, würde ich mit ihnen nicht meine persönlichen Probleme besprechen können. Sie wären viel zu beschäftigt. Vielleicht würden sie mir Aufgaben zuweisen, aber ich war mir meiner selbst noch nicht sicher genug, um ihr Gefolgsmann zu werden. Ich brauchte mehr Zeit zum Nachdenken und jemanden, der mir dabei half, meine Gedanken zu sortieren.
So kam mir immer mehr Gerald Heard in den Sinn. Er und sein Freund Chris Wood waren 1937 nach Los Angeles ausgewandert, zusammen mit Aldous Huxley und seiner Frau Maria. Als sie noch in London lebten, hatte ich mich mit Gerald und Chris oft getroffen, und Gerald kannte ich gut genug, um auf sein Verständnis hoffen zu können. Aldous und Maria Huxley war ich noch nie begegnet, und ich brannte darauf, mit Aldous zu diskutieren, dessen zwei Jahre zuvor veröffentlichtes Buch Ziele und Wege als ein pazifistisches Grundlagenwerk galt.
Gerüchteweise wusste ich, dass Heard und Huxley sich mit dem Kult des Yoga, mit Hinduismus oder dem Vedanta beschäftigt hatten – noch ließ ich mich nicht dazu herab, genauer herausfinden zu wollen, was diese Begriffe bedeuteten. Mir war dieses ganze asiatische Zeugs in höchstem Maße zuwider. Allerdings war mein Widerwille ein anderer als der, den ich gegenüber Christen empfand. Christen sah ich als griesgrämige Lebensverächter und Sexhasser, die heuchlerisch ihre im Verborgenen lauernden Gelüste leugneten. Hindus sah ich als gefühlige Geheimniskrämer, deren Hokuspokus eher lächerlich als bedrohlich war. Dass Heard und Huxley sich von derlei Unfug beeindruckt zeigten, war bedauerlich. Ihren Fehltritt erklärte ich mir damit, dass es für Schwerintellektuelle typisch war, sich von Zeit zu Zeit von ihren Gefühlen überrumpeln und in die Irre führen lassen. Aber ein solcher Fehltritt konnte doch bestimmt nur vorübergehend sein? Ich nahm mir vor, jede Erörterung des Themas mit ihnen so taktvoll wie möglich zu vermeiden. Schließlich war es ihr Intellekt, den ich zu Rate ziehen wollte.
So begann ich denn, mit Gerald zu korrespondieren. Zu meiner Überraschung und Erleichterung erwähnte er nichts von Yoga. Was er schrieb, war im Gegenteil beruhigend pragmatisch. Sein Gedanken galten vor allem der Bildung von Gruppen. Pazifisten müssten sich in Gruppen organisieren, die klein genug seien, um Zusammenhalt zu gewährleisten, wobei jedes Mitglied die volle Verantwortung für jedes andere übernähme. Der Unordnung und der Zerstörung müssten Ordnung und schöpferische Akkuratesse entgegengesetzt werden. Wir müssten ein Doktorat psychisch gesunder, gut gerüsteter Heiler schaffen … Geralds Ausdrucksweise erschloss sich mir nicht immer, aber sie hatte etwas Autoritatives. Er schien zu wissen, was er wollte. Die Vorstellung, einer Gruppe Gleichgesinnter zuzugehören, reizte mich sehr. Seit meiner Entscheidung, Pazifist zu werden, hatte ich mich isoliert gefühlt, da ich befürchtete, viele meiner Freunde würden sie nicht gutheißen.
Als ich Gerald das erste Mal schrieb, war nicht ich es, der vorschlug, nach Kalifornien zu reisen, vielmehr drängte er mich in seinem Antwortbrief dazu. Von da an hielt ich es für selbstverständlich, dass ich ihn früher oder später aufsuchen würde. Abgesehen von dem Wunsch, mit Gerald und Huxley zu reden und von New York wegzukommen, hatte ich schon immer eine romantische Sehnsucht nach dem »fernen Westen« gehabt. Nun, da die Reise tatsächlich in Aussicht stand, wurde mir klar, dass ich sie mit einem Amerikaner teilen musste, um das Land nicht nur mit meinen ausländischen Augen, sondern auch mit seinen einheimischen wahrzunehmen. Zu meinem Glück gab es einen jungen Amerikaner, der bereit war, mich zu begleiten. Ich werde ihn Vernon nennen.
Vernon und ich hatten uns während meines ersten Aufenthalts in New York kennengelernt und eine Affäre begonnen. Als ich nach England heimfuhr, schrieben wir einander, und als ich im Januar zurückkehrte, wartete er am Kai, um mich abzuholen. Für den Anfang hatten wir uns ein Zimmer im selben Hotel wie Wystan genommen. Später, als Wystan und ich eine Wohnung gemietet hatten, zog Vernon bei uns ein.
Er und ich verließen New York am 6. Mai mit dem Bus. Busreisen waren damals billig, und so konnten wir es uns leisten, einen großen Abstecher in den Süden zu machen, über Memphis, New Orleans, Houston und El Paso. Außerdem legten wir einen Zwischenstopp ein, um den Grand Canyon zu besichtigen. Es dauerte fast zwei Wochen, bis wir in Los Angeles ankamen.
Ich war traurig, Wystan zurückzulassen, doch nichts hätte ihn dazu bewogen, mitzukommen. In New York war er beschäftigt und glücklich. Natürlich versicherten wir uns gegenseitig, unsere Trennung werde nur vorübergehend sein, und tatsächlich kam Wystan noch im selben Jahr für kurze Zeit nach Kalifornien – und hasste es. In den verbleibenden rund dreißig Jahren seines Lebens waren wir noch oft zusammen. Doch unsere Beziehung hatte sich verändert, nicht weil unsere Liebe geringer geworden wäre, sondern weil wir nicht länger aufeinander angewiesen waren. Als wir in jenem Januar von England aus in See gestochen waren und fast alle, die wir kannten, zurückgelassen hatten, schienen seine und meine Zukunft auf Gedeih und Verderb miteinander verflochten. Wir waren ein zueinanderpassendes isoliertes Paar. Amerika sollte unser gemeinsames Abenteuer werden. Doch es war Amerika, das sich, buchstäblich, zwischen uns drängte.
Als ich Chris Wood in Los Angeles wiedertraf, schien er sich nicht von dem Londoner Chris zu unterscheiden, den ich gekannt hatte, außer dass er von der Sonne gebräunt war. Gerald hingegen hatte sich ganz gewiss verändert. Der Londoner Gerald war glattrasiert gewesen, der kalifornische Gerald trug einen Bart. Es gab einen Grund für diesen Bart: Gerald hatte ihn wachsen lassen, weil er sich nicht rasieren konnte, solange er mit einem gebrochenen Arm das Bett hütete – Folge eines Sturzes im Schnee in Iowa während einer Vortragsreise mit Huxley. Doch das war Ende 1937 gewesen, und der Bart war immer noch da. Er zeigte sogar Anzeichen sorgfältiger Pflege und war gleichmäßig getrimmt. Er verlieh seinem Gesicht einen nach oben gerichteten, himmelsuchenden Ausdruck, der etwas beunruhigend Jesusmäßiges hatte. Und während der Londoner Gerald ordentlich, ja elegant gekleidet gewesen war, trug der kalifornische Gerald Jacketts mit zerschlissenen Säumen und Jeans mit Löchern oder Flicken auf den Knien. Der Londoner Gerald hatte den Eindruck eines Agnostikers aus Veranlagung auf mich gemacht, mit trockenem Witz und einem gekünstelt skeptischen Lächeln. Der kalifornische Gerald war zwar ebenfalls witzig, hatte jedoch die schnelle, eifrige Rede und die entschlossenen Gesten des Gläubigen.
Der woran glaubte? Das musste ich noch herausfinden – ein schrittweiser Prozess. Gerald war ein Meister im Ausweichen. Stellte ich ihm eine direkte Frage, bekam ich eine Antwort, die wie ein Fluss ein riesiges Wissensgebiet durchmaß und mich an den Ufern der Vorgeschichte, der Anthropologie, der Astronomie, der Physik, der Parapsychologie, der Mythologie und vielem anderen mehr entlangführte. Die Einblicke, die er mir in diese Gebiete gewährte, waren betörend, und immer wieder bat ich ihn, bei diesem oder jenem Aspekt zu verweilen, wobei ich vergaß oder mir nichts daraus machte, was meine ursprüngliche Frage gewesen war.
Gerald war einfach nicht die Art von Person, zu der man sagte: »Bitte fassen Sie kurz Ihre Ansichten zusammen, damit ich entscheiden kann, ob ich ihnen zustimme.« Auch konnte ich nicht einfach seinen Pazifismus übernehmen, während ich seine religiösen Überzeugungen ablehnte. Allmählich hatte ich begriffen, dass beides innig miteinander verknüpft war.
Abgesehen davon verwahrte sich Gerald ebenso subtil wie entschieden gegen Widerspruch. War ich mit einer seiner Äußerungen – oder mit seiner Verwendung bestimmter Wörter – nicht einverstanden, wies er mein Nichteinverständnis zurück, indem er durchblicken ließ, es sei alles nur eine Frage der Semantik. Er war sich seiner selbst so gewiss, dass er es sich leisten konnte, sich bei mir zu entschuldigen. Es tue ihm leid, sagte er. Er habe sich ungeschickt ausgedrückt. Er hätte seine Auffassung mit angemesseneren Begriffen darlegen sollen – zumal mir gegenüber, der ich so viel besser mit Worten umgehen könne als er. Wie man jemandem schmeichelt, hatte er nicht vergessen.
Trotz seiner großen Gelehrsamkeit behandelte er mich wie einen Ebenbürtigen. Sein Gestus war, sich mit mir zu beraten, nie, mich zu belehren. »Du erinnerst dich doch noch an das sonderbare Buch von Smith über die Sitten der Mikronesier«, so begann er für gewöhnlich eine seiner Ausführungen. Während unserer ersten gemeinsamen Wochen betonte ich ein ums andere Mal, nein, ich hätte Smith, Jones, Robinson beziehungsweise Brown nie gelesen. Später ließ ich derlei Wendungen unkommentiert. Sie waren rein rhetorisch, denn Gerald teile einem ohnehin sofort mit, was Smith zu besagtem Thema geäußert habe. Auf die nämliche Weise erklärte er: »Ich würde gern deine Meinung zu Smiths Theorie hören«, nur um mir übergangslos seine Meinung zu erläutern, und folglich meine – denn Meinungsverschiedenheiten waren für ihn zwischen gesitteten Menschen schlicht nicht möglich.
Ich wollte unbedingt mehr über die pazifistischen Gruppen erfahren, von denen er in seinen Briefen geschrieben hatte. Wie müssten sich die Mitglieder seiner Ansicht nach vorbereiten? Sei eine paramedizinische Ausbildung notwendig? Ein Studium von Gandhis Taktik der Gewaltlosigkeit? Nein, Gerald zeigte keinerlei Interesse, als ich diese Punkte erwähnte. Er sprach nur von einer Form der Selbstvorbereitung auf »Tiefenebene«, wie er es nannte. Um ein echter Pazifist zu werden, müsse man Frieden in sich selbst finden. Erst dann könne man pazifistisch in der Welt dort draußen handeln.
Gerald hatte bereits mit seinem eigenen drastischen Programm der Selbstvorbereitung begonnen. Jeden Tag saß er dreimal zwei Stunden lang da und meditierte – am frühen Morgen, gegen Mittag und am frühen Abend. Während dieser sechs Stunden war er, soweit ich es beurteilen konnte, damit beschäftigt, seine Gedanken auf etwas zu konzentrieren, das er das »Etwas« nannte. Dieses »Etwas« war jene Quelle inneren Friedens, mit der er in Kontakt zu treten suchte. Ich denke, es war Geralds angeborene Akribie, die ihn davon abhielt, sie »Gott« zu nennen – zu sagen, er suche Gott, hätte anmaßend und unhöflich geklungen. Vielleicht vermutete er auch, dass ich eine Abneigung gegen das Wort hatte. Falls dem so war, hatte er recht. Ich verabscheute es.
Meine Interpretation des Gottesbegriffs hatte ich ganz naiv von linken antireligiösen Propagandisten übernommen. Gott existierte nicht, sondern war nur ein Symbol für den kapitalistischen Superboss. Von den Kapitalisten wurde er zum Gott erhoben, damit er hoch oben im Himmel über die Massen der Arbeiterklasse herrschen und sie mit dem Opium des Volkes, also der Religion, betäuben konnte, um so dafür zu sorgen, dass sie sich mit langen Arbeitszeiten und Hungerlöhnen zufriedengaben.
Ich musste mir jedoch bald eingestehen, dass Geralds »Etwas« – von der Frage seiner Existenz oder Nichtexistenz einmal abgesehen – das genaue Gegenteil meines »Gottes« war. Zwar war es per Definition überall, also auch im Himmel, aber zuallererst musste man es in sich selbst suchen. Man durfte es sich nicht als einen Boss vorstellen, dem man zu gehorchen, sondern als eine Natur, die man zu erkennen hatte – eine Erweiterung der eigenen Natur, mit der man sich bewusst vereinigen konnte. Das Sanskrit-Wort yoga, Vorläufer des Wortes »Joch«, bedeutet »Vereinigung« und somit den Prozess der Vereinigung mit dieser ewigen, allgegenwärtigen Natur, von der jeder, jede und jedes ein Teil ist.
In den zurückliegenden Jahren hatte ich immer wieder erklärt, ich wisse, dass Religion eine Lüge sei, da ich wisse, dass ich keine ewige Seele habe. Nun, nach den Gesprächen mit Gerald, wurde mir klar, dass ich das Wort »Seele« im Sinne meiner Ego-Persönlichkeit missbraucht hatte. Ich hatte lediglich (und sehr richtig) gesagt, dass meine Ego-Persönlichkeit, Christopher, wie mein Körper einer Veränderung unterworfen sei und daher nicht ewig fortbestehen könne. Wenn ich eine Seele hätte, könnte sie nur dieses »Etwas« sein, in Bezug auf Christopher gesehen. Der Einfachheit halber konnte ich sie, wenn ich über sie nachdachte, »meine« Seele nennen, aber ich musste mir in Erinnerung rufen, dass Christopher sie niemals besitzen konnte. Falls sich die beiden jemals vereinigen sollten, würde Christopher aufhören, als Individuum zu existieren. Er würde in dem »Etwas« aufgehen, nicht umgekehrt.
Doch die Frage blieb: Warum sollte ich an dieses »Etwas« glauben?
Zu den verschiedenen Wissensgebieten, die Gerald mir eröffnete, gehörte die Geschichte der Mystik. Zum ersten Mal erfuhr ich, dass es im Laufe der Geschichte Tausende Männer und Frauen in vielen verschiedenen Ländern und Kulturen gegeben hatte, die behaupteten, eine Vereinigung mit dem Ewigen in sich selbst erfahren zu haben. Dass ihre Berichte über diese Erfahrung einander im Wesentlichen glichen, war gewiss beeindruckend, bewies aber meiner Ansicht nach gar nichts. Selbst wenn diese Menschen der modernen Welt angehörten, schienen sie mir völlig entrückt. Vielleicht hatten sie sich alle nur etwas vorgemacht, wie aufrichtig auch immer?
Gerald konterte meine Einwände mit einem Kompliment. Meine Haltung zeige, sagte er, dass ich das Problem im rechten Geist angehe. Leichtgläubigkeit sei das größte Hindernis für spirituellen Fortschritt, blinder Glaube in der Tat nichts als Blindheit. Er zitierte Tennysons Vers über den »ehrlichen Zweifel« und erzählte mir, Ramakrishna (wer immer das war) habe seine Schüler aufgefordert, ihn wieder und wieder zu prüfen, so wie ein Geldwechsler Münzen klingeln lässt, um zu hören, ob sie echt sind. Es habe keinen Sinn, die Dogmen der Kirche oder die Worte der Heiligen Schrift einfach nur passiv zu akzeptieren. Ich wisse doch wohl, was Vivekananda (wer immer das war) gesagt habe: »In den christlichen Ländern hat jeder Mensch eine große Kathedrale auf dem Kopf und darauf noch ein Buch.« Nein – die einzige Möglichkeit, mit der Suche nach dem »Etwas« zu beginnen, bestehe darin, sich zu sagen: »Ich werde unvoreingenommen sein und versuchen, den Meditationsanweisungen zu folgen, die mein Lehrer mir gibt. Wenn ich nach sechs Monaten ehrlichen Bemühens keinerlei Ergebnisse erzielt habe, dann lasse ich es sein und sage allen, dass es die reinste Augenwischerei ist.«
Das hörte sich fair an. Und ich war beeindruckt von Geralds Zurückhaltung. Er drängte mich nicht dazu, sofort mit der Meditation zu beginnen. Er lockte mich nicht mit verführerischen Schilderungen seiner eigenen Meditationserfahrungen. Ganz im Gegenteil, er sprach darüber in demselben Ton, den ich angeschlagen hätte, wenn ich mich über meine Schwierigkeiten, ein Buch zu schreiben, beklagen wollte: Es war eine Menge harter Arbeit und die meiste Zeit frustrierend. »Wenn man erst so spät im Leben dazu findet, ist der Verstand schon ziemlich hinüber.«
Ja, ich war wirklich beeindruckt. Immerhin akzeptierte ich bereits, dass zumindest Gerald glaubte, bei der Kontaktaufnahme mit dem »Etwas« in sich selbst Fortschritte zu machen. Er belog mich nicht. Dazu hatte er keinen Grund. Er schloss sich nicht sechs Stunden am Tag in seinem Zimmer ein und tat, als würde er meditieren, nur um Chris Wood zu beeindrucken. Gleichzeitig war nicht zu leugnen, dass Gerald ein Schauspieler war, mit einem irischen Vergnügen an Melodramatik und markanten Sprüchen. Ja, ich glaubte an ihn, gerade weil er so theatralisch war, weil er sich als zerlumpter Landstreicher verkleidete, weil sein Bart jesusmäßig, aber getrimmt war, weil seine Klagen über das menschliche Los immer auch einen Anflug von Fröhlichkeit hatten und seine wissenschaftlichen Analogien einen Hauch von Poesie. Ich wäre ihm gegenüber sehr viel misstrauischer gewesen, hätte er sich als ernstes, unfehlbares Orakel geriert. Meine eigene Veranlagung sprach auf seine Theatralik an und empfand sie als beruhigend, denn auch ich war ein Schauspieler.
Was seine Gesellschaft so anregend machte, war, dass er so ungeheuer bewusst zu sein schien. Bewusstheit war seine Losung. Seiner Meinung nach musste man sich der wirklichen Situation ständig bewusst sein, nämlich dass es das »Etwas« gibt und folglich wir alle wesensmäßig vereint sind. Wann immer unsere Bewusstheit nachlässt, fallen wir zurück in die Akzeptanz der unwirklichen Situation, die als Raumzeit erlebt wird und den Unglauben an das »Etwas« und den Glauben an individuelle Gesondertheit erzwingt. Gerald zitierte Jesus, der den Apostel Simon Petrus ermahnt: »Simon, Simon, siehe, der Satanas hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen.« Gerald sprach das Wort »begehrt« mit einer Art Knurren aus und fletschte dabei auf einer Seite seines Mundes die Zähne. Sodann mimte er, geradezu unheimlich, den Satan selbst, trennte die sterbliche Ego-Schale vom unsterblichen Weizenkorn und blies sie mit einem genüsslichen Atemstoß ins Verderben. In Geralds Auslegung war »Satan« die ablenkende, zersetzende, entfremdende Macht der Raumzeit, die durch ihre Agenten – Radio, Kino, Presse – wirke. »Das ist des Teufels!«, rief Gerald im Flüsterton, die blassblauen Augen wild wie die eines von Entsetzen heimgesuchten Mannes in einem Spukhaus. (Er hatte das Thema in einem in jenem Jahr veröffentlichten Buch aufgegriffen: Schmerz, Geschlecht und Zeit.)
Laotses Tao Te King war Geralds pazifistisches Lieblingsevangelium. Oft wiederholte er einen Satz aus dem siebenundsechzigsten Kapitel: »Wen der Himmel retten will, den schützt er durch die Liebe.« Die einzig realistische Haltung sei die Sorge um andere, da nur sie die wirkliche Situation anerkenne: unser Einssein mit allen anderen. Gefühle der Liebe und des Mitgefühls seien nicht nur »gut« und »richtig«, letztlich dienten sie dem Selbstschutz. Hassgefühle seien letztlich selbstzerstörerisch.
Laotse sagt, wir sollen sein wie das Wasser, denn das Fließende überwindet stets das Starre, am Ende werden Felsen und Vorurteile hinweggespült. Um dies zu veranschaulichen, pflegte Gerald zu sagen, dass der Mensch, der die Dinosaurier überlebt habe und dem es gelungen sei, sich zu entwickeln, ohne dass ihm Flügel, Kiemen oder Giftdrüsen gewachsen seien, von einem kleinen, schwachen, aber anpassungsfähigen Spitzhörnchen abstamme. (Ein berühmter Biologe versicherte mir später, Gerald habe sich hier von seinem Sinn für Poesie hinreißen lassen. Der Mensch stamme vermutlich eher von einem großen aggressiven Affen ab.)
Gerald stimmte mit Laotse darin überein, dass man, wenn es sich vermeiden lasse, die andere Partei niemals ins Unrecht setzen dürfe. Märtyrertum möge heldenhaft sein, wenn es unvermeidlich sei, aber man müsse überzeugt sein, alles getan zu haben, um seine Verfolger vor dem spirituell selbstzerstörerischen Akt des Tötens zu bewahren. Andernfalls sei der eigene Tod ein Akt passiver Aggression, an dem man eine Mitschuld trage. Dann sagte er mit einem Seufzer: »Ich fürchte, das sonderbare Individuum Jesus von Nazareth hat sich vorsätzlich lynchen lassen.«
Aber Gerald missbilligte weniger Jesus als seine Kirche. Er sagte, er könne niemals Christ werden, solange die Kirche das Monopol göttlicher Inspiration für sich in Anspruch nehme – was Hindus und Buddhisten nicht täten – und solange sie die Kreuzigung als den höchsten und krönenden Triumph des Lebens Jesu hinstelle. Hierin schloss sich Gerald Bernard Shaw an, der statt von Christentum (Christianity) von »Kreuzigungstum« (Crosstianity) gesprochen hatte.
Gerald bezeichnete das Leben, das er zu führen versuchte, als »intentionales Leben«. Dessen Ziel bestand darin, das »abgeschnürte« Ego zu »veröden«. (Er verwendete gern medizinischen Termini.) Ein intentionales Leben erfordere nicht nur lange Meditationszeiten (er bestand darauf, dass seine eigenen sechs Stunden nur das absolute Minimum seien), sondern auch den Versuch, von Moment zu Moment Wachsamkeit gegen jeden Gedanken und jede Handlung zu üben, da jeder Gedanke und jede Handlung dazu beitragen, Hindernisse auf dem Weg zur Vereinigung mit dem »Etwas« zu errichten respektive zu beseitigen. Kein Gedanke und keine Handlung, so unwichtig sie auch erscheinen mögen, könne als neutral betrachtet werden.
Was waren das für Hindernisse? Gerald, der einen systematischen Verstand hatte und dazu neigte, in Dreiheiten zu denken, zählte sie an seinen langen, ausdrucksstarken Fingern ab: Neigungen, Besitztümer und Ehrgeiz. Zu den Neigungen gehörte auch ihr Gegenteil, die Abneigungen. Sie reichten von der, sagen wir, Lust auf Blondinen, Heroin oder Karamellbonbons bis hin zum Ekel oder der Angst vor Krüppeln, Wundbrand oder Eidechsen. Neigungen hielt Gerald für die am wenigsten schädliche der drei Kategorien. Der Ehrgeiz hingegen sei die schlimmste, da es eine Form des Ehrgeizes gebe, die dauerhafter sei als alle anderen Hindernisse. Seine Neigungen könne man ändern, seine Abneigungen ablegen. Man könne sich seines Besitzes entledigen. Man könne von seinen Ämtern zurücktreten und sich ins stille Kämmerlein zurückziehen. Doch dann, und gerade dann, neige die schlimmste Form des Ehrgeizes dazu, ihr Haupt zu erheben: wenn man anfange zu glauben, man sei eine spirituell überlegene Person und folglich berechtigt, schwächere Mitgeschöpfe zu verurteilen. (Lief Gerald selber Gefahr, dieser letzten Versuchung zu erliegen? Ja – und sei es nur, weil er in der Lage zu sein schien, alle anderen Hindernisse auf dem Weg dorthin zu überwinden. Ich konnte mir vorstellen, dass Gerald eines Tages beginnen mochte, sich als religiösen Lehrer selbst allzu ernst zu nehmen. Aber sicher nicht für lange. Er war ein zu großer Komödiant, als dass er sich der komischen Seite seiner Heiligkeit nicht rasch inne geworden wäre.)
Der Gedanke des »intentionalen Lebens« faszinierte mich. Ich sah, wie sehr es die Bedeutung noch des gewöhnlichsten Tages erhöhen, wie sehr es die Langeweile beseitigen würde, indem es das Leben in eine Kunstform verwandelte. In der Tat war sie mit jener Haltung verwandt, die – im Idealfall – ein Schriftsteller gegenüber seiner Arbeit an einem Roman einnehmen sollte. Freilich mit einem großen Unterschied: Der Schriftsteller ist nur mit seinem Roman beschäftigt, und auch das nur während der Arbeitszeit. Wer intentional lebt, ist mit seiner gesamten Lebenserfahrung beschäftigt, und zwar in jedem wachen Moment eines jeden Tages – bis man stirbt. Die Endgültigkeit einer solchen Beschäftigung schreckte und ängstigte mich. Auf Geralds asketisches Temperament jedoch wirkte sie sehr anziehend. Die negative Seite seiner Beschäftigung war sein Hass auf die Raumzeit, und diesen Hass kostete er aus: »Erst wenn die schiere Bestialität dieser Welt anfängt, dir wehzutun – so wie wenn du dir den Finger in der Tür einklemmst« – hier zuckte er zusammen und ahmte den körperlichen Schmerz nach –, »bist du bereit, diesen Schritt zu tun.«
Gerald glaubte an die hinduistische und buddhistische Lehre von der Reinkarnation – dass das Leben im Raum-Zeit-Kontinuum ein Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt ist. Ob man will oder nicht, man wird als Folge vergangener Taten (des Karmas) immer wieder aufs Neue geboren. Aus diesem Kreislauf kann sich nur befreien, wer die Vereinigung mit seiner wahren Natur erreicht und so seine Bindung an die Raumzeit löst. Deshalb strengte sich Gerald auch so an: Er wollte sicherstellen, dass dieses Leben sein letztes sein würde.
Sosehr ich Geralds Gefühle respektierte, seine Glaubensvorstellungen konnte ich nicht teilen. Wie konnte ich die Raumzeit hassen, wenn sie so viel Liebenswertes und Schönes enthielt, einschließlich Vernon? Zugegeben, meine Gefühle für Vernon waren sexueller Art und besitzergreifend. Ich fand daran nichts grundsätzlich Böses, aber es war eine Verstrickung mit dem weltlichen Leben – eine Verstrickung, die immer enger wurde, denn jetzt benötigten wir eine Wohnung und mindestens ein Auto. Schon damals war der Transport im weitläufigen Großraum Los Angeles ein so großes Problem wie heute. Chris Wood hatte für unsere finanzielle Sicherheit gesorgt, indem er mir für die nächsten paar Monate zweitausend Dollar lieh. Aber ich würde sie früher oder später zurückzahlen müssen, indem ich arbeiten ging, und ich konnte nicht legal arbeiten, bevor ich nicht ein Quota-Visum und damit eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung hätte, statt nur Besucher zu sein. Und wenn ich das erreicht hätte, auf welche Art von Arbeit konnte ich hoffen? Es war ja schön und gut, dass ich in New York beschlossen hatte, eine »regelmäßige bescheidene Anstellung« anzustreben. Nachdem ich einige Wochen in Los Angeles verbracht hatte, stellte ich fest, dass die Wirtschaftskrise noch immer andauerte und dass um jede »bescheidene Anstellung« Tausende besser qualifizierter Bewerber konkurrierten. Die einzige Arbeit, für die ich wirklich qualifiziert war, war die eines Drehbuchautors in einem Filmstudio. Damit standen mir nur zwei Optionen offen: entweder sehr viel Geld zu verdienen oder gar keins. Bei einer Filmagentin erkundigte ich mich nach meinen Chancen. Sie hatte von mir als Schriftsteller noch nie gehört und hielt mich offensichtlich für einen hoffnungslosen Fall. In den Studios laufe es gerade sehr schleppend, sagte sie mir. So machte ich mir Sorgen über Sorgen und verstrickte mich dabei immer tiefer in weltliche Angelegenheiten.
Dies wiederum gab mir das Gefühl, dass ich meine gewohnten Denkmuster überwinden und es mit Meditation versuchen müsse. Meditation mochte mir zumindest dabei helfen, tagsüber kurze Pausen vom Sich-Sorgen einzulegen. Ich wusste bereits, dass Gerald Meditationsunterricht bei einem in der Nähe lebenden Hindu-Mönch, Swami Prabhavananda, genommen hatte. Nun bat ich ihn, mir zu erzählen, was der Swami ihn gelehrt habe. Gerald tat jedoch herausfordernd geheimnisvoll. Es sei strengstens untersagt, die Unterweisungen eines Lehrers an Dritte weiterzugeben. Derartige Unterweisungen variierten von Schüler zu Schüler, je nach individuellen Bedürfnissen und Temperament. Es wäre so, als ließe man einen Mitpatienten die eigene Medizin trinken. Auf seine melodramatische Art deutete Gerald sogar an, dass ich, würde ich ausprobieren, was ihm beigebracht worden sei, schreckliche psychische Folgen erleiden, vielleicht sogar verrückt werden könnte.
Dann lenkte er ein und gab mir einige vernünftige und einfache Ratschläge. Ich solle gar nicht erst versuchen zu meditieren, auf welche Weise auch immer. Ich solle nur zweimal am Tag, morgens und abends, zehn oder fünfzehn Minuten lang still sitzen und mir immer wieder das »Etwas« in Erinnerung rufen – was es sei und weshalb man mit ihm in Kontakt treten wolle. Das sei alles.
Sobald ich mich entschlossen hatte, einen Versuch zu wagen, löste allein schon der Gedanke an Meditation eine seltsam starke Erregung aus. Ich betrachtete sie als den Versuch einer Konfrontation mit etwas, dem ich bis dahin noch nicht begegnet, das aber stets in mir gegenwärtig war. Wenn ich versuche, mich daran zu erinnern, wie ich mich damals fühlte, so denke ich an das Betreten eines unbekannten Korridors in einem Haus, das mir ansonsten völlig vertraut ist. Der Korridor liegt im Dunkeln. Ich stehe an einem Ende des Korridors, an der Schwelle zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten. Ich empfinde eine gewisse Ehrfurcht, aber keine Furcht. Die Dunkelheit wirkt beruhigend und durchaus nicht fremd. Ich brauche nicht zu fragen: »Ist da irgendetwas?« Mein Instinkt versichert mir, dass da etwas Bestimmtes ist. Aber was? Das »Etwas«? (Was immer es ist.) Oder nur mein eigenes Unbewusstes? (Was immer das bedeutet.) Im Moment scheint mir die Frage ohne praktischen Nutzen. Ich begnüge mich damit, einfach nur dort zu sein, wo ich bin: an der Schwelle zum dunklen Korridor.
Die einzige Ablenkung, die ich in jenen Tagen bemerkte, wurde durch meine eigene Verlegenheit bewirkt. Mir war deutlich bewusst, dass ich ein fremdartiges Spiel spielte und es im Beisein aller meiner Freunde drüben in England zu spielen schien. »Christopher ist nach Hollywood gegangen, um Yogi zu werden«, hörte ich sie sagen – natürlich nach Hollywood und nicht nach Los Angeles, denn »Hollywood« steht für die Filmwelt und ihre ganze Verlogenheit. Natürlich wusste ich: Meine wahren Freunde würden über mich nicht bösartig spotten. Vielleicht wären einige schmerzlich berührt oder gar bestürzt, fast alle wären verblüfft. Aber sie würden doch voraussetzen, dass ich zumindest ehrliche Beweggründe hatte für das, was ich tat. Nein, wer da spottete, das war ich selbst – oder vielmehr eine feindselige Minderheit in mir.
Vernon jedenfalls spottete nicht. Da er jung und neugierig auf alles ihm Unbekannte war, zeigt er sich sehr interessiert und begann Gerald auszufragen. Vielleicht hatte er ja auch selbst schon meditiert. Dass ich ihn nicht danach fragte, lässt vermuten, dass ich mich schuldig fühlte, weil meine Sitzungen so sporadisch waren. Ich glaube, ich spürte die unvermeidliche Unzufriedenheit eines Anfängers, der keine konkreten Anweisungen erhalten hat. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weshalb ich Geralds Swami Prabhavananda nicht sofort kontaktierte. Vielleicht war der Swami nicht zu Hause. Wie auch immer, erst Ende Juli brachte mich Gerald zu ihm.
2
Damals, und bis zum Bau der Schnellstraße durch Hollywood in den fünfziger Jahren, führte die Ivar Avenue vom Hollywood Boulevard steil hinauf zur Franklin Avenue. Dort schien die Ivar zu enden. Aber das tat sie nicht. Ein kurzes Stück weiter rechts, entlang der Franklin, gab es eine Abzweigung nach links, und dort ging sie noch ein Stück weiter. Diese Abzweigung war leicht zu übersehen. Viele von Prabhavanandas Besuchern übersahen sie, wenn sie das erste Mal nach ihm suchten. Bezeichnenderweise betrachtete Gerald dies gern als symbolträchtig: Wo ein Quell ewiger Wahrheit in der Raumzeit existiere, sei er stets sorgfältig verborgen.
Hatte man die Abzweigung jedoch erfolgreich genommen, fand man sich auf einer schmalen Straße wieder, die sich nur einen Häuserblock weit erstreckte. Hier war der Grund mehr oder weniger eben, denn man befand sich gewissermaßen auf der ersten Stufe jener treppenartigen Hügel, die über die Stadt hinweg aufs Meer blicken. Unter einem davon lag der Hollywood Boulevard, belebt mit Geschäften und Restaurants. Wenn in Grauman’s Chinese Theater eine abendliche Filmpremiere stattfand, funkelte er prächtig und bestrich mit den Strahlen seiner Bogenlampen den Himmel. Hier oben auf der Ivar jedoch, in einem am Hang gelegenen verschlafenen Vorort mit kleinen Häusern inmitten blühender Büsche und Weinreben, fühlte man sich abgeschieden.
Auf halber Strecke der Straße erwartete einen zur Rechten eine Überraschung: ein gedrungener Hindutempel mit weiß verputzten Mauern, Zwiebelhauben und goldenen Fialen. Zu dem Tempel führte eine auf beiden Seiten mit Zypressen bestandene Treppe.
An der Straßenecke neben dem Tempel stand ein hölzerner Bungalow mit der Hausnummer 1946 – damals einer der typischsten Bauten der Stadt, den Bungalows des Orients nachempfunden und vielleicht deshalb mit sehr kleinen Fenstern versehen, so als müsse das schattige Innere in einem viel heißeren Klima als dem unsrigen für Kühle sorgen. In diesem Bungalow lebten Prabhavananda und zwei oder drei weitere Personen.
Ich habe keinerlei Erinnerungen an meinen ersten Besuch. Könnte es daran liegen, dass Gerald so hinreißend sprach, dass die Persönlichkeit des Swami in den Hintergrund gedrängt wurde, so wie alle anderen, die möglicherweise anwesend waren? Die gleiche Wirkung hatte ich früher schon an mir selbst erlebt. Dennoch wurde mit diesem Besuch alles erreicht, was aus meiner Sicht notwendig war: Der Swami und ich vereinbarten, dass ich ein paar Tage später allein kommen solle, damit er mir einige Anweisungen geben könne. Unsere zweite Begegnung ist in meinem Tagebuch vermerkt. Sie fand am 4. August statt.
Diesmal empfing er mich nicht im Bungalow, sondern in einem kleinen Arbeitszimmer, das zum Tempelgebäude gehörte. Als ich dort ankam, wartete er bereits auf mich. Sofort empfand ich die Atmosphäre der Ruhe, die in diesem Zimmer herrschte und die mir zunächst unangenehm war. Es war wie ein plötzlicher Höhenunterschied, an den ich mich erst hätte gewöhnen müssen.
Der Swami ist kleiner, als ich ihn in Erinnerung hatte – charmant und jungenhaft. Dabei ist er Mitte vierzig und hat am Hinterkopf eine kahle Stelle. Er hat ein leicht mongolisches Aussehen: lange gerade Augenbrauen und weit auseinanderstehende dunkle Augen. Er spricht sanft und überzeugend. Sein Lächeln ist außergewöhnlich. Es ist so berührend, so offen, so freudestrahlend, dass ich am liebsten weinen würde.
Eine der Besonderheiten des Swami wird im Tagebuch nicht erwähnt: Er war Kettenraucher. Da auch ich ein starker Raucher war, dürfte mich das nicht weiter gestört haben.
Ich fühlte mich schrecklich unbeholfen – mit den Federn und Armreifen meiner Eitelkeit wie eine reiche, übertrieben herausgeputzte Frau. Alles, was ich sagte, klang künstlich und unaufrichtig. Ich spielte ihm eine kleine Szene vor und versuchte, sympathisch zu wirken. Ich sagte ihm, ich sei mir nicht sicher, ob ich diese Meditationen praktizieren und zugleich das Leben beibehalten könne, das ich führte. Er erwiderte: »Sie müssen wie die Lotusblume im Teich sein. Die Lotusblume wird nie nass.«
Ich sagte, ich hätte Angst vor meiner eigenen Courage, denn falls ich versagte, wäre ich vollends entmutigt. Er erwiderte: »Bei der Suche nach Gott gibt es kein Versagen. Jeder Schritt, den Sie tun, bringt Sie ein Stück weiter.«
Ich sagte, dass ich das Wort »Gott« hasste. Er willigte ein, dass man ebenso gut »das Selbst« oder »die Natur« sagen könne.
Er sprach über den Unterschied zwischen Yoga-Meditation und Autohypnose. Autohypnose oder Autosuggestion lasse einen sehen, was man sehen wolle. Meditation lasse einen etwas sehen, womit man nicht gerechnet habe. Autosuggestion führe bei jedem Individuum zu unterschiedlichen Ergebnissen. Meditation führe bei allen Menschen zu demselben Ergebnis.
Ich erklärte, Yoga hätte ich immer für albernen, abergläubischen Unsinn gehalten. Der Swami lachte. »Und jetzt sind Sie in die Falle getappt?«
In dieser Darstellung gibt es eine äußerst wichtige Auslassung. Mein vager Hinweis auf »das Leben, das ich führe« scheint sich lediglich auf ein weltliches Leben im herkömmlichen Sinne zu beziehen: auf meine Bemühungen um Arbeit und Geld. Auch davon musste ich dem Swami erzählt haben, was ihn dazu veranlasste, mir dazu zu raten, wie die Lotusblume zu sein – ein Gebot des Hinduismus. Doch die Frage, die ich ihm eigentlich hatte stellen wollen, war viel ernster. Würde seine Antwort nicht zufriedenstellend ausfallen, hätte es keinen Sinn, sich noch einmal zu treffen.
Ich wünschte, ich könnte mich an den genauen Wortlaut meiner Frage erinnern. Zweifellos diente sie der Selbstrechtfertigung. Vielleicht errötete ich und stammelte vor mich hin. Im Kern lautete die Frage: Kann ich ein spirituelles Leben führen, solange ich eine sexuelle Beziehung zu einem jungen Mann unterhalte?
An die Antwort des Swami allerdings kann ich mich erinnern: »Sie müssen versuchen, ihn als den jungen Krishna zu sehen.«
Damals wusste ich von Krishna nur, dass die Hindus ihn als Avatar betrachten – als eine der Inkarnationen des »Etwas«, von denen man glaubt, dass sie von Zeit zu Zeit auf der Erde geboren werden – und dass Krishna in seiner Jugend außerordentlich schön gewesen sein soll. Ich verstand den Swami so, dass ich mich bemühen sollte, Vernons Schönheit – also genau jenen Aspekt an ihm, der mich sexuell anzog – als die Schönheit Krishnas zu sehen, die seine Anhänger spirituell anzieht. Ich sollte versuchen, in Vernon das Krishna-Ähnliche zu sehen und zu lieben. Nun, warum nicht? Ich sagte mir, dass ich Vernon nicht nur begehrte, sondern ihn auch liebte, und dies war eine Möglichkeit, es zu beweisen. Natürlich war ich mir bewusst, dass ich, sollte ich erfolgreich sein, jegliches Verlangen nach Vernons Körper verlieren würde. Doch der Swami hatte nur gesagt: »Versuchen Sie es.« Es konnte nicht schaden, es zu versuchen – vor allem, wenn wir nicht zusammen im Bett lagen.
Die Antwort des Swami entmutigte mich keineswegs, ja, sie fiel freizügiger aus, als ich erwartet hatte. Was mich beruhigte – was mich überzeugte, dass ich sein Schüler werden könnte –, war, dass er nicht den geringsten Anflug von Abscheu gezeigt hatte, als ich ihm meine Homosexualität eingestand. Ich hatte einen Ausbruch eisigen Puritanismus befürchtet: »Sie müssen mir versprechen, diesen Jungen niemals wiederzusehen, andernfalls kann ich Sie nicht annehmen. Sie begehen eine Todsünde.«
Von diesem Moment an begann ich zu verstehen, dass der Swami nicht in Kategorien von Sünde dachte, wie es die meisten Christen tun. Gewiss, er betrachtete mein Verlangen nach Vernon als ein Hindernis für meinen spirituellen Fortschritt – aber als kein größeres oder kleineres Hindernis, als es das Verlangen nach einer Frau, selbst nach einer rechtmäßig angetrauten Ehefrau, gewesen wäre. Christliche Sünden sind Vergehen gegen Gott, und jede hat ihren festgesetzten Schweregrad. Die Hindernisse, die der Swami erkannte, sind Vergehen gegen sich selbst, und ihre Bedeutung hängt von der Verfassung jedes Einzelnen ab. In der Tat war die Haltung des Swami wie die eines Trainers, der seinen Athleten sagt, dass sie das Rauchen, den Alkohol und bestimmte Nahrungsmittel aufgeben müssen, nicht etwa weil diese von Natur aus von Übel sind, sondern weil sie den Athleten daran hindern, etwas zu bekommen, das er viel stärker will – etwa eine olympische Medaille.
Ich bezweifle, dass ich zu diesem Zeitpunkt bereits von der Kundalini gehört hatte. Aber an dieser Stelle will ich darüber schreiben, weil die Kundalini relevant ist für das Thema Sex und Keuschheit.
Der hinduistischen Physiologie zufolge ist die Kundalini eine ungeheure Energiereserve, die sich am unteren Ende der Wirbelsäule befindet. Ihr Name bedeutet »das Aufgerollte«, daher wird sie manchmal auch als »Schlangenkraft« bezeichnet. Es heißt, dass diese Kraft, ist sie erst einmal geweckt, entlang des Spinalkanals nach oben steigt. Dabei durchläuft sie mehrere Bewusstseinszentren, die als Chakren bezeichnet werden. Ein Chakra ist kein anatomisches Organ. Seine Natur wird als »feinstofflich« beschrieben. Feinstoffliche Materie ist für das »grobstoffliche« Auge unsichtbar und kann nur in spirituellen Visionen gesehen werden.
Bei der großen Mehrheit der Menschen steigt die Kundalini selten über die drei untersten Chakren. Daher verursacht ihre Kraft nur materielle Begierden, einschließlich der Lust. Ist ein Mensch jedoch hinreichend spirituell, steigt die Kundalini zu den oberen Chakren auf und führt so zu immer höheren Graden der Erleuchtung. In äußerst seltenen Fällen kann die Kundalini das oberste, siebte Chakra erreichen und den Samadhi-Zustand hervorrufen, die ultimative Erfahrung der Vereinigung mit dem Ewigen in einem selbst.
Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist Keuschheit nicht einmal eine Tugend, sie ist vielmehr eine praktische Notwendigkeit. Indem man keusch ist, erhält man sich die Kundalini-Kraft, die für spirituellen Fortschritt absolut unerlässlich ist.
Ich fand dieses Bild der Kundalini sehr hilfreich als Korrektiv des Puritanismus. Der religiöse Puritaner betrachtet bestimmte Teile und Funktionen des Geist-Körpers als »rein« und andere als »unrein«. Er weigert sich zuzugeben, dass es zwischen diesen beiden Seiten irgendeine Beziehung geben kann. Der antireligiöse Puritaner hingegen glaubt, dass er die Religion erfolgreich verdammt, wenn er erklärt, dass sie nichts anderes ist als unterdrückter Sex. Es gibt nur eine Kundalini, nur eine Kraft, die hinter all diesen Funktionen steht. Weshalb sie also »rein« oder »unrein« nennen?
Am Ende unserer Unterredung nahm der Swami ein Blatt Papier zur Hand, das er mit Anweisungen beschrieb – was ich bei der Meditation anstreben solle:
Versuche, die Gegenwart einer alles durchdringenden Existenz zu spüren.
Sende allen Wesen – im Norden, Süden, Osten und Westen – Gedanken des Friedens und des guten Willens.
Stelle dir den Körper als einen Tempel vor, der die Wirklichkeit enthält.
Meditiere über das Wahre Selbst. Das Selbst in dir ist das Selbst in allen Wesen. Ich bin unendliche Existenz, unendliches Wissen, unendliche Glückseligkeit.
5. August: Nummer eins finde ich am einfachsten – vor allem nachts. In der Wüste wäre es besonders einfach. Hier hört man ständig Autos, Dampfhämmer, ein entferntes Radio, die Uhr, das Brummen des Kühlschranks – und muss sich in Erinnerung rufen, dass die Existenz auch in diesen Mechanismen steckt.
Nummer zwei ist einfach, solange ich an typische Menschen in jedem Land denke. Aus irgendeinem Grund fällt es mir am schwersten, den Südamerikanern oder Menschen in Ländern südlich des Äquators guten Willen entgegenzubringen, vielleicht weil ich noch nie dort war. Auch die Himmelsrichtungen machen mir zu schaffen. Wo ist jeder Mensch? Am einfachsten wäre es auf einem Berggipfel oder einem Wolkenkratzer.
Nummer drei: sehr schwierig. Hat viel mit Gedanken an Sex zu tun.
Nummer vier: relativ leicht. Wenn ich an das Schreiben denke, kann ich leicht erkennen, dass der Schriftsteller einen großen Vorrat an universellem Wissen anzapft. Je wagemutiger, je hartnäckiger er ist, desto mehr findet er heraus … »Unendliche Glückseligkeit« – unendliche Möglichkeiten der Glückseligkeit in jedem von uns. Warum mache ich mich unglücklich? Angst und Begierde sind nichts weiter als ein verstopftes Abflussrohr. Beseitige sie, und das Wasser fließt wieder. Es ist die ganze Zeit über da.
Heute Abend, auf dem Fußboden des Schlafzimmers, im Dunkeln. Unbefriedigend. Bin an Nummer eins hängen geblieben, weil ich das Gefühl nicht loswurde, dass alle Welt schlief und deshalb nicht länger Teil des »Bewusstseins« war. Die Körperhaltung ist schwierig. Mein Rücken tut weh. Aber irgendwie fühle ich mich erfrischt.
Dass ich in meinem Tagebuch die »Körperhaltung« erwähne, erinnert mich daran, dass ich schon vorher, vor meiner Bekanntschaft mit dem Swami, im Schneidersitz auf dem Fußboden gesessen habe. Dies nicht, um Gerald zu imitieren, denn der zog es vor, auf einem Stuhl zu sitzen. Ich glaube, ich bevorzugte den Fußboden, weil ich meine Meditation in gewisser Weise mit meiner normalen Lebenserfahrung kontrastieren wollte. Vom Fußboden aus betrachtet sieht selbst ein vertrautes Zimmer anders aus. Es war, als hätte ich mich in eine andere Dimension versetzt.
Alles, was der Swami verlangte, war, dass man eine Position einnehmen sollte, bei der die Wirbelsäule gerade gehalten wurde. Solange ich aufrecht säße, könnte ich auch auf einem Stuhl meditieren. Der Schneidersitz sei nicht wichtig, sagte er. Hindus säßen nur deshalb im Schneidersitz, weil sie von Kindheit an daran gewöhnt seien.
Der klassische Lotussitz, bei dem die Beine so verschränkt werden, dass die Füße auf dem jeweils anderen Oberschenkel ruhen, gelang mir nie. Dafür waren meine Beine zu steif. Aber ich stellte fest, dass ich es mir im Schneidersitz recht bequem machen konnte, wenn ich mir ein Kissen unters Steißbein legte. Bald konnte ich diese Position mindestens eine Stunde lang mit geradem Rücken aushalten. Selbst auf Partys saß ich so auf dem Fußboden – und erwarb mir damit zweifellos den Ruf eines Wichtigtuers.
Ich habe bereits erwähnt, wie Gerald mich nicht nur mit dem Swami bekannt machte, sondern auch meinen Geist darauf vorbereitete, die Lehre des Swami zu empfangen. Ohne seine Hilfe hätte ich den Weg in die Ivar Avenue 1946 bestimmt nicht gefunden. Dafür werde ich ihm mein Leben lang dankbar sein. Wie auch dafür, dass er nie versucht hat, mich zu seinem eigenen Schüler zu machen. Das wäre zweifellos eine Farce geworden. Gerald und ich gehörten der gleichen Gesellschaftsschicht an, wir stammten beide aus London, hatten viele gemeinsame Freunde und waren mit der Ausdrucksweise und dem Humor des jeweils anderen bis in die kleinste Nuance vertraut. Obwohl Gerald streng zölibatär lebte, betrachtete er mein Sexualleben mit Toleranz. Trotz unseres unterschiedlichen Temperaments fühlten wir uns sehr wohl miteinander. Aus genau diesen Gründen hätten wir niemals eine Lehrer-Schüler-Beziehung eingehen können. Keiner von uns hätte seine Rolle ernst genommen.
Was ich jedoch sehr ernst nahm, war Geralds Urteil über andere Menschen. Mit seinen milden blauen Augen hatte er so viele Menschen durchschaut, die ihr spirituelles Wissen nur heuchelten, mit seiner langen, empfindlichen Nase stets den Braten gerochen, wenn Schwindel im Spiel war. Dass Gerald ihn akzeptierte, brachte auch mich dazu, Prabhavananda zu akzeptieren, jedenfalls bis ich in der Lage wäre, mir eine eigene Meinung zu bilden.
Ich weiß nicht mehr, wie im Einzelnen und durch wen ich die Fakten zu Prabhavanandas Vorleben und Herkunft herausfand. Jedenfalls scheint dies der richtige Ort zu sein, um das Wesentliche zu erzählen.
Er wurde am 26. Dezember 1893 in Sur Managar geboren, einem Dorf in Bengalen nahe der Stadt Bankura nordwestlich von Kalkutta. In den ersten zwanzig Jahren seines Lebens hieß er Abanindra Nath Ghosh.
Abanindras Eltern waren normale gläubige Hindus. Er übernahm ihre religiösen Überzeugungen, war aber kein sehr meditativer oder zurückgezogen lebender Junge. Er spielte gern Fußball und trieb anderen Sport, und er hatte viele Freunde.
Doch als er vierzehn Jahre alt war, hatte er von Ramakrishna gelesen, dem heiligen Mann, der von einigen bereits als Avatar angesehen wurde. Ramakrishna war in einem nicht weit entfernten Dorf zur Welt gekommen und hatte sein Erwachsenenleben in einem Tempel in der Nähe von Kalkutta verbracht. Abanindra hatte auch von Ramakrishnas wichtigsten Schülern Vivekananda und Brahmananda gelesen, die nach Ramakrishnas Tod im Jahre 1886 den Ramakrishna-Orden gegründet hatten. Ihre Namen übten eine geheimnisvolle Anziehungskraft auf ihn aus.
Eines Tages begegnete Abanindra scheinbar zufällig Sarada Devi. Sie war Ramakrishnas Frau gewesen und wurde von seinen Schülern als spirituelle Mutter betrachtet – »heilige Mutter«, nannten sie sie. Eine ihrer Begleiterinnen erklärte Abanindra, wer sie war, sonst hätte er sie für eine gewöhnliche Bäuerin gehalten, so wie sie barfuß und ohne jede Selbstgefälligkeit vor einem Dorfgasthof saß. Als er sich ihr näherte und sich verneigte, um ehrerbietig ihre Füße zu berühren, sagte sie: »Mein Sohn, habe ich dich nicht schon einmal gesehen?«
Als Abanindra achtzehn Jahre alt war und in Kalkutta studierte, besuchte er Belur Math, das Hauptkloster des Ramakrishna-Ordens, das im Randgebiet der Stadt am Ganges liegt. Er wollte den Raum sehen, in dem sich Vivekananda aufgehalten hatte und der seit seinem Tod im Jahre 1902 als öffentlicher Schrein dient. Als Abanindra das Vivekananda-Zimmer verließ, sah er sich zum ersten Mal Brahmananda gegenüber. Und Brahmananda sagte zu ihm: »Habe ich dich nicht schon einmal gesehen?«
Die Bestürzung und Verwirrung, die diese Begegnung bei Abanindra auslöste, sind kaum in Worte zu fassen. Ich werde in diesem Buch noch häufiger auf sie zurückkommen. An dieser Stelle will ich nur erwähnen, dass Abanindra sich danach sehnte, Brahmananda wiederzusehen. So gab er das Geld, mit dem er eigentlich seine Studiengebühren bezahlen sollte, einige Monate später für eine Fahrkarte nach Haridwar aus, weil er wusste, dass Brahmananda dort ein Kloster besuchte. Er kam mitten in der Nacht an, unangekündigt, doch Brahmananda schien nicht im Mindesten überrascht, ihn zu sehen. Er erlaubte Abanindra, einen Monat zu bleiben, nahm ihn formell als seinen Schüler an und schickte ihn anschließend zurück nach Kalkutta, damit er seine Ausbildung fortsetze.
Obwohl Abanindra eine so große Zuneigung zu Brahmananda empfand, hatte er noch nicht die Absicht, Mönch zu werden. Am College geriet er unter den Einfluss anderer Kräfte. Die organisierte militante Opposition gegen die britische Herrschaft erstarkte, und viele Studenten waren daran beteiligt. Abanindra entschied, dass es seine erste Pflicht sei, Patriot zu sein. Er musste sich der Sache der Freiheit Indiens verschreiben. Um dies zielstrebig tun zu können, gelobte er, nicht eher zu heiraten, als bis diese Freiheit errungen wäre. Er trat einer revolutionären Organisation bei und verfasste Pamphlete, die heimlich verteilt wurden. Da er so jungenhaft und unschuldig aussah, vertrauten ihm seine Kameraden mehrere Revolver an, die aus einem britischen Waffenlager gestohlen worden waren. Er versteckte sie in seinem Zimmer. Die meisten der jungen Männer hatten keine militärische Ausbildung – Abanindra wusste nicht, wie man einen Revolver richtig handhabte. Sie riskierten ihr Leben, aber das taten die Veteranen der Bewegung ebenfalls. Einer von ihnen warf eine Bombe auf den Vizekönig und musste außer Landes fliehen. Ein weiterer, ein enger Freund von Abanindra, wurde verhaftet und starb im Gefängnis, vermutlich an den Folgen der Folter. Die Behörden nannten es Selbstmord.
Abanindra studierte mittlerweile Philosophie. Regelmäßig besuchte er Belur Math, da ihn einer der dortigen Swamis in den Lehren Adi Shankaras unterrichten konnte. Sein Lehrer drängte ihn immer wieder, Mönch zu werden, Abanindra jedoch stritt mit ihm und meinte, das Klosterleben sei Weltflucht, eine Weigerung, seine politische Pflicht zu erfüllen.
Während der Weihnachtsferien blieb Abanindra für einige Tage im Math (Kloster). Zu dieser Zeit ereignete sich ein weiterer außergewöhnlicher Vorfall. Im Folgenden Abanindras viele Jahre später geschriebener Bericht. (»Maharaj« war der vertraute Name, unter dem Brahmananda im Orden bekannt war. Seine ungefähre Bedeutung ist »Meister«.)
Eines Morgens ging ich wie üblich zum Maharaj, um mich vor ihm niederzuwerfen. Ebenfalls im Raum war ein alter Mann. Plötzlich fragte dieser den Maharaj: »Wann wird der Junge Mönch werden?« Der Maharaj schaute mich von oben bis unten an, und als er leise antwortete, war sein Blick von großer Güte: »Wenn der Herr es will.« Das war das Ende meiner politischen Pläne und Ambitionen. Ich blieb im Kloster.
In den folgenden Jahren hielt sich Abanindra im Ramakrishna-Kloster in Madras auf. Er besuchte Brahmananda, wann immer es ihm erlaubt war, was nicht oft geschah, da Brahmananda in Ausübung seiner Pflichten als Ordensoberhaupt von einem Kloster zum anderen reisen musste. Brahmananda war jedoch anwesend, als Abanindra im Herbst 1921 seine letzten Gelübde (Sannyas) ablegte und Swami Prabhavananda wurde. (Prabhavananda bedeutet »derjenige, der in der Quelle aller Schöpfung Glückseligkeit findet«; ananda, mit der Bedeutung »Glückseligkeit« oder »Friede«, ist das Suffix, das gewöhnlich dem Vornamen eines Swami hinzugefügt wird.)
Im Jahr 1922 starb Brahmananda. 1923 erfuhr Prabhavananda von seinen Oberen, im San-Francisco-Zentrum werde der Assistent eines Swami benötigt und man wolle ihn dorthin schicken. (Es gab bereits mehrere solcher Zentren, die Vivekananda während seines zweiten und letzten Besuchs in den Vereinigten Staaten 1899 bis 1900 gegründet hatte. Diese Zentren wurden oft Vedanta-Gesellschaften genannt, weil sie sich dem Studium und der Praxis jener Philosophie widmeten, die in den Veden, den ältesten Hindu-Texten, gelehrt wird.)
Seit Brahmanandas Tod hatte Prabhavananda gehofft, in einem Kloster in den Ausläufern des Himalaya ein kontemplatives Leben führen zu dürfen, wo er intensiv meditieren könne. Er fühlte sich völlig ungeeignet, irgendjemanden zu unterrichten. In seinen eigenen Worten: »Ich war kaum dreißig, sah aus wie zwanzig und fühlte mich noch jünger.« Doch seine Vorgesetzten tadelten ihn wegen seines mangelnden Selbstvertrauens. Wie konnte er sich anmaßen zu glauben, Erfolg oder Misserfolg hingen von seinen eigenen Bemühungen ab? Hatte er kein Vertrauen, dass Brahmananda ihm helfen würde? »Wie kannst du behaupten, nicht unterrichten zu können? Du hast den Sohn Gottes gekannt!«
Als Prabhavananda zum zweiten Mal einen Vortrag im San-Francisco-Zentrum hielt, verlor er plötzlich den Faden und musste den Vortrag abbrechen. Doch das war nur das Lampenfieber des Neulings. Schon bald wurde er ein wirkungsvoller Redner und tüchtiger Assistent des leitenden Swami. Nach zwei Jahren wurde er nach Portland in Oregon geschickt, um dort ein Zentrum zu eröffnen.
Während er in Portland lebte, wurde Prabhavananda nach Los Angeles eingeladen, um eine Reihe von Vorträgen über die Vedanta-Philosophie zu halten. Zu dieser Zeit lernte er Mrs Carrie Mead Wyckoff kennen. Dreißig Jahre zuvor, als junge Frau, hatte Mrs Wyckoff Vivekananda getroffen, als dieser in Kalifornien weilte. Später war sie eine Schülerin von Swami Turiyananda, einem anderen Schüler Ramakrishnas, geworden. Er hatte ihr den Ordensnamen Lalita gegeben – Lalita war eine der Mägde Krishnas. Von da an nannten die Menschen sie gewöhnlich »Schwester Lalita«.
Schwester Lalita war mittlerweile Witwe und hatte gerade ihren einzigen Sohn verloren. So schien es ganz natürlich, dass die ältere Dame und der jugendliche Swami eine Art Adoptivbeziehung eingingen. Schwester Lalita kehrte mit ihm nach Portland zurück und führte ihm im Zentrum den Haushalt. Dann, im Jahre 1929, bot sie ihm ihr Haus in der Ivar Avenue 1946 an – als Sitz des Zentrums einer künftigen Vedanta-Gesellschaft von Südkalifornien. Sobald die Vorbereitungen für die Fortsetzung der Arbeit in Portland getroffen worden waren, zogen sie dort ein.
Zu Beginn war die Gesellschaft sehr klein. Das Wohnzimmer reichte aus, um Prabhavanandas Versammlungen abzuhalten. Eine Engländerin, die sie Amiya nannten, zog bei ihnen ein. Später kamen noch zwei oder drei weitere Frauen hinzu. Sie hatten kaum genug Geld zum Leben.
Um 1936 begann die Gemeinde zu wachsen. Prabhavananda war in der Gegend als Redner bekannt geworden. Es kam nur noch selten vor, dass jemand anrief, um zu fragen, ob der Swami ein Horoskop erstellen oder ein Exempel seiner hellseherischen Fähigkeiten geben könne. Es hatte sich nämlich herumgesprochen, dass er kein Swami im üblichen kalifornischen Sinne war, sondern ein Religionslehrer, dessen Titel die gleiche Bedeutung hatte wie »Hochwürden« in der katholischen Kirche.
Und dann tauchten Spender mit genügend Geld auf, um den Bau eines Tempels zu finanzieren. In Schwester Lalitas Garten war Platz. Er wurde im Juli 1938