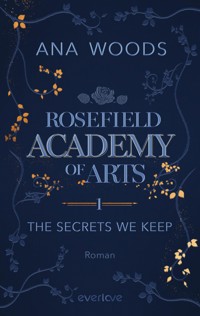3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
**Erkenne deine wahre Bestimmung** Dämonen, Voodoo-Zauber oder gefährliche Götter haben für Elayne immer ins Reich der Märchen gehört. Doch als sie und ihre Familie nach New Orleans ziehen, muss sie schon bald erkennen, dass in der legendären Stadt unerklärliche Dinge vor sich gehen. Dunkle Gestalten suchen sie heim und ihre kleine Schwester wird plötzlich von schrecklichen Albträumen gequält. Auf der Suche nach Antworten trifft Elayne auf den mysteriösen und attraktiven Blake, der ihr das Unvorstellbare verrät: Verborgen vor aller Welt tobt ein Krieg zwischen Gut und Böse – und sie soll ein Teil davon sein! Entschlossen, ihrer Schwester zu helfen, folgt sie Blake in den Untergrund New Orleans, nicht ahnend, was sie in der Dunkelheit wirklich erwartet … Bist du bereit, dich dem geheimen Orden von New Orleans anzuschließen? //Dies ist der erste Band der romantischen Urban-Fantasy-Dilogie »Der geheime Orden von New Orleans«. Alle Bände der Buchreihe bei Impress: -- A Whisper of Darkness (Der geheime Orden von New Orleans 1) -- A Touch of Light (Der geheime Orden von New Orleans 2)// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Ana Woods
A Whisper of Darkness (Der geheime Orden von New Orleans 1)
**Erkenne deine wahre Bestimmung**
Dämonen, Voodoo-Zauber oder gefährliche Götter haben für Elayne immer ins Reich der Märchen gehört. Doch als sie und ihre Familie nach New Orleans ziehen, muss sie schon bald erkennen, dass in der legendären Stadt unerklärliche Dinge vor sich gehen. Dunkle Gestalten suchen sie heim und ihre kleine Schwester wird plötzlich von schrecklichen Albträumen gequält. Auf der Suche nach Antworten trifft Elayne auf den mysteriösen und attraktiven Blake, der ihr das Unvorstellbare verrät: Verborgen vor aller Welt tobt ein Krieg zwischen Gut und Böse – und sie soll ein Teil davon sein! Entschlossen, ihrer Schwester zu helfen, folgt sie Blake in den Untergrund New Orleans, nicht ahnend, was sie in der Dunkelheit wirklich erwartet …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
© privat
Ana Woods lebt am grünen Stadtrand von Berlin, wo sie von Inspiration zu ihren Romanen nur so umgeben ist. Bereits in jungen Jahren fing sie mit dem Schreiben an und verzauberte mit ihren fantasievollen Kurzgeschichten nicht nur Freunde und Familie, sondern ebenfalls ihre Lehrer und Klassenkameraden. 2017 hat Woods sich ihren Traum erfüllt und sich als Autorin selbstständig gemacht.
PROLOG
Die Frau machte einen folgenschweren Fehler, als sie die Lichtkegel der gut besuchten Straße verließ, um eine Abkürzung durch die verschmutzten Gassen der Stadt einzuschlagen. Sie konnte nicht wissen, dass diese Entscheidung ihren Tod bedeutete.
Lange hatte er sich in den Schatten versteckt wie ein Panther, der auf seine Beute lauerte. Er hatte nicht auf sie im Besonderen gewartet, sondern auf eine sich verirrende Seele, die niemals mehr das Tageslicht erblicken würde.
Eigentlich hatte er damit gerechnet, noch viele weitere Stunden hier zu sitzen, zu verharren, bis er endlich zuschlagen konnte. Dass es dieses Mal so schnell ging, war einer glücklichen Fügung des Schicksals zu verdanken.
Vorsichtig trat er hervor, folgte der Frau wie ihr eigener Schatten. Sie sah ihn nicht kommen. Für sie war er nichts weiter als ein kaum wahrnehmbares Flimmern. Dennoch spürte sie ihn. Unbehagen durchzuckte ihren Körper, sorgte dafür, dass ihre Nackenhaare sich aufstellten.
Die Frau drehte sich um ihre eigene Achse, suchte ihn in der Dunkelheit. Nun, da sie in seine Richtung blickte, konnte er sie zum ersten Mal wirklich sehen. Sie war hübsch, keine Frage. Der rosige Ton ihrer Wangen verlieh ihr eine jugendliche Unschuld und das blonde Haar fiel in sanften Locken auf ihre Schulter.
Ein leises Grunzen entfuhr ihm. Es war stets amüsant, dabei zuzusehen, wie seine Beute langsam panisch wurde, gar paranoid.
Die Frau wandte sich wieder um, lief schneller. Ihre Absätze klackerten auf dem vom Regen durchtränkten Asphalt. Sie hatte die Wahl gehabt. Sie hätte umdrehen und Zuflucht im Schein der Straßenlaternen suchen, sich unter all die Menschen mischen können, die das Nachtleben New Orleans’ in vollen Zügen genossen. Doch nun war es zu spät.
Immer wieder warf sie einen Blick hinter sich, festigte den Griff um ihre lederne Handtasche, die Brust sich schnell hebend und senkend, schneller und schneller. Er konnte die Angst riechen, spürte, wie das Blut durch ihren Körper rauschte, das Adrenalin durch ihre Adern pumpte. Es betörte ihn, machte es ihm schier unmöglich, noch länger zu warten.
Nur noch wenige Schritte trennten die Frau von der Sicherheit, nach der sie sich in jenem Augenblick so sehr sehnte. Doch so weit würde es nicht kommen.
Ihr stoßweiser Atem beschleunigte sich, als er langsam seinen Arm nach vorne gleiten ließ. Seine kalten Finger umschlossen ihr Handgelenk. Sie wusste, was nun passieren würde. Tief in ihrem Inneren wusste sie, dass dies ihre letzte Nacht auf Erden sein sollte. Entgegen seiner Erwartung wehrte die Frau sich nicht. Stattdessen hielt sie inne und drehte sich ihm zu.
»Wer ist da?«, stieß sie hervor. Es gelang ihr nicht gänzlich, das Zittern in ihrer Stimme zu verbergen, auch wenn sie versuchte, Stärke zu zeigen. Ein Anflug von Bewunderung durchzuckte ihn.
Er entschied sich, etwas zu tun, das er bisher bei keinem seiner Opfer getan hatte. Er legte seinen Schleier ab und offenbarte sich ihr. Stück für Stück materialisierte er sich vor den Augen der Frau, deren schönes Gesicht sich vor Entsetzen verzerrte. Es würde schnell gehen. Sie sollte keine Qualen leiden.
Rasch zückte er den Dolch – ein glatter Schnitt in die Kehle. Sie wusste kaum, wie ihr geschah. Mit beiden Händen versuchte sie, die Blutung zu stoppen, doch er war gut in dem, was er tat. Sie würde sterben, egal wie sehr sie kämpfte.
Ein letztes qualvolles Röcheln, ehe sie wie ein nasser Sack zu Boden fiel. Er beugte sich dem leblosen Körper entgegen, ging in die Hocke, um ihr so nah wie möglich zu sein. Dann legte er seine Lippen an ihre noch warmen Ohren und flüsterte ihr zu.
»Dein schlimmster Albtraum.«
KAPITEL 1
Mit den letzten Kraftreserven, die ich in den Tiefen meines Körpers fand, ließ ich auch den letzten Umzugskarton auf den Boden fallen. Feiner Staub wirbelte auf und kitzelte in meiner Nase. Da waren wir also. In unserem neuen Zuhause. Ich hatte mir ehrlich gesagt etwas vollkommen anderes darunter vorgestellt, als Dad von all dem Platz geschwärmt hatte. Im Vergleich zu unserem schönen Einfamilienhaus auf Long Island wirkte dieses Apartment ein wenig … nun ja, erbärmlich!
Innerlich verfluchte ich ihn dafür, diesen Job angenommen zu haben. Hätte er nicht noch ein einziges Jahr warten können? Nun musste ich das letzte Highschooljahr an einer neuen Schule antreten und wieder einmal von vorne beginnen. Es hatte lange genug gedauert, mir einen Freundeskreis aufzubauen, einen netten Jungen für mich zu gewinnen und mein Leben inbrünstig zu lieben.
Maunzend streifte Bob mich mit seinem grau-schwarz getigerten Schwanz, ehe er zwischen dem ganzen Kram verschwand. Vermutlich suchte er nach irgendeinem leeren Karton, um sich hineinzulegen. Kater musste man sein. Auch ich hätte mich am liebsten in eine Ecke gekauert – natürlich nicht, ohne diese vorher von der dicken Staubschicht zu befreien. Das war mir allerdings nicht vergönnt.
»Würdest du deine Kisten bitte in dein Zimmer stellen? Oder möchtest du, dass wir uns alle das Genick brechen?«, stöhnte Mom, während sie sich an mir vorbeikämpfte. Schweiß rann über ihr sonst so makelloses Gesicht und einige leicht ergraute Strähnen lösten sich aus ihrem hoch sitzenden Zopf.
»Natürlich, Mom«, antwortete ich und griff nach dem Karton, der mir am nächsten stand, ohne genau auf die Aufschrift zu achten. Eigentlich hatte ich keine Lust, noch irgendetwas zu tragen, aber in ihrem Zustand wollte ich mich auch nicht mit meiner Mutter anlegen. Sie war ein unglaublich fröhlicher Mensch. Es dauerte eine ganze Weile, ehe man sie auf die Palme brachte. Überschritt man diese hauchdünne Linie allerdings, dann war es, als würde man in einen sich auftürmenden Tsunami springen. Mit anderen Worten: Man wäre lebensmüde.
Drei Türen führten von dem schmalen Flur ab. Ich öffnete jede einzelne von ihnen und musste bedauerlicherweise feststellen, dass jedes der Schlafzimmer vollkommen identisch aufgebaut war. Schnaufend trat ich durch die letzte Tür und beförderte den Karton in die nächstbeste Ecke. Hier würde ich also das kommende Jahr leben. In einem quadratischen Zimmer, das etwa vier Meter von Wand zu Wand betrug und lediglich ein kleines verschmutztes und von Gitterstäben umzäuntes Fenster besaß. Willkommen in Ihrem persönlichen Gefängnis!
Ehe ich mir Ärger einhandeln konnte, holte ich auch die restlichen Kartons und türmte sie nacheinander auf. Glücklicherweise waren die größeren Möbel bereits gestern angeliefert worden, weshalb ich mich nun vollkommen erschöpft rücklings auf die weiche Matratze werfen konnte. Die Zimmerdecke war vergilbt und der Putz löste sich an einigen Stellen, wodurch die Stromkabel der Lampe hervorlugten.
Unwillkürlich senkten sich meine Mundwinkel. Von außen machte das Haus im Grunde einen relativ schönen Eindruck. Es war weiß und sowohl die Fensterläden als auch die Eingangstür waren in einem einladenden Grünton angestrichen. Beinahe hätte man es für ein kleines Vorstadthäuschen halten können. Doch kaum hatten wir das Treppenhaus betreten und die Stufen in die erste und oberste Etage erklommen, hatte sich Enttäuschung breitgemacht. Das hier war alles andere als ein Paradies.
Ich schwang mich vom Bett, welches einen ächzenden Laut von sich gab, und öffnete das kleine Fenster. Die Gitterstäbe waren bereits verrostet und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wozu sie dienten. Schließlich wohnten lediglich zwei Parteien in diesem Haus und die Entfernung zwischen meinem Zimmer und der Straße betrug nur ein paar Meter. Nicht mal wenn ich herausspringen wollte, würde ich mich dabei ernsthaft verletzen. Es sei denn, ich würde mit dem Kopf vorausspringen.
Ich genoss die warme Brise, die über mein schweißnasses Gesicht wehte. Bis das Quietschen des Dielenbodens mir die Ankunft eines ungebetenen Gastes in meinem Zimmer verriet.
»Gefällt es dir?«, wollte mein Vater vorsichtig wissen.
Zwar gab ich mir alle Mühe, doch meine Augäpfel gehorchten mir einfach nicht und rollten herum. Auch das leise Stöhnen konnte ich nicht zurückhalten.
Ein Blick zu Dad genügte, um ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Er meinte es nur gut und verdiente meine miese Laune nicht. »Es ist …«, begann ich den Satz, doch mir wollte partout kein passendes Ende einfallen.
»Ja?«, hakte Dad nach und zog eine Augenbraue in die Höhe. Zumindest versuchte er es, gelingen wollte es ihm nie. Die zweite Braue wollte einfach nicht an Ort und Stelle verharren, weshalb das Gesicht, das er zog, zum Schießen aussah.
»… nett.« Ich wusste selbst, dass nett die kleine Schwester von abscheulich war. Aber in diesem Zusammenhang schien es mir die einzig vernünftige Antwort zu sein.
Dad machte ein paar Schritte auf mich zu und ließ den Blick durch das Zimmer gleiten. Einen Moment lang haftete dieser an dem sich lösenden Putz und den Kabeln, die mir einen tödlichen Schlag verpassen konnten, sollte ich jemals auf die Idee kommen, an ihnen herumzuspielen.
Mein Vater ließ sich mir gegenüber auf das Bett sinken. Kurz überlegte ich, ob ich mich dazusetzen sollte, entschied mich allerdings, hier am Fenster zu bleiben. Die frische Luft war genau das, was ich gerade brauchte.
»Ich weiß, du vermisst New York und deine Freunde. Aber glaube mir, Elayne, du wirst hier glücklich werden.« In seiner Stimme lagen so viel Fürsorge und Liebe, dass ich ihm nicht länger böse sein konnte.
»Ich weiß, Dad«, versicherte ich ihm daher. »Es wird nur etwas dauern, ehe ich mich eingewöhnt habe.«
»Ein paar Eimer Farbe würden sicher helfen.« Er presste seine Lippen fest zusammen, woraufhin wir gemeinsam in Gelächter verfielen. Ja, Farbe brauchte diese triste Einöde definitiv.
»Können wir diese Gitterstäbe auch irgendwie loswerden?« Ich deutete hinter mich aufs Fenster und schaute flehend.
Dad überlegte einen Augenblick, dann nickte er. »Das sollten wir hinkriegen.«
»Danke!« Erleichterung durchflutete mich und schlagartig fühlte ich mich wie elektrisiert. Mit etwas Arbeit konnte ich aus dieser Bruchbude sicher eine heimelige Oase schaffen.
Wir schwiegen noch einige Minuten, ehe Dad sich erhob und das Zimmer verließ. Im Türrahmen drehte er sich ein letztes Mal zu mir um und schenkte mir das warme Lächeln, das ich so an ihm liebte. »Willkommen zu Hause.«
Ich lauschte seinen Schritten, die immer leiser wurden. Erst als sie verstummt waren, wagte ich es aufzuatmen und widmete mich wieder dem Fenster. Kopfschüttelnd scannte ich die Umgebung. Als Dad uns von unserem neuen Apartment erzählt hatte, hatte er davon geschwärmt, wie zentral es gelegen sei und dass man vom Fenster aus das beliebte French Quarter von New Orleans sehen könne. Nun, wenn ich mich so weit wie möglich herauslehnte – was aufgrund der Gitter momentan ja nicht funktionierte –, mich nach links drehte und ein Fernglas in die Hand nahm, dann ja. Dann konnte ich vielleicht irgendwo am Horizont auf der anderen Seite des Mississippi River die Lichter des French Quarters wahrnehmen. Dass man aber erst einmal hoch zum Algiers Ferry Terminal und den Fluss mit einer Fähre überqueren musste, das hatte Dad uns natürlich verschwiegen.
Direkt gegenüber von meinem Zimmer lag eine kleine Tankstelle, die aussah wie in jedem Horrorfilm. Es hätte mich nicht gewundert, wäre ein gruseliger Mann in Holzfällerhemd und Latzhose hervorgekommen, hätte auf einem Stück Stroh herumgekaut und verlorenen Autofahrern den genau falschen Weg gezeigt. Den, der sie in ihren sicheren Tod führte.
Ein eisiger Schauer kroch plötzlich meinen Rücken hinab. Mit einem lauten Knall schloss ich das Fenster und wünschte mir meine Gardinen her. Aber ich wusste nicht, in welchem der unzähligen Kartons sich diese befanden. Was ich aber wusste, war, dass ich heute Nacht vermutlich kein Auge zubekommen würde.
***
»Aufwachen!«
Vorsichtig tastete ich nach dem kleinen Kissen, das sich irgendwo auf meinem Bett befinden musste. Als ich es zu greifen bekam, holte ich aus und warf es in Richtung Tür, wo ich meine nervige Schwester vermutete. Sie kicherte lautstark.
»Daneben, daneben!«
Stöhnend rollte ich mich auf den Rücken und öffnete die Lider. Ganz großer Fehler. Die Sonne blendete mich so stark, dass ich die Augen schnell wieder schloss. »Wie spät ist es?«, grummelte ich benommen.
»Acht Uhr!«, rief Grace. Wie konnte man um diese Uhrzeit schon so hellwach und gut gelaunt sein? Ach, ich vergaß. Sie hatte beim Umzug ja keinen Finger krummgemacht und war dementsprechend kein Häufchen Elend. Ich hingegen fühlte mich so gerädert, als hätte mich ein Laster überfahren.
Grace tippelte über den Dielenboden und warf sich zu mir aufs Bett. Manchmal wünschte ich mir, eine große Schwester zu haben anstatt einer zehnjährigen, bei der man meinen könnte, sie trinke den gesamten Tag Energydrinks. Sie wollte immer beschäftigt werden. Und wenn ich immer sagte, dann meinte ich auch immer. So lieb ich sie hatte, sie konnte wirklich anstrengend sein.
»Na warte«, knurrte ich und warf mich auf Grace, die sofort in einen Lachanfall verfiel. Sie kreischte und strampelte wild umher, während ich meine Finger in ihrem Bauch vergrub und sie kitzelte.
»Aufhören!«, quietschte sie, vor Lachen halb erstickend. Aber ich dachte gar nicht daran.
Erst als Mom im Türrahmen erschien und sich gähnend die Rückstände der vergangenen Nacht aus den Augenwinkeln rieb, ließ ich von Grace ab. Unsere Mutter sah noch furchtbarer aus, als ich mich fühlte. Pechschwarze Schatten lagen unter ihren Augen, deren Farbe heute dem tosenden Meer nach einem schrecklichen Sturm ähnelte anstatt eines wolkenlosen Sommerhimmels.
»Morgen, Kinder.« Sie streckte sich ausgiebig, wobei ihre Rückenwirbel knackten. Grace und ich fuhren zeitgleich zusammen und verzogen unsere Gesichter. Mom lachte leise. Sie wusste, wie sehr wir das Geräusch von knackenden Knochen hassten. »Wie wäre es, wenn wir in diesem kleinen Café frühstücken gehen? Das mit den bunten Stühlen, an dem wir gestern vorbeigefahren sind. Wie hieß es noch gleich?« Für einen Moment setzte sie einen grüblerischen Ausdruck auf. »Buttercup – genau!«
»O ja!«, rief Grace vollkommen außer sich und stürmte auch schon aus dem Zimmer, um sich fertig zu machen. Sie war nun in dem Alter, wo sie sich ihre Kleidung selbst aussuchen durfte, was gut und gerne mal in einer sehr skurrilen Zusammenstellung endete.
Zwar schmerzte jede Faser meines Körpers und ich hätte mich am liebsten wieder unter die Bettdecke gekuschelt, aber ich konnte nicht abstreiten, dass auch mich der Hunger plagte. Gestern war ich so schnell eingeschlafen, dass ich nichts mehr gegessen hatte.
Mom stand noch immer bei mir im Zimmer, hatte den Kopf schief gelegt und musterte mich. »Ist alles in Ordnung?«, fragte ich, da ich sie selten so in Gedanken erlebte.
Ruckartig hob sie das Kinn, blinzelte einige Male, als wäre sie durch meine Worte aus ihrem Traum erwacht. »Ja«, murmelte sie. »Ich bin wohl noch nicht ganz wach.«
»Nicht nur du«, erwiderte ich und schwang die Beine über die Bettkante. Als meine nackten Füße den Boden berührten, verzog ich den Mund. Die alten Dielen fühlten sich rau unter meinen Sohlen an. Ich musste nachher dringend meinen flauschigen Teppich suchen, um ihn vors Bett zu legen.
»Ich gehe mal Kaffee kochen. Die Maschine war das Erste, was ich gestern noch aufgestellt habe.« Mom lächelte wissend. In mancher Hinsicht ähnelten wir dem Mutter-Tochter-Duo aus den Gilmore Girls, frei nach dem Motto: Nur Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen! Manchmal dachte ich, das koffeinhaltige Gebräu floss anstelle von Blut durch meine Adern.
Kaum war Mom Richtung Küche aufgebrochen, stürzte ich mich auf den erstbesten Karton und wühlte darin nach frischer Kleidung. Ich jubelte innerlich, als ich ein paar Röcke und Oberteile fand. Das Klima in Louisiana war dem in New York ziemlich ähnlich, wenn es auch im Sommer in unserer neuen Heimat etwas wärmer wurde. Im Grunde konnte ich mich glücklich schätzen, dass wir nicht nach Alaska gezogen waren, sonst hätte ich meinen kompletten Kleiderschrank erneuern müssen.
Ich nahm die Stücke, die ich zuerst zu greifen bekam, und hastete damit in das Badezimmer, das gegenüber meinem Zimmer lag. In unserem Haus auf Long Island hatten wir zwei Bäder zur Verfügung gehabt. Es würde eine enorme Umstellung werden, zu viert eines teilen zu müssen.
Schnell schlüpfte ich aus meinen Schlafsachen und unter die Dusche. Der heiße Strahl fühlte sich wie ein Segen an. Endlich konnte ich mir die Schweißrückstände von Körper und Haaren waschen.
Nachdem ich mich abgetrocknet hatte, wischte ich den beschlagenen Spiegel mit der Handfläche ab und erschrak vor meinem eigenen Abbild. Wie Mom hatte auch ich dunkle Ringe unter den blauen Augen, meine schulterlangen braunen Haare waren schlaff und strähnig.
Während ich mir den Jeansrock überstreifte, der mir gerade bis zu den Knien reichte, und anschließend das geblümte Tanktop über den Kopf zog, drang der himmlische Geruch von Kaffee unter dem Türspalt zu mir hindurch. Schnell kämmte ich mir die Haare mit den Fingern und ließ sie an der Luft trocknen. Es war ein heißer Tag Ende Juni, da lohnte es sich nicht, den Föhn auszupacken.
Ich schlüpfte aus der Tür und in den Flur, von wo aus ich Mom und Dads Stimmen vernahm. Etwas an ihnen irritierte mich. Waren sie normalerweise sehr liebevoll im Umgang miteinander, klangen sie gerade verärgert. Auf Zehenspitzen schlich ich durch den Flur und presste mich dabei fest gegen die Wand, damit sie mich nicht beim Lauschen erwischten.
»Du hast es versprochen, James!« Es hörte sich an, als spräche Mom aus zusammengebissenen Zähnen, zischende Laute, denen einer Schlange ähnlich. »Du sagtest, wir wären hier sicher!«
Was sie wohl damit meinte? Dad schnaubte. Ohne ihn zu sehen, wusste ich, dass er sich gerade durch die Haare fuhr und den Nasenrücken rieb. Das tat er immer, wenn er sich in einer Diskussion mit Mom befand. »Und das sind wir, Beth«, beharrte Dad. »Alles wird gut, ich verspreche es dir.«
Langsame Schritte auf dem Fliesenboden der offenen Wohnküche ertönten, gefolgt von einem flüchtigen Kusslaut.
Mom seufzte.
»Viel Spaß mit den Kindern. Gib ihnen einen Kuss von mir«, sagte Dad, ehe sich seine Schritte entfernten.
Erschrocken fuhr ich zusammen, als mir bewusst wurde, dass er jeden Augenblick in den Flur treten würde. Ich machte einen Satz nach hinten und tat so, als wäre ich eben erst aus dem Bad gekommen.
»Elayne, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit.«
»Okay, bis heute Abend, Dad.« Lächelnd winkte ich ihm, dann trat er auch schon durch die Haustür. Puh, da hatte ich noch einmal Glück gehabt.
Mom stand in der Küche und hatte sich gegen die Arbeitsplatte am Fenster gelehnt. Die Kaffeetasse umklammerte sie fest mit beiden Händen und starrte ins Leere. Auch als ich mir den Hocker des Tresens zurechtschob, der Küche von Wohnbereich trennte, zuckte sie nicht. Mein Blick fiel auf die Zeitung, die direkt vor mir lag.
Ein entsetzter Laut entfuhr mir, als ich die Schlagzeile las: Junge Krankenschwester ermordet aufgefunden. Täter noch auf freiem Fuß. Polizei bittet um Mithilfe.
»Lies das nicht, bitte«, sagte Mom, die wohl aus ihrer Trance erwacht sein musste, und riss mir die Zeitung aus der Hand. Aber es war zu spät, die Worte und auch das Bild hatten sich in meinem Kopf verfestigt. Eine hübsche, blond gelockte Frau, die ihr gesamtes Leben noch vor sich gehabt hatte.
»Wie furchtbar!«, nuschelte ich. Der Schock saß tief. Darüber mussten meine Eltern eben gesprochen haben. Aber im Grunde war es in New York nicht viel sicherer, auch dort gab es etwa dreihundert Mordfälle jährlich.
»Ich bin fertig!«, stieß Grace hervor und riss mich damit aus den Gedanken. Sie hatte sich für einen Rüschenrock und ein glitzerndes Einhornoberteil entschieden.
Mom hielt die Zeitung fest und fing meinen Blick auf. Der ihre besagte, dass wir dieses Thema auf sich beruhen lassen und nicht darüber reden sollten. Ich nippte an meiner Tasse und nickte ihr zu, woraufhin sie lächelte. Unsere telepathische Verbindung funktionierte noch.
»Lasst uns gehen, kommt schon!«, quengelte Grace weiter. Dabei riss sie die braunen Dackelaugen weit auf und zog die Unterlippe schmollend hervor. Die dunkelblonden Haare hingen in zwei Zöpfen rechts und links von ihrem Kopf und baumelten bei jeder Bewegung hin und her. Sie sah Dad unglaublich ähnlich, von Tag zu Tag mehr, während ich, je älter ich wurde, immer mehr Ähnlichkeit mit Mom bekam. Wobei es mir, im Gegensatz zu ihr, nicht vergönnt war, alles in Massen in mich hineinschaufeln zu können, ohne ein Gramm zuzunehmen. Manchmal beneidete ich sie um diese Fähigkeit.
»Schuhe an«, sagte Mom. Das ließ Grace sich kein zweites Mal sagen und sprintete in den Flur. Mit einem letzten Hieb stürzte ich den restlichen Kaffee hinunter und stellte die Tasse zurück auf die Anrichte. Mom legte ihren Arm um meine Schulter und gemeinsam schlenderten wir zu Grace, die bereits halb aus der Tür gestürzt war. Kopfschüttelnd zog auch ich die Schuhe an.
Draußen war es unglaublich warm und das, obwohl es noch so früh am Morgen war. Kaum waren wir aus der Tür, pustete mir die warme Sommerluft ins Gesicht und trocknete meine Haare schneller, als ich Föhn sagen konnte.
Unser Haus lag in Algiers Point, einem eher ruhigen Vorort am Westufer des Mississippi. Hier lebten überwiegend kleinere Familien, hin und wieder ein Pärchen mit Hunden. Viel mehr gab es in unserem Viertel leider Gottes auch nicht zu sehen oder zu erkunden. Wollte man Action, musste man wohl oder übel den Fluss überqueren, um sich in das Nachtleben von New Orleans zu stürzen.
Wir passierten einige Einfamilienhäuser mit hübschen kleinen Vorgärten und frisch gestrichenen Zäunen. Überall sprossen Blumen und verströmten ihren himmlischen Duft. Mir fiel es schwer, die Nase nicht in sämtlichen Blüten zu vergraben und den Geruch des Sommers in mich aufzunehmen.
Grace lief vor, rief uns zwischendurch freudig zu, wenn sie eine Katze auf einem der Grundstücke erspähte. Sie liebte diese flauschigen Vierbeiner, während ich sie bloß duldete. Eigentlich hatten unsere Eltern sich niemals ein Haustier anschaffen wollen, doch Grace war ein Überzeugungstalent und musste lediglich mit ihren dichten Wimpern klimpern, um alles zu bekommen, was ihr Herz begehrte. Schade, dass das Wimpernklimpern bei mir nicht mehr zog, sonst wären wir niemals hier am Arsch der Welt gelandet.
»Hier muss es irgendwo sein«, murmelte Mom. Wir waren an diversen kleineren Bars vorbeigekommen und ich hatte auch schon eine Kunstgalerie zwischen all den kreolischen Häusern gesehen. Aber ein Café? Das hätte ich in meilenweiter Entfernung wohl bereits gerochen. Mom wandte sich mir zu und bedachte mich mit einem drängenden Blick.
Ich stöhnte und zog mein Handy aus der Tasche. Es in die Hand zu nehmen, versetzte mir einen Stich. Bisher waren nur zwei Nachrichten von meiner besten Freundin Beverly bei mir eingegangen. Es schmerzte, dass sich nicht mal Connor bei mir gemeldet hatte, obwohl wir im Guten auseinandergegangen waren.
Doch daran durfte ich nicht denken. Andernfalls würde es mir die Tränen in die Augen treiben – und davon hatte ich genug vergossen, seit Dad uns von unserem erneuten Umzug erzählt hatte. Ja, genau, erneuter Umzug. Es war nicht das erste Mal, dass es uns quer durch die Staaten getrieben hatte. Dad arbeitete für Robexus Technologies, ein aufstrebendes Unternehmen, das sich im Bereich Automations- und Roboterausrüstung einen Namen gemacht hatte. Wann immer ein neuer Standort eröffnete, wurde Dad dorthin geschickt, um die neuen Mitarbeiter anzulernen.
Während der Middle School waren wir deshalb jedes Jahr weggezogen. Mit der Highschool hätte alles anders werden sollen. Dad hatte es mir versprochen. Vier Jahre an einem Ort, damit ich in Ruhe meinen Abschluss absolvieren konnte. Tja, und nun waren wir hier. Mehr als tausend Meilen entfernt von New York.
Mit schnellen Fingern öffnete ich die Karte auf dem Handy und reichte es Mom. Sie sagte andauernd, sie sei nicht technikaffin genug, um ein mobiles Telefon zu bedienen, weshalb es stets meine Aufgabe war, mit dessen Hilfe etwas für sie zu suchen. Ich vermutete eher, dass sie zu faul war, sich einzuarbeiten, oder schlichtweg keine Lust hatte, solange sie mich dafür missbrauchen konnte.
»Nächste Straße rechts abbiegen, Gracey!«, rief Mom meiner Schwester zu, als sie die richtige Straße fand. Grace hob ihren kleinen Daumen in die Höhe und hüpfte weiter. Mom reichte mir das Handy, das ich schnell wieder in meiner kleinen Umhängetasche verstaute. Ich spürte den mitfühlenden Blick, den sie mir zuwarf. Allerdings ignorierte ich diesen und konzentrierte mich stattdessen auf den Weg vor uns.
Das Café war so klein und unscheinbar, dass ich in jedem Fall daran vorbeigelaufen wäre. Vor der Fensterfront standen bunte Plastikstühle an runden Metalltischen, auf dem Schild über der Eingangstür stand in bunten Lettern der Name Buttercup.
Ein Blick hinein offenbarte einen Tresen, in dem es diverse Kuchensorten und andere Backwaren gab. Dahinter stand eine ältere Dame mit Dutt und einer rot-weiß gepunkteten Schürze, an der sie sich die mehlbestäubten Hände abwischte. Als sie den Kopf anhob und uns bemerkte, entblößte sie eine Reihe strahlender Zähne, die selbst aus der Entfernung aussahen wie ihre Dritten.
Ich griff nach dem pastellgrünen Stuhl, um ihn mir zurechtzurücken, da bemerkte ich etwas Klebriges, das daran haftete. »Na toll«, nuschelte ich und betrachtete den Schokoladenfleck, der in meiner Handfläche prangte. »Bestellt mir einen Latte Macchiato und einen Bagel. Ich muss mir mal die Hände waschen.«
Mom rümpfte die Nase, als ich die Hand hob und ihr den Fleck zeigte.
Im Inneren des Cafés roch es nach frisch gebackenen Leckereien und Kaffeebohnen.
»Wie kann ich dir helfen, Liebes?« Eine wohlige Wärme durchzog mich beim melodischen Klang ihrer Stimme. Die Dame machte einen so sympathischen Eindruck, dass man sich einfach wohlfühlen musste.
»Ich müsste mir mal die Hände waschen.« Ich deutete auf den Schokoladenfleck. Sofort zogen sich ihre Brauen zusammen und Sorgenfältchen zierten ihre gealterte Haut.
»O Schreck!«, entfuhr es ihr. Ich musste an Granny denken. Auch sie benutzte diesen Ausruf häufig. Die Frau deutete den schmalen Flur entlang, der neben dem Tresen in einen hinteren Bereich des Ladens führte. »Ich werde sofort noch mal drüberwischen. Bitte verzeih!«
»Schon in Ordnung. Ist ja nichts passiert«, versicherte ich, woraufhin man der freundlichen Dame die Erleichterung deutlich ansah.
Das Badezimmer war kaum größer als eine Abstellkammer und löste ein beklemmendes Gefühl in mir aus. Zwar litt ich nicht direkt unter Platzangst, fühlte mich in größeren Räumen aber deutlich wohler.
Das warme Wasser war belebend und binnen Sekunden fühlte ich mich wieder sauber. Ich griff nach den Papiertüchern, verließ das Bad zügig wieder und trocknete mir die Hände auf dem Weg Richtung Ausgang ab. So in meiner Gedankenwelt vertieft, hielt ich den Blick nach unten gesenkt und merkte zu spät, dass jemand die Tür zum Café geöffnet hatte.
Frontal lief ich in einen stählernen Oberkörper hinein, prallte ab und geriet ins Straucheln. »Hoppla«, hörte ich eine raue Stimme sagen. Zugleich griffen zwei starke Hände um meine Arme. Ich klammerte mich an ihnen fest, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren.
Mist, das war so typisch, dass mir so etwas gleich am ersten Tag in einer neuen Stadt passierte. Als ich hochschaute, um mich bei dem Fremden für die Hilfe zu bedanken, stockte mir der Atem. Kein einziges Wort wollte meine Lippen verlassen. Ich blickte in die schönsten kastanienbraunen Augen, die ich je gesehen hatte. Hauchzarte Striemen, schimmernd wie flüssiges Gold, durchzogen seine Iriden und fesselten mich.
»Danke.« Ob ich gerade wirklich laut gesprochen, wusste ich nicht. Aber ich nutzte die Gelegenheit, mir den mysteriösen Fremden genauer anzuschauen. Sein Gesicht war jugendlich, aufgrund der hohen Wangenknochen und dem Bartschatten allerdings sehr maskulin. Ich schätzte ihn auf etwa achtzehn oder neunzehn Jahre. Sein dichtes schwarzes Haar lud dazu ein, die Finger darin zu vergraben.
Mit der Zunge befeuchtete er die Lippen, die sich verschmitzt kräuselten. »Bekomme ich meine Arme wieder?«
Verdammt, nicht nur starrte ich ihn wie ein verliebter Teenager an, ich krallte mich so stark an ihm fest, dass es ihm unmöglich war, seiner Wege zu gehen.
»Ja, klar«, stammelte ich unbeholfen und ließ von ihm ab. Ich hätte rausgehen und mich zu Mom und Grace setzen sollen, aber meine Beine wollten mir nicht gehorchen, weshalb ich den jungen Mann weiterhin ungeniert angaffte.
»Blake, deine Bestellung ist fertig!«, rief die Dame, von der ich vermutete, dass es sich um die Besitzerin handelte, und stellte eine voll bepackte Tüte auf dem Tresen ab.
Der Fremde nahm die Henkel in die Hand und legte ein paar Scheine hin. Dann wandte er sich mir zu und nickte. »Man sieht sich.« Mit diesen Worten öffnete er die Tür und verschwand so plötzlich, wie er gekommen war.
»Er ist süß, nicht wahr?« Die Dame trat vor und grinste wissend. »Blake kommt jeden Dienstag um diese Zeit her und holt das Frühstück für seine Arbeitskollegen.« Ein weiteres Mal wischte sie sich die Hände ab, ehe sie mir die rechte entgegenstreckte. »Ich bin Lucy, mir gehört der Laden.«
»Elayne«, sagte ich und erwiderte ihren Händedruck.
»Was für ein hübscher Name.« In ihrer Stimme schwang so viel Ehrlichkeit mit, dass ich lächelte. »Seid ihr gerade erst hergezogen? Ich habe euch hier noch nie gesehen.«
Mechanisch nickte ich. »Ja, wir sind erst gestern aus New York angekommen.«
»Oh, New York. Dort wollte ich schon immer mal hin.« Lucy klatschte freudig in die Hände und verfiel in einen Monolog über den Big Apple. Dabei ratterte sie sämtliche Klischees runter, die es über die Stadt gab. Ich belächelte ihre Worte und nickte hier und da aus Höflichkeit. Aber meine Gedanken wanderten immer wieder zu den Kastanienaugen, die ich so schnell wohl nicht wieder vergessen würde.
»Nun habe ich dir ein Ohr abgekaut, tut mir leid«, sagte Lucy lachend. Ich winkte ab und ging zurück zu Mom und Grace.
»Wer war der süße Junge?« Mom war so diskret wie immer. Ich verdrehte die Augen, während Grace kicherte und sich dann wieder dem Bagel auf ihrem Teller widmete.
»Keine Ahnung«, murmelte ich und vermischte Milch und Kaffee meines Latte Macchiato mit dem Strohhalm. »Irgendein Gast.«
»Aha«, flötete Mom.
Ich streckte ihr die Zunge heraus, ehe ich mich zurücklehnte und mich voll und ganz meinem Getränk widmete. Mom konnte mal wieder direkt in meinen Kopf schauen. An Tagen wie heute verfluchte ich es, dass wir uns so nahestanden. Denn mir war bewusst, dass sie mich nachher weiter ausquetschen würde.
Bis dahin genoss ich allerdings das Kopfkino, das in kleinen Bildern vor meinem geistigen Auge ablief. Blake. Er sei jeden Dienstag um diese Uhrzeit hier, hatte Lucy gesagt. Wenn ich es darauf anlegte, konnte ich ihn wiedersehen. Aber war das nicht zu aufdringlich? Immerhin hatten wir kaum ein Wort miteinander gewechselt und ich überlegte, mich wie ein Stalker auf die Lauer zu legen?
Kopfschüttelnd vertrieb ich diesen Gedanken wieder. Nein, ich würde auf das Schicksal vertrauen müssen. Sollte es wollen, dass Blake und ich uns wiedersahen, dann würde es früher oder später schon geschehen.
Mich daran klammernd reckte ich den Kopf gen Himmel und ließ mein Gesicht von der hochstehenden Sonne erwärmen.
KAPITEL 2
»Mom, können wir los?«, rief ich ungeduldig. Seit gefühlten Stunden saß ich auf der Couch und wartete darauf, dass sie fertig wurde. Sie hatte mir versprochen, mich heute auf die andere Flussseite zu begleiten, damit ich das New Orleans sehen konnte, von dem die ganze Welt sprach. Und nicht das langweilige New Orleans mit den kleinen Reihenhäusern, das ich tagtäglich zu sehen bekam und mich bereits nach einer Woche zu Tode langweilte.
Ich hörte ihre Schritte, die zwischen Schlaf- und Badezimmer hin und her flitzten. Mom war eine Perfektionistin, wenn es um ihr Aussehen ging. Zwar versicherten wir ihr andauernd, wie wunderschön sie sei, egal, was sie anzog, aber sie winkte unsere Kommentare immer ab und schob es darauf, dass wir ihre Kinder seien und so etwas sagen mussten. Sie hatte unglaublich lange Beine und hellbraunes Haar, in dem einzelne graue Strähnen zu finden waren, die sie nicht älter wirken ließen, sondern aussahen, als wären sie schon immer dort gewesen. Hinzu kam, dass sie einen unglaublichen Körper hatte. Nie käme man auf die Idee, dass sie im kommenden Jahr zum fünften Mal nullen würde.
»Mom!«, rief ich erneut, nun etwas lauter.
»Sofort!«, erwiderte sie.
Stöhnend stand ich auf und ging im Wohnbereich auf und ab. Als ich am Fenster vorbeikam, fröstelte ich und meine Armhärchen stellten sich auf. Mir wurde ganz plötzlich unbehaglich zumute.
Mein Blick huschte zum Fenster, die Gardinen waren nach rechts und links gezogen, wodurch man die Straße gut überschauen konnte. Mein Herzschlag beschleunigte sich, als ich auf der anderen Straßenseite eine kaum sichtbare Gestalt in den Schatten stehen sah. Erst dachte ich, sie mir eingebildet zu haben, doch die flackernden Bewegungen waren deutlich zu erkennen.
»So, da bin ich.« Mom kam in den Wohnbereich gestöckelt. Ich wandte mich ihr zu und nickte ihr Outfit, ein kleines Schwarzes, anerkennend ab.
»Du siehst toll aus, Mom.« Als ich wieder aus dem Fenster schaute, war die Gestalt aus den Schatten fort, so als wäre sie nie da gewesen. Doch ich wusste es besser. Ich hatte sie gesehen. Oder wollte meine Fantasie mir lediglich einen Streich spielen? Kopfschüttelnd zog ich die Gardinen zu. »Dann los.«
***
Fragend zog er die Brauen zusammen, während er das Mädchen dabei beobachtete, wie es die Gardinen zuzog. Für einen kurzen Augenblick hatte er geglaubt, dass es ihn gesehen hatte. Aber das war unmöglich. Er lag in den Schatten verborgen, war eins mit der Dunkelheit. Auf diesem Planeten wandelte niemand, der in der Lage war, ihn zu erblicken. Niemand, bis auf seinesgleichen.
Dennoch hatten ihre Augen auf ihm geruht, skeptisch, angsterfüllt. Er schüttelte den Kopf, denn er wusste, dass er sich ihren Blick eingebildet haben musste. Vermutlich hatte lediglich das Flackern der Straßenlaterne, die sich vor wenigen Minuten eingeschaltet hatte, ihre Aufmerksamkeit erregt. So musste es gewesen sein.
Doch eines ließ sich nicht abstreiten: Irgendetwas an diesem Mädchen war anders. Er hatte es gespürt, kaum dass es die Schwelle zur Stadt überschritten hatte. Es war, als hätte ein Energiestoß ihn durchzuckt und zum Schaudern gebracht. Ihn, das Wesen der Schatten. Vier Tage hatte es ihn gekostet, herauszufinden, von wem diese Aura ausging. Und selbst dann hatte er noch Bedenken gehabt.
Sie war unscheinbar, unsicher, unwissend. Er fuhr sich mit der rauen Zunge über die Lippen, schnalzte, während er darüber nachdachte, wie er vorgehen sollte. Vollkommen gleich, ob sie wusste, was sie war, es war seine Aufgabe, für Sicherheit zu sorgen. Dafür zu sorgen, dass nichts und niemand ihnen in die Quere kam. Nicht, solange das Ziel in greifbarer Nähe lag und das Erwachen nicht mehr fern war.
Er wusste, was zu tun war, hatte es vom ersten Moment gewusst, in dem er sie erblickt hatte.
Das Mädchen musste sterben.
***
Weil Mom so ewig gebraucht hatte, erreichten wir die andere Seite des Flusses erst, als es schon dunkel war. Das French Quarter war für seine bunt bemalten Häuser mit den verschnörkelten, gusseisernen Balkonen bekannt. Von diesen sah man zu dieser Tageszeit allerdings kaum etwas. Seufzend lehnte ich mich auf dem Beifahrersitz zurück und schaute aus dem Fenster.
»Tut mir leid«, presste Mom zwischen ihren Lippen hervor. »Nächstes Mal beeile ich mich, versprochen.«
Würde sie nicht, das wusste sie genauso gut wie ich. Knapp eine Woche hatte ich mich auf den heutigen Ausflug gefreut, ein Tag, der nur Mom und mir gehören sollte. Dad hatte sich dazu bereit erklärt, bei Grace zu bleiben, die Beine hochzulegen und es sich auf der Couch gemütlich zu machen, während irgendein College-Football-Match im Fernsehen lief.
Wir folgten dem Verlauf der dreispurigen Canal Street, vorbei an hoch gebauten Häusern, deren Dächer ich nur sehen konnte, wenn ich meinen Hals verdrehte. Kurz darauf flachten die Gebäude ab und in jedem von ihnen befand sich ein Geschäft in der unteren Etage. Von Bekleidungsgeschäften über Schnapsläden und Banken gab es hier alles.
Links von uns verliefen die Schienen der berühmt-berüchtigten Canal Streetcar Line. Wir hatten Glück, dass in genau diesem Augenblick eine der knallroten Straßenbahnen mit den senfgelb gestrichenen Tür- und Fensterrahmen an uns vorbeifuhr. Auch Mom schmunzelte, als sie das Gefährt sah, das an einen uralten Schulbus erinnerte.
Bevor wir hierhergezogen waren, hatte ich mich selbstverständlich über New Orleans informiert, auch wenn ich nicht daran glaubte, dass wir lange hier leben würden. Dennoch hatten mich die Architektur und die Nostalgie der Fortbewegungsmittel der Stadt direkt fasziniert.
Zwei Blocks und unzählige hochgewachsene Palmen später bogen wir in die Bourbon Street ab, die besonders für ihr reges Nachtleben bekannt war. Hier reihten sich unzählige Restaurants, Bars und Striplokale aneinander, Gruppen von Feierwütigen schlenderten hintereinander her und vor den Geschäften versuchten Mitarbeiter, die Passanten zu Speisen und Getränken im Ladeninneren zu überreden.
Die Leuchtstoffröhren des Hard Rock Cafés waren bereits von Weitem zu erkennen und luden dazu ein, hineinzugehen und es sich bei einem Burger und Softgetränk bequem zu machen. Was meinen Magen ebenfalls freuen würde. Die orange lackierten Backsteine glänzten, als hätte man ihnen gerade erst einen frischen Anstrich verpasst, und durch die geöffneten Türen konnte ich die bunten Holzpaneele im Inneren des Restaurants sehen. Ich musste unbedingt daran denken, bei der nächstbesten Gelegenheit Beverly eines der Hard-Rock-T-Shirts zu kaufen. Sie besaß mittlerweile eine beträchtliche Sammlung, auch wenn sie nicht jedes der Cafés selbst besucht hatte.
Da die Straße regelrecht überfüllt war, kamen wir lediglich in gemächlichem Tempo voran. Unter anderen Umständen hätte ich mich darüber lautstark beschwert, aber heute nutzte ich die Gelegenheit, um mir jedes noch so kleine Detail der Stadt genauestens einzuprägen.
»Schau mal, Lay!« Ich folgte Moms ausgestrecktem Finger und staunte nicht schlecht. Inmitten des rastlosen Nachtlebens befand sich eine ruhige grüne Oase hinter einem schwarzen schmiedeeisernen Tor, das die Aufschrift New Orleans Musical Legends Park zierte. Vor einem kleinen plätschernden Brunnen standen drei lebensgroße Statuen von Musikern. Da dieses Stadtviertel auch für seine Jazzmusik bekannt war, vermutete ich, dass es sich um Legenden dieser Musikrichtung handelte.
Als wir der Bourbon Street noch länger folgten, ließen wir die Lokale und den Lärmpegel hinter uns. Stattdessen waren nun rechts und links von uns pastellfarbige Ein- und Mehrfamilienhäuser, wie es sie auf unserer Seite des Flusses zu Genüge gab.
»Können wir irgendwo was essen gehen?«, fragte ich Mom mit knurrendem Magen.
»Selbstverständlich«, erwiderte sie lächelnd. »Worauf hast du Lust?«
Während ich überlegte, bog Mom links ab. Da wir uns in einer Einbahnstraße befunden hatten, fuhr sie einen größeren Schlenker über die North Rampart Street vorbei am Louis Armstrong Park, den ich mir unbedingt bald tagsüber anschauen musste, zurück in eine Seitenstraße der Bourbon Street, wo sie den Wagen schließlich parkte.
Kaum waren wir ausgestiegen, zog Mom mit ihrem schwarzen Kleid und den endlosen Beinen sämtliche Blicke auf sich. Bis heute war ich mir nicht sicher, ob sie das überhaupt bemerkte oder es als eine Selbstverständlichkeit abtat, was es in ihrem Alter mitnichten war.
»Wie wäre es gleich hier?« Ich deutete auf ein kleines Restaurant mit ausgeblichenem grünem Schild. Zugegeben, es war keines der schicken Lokale direkt auf der Hauptstraße, doch diese waren um diese Uhrzeit mit Sicherheit so überfüllt, dass es eine Ewigkeit dauern würde, bis wir etwas Essbares hatten. Und bis dahin war ich ganz gewiss eines qualvollen Hungertodes gestorben!
Moms missbilligender Ausdruck war überdeutlich, ich aber verschränkte die Arme vor der Brust und hielt ihrem Blick stand. Dieses Spiel konnten wir, wenn nötig, den restlichen Abend spielen. Sie wusste, dass ich in dieser Hinsicht ausdauernd war.
»Na schön«, gab sie nach und öffnete die Tür.
Das rustikale Äußere setzte sich im Innenraum fort. Laminat bekleidete den Boden, sodass meine Stoffschuhe bei jedem Schritt daran kleben blieben. Das quietschende Geräusch tat sein Übriges und hallte in meinen Ohren wider. Auch wenn das Ambiente vielleicht nicht das schönste war, so roch es doch himmlisch, nach fettigen Pommes und Meerestieren.
»Sicher, dass du hier essen willst?«, fragte Mom leise an mein Ohr.
Ich zuckte mit den Schultern. »Ist doch nett hier.« Es gefiel ihr nicht, aber das war mir ausnahmsweise egal, denn ich brauchte schnellstmöglich etwas im Magen.
Mein Blick fiel auf den langen Steintresen, der aussah wie billiger Marmor und so gar nicht zum Rest der hölzernen Einrichtung passte. Schon allein die ausgeblichene Farbe hob sich vom Grünton ab, der auch im Gastraum die Wände schmückte.
»Kommen Sie rein, kommen Sie rein, setzen Sie sich.« Ein rundlicher Mann kam auf uns zu, wischte sich die Hände an dem Geschirrtuch ab, das er in den Bund seiner zu eng sitzenden Hose gestopft hatte, und legte uns die Speisekarten auf einen Tisch am Fenster. Dieses war allerdings von einer so dicken Staubschicht verdreckt, dass man kaum hinausgucken konnte.
O Mann, vielleicht sollten wir uns doch ein anderes Restaurant suchen? Genau in diesem Augenblick meldete mein rumorender Magen sich zu Wort und rebellierte gegen diesen Gedanken. Na schön, wenn mein Magen etwas wollte, dann war es sinnlos, sich dagegen zur Wehr zu setzen.
»Schnaps aufs Haus!«, sagte der Mann und stellte uns jedem ein kleines Glas mit einer übel riechenden alkoholischen Flüssigkeit vor die Nase. Bevor wir dankend ablehnen konnten, war er auch schon wieder verschwunden.
»In New Orleans scheint man das mit dem Alkoholverbot vor einundzwanzig wohl nicht sonderlich ernst zu nehmen«, murmelte Mom und beäugte mich tadelnd. Dennoch hob sie ihr Glas an. »Ausnahmsweise. Aber erzähl Dad nichts davon.«
Als sie mir zuzwinkerte, erhob auch ich mein Glas und stieß mit Mom an. In drei Monaten war mein achtzehnter Geburtstag. Es wäre also gelogen, zu behaupten, ich hätte nie zuvor Alkohol getrunken. Nichtsdestotrotz brannte die bräunliche Flüssigkeit in meiner Kehle so stark, als hätte ich loderndes Feuer geschluckt. Ich hustete und zu meiner Überraschung verzog auch Mom angewidert den Mund.
»Bäh, war das abartig!«
Mom lachte. »Wem sagst du das!«
Kurz darauf trat der Mann wieder an unseren Tisch und fragte, ob uns der Schnaps geschmeckt habe. Als wir der Höflichkeit halber bejahten, war er schon drauf und dran, nachzuschenken. Es gelang Mom, ihm freundlich, aber bestimmt zu erklären, dass sie noch fahren müsse und ich noch minderjährig sei. Er schaute mich mit großen Augen an und murmelte etwas vor sich hin, das klang, als würde er zu allen Göttern beten, nicht in die Hölle zu kommen. Nur mit größter Mühe konnte ich mir ein Kichern verkneifen.
Die Alkoholgesetze in den Staaten waren sehr streng, allerdings war das French Quarter einer der wenigen Orte, an denen man sich öffentlich betrinken durfte, ohne seine Flaschen in braunen Papiertüten verstecken zu müssen. Daher vermutete ich, dass man bei einem kleinen Schnaps durchaus ein Auge zudrücken konnte.
Wir gaben schnell unsere Bestellung auf, ehe der Kellner sich wieder aus dem Staub machen konnte, und warteten entspannt auf unser Essen. Da neben uns lediglich ein weiterer Tisch im Restaurant belegt war, dauerte es nicht lange, bis ein dampfendes Silbertablett mit unterschiedlichen Meerestieren vor uns hingestellt wurde.
Frittierter Fisch, gefüllte Austern, Krebse, Knoblauchbrot mit Aioli und eine Schüssel Pommes, gemischt mit Curley Fries und Chili Cheese Sticks, wartete darauf, von uns vertilgt zu werden. Nun knurrte selbst Mom der Magen so laut, dass sie peinlich berührt den Kopf einzog, um sich dann über das Essen herzumachen.
Hemmungslos schlangen wir und aßen wie die Tiere, was uns egal war. Es war noch um einiges köstlicher, als es aussah. Dieses kleine und unauffällige Restaurant hatte gute Chancen, mein liebstes Fischlokal der Stadt zu werden. Dies war zwar das erste, das wir ausprobiert hatten, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo bessere Austern finden würde.
»Ich würde so gerne dieses Essen heiraten, Babys mit ihm machen und diese auch essen«, flötete Mom, nachdem sie eine weitere Muschel ausgeschlurft hatte.
Ich prustete, musste mir die Hand vor den Mund halten, um nicht alles auszuspucken. »Das ist makaber! Du kannst doch nicht deine Kinder essen!«
»Wenn sie so köstlich sind, dann bleibt mir nichts anderes übrig! Außerdem gibt es in unserem ökologischen System viele Lebewesen, die ihre Neugeborenen töten oder essen!«, beharrte sie.
»Mom!«, sagte ich halb lachend. Sie war unverbesserlich.
Je später es wurde, desto mehr füllte sich das Lokal. Wir hatten mittlerweile aufgegessen, blieben allerdings sitzen, unterhielten uns und lachten ausgelassen. Für einen kurzen Moment war es mir sogar gelungen, den Gedanken an New York zu verdrängen.
Im Hintergrund ertönte leise Musik aus dem Radio. Mom war mit dem Nachbartisch in ein Gespräch darüber verwickelt, welche Orte man sich in der Stadt unbedingt anschauen musste. Da ich mich aber schon vorab erkundigt und sogar einen Reiseführer wie ein Tourist gekauft hatte, waren mir die meisten der Informationen nicht neu. Na ja, im Grunde waren wir bei unseren stetig kurzen Aufenthalten ohnehin nichts weiter als Touristen.
Ich versuchte, auf der anderen Seite der verschmutzten Scheibe etwas zu erkennen, um am nimmermüden Treiben teilzuhaben, wenn auch nur aus der Entfernung. Mittlerweile musste es kurz vor Mitternacht sein. Der abnehmende Mond warf seinen Schein auf die ruhige Seitenstraße und ließ sie in einem schummerigen, beinahe gespenstischen Licht erscheinen.
Mit zusammengekniffenen Augen starrte ich hinaus in die Dunkelheit und hielt in meiner Bewegung inne. Ein heruntergekommenes Haus lag dem Fischlokal gegenüber. Es stand leer – lediglich eine schwach leuchtende Laterne baumelte von der Balustrade und warf einen kümmerlichen Lichtkegel auf die Baracke. Was meine Aufmerksamkeit allerdings erregte, war die hagere Gestalt, die Schutz in den Schatten suchte, sich von ihnen einhüllen ließ, bis sie beinahe in ihnen verschwand. Beklommenheit stieg in mir auf und schnürte mir die Kehle zu. Wie vorhin wurde ich den Eindruck nicht los, dass wer auch immer sich dort drüben befand, mich beobachtete.
Ich schüttelte das bedrohliche Gefühl ab und wandte mich wieder dem Gespräch zu. Doch es war mir unmöglich, mich auf das Gesagte zu konzentrieren. Irgendetwas in dieser Stadt ging nicht mit rechten Dingen vor sich. Ob ich das glaubte, weil ich mir viel über die Gruseltouren durchgelesen hatte, die sowohl für Touristen als auch für Einheimische angeboten wurden? Möglich. Ob ich glaubte, dass an den Mythen und Legenden etwas dran war, die es über das sagenumwobene New Orleans gab? Niemals. Es musste also einen anderen Grund dafür geben, dass mir andauernd mulmig zumute war. Vielleicht lag es auch einfach an diesem Zeitungsartikel. Bisher hatte es keine neuen Informationen bezüglich des Mordfalls gegeben. Also rannte dieser Verrückte noch immer durch die Straßen. Verdammt, ich sollte nicht an solche Dinge denken.
»Ist alles in Ordnung, Elayne? Du bist so blass«, bemerkte Mom.
»Alles okay«, versicherte ich ihr und warf erneut einen Blick aus dem Fenster. Von der Gestalt war nichts mehr zu sehen, weshalb ich den bis eben angehaltenen Atem ausstieß. Ich setzte auf meine geistige To-do-Liste, mir in Zukunft keine Horrorfilme mehr anzuschauen und aufzuhören, gruselige Gestalten zu sehen, wo keine waren.
Mom atmete erleichtert auf und lachte leise. »Gut, ich dachte schon, du hättest einen Geist gesehen.« Unsere Tischnachbarn fielen in das Gelächter mit ein, aber mir war absolut nicht danach zumute. Ein stechender Schmerz setzte sich in meinen Kopf fest und ein Schwindelgefühl überkam mich. Vielleicht bekamen mir die Meerestiere nicht sonderlich gut.
»Ich glaube, ich brauche doch etwas frische Luft.«
Sorgenvoll legte Mom die Stirn in Falten. »Ich zahle nur schnell und dann können wir aufbrechen.«
Ich winkte schnell ab. »Ach, das ist nicht nötig. Bleib ruhig sitzen, ich bin gleich wieder da.«
»Bist du sicher?«, fragte Mom. »Es ist dunkel und du kennst dich hier nicht aus. Mir ist nicht wohl dabei –«
»Mom, ich bin siebzehn Jahre alt und in der Lage, Google Maps zu benutzen«, erwiderte ich und wedelte mit meinem Handy vor ihrem Gesicht herum. »Gib mir zehn Minuten, dann geht es mir sicher besser. Ich wollte Beverly ohnehin eines der Hard-Rock-Café-T-Shirts kaufen. Der Laden ist ja nur zwei Ecken weiter. Und sollte mir doch zu schwindelig werden, dann rufe ich dich kurz an und du kommst mich holen.«
Ich musste mich anhören wie ein quengelndes Kleinkind. Allerdings fühlte ich mich manchmal genau so. Mom und Dad hatten mich schon immer vor der großen, weiten Welt beschützen wollen. Aber ich war beinahe erwachsen, würde nächstes Jahr aufs College gehen, wo man mich ohne Vorlaufzeit in die Selbstständigkeit zwang. Es wäre nicht verkehrt, mir insoweit zu vertrauen, dass ich mir allein die Beine vertreten konnte.
Man konnte Mom ansehen, wie sie mit sich rang. Sie wusste, dass ich recht hatte. Was sollte mir innerhalb so kurzer Zeit schon passieren?
»Schön«, stieß sie hervor. »Aber beeil dich und komm auf direktem Weg zurück.«
Ich verstand nicht, wie Mom sich an manchen Tagen verhalten konnte, als wäre sie meine beste Freundin, und an wieder anderen Tagen, als würde sie mich am liebsten am nächsten Stuhl festketten.
Ehe sie es sich anders überlegen konnte, stand ich auf, lehnte mich vornüber, um Mom einen Kuss auf die Wange zu geben, griff nach meiner Handtasche und verschwand durch die Tür. Selbst die Nachtluft war noch angenehm warm. Es dauerte nicht lange, ehe der Schwindel sich verflüchtigte und der stechende Schmerz einem leichten Pochen wich.
Zahlreiche Menschen waren unterwegs, grölten in ihrem alkoholisierten Zustand und unterhielten damit selbst die Anwohner, die am anderen Ende des Viertels wohnten. Betrunkene konnten sich wie richtige Armleuchter benehmen. Zwei junge Männer kamen näher, rempelten mich beinahe an und pusteten mir ihren Alkoholatem ins Gesicht, der meinen Magen wieder Samba tanzen ließ. Abartig!
Unwillkürlich lief ich schneller, schlang das geblümte Jäckchen fester um meinen Oberkörper und fixierte die Pflastersteine vor mir. Wie in jüngeren Jahren versuchte ich dabei, die Rillen nicht zu betreten, was mir bei den kleineren Steinen mehr schlecht als recht gelang.
Während ich mich umschaute, sah ich die zahlreichen kleinen Gassen, die von den Straßen abgingen und eine ruhigere Alternative zu den überfüllten Bordsteinen boten. Seufzend blieb ich vor einer von ihnen stehen und schaute hinein. In wenigen Metern Abstand zueinander hingen verschnörkelte Laternen an den Mauern. Diese spendeten ausreichend Licht, um sich nicht unwohl zu fühlen, ging man dort entlang. Zudem konnte ich die Parallelstraße sehen, wenn auch in einiger Entfernung. Nichtsdestotrotz war es mir lieber, einen entspannteren Weg einzuschlagen, als mich zwischen schweißgetränkten Körpern hindurchzuquetschen.
»Was soll schon passieren?«, flüsterte ich mir selbst zu. Zum einen würde ich sehen, sollte mir jemand entgegenkommen, und dann konnte ich immer noch wieder umdrehen. Zum anderen konnte ich Taekwondo, weshalb ich durchaus in der Lage war, mich zu verteidigen. Das musste man Mom und Dad lassen, sie hatten wirklich alles getan, um für meinen Schutz zu sorgen.
Früher war ich undankbar gewesen und hatte lieber zum Reit- oder Klavierunterricht gehen wollen. Stattdessen war ich gezwungen worden, Kampfsport zu machen, damit ich auf mich aufpassen konnte. Dad hatte mich sogar zum Schießen und Paintballspielen mitgenommen, um mich den Umgang mit Waffen zu lehren. Keine Ahnung, ob meine Eltern dachten, ich würde eines Tages in den Krieg ziehen müssen. Heute war ich ihnen allerdings dankbar, mich nicht in eine klischeehafte Mädchenrolle gepresst zu haben.
Meine dumpfen Schritte hallten von den hohen Steinwänden wider und begleiteten mich auf meinem spärlich beleuchteten Weg. In meinem Kopf summte ich eines meiner Lieblingslieder: Wherever you will go von The Calling. Es spendete mir Trost und erinnerte mich an Beverly, denn durch diesen Song hatten wir uns erst wirklich kennengelernt.
Es war auf der Geburtstagsfeier eines unserer Klassenkameraden gewesen. Wir waren in einer Karaokebar gewesen, via Losverfahren in willkürliche Teams gesteckt worden, und hatten dann gemeinsam ein vorgegebenes Lied schmettern müssen. So kam es, dass Bev und ich ein Team gebildet und die Rockballade von The Calling gesungen hatten. Wobei »krächzen« es besser traf.
Bei dieser Erinnerung, die nun knapp drei Jahre zurücklag, sammelten sich die Tränen hinter meinen Lidern. Es gelang mir gerade so, sie hinfortzublinzeln. Es schmerzte, wie sehr meine beste Freundin mir fehlte. Hinzu kam, dass das letzte Highschooljahr erst in einigen Wochen beginnen würde und keine Ahnung hatte, wie oder wo ich während der Sommerferien Anschluss finden sollte.
»Weine nicht.« Eine tiefe Stimme drang an meine Ohren. Sie ging mir durch Mark und Bein, ließ mich erschaudern. Instinktiv beschleunigte sich meine Atmung. Mein Herzschlag wummerte in meiner Brust. Ich sollte weitergehen und ignorieren, dass allem Anschein nach jemand hinter mir lief und mein Schniefen gehört hatte. Aber irgendetwas hielt mich zurück. Ein innerer Trieb, der mich zwang, stehen zu bleiben und mich umzudrehen.
»Wer ist da?«, fragte ich, während ich mich umwandte. Ich war überrascht, wie fest meine Stimme klang, obwohl alles in mir panisch aufschreien wollte. Es war niemand zu sehen. Lediglich die Laternen flackerten auf.
Ein lautes Bersten ertönte, ich warf mich zu Boden, legte die Hände schützend über den Kopf. Dann klirrte es ein weiteres Mal und noch ein Mal, bis auch die letzte Glühbirne zersprungen und die Gasse in tiefe Dunkelheit getaucht war.
Scheiße, was war das?
Schnell rappelte ich mich auf und rannte los. Das Blut rauschte durch meinen Körper, Adrenalin füllte mich komplett aus. Schweiß perlte von meiner Stirn, brannte mir in den Augen, aber das war egal. Nur noch wenige Meter trennten mich von der Sicherheit der Menschenmengen, die ich eben noch so sehr verachtet hatte. Nun gab es nichts, was ich mir sehnlicher wünschte, als mich unter die Feiernden zu mischen.
Gerade als ich zu einem Hilferuf ansetzte, legte sich etwas um meine Knöchel und riss mich von den Füßen. Ich landete hart auf meiner Vorderseite. Mein gesamter Körper pochte vor Schmerz. Eine klebrige Flüssigkeit tropfte von meinem linken Ellbogen – Blut, wie ich feststellte. Mit der rechten Hand hatte ich versucht, den Sturz abzufangen und mir die Innenfläche aufgeschürft. Es brannte höllisch.
Ein Schwindelgefühl überkam mich, als ich mich aufrichten wollte. Augenblicklich sackte ich wieder zusammen, robbte nach vorne und drehte mich keuchend auf den Rücken. Alles über mir drehte sich wie flimmernde, tanzende Sterne.
Dann bäumte sich etwas über mir auf.
Jemand.
Doch die Benommenheit hatte mich noch fest im Griff. Ich konnte lediglich die Konturen einer schemenhaften Gestalt erkennen. Ich streckte den Arm nach ihr aus, um mich irgendwo festzuhalten und mich aufzusetzen. Als meine Fingerspitzen die Haut der Person, des Wesens ertasteten, entfuhr mir ein kehliger Laut. Röchelnd drehte ich mich auf die Seite, hustete und würgte, bis ein Schwall Erbrochenes den Asphalt tränkte. Mit dem Ärmel wischte ich mir über den Mund, blinzelte einige Male und flüsterte mir einige Worte wie ein Mantra zu. »Das ist nicht real.«
»Glaube es ruhig«, sagte die dunkle Stimme, deren tiefer Bariton alles in mir zum Vibrieren brachte. »Elayne Marianne Whittaker.«
»Was zum Teufel bist du? Und woher kennst du meinen Namen?« Ich wandte mich der Stimme zu, kniff die Lider zusammen, bis sich das Bild vor mir aufklärte. Augen, rot leuchtend wie das Höllenfeuer, schauten mich an. Scharfkantige Zähne ragten aus dem schiefen Maul und spitze Ohren von dem haarigen Kopf.
Die Kreatur war etwas größer als ich, hatte eine gekrümmte Haltung und ledrige Haut. Speichel floss in Rinnsalen aus ihrem Maul heraus, während sie mich musterte, als wäre ich die Zirkusattraktion. Ich zitterte unkontrolliert. Was auch immer das da war, es musste direkt aus dem Jenseits stammen.
»Interessant«, knurrte es, wobei ein lang gezogener Sabberfaden von seinem Schneidezahn herunterhing, sodass mir die Galle erneut emporstieg.
»Was willst du von mir?« Es waren die einzigen Worte, die ich mich zu sagen imstande fühlte.
Mit einer schnellen Bewegung griff die Kreatur hinter sich und zückte einen silbernen Dolch, den sie mir an die Kehle legte.
»Ich will, dass du stirbst, Elayne«, presste es hervor. Ich meinte, ein Lächeln in seiner Stimme zu hören, was ich mir sicher einbildete. Mit der Gewissheit, die nächsten Minuten nicht zu überleben, schloss ich die Lider und rief mir die Gesichter meiner Eltern und von Grace vor Augen, klammerte mich an jeden ihrer Züge, an ihr helles Lachen, das den regnerischsten Herbsttag erleuchtete, dachte an Beverly, die sich unter Tränen von mir verabschiedet hatte, und an Connor, den Jungen, der mir fast jedes meiner ersten Male gestohlen und sich seit meiner Abreise nicht gemeldet hatte.
Die Klinge wurde fester an meine Kehle gedrückt. Das war es also. So würde mein Ende aussehen.
Ein ohrenbetäubender Siegesschrei ging von der Kreatur aus, als sie die Klinge durchzog, um mich zu töten.
KAPITEL 3
Ich wartete auf den alles verzehrenden Schmerz, doch er blieb aus. Um mich herum war es viel zu still. Vielleicht war ich bereits tot? Vorsichtig versuchte ich, die Lider zu heben, aber alles in mir ächzte. Im Tod litt man sicher nicht solche Höllenqualen.
»Pass auf, nicht so schnell«, sagte eine Männerstimme. Sie war sanft und stand in komplettem Gegensatz zu der Stimme der finsteren Kreatur, die mich eben angegriffen hatte. Ein weiteres Mal versuchte ich, die Augen zu öffnen, bereute es allerdings sofort. Erneut begann sich alles zu drehen und das Schwindelgefühl setzte sich in meinem Kopf fest. Zwei starke Arme richteten mich auf und ließen erst von mir ab, als ich mit dem Rücken gegen die von den Sonnenstrahlen noch aufgewärmte Mauer lehnte.
»Wie fühlst du dich?« Besorgnis lag in der Stimme des Fremden, die irgendetwas in mir auslöste. Der Klang war mir vertraut, fühlte sich gewissermaßen nach Heimat an. Ich schnaufte über meine eigenen lächerlichen Gedanken.
»Scheiße«, entfuhr mir die Antwort auf seine Frage. Ein raues Lachen ertönte.
Ich hörte, wie der Fremde eine Flasche aufschraubte, die er mir vorsichtig in die Hand legte. »Trink das. Du hast ziemlich was abbekommen.«