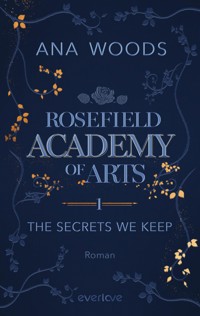9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die »Make a Difference«-Dilogie von Ana Woods rund um die beiden Freundinnen Holly und Kim berührt Herzen und spricht wichtige Themen der Fridays-For-Future-Generation an! Nach dem Tod ihrer Großmutter erfährt Holly, dass sie Teilerbin der Familienranch in Texas ist. Sie möchte diese verkaufen, doch der zweite Erbe ist ausgerechnet Scott – Erzfeind ihrer Jugend –, und er hat andere Pläne. Er möchte die Ranch zu einer Wildtierauffangstation ausbauen. Holly lässt sich überzeugen und muss feststellen, dass aus dem frechen Jungen von damals ein sympathischer Mann geworden ist. Während der Renovierungsarbeiten kommen die beiden sich näher, doch ihre Pläne werden immer wieder durchkreuzt, und plötzlich steht alles auf dem Spiel, was sie sich aufgebaut haben ... Ana Woods erzählt gefühlvoll eine Liebesgeschichte, die so facettenreich ist wie unsere Tierwelt. Romantik, Wortgefechte und Aktivismus – so geht moderne Romance Die Make a Difference-Reihe von Ana Woods: - Finding Paradise - Weil ich dir vertraue
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.everlove-verlag.de
Wenn dir dieser Roman gefallen hat, schreib uns unter Nennung des Titels »Finding Home – Weil du alles für mich bist« an [email protected], und wir empfehlen dir gerne vergleichbare Bücher.
Für meine Schreibmädels Maja & Rune
Ohne euch hätte ich schon vor Jahren das Handtuch geworfen.
© everlove, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Playlist
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Playlist
James Morrison & Nelly Furtado
Broken strings
Engelbert Humperdinck
Can’t take my eyes off you
Katy Perry
Firework
Plested
First time
Calum Scott
Heaven
Usher
His mistakes
McFly
Home is where the heart is
The Proclaimers
I’m gonna be (500 miles)
Brett Young
In case you didn’t know
P!nk & Nate Ruess
Just give me a reason
Josh Abbott Band & Kacey Musgraves
Oh, tonight
Miley Cyrus
Party in the U. S. A.
Ed Sheeran
Photograph
Gabrielle Aplin
Please don’t say you love me
Shawn Mendes & Tainy
Summer of love
Faith Hill
The lucky one
Tim McGraw & Faith Hill
The rest of our life
The Calling
Wherever you will go
Prolog
Noch während ich den Auslöser drückte, wusste ich, dass dies das letzte Bild sein würde. Mom und Meemaw hatten sich früher schon oft gezofft, aber dieses Mal war der Streit so sehr eskaliert, dass Mom entschieden hatte, Bibury auf der Stelle zu verlassen.
Quälend langsam kam die kleine Fotografie aus der Sofortbildkamera. Es dauerte einige Sekunden, ehe der Grauschleier verschwand und einzelne Farben sichtbar wurden, die sich miteinander vermischten und das Abbild meines Motivs offenbarten.
Mom, wie sie den letzten Koffer in den Wagen hievte, und Meemaw, die auf der Veranda stand und ihre Kaffeetasse fest umklammerte. Hinter ihr die hölzerne Fassade des Wohnhauses, über dem die Sonne aufging und den Sand in ein Spiegelbild von kochender Lava verwandelte.
Wehmütig schaute ich vom Foto hoch und ließ den Blick über die Ranch schweifen. Die Ranch, die mein ganzes Leben mein zweites Zuhause gewesen war.
Seit ich denken konnte, hatten wir die Sommer hier verbracht. Aber schon seit geraumer Zeit hatte Spannung in der Luft gelegen, die gestern ihren Höhepunkt erreicht hatte. Ich hatte versucht, Mom dazu zu bringen, ihre Entscheidung zu überdenken, aber keine Chance. Nun blieb mir nichts anderes übrig, als für sie da zu sein. So wie sie es schon immer für mich war.
»Bist du so weit?« Mit einem lauten Knallen schloss Mom den Kofferraum und schob sich eine lose Strähne hinters Ohr. Ein trauriges Lächeln zierte ihre Lippen.
Ich nickte. »Ja, natürlich.« Das war eine Lüge, aber ich brachte es nicht über mich, ihr zu sagen, wie sehr es mich schmerzte, zu gehen. Also zwang ich stattdessen meine Beine dazu, in ihre Richtung zu laufen.
»Verabschiede dich von deiner Großmutter«, sagte Mom, als ich bei ihr ankam. Die wenigen Meter bis zur Veranda erschienen mir endlos. Meemaws Unterlippe bebte, und ich spürte ein Brennen in meinen Augen. Sie zog mich in eine feste Umarmung. Dass ihr Kaffee dabei überschwappte und meine dünne Strickjacke tränkte, war egal.
»Du wirst mir fehlen, Meemaw«, hauchte ich in ihre Haare. Sie rochen nach dem Lavendelshampoo, das sie schon immer benutzt hatte.
»Wir sehen uns bald wieder.« Es war ein Versprechen. Als Meemaw von mir abließ, wischte sie mir eine einzelne Träne von der Wange. Ihre blassgrünen Augen waren glasig, aber sie hatte ihre Gefühle besser unter Kontrolle als ich. »Ich bin so stolz auf dich, Holly.«
Meine Mundwinkel hoben sich, aber ich war nicht in der Lage, etwas zu erwidern. Also drückte ich ihr lediglich das kleine Foto in die Hand, wendete mich ab und ging zum Wagen, in dem Mom bereits auf mich wartete. Bevor ich einstieg, drehte ich mich noch einmal zu Meemaw und hob die Hand zum Abschied. Dieses Bild prägte ich mir auch ohne Kamera ein.
Ich setzte mich auf den Beifahrersitz und schloss die Tür. Mom schaute mich nicht an. Stattdessen hatte sie die Lippen aufeinandergepresst und den Blick starr geradeaus gerichtet. Einen Moment später fuhr sie los. Die Pierson Ranch wurde immer kleiner, bis sie schließlich gänzlich aus meinem Sichtfeld verschwand. Und ich wusste, dass ich nicht so bald zurückkehren würde.
Kapitel 1
Fotografien waren wie Zeitreisen. Ein Blick darauf genügte, um die Erinnerungen der Vergangenheit wieder hervorzurufen.
Behutsam strich ich über den verschnörkelten Bilderrahmen, auf dem sich eine hauchdünne Staubschicht abgesetzt hatte. Meemaw hatte das Foto behalten. Das Foto, das ich an unserem letzten Tag hier in Bibury geschossen und ihr zum Abschied gegeben hatte.
Ich presste die Lider zusammen und atmete tief durch. Dann stellte ich den Rahmen zurück an seinen Platz auf dem Kaminsims. Dort, wo unzählige Erinnerungen aus Meemaws gesamtem Leben zu finden waren. Es waren Bilder von Gramps oder Mom und mir. Einige waren hier in Bibury aufgenommen worden, aber manche hatten wir ihnen auch per Post geschickt. Zu Geburtstagen oder anderen besonderen Anlässen. Jedes davon hatte einen einzigartigen bunten Rahmen erhalten. Farblich passten sie nicht zusammen, aber das war typisch für Meemaw.
Ich musste lächeln, als ich das Bild von mir auf Jellys Rücken sah. Er war mein erstes Pony gewesen. Nun ja, im Grunde gehörte er nicht mir, aber wann immer ich zu Besuch in Bibury gewesen war, hatte ich mich auf seinen Rücken geschwungen und ein paar Runden gedreht. So lange, bis ich groß genug war, um auf einem echten Pferd zu sitzen, mit dem ich ausreiten konnte. Ich erinnerte mich gern an diese Tage zurück.
Das beständige Ticken der Wanduhr brachte mich zurück in die Gegenwart. Mom und ich waren gestern erst spät angekommen und augenblicklich ins Bett gefallen. Erst jetzt hatte ich die Gelegenheit, durch das Haus zu streifen und den bekannten und zugleich schmerzlich vermissten Duft in mich aufzunehmen. Eine Mischung aus Holz und Lavendel, die mir ein zaghaftes Lächeln auf die Lippen zauberte.
Als ich die ausgeblichenen beigen Gardinen zurückzog, wurde das Zimmer von der Mittagssonne erhellt. Einzelne Staubpartikel tanzten in dem sanften Schein. Zwar war ich kein sonderlich ordentlicher Mensch, dennoch setzte ich es auf meine geistige To-do-Liste, das Haus nachher zu putzen. Meemaw hatte es immer gern sauber und aufgeräumt. Wenigstens das konnte ich für sie tun. Jetzt, da sie nicht mehr bei uns war.
Ich ging in die angrenzende Küche, auf deren Anrichte eine Thermoskanne heißen Kaffees bereits auf mich wartete. Mom musste ihn mir vorbereitet haben, ehe sie aufgebrochen war. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und holte eine Tasse aus dem Schrank. Wie der Großteil der Einrichtung bestand auch die Küche aus hellem Holz. Die Scharniere der Türen hatten teilweise bereits Rost angesetzt, und die Farbe war an vielen Stellen abgeblättert. Doch sie war noch funktionstüchtig.
Mit dem Kaffee gewappnet, setzte ich mich auf einen der Hocker am kleinen Tresen. Eine texanische Tageszeitung lag darauf, die ich aber nur halbherzig durchblätterte. Ich hatte einfach nicht den Kopf für Nachrichten.
In wenigen Tagen sollte die Beerdigung stattfinden, und bis dahin gab es noch einige Dinge zu erledigen. Wir hatten zahlreiche Termine vereinbart, die wir nun nach und nach abklapperten. In drei Stunden musste ich bei Mrs Wallace sein, um das Blumenarrangement auszuwählen. Es sollte ein Liegestrauß in Meemaws Lieblingsfarben werden – Creme und Lila.
Währenddessen wollte Mom mit Pfarrer Mitchell die Trauerfeier durchgehen. Es wurden viele Gäste erwartet, und jeder, der wollte, sollte die Möglichkeit bekommen, ein paar letzte Worte zu sprechen.
Ich warf einen Blick aus dem kleinen Fenster über der Spüle. Es war merkwürdig, hier zu sein. Nicht nur auf der Ranch ohne Meemaw, sondern in Bibury. Seit dem Streit vor acht Jahren war ich nicht mehr hier gewesen. Wie immer war es damals um die Übernahme der Ranch gegangen. Meemaw hatte gewollt, dass diese im Besitz unserer Familie blieb, da schon mehrere Generationen vor ihr viel Geld und Arbeit in die Pierson Ranch investiert hatten. Davon wollte Mom allerdings nichts wissen. Für sie wäre es unvorstellbar gewesen, zurück nach Bibury zu ziehen und den Hof zu führen, und auch ich hatte mir für mein Leben immer etwas anderes vorgestellt. Ich wollte die Welt erkunden und die wundersamsten Orte unseres Planeten mit der Kamera einfangen.
Da Meemaw bis auf Mom und mich aber keine näheren Verwandten hatte, hatte sie immer wieder auf Mom eingeredet, bis das Ganze schließlich eskaliert war. Es wurden Dinge gesagt, die besser ungesagt geblieben wären, Tränen waren geflossen, und Türen wurden geknallt. Ich würde diesen Tag mit Sicherheit nie vergessen.
Mom und Meemaw hatten sich zwar vor einigen Jahren langsam wieder angenähert, und sie hatte uns vorletzte Weihnachten über die Feiertage in Los Angeles besucht, aber seit jenem Tag war nichts mehr wie vorher gewesen. Es war schön, dass die beiden vor Meemaws Tod ihre Streitigkeiten beiseiteschieben und einander all das Gesagte vergeben konnten. Trotzdem hätte ich gern noch einen Sommer auf der Ranch verbracht. Mit Mom und Meemaw. Wir alle gemeinsam. Als Familie.
Vielleicht sogar mit Kim, um ihr noch einmal zu zeigen, wie schön das Leben an einem Ort wie Bibury sein konnte. Bei dem Gedanken an meine beste Freundin wurde mir schwer ums Herz. Seit wir uns vor fünfzehn Jahren kennengelernt hatten, waren wir nie länger als ein paar Tage voneinander getrennt gewesen.
Eigentlich hätte ich jetzt zusammen mit ihr auf Jeopardy Island sein sollen, einem exotischen Inselparadies im Indischen Ozean. Lange hatten wir uns auf den einmonatigen Abenteuerurlaub im Survival-Camp gefreut. Aufgrund von Meemaws plötzlichem Tod konnte ich allerdings nicht mitgehen.
Für mich wäre Kim geblieben und hätte Mom und mich nach Bibury begleitet. Sosehr ich es mir auch gewünscht hätte, sie in dieser schwierigen Zeit an meiner Seite zu haben, ich hätte es mir nicht verzeihen können. Wenn jemand diesen Trip dringend nötig hatte, dann war es Kim.
Während ich in unserer Freundschaft der Wirbelwind war, der nur Chaos mit sich brachte, war Kim die pure Ordnung. Sie strukturierte alles – sie machte uns sogar Essenspläne, an die wir uns penibel hielten. Genau deswegen wollte ich unbedingt, dass sie diesen Urlaub antrat. Denn inmitten der Wildnis war es unmöglich, sich an minutengenaue Abläufe zu halten. Ein bisschen Spontaneität würde ihr guttun und dafür sorgen, dass sie mal den Kopf freibekam.
Nichtsdestotrotz fehlte sie mir schrecklich. Doch Trübsal zu blasen brachte mich nicht weiter, daher kippte ich den letzten Schluck Kaffee runter und machte mich stattdessen für das Treffen mit Mrs Wallace fertig.
Eine knappe Stunde später war ich frisch geduscht, umgezogen und hatte den kleineren meiner beiden Koffer ausgepackt. Dafür, dass Mom und ich geplant hatten, spätestens eine Woche nach der Beerdigung zurück nach Kalifornien zu fahren, hatte ich viel zu viel mitgebracht. Das lag wohl an meinem nicht vorhandenen Organisationstalent. Hätte ich mich an Kims Vorschlag mit der Packliste gehalten, wäre das nicht passiert. Wobei ich nach dem Anruf über Meemaws Tod mit den Gedanken ohnehin ganz woanders war.
Ich warf einen letzten Blick in den Spiegel, um sicherzugehen, dass ich in Ordnung aussah. Da ich es nicht für nötig hielt, mir die Haare zu föhnen – sie würden ohnehin trocknen, kaum dass ich das Haus verließ –, wellte sich mein brauner Bob leicht, sodass er gerade so meine Ohren bedeckte. Meine blauen Augen hatte ich mit etwas wasserfester Wimperntusche betont. Alles andere an Make-up würde mir binnen weniger Sekunden bei der Hitze aus dem Gesicht schwitzen.
Halbwegs zufrieden mit meinem Aussehen verließ ich die obere Etage und steuerte wieder die Küche an, um mir einen frischen Kaffee zu kochen. Noch hatte ich ein wenig Zeit, ehe ich losmusste. Am liebsten hätte ich Kim angerufen, aber aufgrund der zwölfstündigen Zeitverschiebung zwischen Bibury und Jeopardy Island war es bei ihr jetzt mitten in der Nacht.
Gerade als ich die Maschine einschaltete, klopfte es an der Tür. Ein kurzer Blick auf die Wanduhr verriet, dass es zu früh für Mom war, um zurück zu sein. Wobei sie wohl ohnehin nicht klopfen, sondern einfach hereinkommen würde. In einer so eingeschworenen Gemeinschaft wie dieser verschloss man seine Türen schließlich nur in den seltensten Fällen.
Ich trat in den Flur und öffnete. Die stickige Sommerluft drang ins Innere und raubte mir den Atem. Ich hatte über die Jahre vergessen, wie heiß es in Bibury werden konnte.
Mein Blick huschte zur Veranda, auf der ein gut aussehender junger Mann stand, der verhalten lächelte. Kleine Grübchen zierten seine Wangen, die von einem Dreitagebart verdeckt waren. Seine blonden Haare lugten unter einem Cowboyhut hervor, und die Sonne brachte seine blauen Augen dazu, wie Eis aufzublitzen. Als ich die kleine Narbe sah, die sich von seiner rechten Braue über seine Schläfe zog, hoben sich meine Mundwinkel. Obwohl er älter geworden war, bestand kein Zweifel daran, wer vor mir stand.
»Scott?«, fragte ich überrascht.
Er nickte. »Freut mich, dich wiederzusehen, Holly. Auch wenn die Umstände nicht die besten sind.« Zwar gab er sich sichtlich Mühe, aber er konnte seinen texanischen Akzent nur schwer verbergen. »Mein herzliches Beileid.«
»Danke«, entgegnete ich und trat einen Schritt zurück, um die Tür weiter zu öffnen. »Möchtest du reinkommen?«
Als er über die Schwelle trat, nahm ich den für Scott typischen Ranchgeruch nach Koppel und Heu wahr – das war schon damals so gewesen, und daran hatte sich auch heute nichts geändert. Er war der Sohn unseres Reitlehrers Frankie und mittlerweile selbst als solcher auf der Pierson Ranch angestellt. Früher hatten wir einen ständigen Konkurrenzkampf ausgefochten. Wenn ich eines nicht hatte ausstehen können, dann gegen Scott zu verlieren. Sei es beim Wettreiten, beim Schafetreiben auf dem Bo-Peep-Festival, das jedes Jahr im Frühling in Bibury stattfand, sogar beim Stallausmisten hatten wir uns gemessen und uns dabei mehr als einmal in die Haare gekriegt. Aber trotz allem hatten wir uns gut verstanden … na ja, meistens jedenfalls.
»Das ist für euch«, sagte Scott und lehnte sich gegen die kleine Kommode im Flur. Dabei streckte er mir die in Alufolie gewickelte Schale entgegen, die er in der Hand hielt. Er musste meinen leicht skeptischen Blick bemerken, denn er fügte hinzu: »Ein Kirsch-Käsekuchen. Dad hat darauf bestanden, dass ich euch einen backe und vorbeibringe. Ich habe ihm zwar gesagt, dass das unnötig ist, weil ohnehin die ganze Stadt kommen und euch versorgen wird, aber du kennst ihn ja.« Scott lachte leise. Ein angenehmer Klang, rauer als in meiner Erinnerung.
Ich nahm den Kuchen entgegen und hob die Folie an. Sofort lief mir das Wasser im Mund zusammen. »Den hast du wirklich selbst gemacht?«
»Jap, und er schmeckt hervorragend.«
»Das glaube ich dir sofort«, erwiderte ich grinsend und balancierte die Form in die Küche. »Möchtest du ein Stück mit Kaffee?«, rief ich über meine Schulter. Scott machte keine Anstalten, mir zu folgen.
»Nein, danke. Ich trinke keinen Kaffee und …«
»Was?«, unterbrach ich ihn, drehte mich um und starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. »Wie stehst du dann die Arbeit hier durch?«
»Mit Schwarztee und indem ich früh ins Bett gehe.«
»Du warst mir schon immer suspekt«, sagte ich kopfschüttelnd.
»Dito.« Scott verschränkte die Arme vor der Brust und lächelte. »Ich muss jetzt aber auch schon wieder an die Arbeit. Die Tiere versorgen sich nicht von allein. Ich wollte euch nur mein Beileid aussprechen. Ist Selena da?«
»Noch nicht, sie hat einen Termin mit dem Pfarrer.«
Scott nickte. »Verstehe. Dann sag ihr bitte, dass ich hier gewesen bin.«
»Mach ich, und danke noch mal für den Kuchen und deine Worte.«
»Das ist doch selbstverständlich.« Er tippte sich an die Krempe, ehe er sich umwandte und so schnell wieder verschwand, wie er aufgetaucht war.
Noch einen Moment blieb ich im Türrahmen stehen und schaute zu dem Fleck, an dem Scott eben noch gestanden hatte. Er hatte sich verändert. Zumindest optisch. Auch als Junge war er schon nett anzusehen gewesen. Jetzt aber war er ein richtiger Mann – gut gebaut, überragte mich um einen Kopf und war wirklich sehr attraktiv. Ich hatte schon immer eine Schwäche für Cowboys, was wohl den Sommern hier zu verdanken war.
Unwillkürlich fragte ich mich, ob Scott sich auch sonst verändert hatte. Er war früher ziemlich frech gewesen, hatte mich geärgert oder bei Meemaw verpetzt, wenn ich etwas Verbotenes getan hatte. Aber er hatte auch andere Seiten gehabt. Seiten, die das Herz der dreizehnjährigen Holly Purzelbäume schlagen ließen.
Schnell vertrieb ich den Gedanken wieder. Wir würden ohnehin nur wenige Tage in Bibury bleiben. Am Freitag, einen Tag nach der Beerdigung, stand unser Termin mit dem Nachlassverwalter auf dem Plan. Danach würden wir eine Entscheidung über die Zukunft der Ranch treffen. Doch bisher sah alles danach aus, dass wir sie verkaufen würden.
Als mir der Geruch von Kaffee in die Nase stieg, fiel mir wieder ein, dass ich in einer halben Stunde losmusste. Also nahm ich mir ein Stück Kuchen, um mich für den Tag zu stärken.
Kapitel 2
Die leisen Klänge des Liedes vermischten sich mit dem Gesang der Vögel, die über uns in den Zweigen zwitscherten und Meemaw auf diese Weise ebenfalls die letzte Ehre erwiesen. Langsam wurde der Eichenholzsarg in die Erde gelassen. Mom hatte ein besonders schön veredeltes Exemplar aus dem großen Angebot ausgesucht, wofür Meemaw sie mit erhobenem Zeigefinger ausgeschimpft hätte. Sie hatte es nie gemocht, wenn man zu viel Geld für in ihren Augen unnütze Dinge ausgab.
Ich wischte mir eine einzelne Träne von der Wange und fixierte den Strauß, den Mrs Wallace vorbereitet hatte. Er war wunderschön und wohlduftend, so wie ich ihn in Auftrag gegeben hatte.
Erst als die Musik vollständig verklungen war, hob ich den Kopf und schaute zu Pfarrer Mitchell, der die Messe geleitet hatte. Er sprach ein paar letzte Worte, und wenige Minuten später war es vorbei.
Mom und ich schüttelten noch ein paar Hände und erinnerten an den Leichenschmaus, ehe sich die Trauergäste nach und nach vom Grab entfernten. Die halbe Stadt war hier gewesen, um sich von Meemaw zu verabschieden.
Mom hakte sich bei mir unter und strich behutsam über meinen Arm. Ein glasiger Schimmer lag in ihren Augen. »Deiner Großmutter hätte die Beerdigung sicher gefallen«, sagte sie und wischte sich mit dem zerknüllten Taschentuch über die Nase.
Ich nickte. »Das denke ich auch.«
Eine Weile schauten wir gedankenverloren zur Grabstätte. Es war ein schöner Platz auf einem der zahlreichen Hügel des Kirchenfriedhofs unter einem Schatten spendenden Baum. Paradoxerweise hatte Meemaw die Hitze nie gemocht, obwohl sie ihr ganzes Leben lang eine Ranch in der texanischen Prärie geführt hatte. Doch nun konnte sie an einem kühleren Fleckchen neben Gramps ruhen.
»Die anderen warten sicher schon«, sagte Mom irgendwann.
»Du hast recht, lass uns gehen.«
Weiterhin beieinander untergehakt, liefen wir den schmalen Steinpfad entlang. Es war ein unglaublich heißer Tag, weshalb ich mir mit der freien Hand Luft zufächeln musste, um nicht einzugehen wie eine Blume.
Wir ließen die Kirche hinter uns und schlenderten die Hauptstraße zum Cockeyed Sheep entlang – eine etwas heruntergekommene Kneipe, die uns netterweise für den Leichenschmaus zur Verfügung gestellt wurde. Heute Morgen hatten Mom und ich schon zahlreiche Speisen und Getränke vorbeigebracht, die von Freiwilligen während der Zeremonie aufgebaut wurden. Eine Hand wusch die andere an einem Ort wie Bibury.
Je näher wir kamen, desto lauter wurde das Stimmengewirr, das aus der Kneipe drang. Mom öffnete die Tür, woraufhin die Gespräche verklangen und die Gäste sich uns zuwandten. Als wir an ihnen vorbei zur Bar gingen, erreichten uns leise Beileidsbekundungen.
Auf dem Tresen standen zahlreiche Sektgläser, die Amity bereitgestellt hatte. Sie war die Tochter des Pfarrers. Als junges Mädchen hatte sie immer karierte Kleider getragen, und zwei Flechtzöpfe hatten von ihrem Kopf gebaumelt. Heute trug sie eine kesse blonde Kurzhaarfrisur und hatte das Cockeyed Sheep übernommen, wo sie auch als Barkeeperin arbeitete. Ganz zum Leidwesen ihres Vaters.
Mom griff zwei Sektgläser und reichte mir eines davon. Anschließend sprach sie einige Worte. »Auf Donna Pierson«, beendete sie ihre Rede und hob das Glas.
»Auf Donna Pierson«, erwiderten die Trauergäste. Ich stieß mit Mom an und kippte den Sekt in einem Zug runter.
Wenige Augenblicke später gingen die Gespräche wieder los. Mom mischte sich unter die Gäste, während ich mir einen Barhocker zurechtschob und mich an den Tresen setzte. Mir war im Moment nicht nach Reden zumute. Meine Gedanken hingen noch bei der Beerdigung, die nicht nur körperlich, sondern auch seelisch an mir gezehrt hatte. Meemaw fehlte mir. Sehr sogar.
Ich griff mir ein weiteres Sektglas und leerte auch dieses zügig.
»Wenn du dich betrinken möchtest, gebe ich dir auch gern etwas Stärkeres«, sagte Amity mit einem Lächeln auf den Lippen, das ihre hellbraunen Augen zum Funkeln brachte.
»Immer her damit«, entgegnete ich und klopfte auf den Tresen.
Lachend stellte Amity zwei Schnapsgläser vor uns ab und befüllte sie mit einer klaren Flüssigkeit. Der Geruch von Wodka brannte in meiner Nase. Nicht unbedingt das, was ich normalerweise trank, aber heute war auch kein Tag wie jeder andere.
»Auf deine Großmutter.« Wir stießen an und kippten das Zeug runter.
»Urgh!« Es schüttelte mich am ganzen Körper.
»Noch einen?« Amity hob die Flasche, doch ich legte kopfschüttelnd meine Hand übers Glas.
»Bitte nicht.«
Sie lachte. Ein klangvoller Laut an einem so düsteren Tag. »Na schön. Kann ich dir sonst noch etwas Gutes tun, Holly?« Sie deutete zum Zapfhahn vor sich. »Ein kühles Bier vielleicht?«
»Da kann ich nicht Nein sagen«, erwiderte ich.
»Kommt sofort.« Amity zwinkerte und wandte sich von mir ab, um mir mein Getränk zuzubereiten. Indessen drehte ich mich auf dem Barhocker um und ließ den Blick über die Gäste schweifen. Einige nickten mir zu – eine freundliche Geste, die ich erwiderte.
Amity stellte das Bier vor mir ab und entschuldigte sich einen Moment, um ein paar andere Gäste zu bewirten. Eigentlich hätte sie das nicht tun müssen, wir hatten für genug eigene Getränke gesorgt, an denen sich jeder nach Belieben bedienen konnte, aber Amity war schon immer freundlich und hilfsbereit gewesen. Eine Charaktereigenschaft, die sie glücklicherweise beibehalten hatte.
Ich schlürfte die Schaumkrone vom Bier. Ein angenehmes Prickeln in meiner Kehle, das genau das Richtige heute war.
»Darf ich mich setzen?« Scott kam näher und deutete auf den Barhocker neben meinem. Seine breiten Schultern steckten in einem weißen Hemd. Die Krawatte um seinen Hals hatte er etwas gelockert, und die Anzugjacke hielt er in der Hand. Heute waren seine Haare ordentlich zurückgekämmt, vom Cowboy fehlte jede Spur.
»Klar, setz dich«, sagte ich.
»Danke.« Er legte die Jacke fein säuberlich auf den Hocker und setzte sich darauf. »Und noch mal mein herzliches Beileid, auch wenn du es vielleicht nicht mehr hören kannst.«
Ich nickte und betrachtete die einzelnen Bläschen, die in meinem Bier aufstiegen. »Deine Rede war sehr schön.« Während der Zeremonie hatten einige Gemeindemitglieder ein paar Worte gesprochen. Unter ihnen waren auch Scott, sein Vater Frankie und José, der Pferdezüchter der Ranch, gewesen. Ihre Worte hatten mir viel bedeutet, da sie mir verdeutlicht hatten, dass Meemaw auch während unserer Abwesenheit nie allein gewesen war. Sie hatte gerade in Scott und Frankie zwei Menschen gefunden, die wie eine Familie für sie waren, mit denen sie Feiertage verbracht und die sie sonntags zum Essen eingeladen hatte. Da fiel mir auf, dass ich Scotts Vater nach der Beisetzung nicht mehr gesehen hatte. Bisher hatte ich keine Gelegenheit gehabt, mich mit ihm zu unterhalten. »Ist dein Dad nicht mehr hier?«
Sacht schüttelte Scott den Kopf. »Nein, ich habe ihn nach Hause gebracht. Aufgrund seiner Krankheit fällt es ihm schwer, so lange unterwegs zu sein. Aber ich soll Selena und dich lieb grüßen.«
»Verstehe. Grüß ihn bitte zurück.« Als Meemaw uns zuletzt in Los Angeles besucht hatte, hatte sie uns von Frankies Nervenkrankheit erzählt. Sie war der Grund, aus dem er seine Arbeit als Reitlehrer niederlegen musste und Scott die Stelle übernommen hatte. Es tat mir leid, dass es ihm so schlecht ging. Frankie war immer schon ein herzensguter Mann gewesen, der mir viel beigebracht hatte. Nachdem Gramps körperlich nicht mehr so fit gewesen war, war Frankie regelmäßig mit mir ausgeritten.
Amity stellte Scott ebenfalls ein Bier hin. Er nahm das Glas und hob es in meine Richtung. Klirrend stieß ich mit ihm an.
»Wie geht es dir mit allem?«, fragte er nach einer Weile.
Ich zuckte mit den Schultern. »So weit ganz gut, schätze ich. Natürlich hätte ich mich gern von Meemaw verabschiedet, aber ich bin froh, dass wir uns überhaupt noch gesehen haben, nachdem … na ja.«
Eigentlich hatte Meemaw uns über Thanksgiving in diesem Jahr besuchen wollen. Ich hatte mich schon sehr gefreut, sie nach so langer Zeit endlich wiederzusehen. Aber ihr Tod war überraschend gekommen. Sie war gerade erst Mitte sechzig und körperlich gesund gewesen. Trotzdem hatte sie einen Herzinfarkt erlitten, den sie nicht überlebt hatte. Das hatte mir wieder einmal bewusst gemacht, wie plötzlich alles vorbei sein konnte.
»Das verstehe ich. Wenn du irgendwas brauchst, dann sag Bescheid. Ich bin für dich da.« Ein zaghaftes Lächeln umspielte Scotts Lippen.
»Danke, das weiß ich zu schätzen. Aber wir werden vermutlich nächste Woche wieder nach Hause fahren.«
Scott zog die Brauen zusammen und legte den Kopf schief. »Ihr wollt schon abreisen? Wieso?«
»Mom hat einen Job, und ich studiere«, entgegnete ich leicht verwirrt. »Unser Leben spielt sich in Kalifornien ab.«
Scott nahm einen kräftigen Schluck, dann fixierte er mich wieder. »Ich dachte, du übernimmst die Ranch. Donna hat immer wieder davon gesprochen, dass du eines Tages in ihre Fußstapfen treten wirst.«
Ein Lachen drang aus meiner Kehle, das nur dazu führte, dass ich mich an meinem Bier verschluckte. »Ich? Die Ranch übernehmen? Du weißt schon, dass ich erst einundzwanzig bin und noch die Welt erkunden will?«
Es war nicht so, dass ich nie darüber nachgedacht hatte, eines Tages Meemaws Job zu übernehmen. Schließlich war die Pierson Ranch schon seit Generationen im Besitz unserer Familie. Aber eines Tages war in meinem Kosmos stets sehr weit entfernt gewesen. Erst wollte ich mein Studium beenden, einen guten Job finden, durch die Welt reisen und Dinge erleben.
»Man kann auch mit Anfang zwanzig sesshaft werden.« Scott zwinkerte, dann legte sich ein spitzbübisches Lächeln um seine Lippen. »Was ist aus der spontanen Holly von früher geworden? Dinge zu planen war doch nie deine Stärke.«
»Spontan zur Kirmes statt ins Kino zu gehen ist aber etwas anderes, als von jetzt auf gleich das ganze Leben hinter sich zu lassen.«
»Ach, und wie war das bei deinem Besuch, als du entschieden hast, dir ein Hausschwein zu kaufen, und es dann zurückbringen musstest, weil Donna und Selena es dir verboten hatten?«
»Dass du dich daran überhaupt erinnerst!«, entgegnete ich lachend.
»Natürlich. Ich werde jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue, an früher erinnert.« Er deutete auf die kleine Narbe an seiner Schläfe. Ich grinste, auch wenn es eigentlich nicht lustig war. Die Narbe ging gewissermaßen auf meine Kappe, denn ich hatte ihm bei einem Wettreiten den Weg so versperrt, dass er das Hindernis vor uns nicht rechtzeitig sehen konnte. Sein Pferd war ins Straucheln geraten, woraufhin Scott abgeworfen wurde und sich den Kopf an einem kleinen Stein aufgeschlagen hatte. Es grenzte an ein Wunder, dass er bis auf die Platzwunde keine weiteren Verletzungen davongetragen hatte.
Ich nippte an meinem Bier und hob die Schultern. »Na, immerhin hast du so eine bleibende Erinnerung an mich.«
»Ich hätte dich auch so nicht vergessen«, entgegnete Scott und schaute mich weiterhin lächelnd an.
Mein Herz machte einen nervösen Hüpfer, und Hitze stieg mir in die Wangen. Keine Ahnung, warum seine Worte eine solche Wirkung auf mich hatten. Das musste daran liegen, dass heute so ein emotionaler Tag war. Ich wich seinem Blick aus, spürte ihn aber weiterhin auf mir ruhen.
»Jedenfalls ist es derzeitig nicht geplant, dass ich die Ranch übernehme«, durchbrach ich irgendwann die Stille zwischen uns. »Morgen werden wir mehr wissen, aber bisher sieht alles danach aus, dass wir verkaufen werden.«
»Aber sie gehört eurer Familie schon seit Generationen.« Unverständnis zeichnete sich in seinen Zügen ab.
Allerdings war das keine Diskussion, die ich jetzt führen wollte. Oder sonst irgendwann. »Das weiß ich selbst«, sagte ich seufzend. »Aber so ist der Lauf der Dinge nun mal.«
Scott presste die Lippen aufeinander. Kurz meinte ich, dass er noch etwas sagen, die Diskussion vertiefen wollte, doch er hielt sich zurück. Stattdessen nickte er lediglich. »Natürlich. Tut mir leid, ich wollte jetzt auch eigentlich gar nicht davon anfangen.«
»Schon okay«, winkte ich ab und widmete mich wieder dem halb leeren Glas Bier in meiner Hand.
»Ich werde dann mal deine Mutter suchen und ihr mein Beileid aussprechen.« Scott stand auf und legte mir die Hand kurz auf den Unterarm. Ein warmes Gefühl zog durch mich hindurch, und ein sanftes Kribbeln legte sich über meine Haut. »Wir sehen uns später.«
»Ja, bis dann.« Er griff nach seiner Jacke und drehte sich um. Kurz darauf war Scott in der Menge verschwunden. Ich ließ mir seine Worte noch einmal durch den Kopf gehen. Die Zukunft der Ranch war schon immer der Streitpunkt in unserer Familie gewesen. Da Mom sich vehement mit Händen und Füßen geweigert hatte, die Ranch zu übernehmen, war ich die einzig naheliegende Wahl. Mehr Verwandtschaft hatten wir nicht.
Trotzdem wäre es nicht nur ein unglaublicher Schritt, sondern auch eine enorme Last, die ich nicht gewillt war zu tragen. Das Beste für alle – die Mitarbeiter und die Tiere – wäre ein neuer Eigentümer.
Nachdem Amity mir ein weiteres Bier hingestellt und ein paar Worte mit mir gewechselt hatte, entschuldigte ich mich, um ein wenig frische Luft zu schnappen. In der Kneipe war es stickig und schwül, weshalb die lauwarme Sommerabendbrise eine willkommene Abwechslung war.
Ich schlang die Arme um den Oberkörper und lehnte mich gegen die Fassade. Als ich die Augen schloss, merkte ich, dass mir etwas schwummerig war. Es wäre wohl besser gewesen, nicht so wild durcheinanderzutrinken.
»Willst du eine?« Bei den Worten zuckte ich kaum merklich zusammen und öffnete die Augen wieder. Da ich so in Gedanken gewesen war, hatte ich nicht bemerkt, dass José nur wenige Meter entfernt stand. Er reichte mir eine geöffnete Zigarettenschachtel.
Kopfschüttelnd winkte ich ab. »Nein, danke. Ich rauche nicht.«
Er schloss die Packung wieder und ließ sie in seiner Hosentasche verschwinden. Zum Glück war José eher von der ruhigen Sorte, weshalb er mich nicht krampfhaft in ein Gespräch verwickeln wollte. Vor etwa fünfzehn Jahren war er mit seiner Familie aus Mexiko in unser Land gekommen. Ich erinnerte mich noch daran, dass er anfangs kaum Englisch gesprochen hatte. Aber José war immer fleißig und bemüht gewesen, weshalb er sich unsere Sprache schnell angeeignet und auf der Ranch immer einhundertzehn Prozent gegeben hatte. Nicht nur war er ein hervorragender Pferdezüchter, sondern auch handwerklich sehr begabt.
Als ich den Kopf drehte, sah ich Scott mit einer blonden Frau an einem der kleinen Tische vor der Kneipe sitzen. Da sie mit dem Rücken zu mir saß, konnte ich sie nicht erkennen.
»Ist das Hannah?«, fragte ich José.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, Brooke Hanson. Sie ist unsere Tierärztin, erst letztes Jahr hergezogen.«
»Seine neue Freundin?« Die Frage rutschte mir raus, ehe ich darüber nachdenken konnte. Eigentlich sollte ich mich nicht für Scotts Privatleben interessieren, schließlich ging es mich nichts an. Aber zum Leidwesen meiner Mitmenschen war ich schon immer sehr neugierig. Und vielleicht tat auch der Alkohol sein Übriges.
José nahm einen kräftigen Zug von seiner Zigarette und blies den Rauch in die entgegengesetzte Richtung. Durch die Brise bekam ich allerdings trotzdem die Hälfte davon ins Gesicht. Er lehnte sich zu mir herüber, wobei mir eine seiner schwarzen Locken die Wange kitzelte. Dann senkte er die Stimme. »Nein, nicht direkt. Die beiden hatten ein paar Monate was am Laufen, aber das ist schon länger vorbei. Seit Hannah ihn kurz vor der Hochzeit betrogen hat und überstürzt abgehauen ist, hat er sich auf keine Frau mehr so richtig eingelassen.«
»Was? Ist das dein Ernst?«, fragte ich überrascht. Damit hätte ich nie gerechnet. Klar, ich war lange nicht hier gewesen und wusste nicht, was sich im Laufe der Jahre verändert hatte, doch Hannah war früher das nette Mädchen von nebenan gewesen. Sie hatte immer ein offenes Ohr, half, wenn Not am Mann war, und besaß das hellste, ansteckendste Lachen weit und breit. Man musste sie einfach gernhaben.
José nickte. »Ja, das ist jetzt vier Jahre her. War ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für ihn.« Er legte sich den Zeigefinger an die geschlossenen Lippen. »Aber das weißt du nicht von mir.«
»Natürlich nicht«, entgegnete ich und warf noch einen verstohlenen Blick zu Scott und Brooke. Ich überlegte, ob ich sie begrüßen und mich vorstellen sollte, doch die beiden schienen in eine angeregte Unterhaltung vertieft zu sein, weshalb ich nicht stören wollte.
»Kommst du mit rein?« José drückte seine Zigarette in dem kleinen Aschenbecher auf der Fensterbank aus und steuerte den Eingang an. Ich nickte, und gemeinsam traten wir wieder in den stickigen Innenraum des Cockeyed Sheep.
Kapitel 3
Der gestrige Tag war so lang und anstrengend gewesen, dass ich, wieder auf der Ranch angekommen, nur noch meine Chatnachrichten von Kim gelesen und beantwortet hatte und anschließend sofort ins Bett gefallen war.
Den Vormittag hatte ich damit verplempert, halbwegs wach zu werden, was mehrere Tassen Kaffee und eine Ladung kaltes Wasser ins Gesicht benötigt hatte. Und selbst dann war ich lediglich mittelmäßig wach gewesen. Keine Ahnung, wie Mom es geschafft hatte, früh in die Stadt zu fahren, um Erledigungen zu machen. Oder wie Menschen es generell schafften, morgens mit dem Sonnenaufgang aufzustehen und in den Tag zu starten. Mir graute es schon, wenn ich nur daran dachte.
Mit meiner Kamera gewappnet, ging ich hinaus. Auf der Veranda streckte ich erst mal ausgiebig meine müden Glieder und ließ die warmen Sonnenstrahlen meine Haut erwärmen. Der Geruch von Heu hing in der Luft, und in der Ferne hörte ich das leise Wiehern der Pferde. Es erinnerte mich an früher und zauberte mir ein Lächeln ins Gesicht.
Nur wünschte ich mir nichts sehnlicher, als dass Meemaw auch hier wäre. Ich war immer gern mit ihr über die Ranch geschlendert und hatte ihr in den Ställen geholfen. Körperliche Arbeit war zwar nie meine Stärke gewesen, aber ich hatte mein Bestes gegeben, um sie stolz zu machen. Der Gedanke daran versetzte mir einen Stich.
Noch einmal atmete ich tief durch und lief die morschen Stufen hinunter. Ein Wunder, dass sie bisher nicht in sich zusammengebrochen waren.
Durch den Sand, der mit Erde und Gräsern vermischt war, wandelte sich das strahlende Weiß meiner Stoffschuhe binnen Sekunden zu einem eher fahlen Grau. Die heutige Wahl meiner Schuhe war wohl nicht meine beste gewesen. Da nun allerdings ohnehin schon Hopfen und Malz verloren war, lief ich einfach weiter.
Aufgrund der zahlreichen Termine in der letzten Woche hatte ich kaum Gelegenheit gehabt, wirklich zu realisieren, dass wir hier waren. Nun dem schmalen Pfad hinter dem Haupthaus zu folgen, rief gemischte Gefühle in mir hervor. Doch es war die Freude, die überwog.
Ich schaltete die Kamera ein. Auf dem Startbildschirm grinsten mir Kim und ich entgegen. Es war das Selfie, das wir bei unserem Abschied im alten Baumhaus gemacht hatten. Unsere Augen waren gerötet und die Haare zerzaust. Man erkannte deutlich, wie mitgenommen wir waren. Trotzdem strahlten wir über beide Ohren. So wie wir es immer taten, wenn wir zusammen waren.
Kurz klickte ich mich durch die Fotos. Die letzten hatte ich am Santa Monica Pier gemacht. Kim und ich waren ein paar Tage vor unserer Abreise dort gewesen, um die Prüfungswoche ausklingen zu lassen. Die Bilder jetzt zu sehen führte mir wieder vor Augen, wie sehr mir meine beste Freundin fehlte. Durch die Termine war ich so abgelenkt gewesen, dass ich nicht großartig darüber nachdenken konnte. Aber nun, wo bis auf das Treffen mit dem Nachlassverwalter nachher nichts mehr anstand, hatte ich alle Zeit der Welt, mir einen Kopf zu machen.
Am liebsten hätte ich sie angerufen, aber auf Jeopardy Island war es gerade wieder mal mitten in der Nacht. In ihren gestrigen Nachrichten hatte Kim mir von ihren bisherigen Erlebnissen beim Basistraining des Survival-Camps erzählt. Da ich nicht mitfahren konnte und die praktischen Übungen in der ersten Woche paarweise ausgeführt werden mussten, wurde ihr ein junger Mann namens Aidan zugeteilt. So wie sie sich über ihn aufregte, war ich mir ziemlich sicher, dass sie etwas für ihn übrighatte. Zwar behauptete sie, ihn nicht leiden zu können und dass er sie buchstäblich in den Wahnsinn trieb, aber mir konnte sie nichts vormachen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie am Ende des Trips mit einem Mann im Schlepptau ankommen würde.
Während ich zu den Ställen lief, knipste ich einige Bilder der Ranch und der Bergkette, die sich hinter dem großen Grundstück erstreckte. Es war ein atemberaubender Anblick, der einer der Gründe dafür war, dass ich mich für ein Fotografiestudium entschieden hatte. Ich konnte einfach nicht genug davon kriegen, zu beobachten, wie die Sonnenstrahlen sich über den Gipfeln brachen und den Sand in ein rotglitzerndes Meer verwandelten.
Hoffentlich würde ich eines Tages mit meinen Bildern mehr Menschen erreichen. Vor unserer Abreise hatte ich mich auf eine studentische Aushilfsstelle in der Grafikabteilung der L. A. Times beworben. Lange hatte ich auf genau so eine Chance gewartet, denn eine große, renommierte Zeitung im Lebenslauf zu haben öffnete zahlreiche Türen. Es war ein riesiger Schritt, um meinem Traum, Reisefotografin zu werden, näher zu kommen. Bisher hatte ich keine Rückmeldung erhalten, doch wann immer mein Handy klingelte, erhöhte sich schlagartig mein Puls. Kurz darauf folgte dann die Ernüchterung, wenn es nur eine Pop-up-Werbenachricht war. Aber noch hatte ich die Hoffnung nicht aufgegeben.
Als ich weiterlief, ließ ich den Blick wieder schweifen. Die Pierson Ranch bestand aus einem etwa fünfhundert Hektar großen Grundstück. Neben dem Wohnhaus gab es ein Gästehaus, in dem die Touristen für einen Reiterurlaub einquartiert wurden. Außerdem lebten dort die Saisonarbeiter, die regelmäßig auf die Ranch kamen, um ein bisschen Landluft zu schnuppern und mit anzupacken. Bewirtet wurden sie von Josés Bruder Miguel, dem ich vor unserer Abreise auch noch unbedingt einen Besuch abstatten musste.
Hinter dem Gästehaus befanden sich die Ställe und eine der weitläufigen Koppeln, die sich bis zur Bergkette erstreckte. Auf der anderen Seite der Ställe lag die wunderschöne Weide, die ich auch von meinem Zimmer aus sehen konnte. In ihrer Mitte war ein kleiner Teich angelegt, auf dem einige Enten ihre Runden drehten.
Im Grunde war es ein unfassbar schöner Ort, an dem man es sich gut gehen lassen konnte. Die Luft war deutlich frischer als in Los Angeles, und man war umgeben von wilder und unberührter Natur, von atemberaubenden Landschaften. Von Wüsten, in denen Kakteen mit bunten Blüten wuchsen, bis hin zu Bergen, zwischen denen hin und wieder kleine Bäche plätscherten. Um den Kopf freizukriegen, konnte ich mir kaum einen besseren Ort vorstellen. Außer vielleicht eine Survival-Insel inmitten des Indischen Ozeans.
Ich schlenderte an der Weide vorbei, passierte einige frei laufende Hühner, die Körner vom Boden pickten und von denen ich Fotos schoss, und steuerte die Ställe an. In der Ferne sah ich einige Mitarbeiter herumwuseln. Die meisten von ihnen kannte ich nicht, was daran lag, dass es auf der Ranch nur einen kleinen, festen Arbeiterstamm gab.
Der Geruch von Erde und Stroh hing in der Luft. Ein vertrauter Duft, der ein Gefühl von Heimat in mir hervorrief.
Das vordere Stalltor war geöffnet. Ich schob meinen Kopf hindurch. »Hallo? Ist hier jemand?«
Ich wartete einen Moment. Da ich keine Antwort erhielt, trat ich ein. Der Mittelgang war sandig und mit zahlreichen Strohhalmen bedeckt, die bei jedem meiner Schritte leise quietschten und knackten.
Links und rechts im Stall befanden sich jeweils zehn Boxen, in denen verschiedenfarbige Hengste und Stuten schnaubend die Köpfe neigten, als wollten sie mich beim Vorbeigehen begrüßen.
Lächelnd blieb ich vor einer der Boxen stehen. Ein wunderschöner Mausfalbe schaute mich aus großen schwarzen Knopfaugen an. Sein rauchgraues Fell schimmerte silbrig. Schnaubend schüttelte er die tiefschwarze Mähne. Vorsichtig hob ich die Hand und wartete auf seine stumme Einwilligung, dass ich ihn berühren durfte.
Erst beäugte er mich leicht skeptisch, doch als ich einen Schritt näher an ihn herantrat, schob er den Kopf aus der Box. Langsam fuhr ich mit den Fingerspitzen über seine Nase und Stirn.
»Du warst schon immer eine Pferdeflüsterin«, sagte José lachend. In Arbeitskleidung und mit einem Eimer in der Hand trat er aus der Box neben der des Pferdes, vor dem ich stehen geblieben war. Er nahm die Kopfhörer aus den Ohren – der Grund, aus dem er mich nicht hatte rufen hören.
»Wie meinst du das?«, fragte ich und kraulte dem Hengst die Mähne.
»Aramis braucht normalerweise eine Weile, ehe er jemandem vertraut und sich anfassen lässt. Er kam vor zwei Jahren auf die Ranch, als sein Besitzer gestorben ist. Anfangs war er total verängstigt und hat niemanden in seine Nähe gelassen. Aber Scott hat ihn wieder aufgepäppelt.« José stellte den Eimer vor sich ab und kam auf mich zu. Dann strich er Aramis ebenfalls über die Mähne. Ich meinte das Tier lächeln zu sehen. Kaum vorstellbar, wie es für den Hengst gewesen sein musste, aus seiner gewohnten Umgebung herausgerissen und hierher verfrachtet zu werden. Kein Wunder, dass es anfangs zu Schwierigkeiten mit ihm kam. Glücklicherweise hatten Scott und sein Vater schon immer ein Händchen für Pferde gehabt.
»Brauchst du Hilfe?«, fragte ich José und deutete auf den Eimer. »Ich habe noch etwas Zeit vor unserem Treffen mit dem Nachlassverwalter.«
Lächelnd schüttelte er den Kopf. »Nein, alles gut, ich bin fast fertig. Aber wenn du willst, sattle ich dir eines der Pferde, dann kannst du noch etwas ausreiten.«
Bei dem Gedanken daran machte mein Herz einen aufgeregten Hüpfer. Mittlerweile war es acht Jahre her, dass ich zuletzt auf dem Rücken eines Pferdes gesessen hatte. Sacht schüttelte ich den Kopf. »Lieber nicht. Ich kann nicht mehr reiten.«
»Reiten ist wie Fahrradfahren. Gerade wenn du es als Kind gelernt hast, verlernst du es so schnell nicht wieder.« Ein erwartungsvoller Ausdruck legte sich auf Josés Gesicht.
Gedanklich wog ich das Für und Wider ab, entschied mich schlussendlich aber doch dagegen. Würde ich jetzt auf ein Pferd steigen und über das Grundstück reiten, würde ich womöglich die Zeit vergessen und Mom mich einen Kopf kürzer machen. »Ein anderes Mal vielleicht.«
José zuckte mit den Schultern. »Sag einfach Bescheid. Ich muss dann mal weitermachen.«
»Alles klar. Grüß Miguel bitte ganz lieb von mir.«
»Mach ich. Wir sehen uns, Holly.« José wandte sich um und ging ans Ende des Stalls, wo er in einer der Boxen verschwand, um das nächste Pferd zu versorgen.
Ich verabschiedete mich von Aramis, ehe ich den Stall wieder verließ und weiter über die Ranch schlenderte. Dabei fiel mir auf, dass ich lediglich Arbeiter sah und keine Touristen. Instinktiv fragte ich mich, ob es dafür einen Grund gab. Früher war die Ranch gut besucht gewesen. Gerade in den Sommermonaten tummelten sich hier unzählige Familien und Freundesgruppen, um einen unvergesslichen Urlaub zu erleben. Dass nun eine gähnende Leere herrschte, war ungewöhnlich. Bei Gelegenheit musste ich José oder Scott fragen, was es damit auf sich hatte.
Als ich nach einer Weile auf meine Handyuhr schaute, war es kurz vor drei. In einer halben Stunde wollte Mom mich für den Termin mit dem Nachlassverwalter abholen, weshalb ich entschied, langsam den Rückweg anzutreten. Ich knipste noch ein paar Bilder, die ich anschließend auf dem Display der Spiegelreflexkamera anschaute. Die meisten waren typische Tourifotos und entsprachen nicht meinen Ansprüchen. Aber mir fehlte die Zeit, jetzt an den Einstellungen herumzuwerkeln, daher würde ich das auf nachher oder morgen verschieben.
Ich beschleunigte meine Schritte, damit mir noch etwas Zeit blieb, mich frisch zu machen und umzuziehen. Vor dem Haus parkte ein bordeauxfarbener Jeep, den ich hier noch nie gesehen hatte. Auf der Veranda stand ein stämmiger Mann, der mir ebenfalls nicht bekannt vorkam.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte ich, als ich näher kam.
Der Mann drehte sich zu mir um. Er trug eine enge schwarze Jeans, schwarze Cowboystiefel und einen Cowboyhut, an dessen Krempe er tippte, während er den Kopf leicht neigte. Ich lief die Stufen zu ihm hoch und stellte mich ihm gegenüber. »Howdy! Sind Sie Ms Pierson?«, fragte er mit starkem Südstaaten-Dialekt. Ich hatte es immer begrüßt, dass weder Gramps noch Meemaw diesen häufig verwendet hatten, wenn ich zu Besuch war. Da ich ihnen kaum folgen konnte, hatten sie den Versuch aufgegeben, ihn mir beizubringen.
Langsam nickte ich. »Holly Pierson, ja.«
Der Mann räusperte sich. »Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Und mein herzliches Beileid zu Ihrem Verlust. Es muss schwer sein, die Großmutter zu verlieren.« Mitfühlend senkte er die Mundwinkel.
»Danke«, entgegnete ich weiterhin skeptisch. »Und Sie sind …?«
»Oh!«, rief er aus und streckte mir seine Hand entgegen. »Wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Mein Name ist Richard Kingsley, Inhaber der Kings & Queens Ranch in Lowerglade.«
Ich legte meine Hand in seine und musste mich zwingen, nicht angewidert den Mund zu verziehen. Seine Haut war schweißnass. Daher war ich glücklich, als er endlich von mir abließ und ich mir klammheimlich die Hand an der Hose abwischen konnte.
Noch immer war ich kaum schlauer als vorher, was Kingsley bemerkt haben musste. Er griff in seine hintere Hosentasche und zog ein kleines rechteckiges Papier hervor. »Sie fragen sich bestimmt, weshalb ich hier bin.«
»In der Tat.«
Er grinste breit. »Das habe ich mir gedacht. Nun, Sie müssen wissen, dass Ihre und meine Ranch nahezu aneinandergrenzen. Schon seit geraumer Zeit habe ich den Wunsch, mich zu vergrößern. Genau deshalb bin ich hier. Ich möchte Ihnen ein Angebot für das Grundstück machen.« Kingsley reichte mir das Papier.
Als ich es an mich nahm und überflog, klappte mir die Kinnlade herunter. »Sind Sie sich sicher, dass Sie sich nicht verschrieben haben?« Noch nie zuvor hatte ich so viele Nullen auf einem Scheck gesehen. Das war so viel Geld, dass Mom und ich nie mehr arbeiten müssten und trotzdem massig übrig bleiben würde.
»Ja, ich bin mir sicher«, sagte Kingsley weiterhin lächelnd.
Dollarzeichen mussten in meinen Augen aufblitzen. Mein Herz polterte unbeständig in meinem Brustkorb, drohte vor Aufregung beinahe herauszuspringen. Ich merkte erst, dass meine Finger zitterten, als ich das Knistern des Schecks hörte.
»Die Entscheidung liegt nicht nur bei mir«, sagte ich, als ich meine Stimme wiederfand. »Wenn Sie mir Ihre Nummer hinterlassen, melde ich mich, sobald ich mehr weiß.«
»Natürlich!« Mit einer schnellen Handbewegung holte Kingsley eine Visitenkarte aus der Brusttasche seines Hemdes. Sein Gesicht grinste mir vom Logo aus entgegen.
»Danke schön.«
Kingsley neigte den Kopf und tippte sich ein weiteres Mal an die Krempe. »Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Ms Pierson. Ich freue mich schon sehr, von Ihnen zu hören.«
Noch einen Moment schaute ich zu Kingsley, während er seinen Wagen ansteuerte und von unserem Grundstück fuhr. Erst als der Jeep hinter der aufgewirbelten Sandwolke verschwand, atmete ich wieder auf.
Ein lauter, quietschender Schrei entfuhr mir. Wie ein Gummibärchen sprang ich auf und ab. Mom würde ausrasten, wenn sie den Scheck sah! Zwar hatten wir bisher nicht mit Sicherheit gewusst, was aus der Ranch werden sollte, aber ein solches Angebot auszuschlagen wäre wahnsinnig. Dass das Grundstück so viele Millionen wert war, hätte ich im Leben nicht gedacht.
Nun konnte ich den Termin mit dem Nachlassverwalter kaum noch erwarten. Schnell schlüpfte ich ins Haus, um mich dafür fertig zu machen.
Kapitel 4
Mom hatte es nicht glauben können. Mehrmals hatte sie den Scheck gegen das Licht gehalten, um einen Hinweis darauf zu finden, dass er vielleicht gefälscht war. Auf die Frage hin, wie sie einen gefälschten Scheck überhaupt erkennen wollte, hatte sie gesagt, sie wisse es selbst nicht.
Minutenlang hatte ich sie dabei beobachtet und klammheimlich in mich hineingegrinst.
Zwei Minuten vor vier parkte Mom den Wagen vor dem Gebäude, in dem unser Treffen stattfand. Es war ein kleiner Bürokomplex mit gerade einmal drei Etagen in Hillsfield, einem Nachbarort von Bibury.
»Bereit?«, fragte Mom.
»Bist du es denn?«
Sie zuckte mit den Schultern und presste die Lippen fest aufeinander. »Ich schätze, schon.«
»Dann bin ich es auch.« Ich warf ihr ein aufmunterndes Lächeln zu, aber ihr Blick huschte nervös umher. Eigentlich wussten wir, was auf uns zukam. Gemeinsam mit dem Nachlassverwalter, Peter Haney, würden wir Meemaws Testament durchgehen und etwaige aufkommende Fragen besprechen. Ein simpler Vorgang, der keinen Grund bot, nervös zu sein.
Nichtsdestotrotz zitterten Moms Finger. Ich umschloss sie mit meiner Hand und drückte sanft zu. »Es wird alles gut laufen, Mom.«
»Ja, du hast recht.« Ein dumpfes Lachen drang aus ihrer Kehle und ließ ihren Körper vibrieren. Dabei schwang ihr hellbrauner Pferdeschwanz hin und her, in dem sich einzelne graue Härchen befanden. »Eigentlich sollte ich für dich da sein, schließlich bist du die Tochter und ich die Mutter.«
»Ach, papperlapapp. Du warst fast zweiundzwanzig Jahre für mich da. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich dir etwas zurückgebe.« Mein Leben lang waren wir durch dick und dünn gegangen. Wir hatten es nicht immer leicht gehabt, ganz besonders, nachdem meine Eltern sich hatten scheiden lassen. Das war der Moment gewesen, in dem wir beinahe bei null hatten anfangen müssen, denn Dad hatte einen Trümmerhaufen zurückgelassen. Jahrelang hatte er Mom betrogen und war schließlich mit seiner neuen Flamme durchgebrannt. Von jetzt auf gleich hatte er seine Sachen gepackt und war fortgegangen. Damals hatte ich nicht verstanden, was passiert war, warum mein Vater uns im Stich ließ. Doch irgendwann wurde ich älter und begriff.
Schlussendlich war es Mom und mir gelungen, die Scherben zusammenzukehren und erhobenen Hauptes weiterzumachen. Uns ein eigenes Leben aufzubauen.