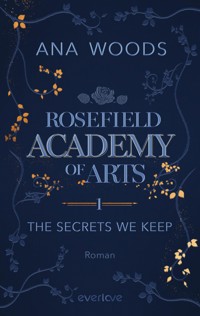9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die »Make a Difference«-Dilogie von Ana Woods rund um die beiden Freundinnen Holly und Kim berührt Herzen und spricht wichtige Themen der Fridays-For-Future-Generation an! Ordnung und Struktur stehen bei Kim an oberster Stelle. Dass sie ohne ihre Freundin Holly den Survival-Urlaub auf Jeopardy Island antreten muss, bringt sie ziemlich aus dem Konzept. Doch sie stellt sich dem Abenteuer, bei dem sie viel über Umweltschutz und bewusstes Leben lernt. Als sie erfährt, dass die Insel einem Luxusresort weichen soll, ist Kim erschüttert. Aber der attraktive und geheimnisvolle Aidan schafft es, sie auf andere Gedanken zu bringen. Trotz der sprühenden Funken ist Kim sich sicher: Es ist nicht mehr als ein Urlaubsflirt. Denn sich zu verlieben, war so nicht geplant. Ana Woods schreibt über Umwelt-, Tierschutz und die ganz großen Gefühle Für Leser:innen von Lilly Lucas und Stella Tack Die Make a Difference-Reihe von Ana Woods: Finding Home - Weil du alles für mich bist
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.everlove-verlag.de
Wenn dir dieser Roman gefallen hat, schreib uns unter Nennung des Titels »Finding Paradise – Weil ich dir vertraue« an [email protected], und wir empfehlen dir gerne vergleichbare Bücher.
© everlove, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Playlist
Prolog
Journal-Eintrag
Tag 30
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Epilog
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Nanni
Du hast dir ein »erwachseneres« Buch gewünscht – hier hast du es 😀
Playlist
A Fine Frenzy
Almost lover
Queen
Bohemian rhapsody
Colbie Caillat
Bubbly
Taylor Swift
Cruel summer
David Bowie
Heroes
Panic! At the disco
High hopes
Linkin Park
In the end
Tim McGraw & Faith Hill
It’s your love
Sarah Connor & Natural
Just one last dance
Oliver James
Long time coming
Jonathan Groff
Lost in the woods
Baptiste Giabiconi
One night in paradise
Monica Naranjo
Oyeme
Kacey Musgraves
Rainbow
Oliver James
The greatest story ever told
Nirvana
The man who sold the world
Ashe & FINNEAS
Till forever falls apart
Stargate, P!nk, Sia
Waterfall
Prolog
Journal-Eintrag
Tag 30
Mein Herz an diesen Ort zu verlieren, war nie Teil meines Plans. Und doch sitze ich nun hier, auf einem Felsen am Rande des Dschungels, und lasse den Blick schweifen.
Ich sehe die Sonnenstrahlen, die sich ihren Weg durch das dichte Blätterdach bahnen, und die unzähligen Blumenarten, deren Farbenpracht mir ein leises Seufzen entlockt. Zu meiner Rechten befindet sich die kleine Lichtung, auf der ein Großteil unseres Basistrainings stattgefunden hat. Das Training, das gerade erst drei Wochen zurückliegt, obwohl es mir wie ein halbes Leben vorkommt.
All das sehe ich und werde wehmütig, denn ich weiß, dass ich gehen muss, obwohl ich mich am liebsten an den nächsten Baum ketten und die Insel nie wieder verlassen würde.
Die frische Luft füllt meine Lunge und erweckt mein Innerstes zu neuem Leben. Die himmlische Melodie paradiesischer Vögel wird durch den Dschungel getragen. Ihr Gesang, dem ich ewig lauschen könnte, zaubert mir ein Lächeln auf die Lippen. In weiter Ferne erklingen das Rauschen des Meeres und das Zerschellen der Wellen an den Klippen.
Ich grabe die Fingerspitzen in die feuchte Erde, schließe einen Moment die Augen und atme tief durch. Nachts hat es geregnet – ich kann es riechen. Der Duft kitzelt mir in der Nase. Er erinnert mich an Freiheit und Abenteuer. Er erinnert mich an all die Ereignisse der vergangenen Wochen. Sie haben mich verändert – auf eine Weise, die ich niemals für möglich gehalten hätte.
Nein, mein Herz an diesen Ort zu verlieren, war nie Teil meines Plans. Doch noch weniger war es geplant, mich bedingungslos in einen Mann zu verlieben – trotz aller Risiken, die das mit sich bringt.
Kapitel 1
Das Baumhaus sah noch genauso aus wie in meiner Erinnerung. Ein flaches Dach, über das sich einzelne dünne Äste senkten, der grüne Anstrich, von dem ich früher dachte, er würde das Haus vor den Augen anderer tarnen, und provisorische Fensterläden, die schief in den Angeln hingen. Der einzige Unterschied bestand darin, dass die Stufen mittlerweile morsch waren, die Farbe abblätterte und die Nägel, die Dad vor all den Jahren mühsam in das Holz gehämmert hatte, Rost ansetzten. Der natürliche Alterungsprozess des Lebens.
Holly schob ihren braunen Haarschopf durch die Türöffnung und winkte mich grinsend nach oben. »Da bist du ja endlich. Hast du dich verlaufen?«
Kopfschüttelnd trat ich auf die erste Sprosse, die gefährlich ächzte. »Nein, aber im Gegensatz zu dir habe ich nicht vergessen, dass die Katzensitterin heute Bonnie und Clyde abholen wollte.«
»Upsi«, ertönte es von oben. Holly hatte ein Gedächtnis wie ein Sieb. Zu ihrem Glück konnte sie sich immer auf mein Organisationstalent verlassen. Andernfalls wäre sie vermutlich aufgeschmissen gewesen.
Drinnen angekommen, holte ich erst einmal tief Luft. Es roch nach feuchtem Holz und Staub. Holly saß auf einem der kleinen bunten Plastikstühle, die wir als Kinder für unsere Teezeremonien verwendet hatten. Dass sie unser Gewicht überhaupt noch trugen, zauberte mir ein Schmunzeln aufs Gesicht. Langsam rappelte ich mich auf, schob mir den blauen Stuhl zurecht und setzte mich.
Es war ewig her, dass ich zuletzt hier gewesen war. Vor zehn Jahren hatten meine Eltern das Haus verkauft. Zwar hatte die neue Besitzerin, die verwitwete Mrs Cooper, Holly und mir erlaubt, das Baumhaus zu nutzen, wann immer wir wollten, aber dieses Angebot hatten wir bisher nur ein paarmal in Anspruch genommen.
Nun an diesem kleinen Holztisch zu sitzen, in den wir früher Bilder geritzt hatten, ließ mich nostalgisch werden. Mit den Fingern fuhr ich die Konturen eines krummen Strichmännchens nach. »Warum wolltest du dich ausgerechnet hier mit mir treffen?«
Holly zuckte mit den Schultern und öffnete ihren Rucksack. »Ich weiß auch nicht.« Sie holte zwei Trinkpäckchen und eine Tüte Cracker heraus, die sie vor uns abstellte. »Es ist einfach so ein Gefühl, dass dieser Sommer uns verändern wird. Da dachte ich, es wäre schön, an den Ort zurückzukehren, an dem alles angefangen hat.«
Ein Lächeln zupfte an meinen Mundwinkeln, gleichzeitig wurde mir schwer ums Herz. Ich erinnerte mich noch genau an den Tag vor fünfzehn Jahren, an dem Holly weinend in meinem Baumhaus gesessen hatte. Wie jeden Nachmittag war ich zum Spielen raufgeklettert. Da hatte ich sie gefunden – ein fremdes Mädchen mit zerzausten braunen Haaren und verquollenen blauen Augen, das sich wimmernd dafür entschuldigt hatte, bei mir eingebrochen zu sein.
Anstatt sie zu verpetzen, hatte ich mich zu ihr gesetzt und sie gefragt, weshalb sie weinte. Sie hatte mir von der Scheidung ihrer Eltern erzählt und dass sie aus diesem Grund von zu Hause abgehauen war. Als es zu regnen angefangen hatte, war sie in das Baumhaus geklettert, um sich zu verstecken.
Anschließend hatte ich sie zum Essen zu uns eingeladen. Mom und Dad hatten sofort Hollys besorgte Eltern angerufen, die sie kurze Zeit später bei uns abgeholt hatten. Seitdem waren wir unzertrennlich und lebten seit mittlerweile drei Jahren zusammen in einer Zweier-WG hier in Los Angeles.
»Was hat Mrs Philipps eigentlich zu deiner Arbeit gesagt?«, fragte Holly. Ihre Stimme riss mich aus den Gedanken.
»Sie fand sie gut.« Hastig öffnete ich die Tüte und nahm mir ein paar der salzigen Cracker heraus.
»Und weiter? Muss ich dir immer alles aus der Nase ziehen?« Ermahnend hob Holly ihren Zeigefinger und versuchte, ihn hin und her wackeln zu lassen. Aufgrund ihrer kaum bis gar nicht vorhandenen motorischen Fähigkeiten sah es aber eher so aus, als würde sie in der Luft kleine Kreise ziehen. Ich biss mir auf die Unterlippe, aber Holly kannte mich gut genug, um zu wissen, was ich dachte. »Witzig, Kim, sehr witzig.«
»Finde ich auch«, erwiderte ich grinsend. »Also, Mrs Philipps war sehr angetan von der Arbeit und nannte sie eine Offenbarung.«
»Das ist ja großartig! Ich wusste, du schaffst das. Wenn jemand einen interessanten Artikel über aus der Kantine verschwundene Lebensmittel schreiben kann, dann du!«
Der Artikel war wirklich gut geworden, obwohl ich anfangs nicht sehr begeistert von der mir zugewiesenen Aufgabe gewesen war. Wir hatten im vergangenen Semester des Journalismusstudiums so viele Themengebiete durchgenommen, und ausgerechnet mir war für den Abschlussartikel investigative Arbeit zugeteilt worden. Aber ich hatte mich schnell eingefunden und mich bei der Bearbeitung wie eine Detektivin gefühlt, war sämtlichen Spuren nachgegangen und hatte mich richtig hineingesteigert. Über Wochen hatte ich gemeinsam mit Holly meine Umgebung genauestens analysiert. An einigen Tagen hatten wir uns mit Fernglas und Nervennahrung gewappnet versteckt, um den Übeltäter auf frischer Tat zu ertappen. Was uns schlussendlich auch gelungen war.
Der Kochauszubildende unserer Universität war es gewesen! Wann immer er Geschirr oder Speisen von A nach B bringen musste, hatte er Essen unter der Tischdecke versteckt und mit rausgeschmuggelt. Richtig misstrauisch waren wir geworden, als er mit dem Rollwagen im Hauswirtschaftsraum verschwunden war. Als ich die Tür aufgerissen hatte, hatte er auf dem Boden gesessen – die Puddingschüssel auf dem Schoß und eine Suppenkelle, die er als Löffel missbraucht hatte, in der Hand. Holly hatte sofort ihre Kamera gezückt und ein Foto von ihm geschossen. Sein entsetzter Gesichtsausdruck zierte nun die Titelseite meines Artikels.
»Du guckst echt gruselig, woran denkst du?«, fragte Holly. Als ich mit den Fingerspitzen mein Gesicht abtastete, erfühlte ich das diabolische Grinsen, das sich auf meine Lippen gelegt hatte. Eigentlich hatte ich keinen Grund zu lachen, denn der Azubi war aufgrund meiner Investigationsarbeit hochkant rausgeflogen.
»Ach, nichts«, erwiderte ich rasch und versuchte, nicht weiter über das College nachzudenken. Es erinnerte mich nur tagtäglich daran, dass ich nicht wusste, was ich mit mir anfangen sollte.
Bis zum Abschluss war alles genau durchgeplant. Mein Leben bestand aus ellenlangen Listen, die ich für absolut alles führte – To-do-Listen, Einkaufszettel, stundengenaue Tagesabläufe. Wobei Holly mich mittlerweile wenigstens so weit gebracht hatte, dass ich zwischendurch einen PfS – Puffer für Spontanes einplante. Das war bis zum Ende der Highschool noch undenkbar gewesen, denn ohne konkrete Pläne fühlte ich mich unwohl und gewissermaßen verloren. Ich brauchte Ordnung und Struktur.
Dass ich Journalistin werden wollte, hatte ich schon immer gewusst. Nur die genaue Richtung war mein Problem. Es gab zu viele Dinge, die mich interessierten. Auch zahlreiche Praktika später hatte es nichts gegeben, das ein waschechtes Feuer in mir entfacht hatte, sodass ich allmählich Zweifel bekam, ob dieser Weg wirklich der richtige für mich war.
»Du solltest dir nicht so das Hirn zermartern«, sagte Holly. »Das Camp wird dir sicher guttun, und ich verwette meine Kamera darauf, dass du danach genau wissen wirst, womit du den Rest deines Lebens verbringen willst.«
»Meinst du nicht, deine Kamera ist ein zu hoher Einsatz?«, fragte ich mit hochgezogenen Augenbrauen.
Holly zuckte mit den Schultern. »Nicht wirklich, weil ich weiß, dass ich ohnehin gewinnen werde.«
Schnaubend schüttelte ich den Kopf. Ja, Holly kannte mich besser als ich mich selbst. Aber dieses eine Mal hatte ich Bedenken, ob sie richtiglag. Doch das war kein Thema, das ich jetzt vertiefen wollte. Nicht, wo uns morgen der große Abschied bevorstand.
»Hast du noch etwas von deiner Mutter gehört?«, fragte ich, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
Holly seufzte. »Ja, wir haben vorhin telefoniert. Wir verbringen nun doch keine Nacht in Phoenix. Stattdessen holt sie mich morgen schon um vier Uhr früh ab, damit wir abends in Bibury sind.«
»Bist du sicher, dass ich euch nicht begleiten soll? Noch kann ich …«
»Nein«, unterbrach Holly mich. »Mir geht es gut, ehrlich. Natürlich wäre es schön gewesen, Meemaw noch einmal zu sehen, aber na ja. Jedenfalls möchte ich, dass du den Urlaub antrittst. Für uns beide! Wir haben uns doch so darauf gefreut, und außerdem hast du diese Auszeit bitter nötig. Du sollst dich nicht zusätzlich noch mit meinen Problemen belasten.«
»Okay«, sagte ich eher widerwillig. Es stimmte mich etwas traurig, dass sie ihre Probleme als Belastung für mich ansah, denn das waren sie nicht.
Dennoch hatte sie zum Teil recht. Aber es war ein unglaublicher Schritt, so lange von Holly getrennt zu sein. Wir waren nicht nur beste Freundinnen, sondern studierten auch beide an der Jameson University und verbrachten den Großteil unserer Zeit zusammen, ohne einander auf den Keks zu gehen.
Den Urlaub hatten wir ebenfalls gemeinsam antreten wollen, und ob ich ihn ohne Holly überstehen würde, stand in den Sternen. Das Camp war ein Kompromiss zwischen uns gewesen. Da ich die Natur liebte und die frische Luft am Strand oder im Wald immer dafür sorgte, dass man den Kopf frei bekam und die Gedanken treiben lassen konnte, wollte ich unbedingt einen Outdoorurlaub machen. Holly mochte die Natur zwar auch, aber vor allem liebte sie das Abenteuer. Genau deshalb hatte sie uns beide zu einem dreißigtägigen Survivalcamp auf einer Insel inmitten des Indischen Ozeans angemeldet. Dass sie nun selbst nicht teilnehmen konnte, war ärgerlich, aber nicht zu ändern. Schließlich hatte sie es sich nicht ausgesucht, nun mit ihrer Mom auf die Familienranch nach Texas fahren zu müssen, um den Nachlass ihrer plötzlich verstorbenen Großmutter zu verwalten.
Ich hätte Holly zwar lieber an meiner Seite gehabt, aber ihr zuliebe würde ich allein fliegen. Wenigstens hatte es online genaue Tagesabläufe zur Einsicht gegeben, die mir eine kleine Stütze sein würden, wenn schon meine beste Freundin das nicht sein konnte.
»Jetzt schau doch nicht wie drei Tage Regenwetter!«, sagte Holly amüsiert. »Du wirst schon sehen, die Zeit vergeht wie im Flug.«
»Schon möglich. Aber vielleicht verlierst du dein Herz an die Ranch, mutierst zu einem waschechten Cowgirl und kommst nie mehr zurück«, witzelte ich und nahm einen Zug aus meinem Trinkpäckchen.
Holly lachte auf. »Genau! Und du findest deinen Tarzan, mit dem du dich von Liane zu Liane schwingst.«
Nun stimmte ich in ihr Lachen mit ein, denn alles an diesem Gedanken war abwegig. Seit mein langjähriger Highschoolfreund Jonas mich kurz vor dem Abschlussball abserviert hatte, hatte ich mit Männern nicht mehr viel am Hut. Hin und wieder ein paar Dates, aber nichts Ernstes. Für die Liebe hatte ich ohnehin keine Zeit. »Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass du in Texas bleibst, ist deutlich höher.«
»Wir werden sehen. Eigentlich hoffe ich, den studentischen Aushilfsjob in der Grafikabteilung der LA Times zu bekommen und nach Meemaws Beerdigung ganz schnell zurück nach Hause fahren zu können.«
»Sicher? Möchtest du nicht noch ein paar Wochen bleiben? Du liebst Bibury doch so sehr.«
»Ja, ich bin mir sicher.« Hollys Mundwinkel zuckte zwar, aber etwas in ihrer Miene veränderte sich. Wie es nur allzu oft der Fall war, wenn das Thema zur Sprache kam.
Als Kind war sie jeden Sommer mit ihrer Mutter auf der Familienranch in Bibury gewesen, und einige Male hatte ich sie begleitet. Sobald sie auf dem Rücken eines Pferdes saß, ging für sie die Sonne auf. Doch nach einem Streit zwischen ihrer Mutter und Meemaw, war sie nicht mehr hingefahren. Das hatte Holly schon immer etwas traurig gestimmt, weshalb ich ihr mehrmals angeboten hatte, sie wieder nach Bibury zu begleiten. Aber diese Angebote hatte sie stets ausgeschlagen.
»Übrigens habe ich noch eine Kleinigkeit für dich.« Holly wechselte das Thema und holte eine mit dunklem Samt überzogene Schachtel aus ihrem Rucksack.
»Willst du mir einen Heiratsantrag machen?«, fragte ich und nahm das Kästchen entgegen.
Hollys Augen weiteten sich vor Entsetzen. »Und ich dachte, wir wären einander ohnehin schon längst versprochen!«
Kopfschüttelnd hob ich den Deckel an. Zum Vorschein kam ein kleiner silberner Anhänger in Form eines Smartphones. Mit einem breiten Grinsen holte ich ihn heraus. »Wofür steht er?«
»Dafür, dass wir den Sommer über nur mittels Handy kommunizieren können«, entgegnete Holly und streckte mir ihr Handgelenk entgegen, an dem ihr Armband mit einem identischen Anhänger baumelte.
»Ich liebe ihn!« Und das meinte ich ernst. Vor rund zehn Jahren hatten wir uns beide das gleiche Armband gekauft, das wir immer um einen Anhänger erweiterten, wenn wir ein einschneidendes Erlebnis oder einen ganz besonderen Moment geteilt hatten. Seien es die kleinen Mickey-Mouse-Ohren, die wir uns im Disney World Resort in Orlando geholt hatten, oder der silberne Katzenanhänger mit blauen Glitzeraugen, den wir uns gekauft hatten, kurz nachdem Bonnie und Clyde bei uns eingezogen waren. Mittlerweile war eine beachtliche Sammlung entstanden, und ich hatte gehofft, dass wir nach dem Sommer vielleicht ein kleines Zelt würden dranhängen können. Nun war es lediglich ein Smartphone geworden – was schade war, doch es rührte mich, dass sie überhaupt daran gedacht hatte, wo ihr gerade unzählige andere Dinge im Kopf herumschwirren mussten.
Holly griff über den Tisch nach meinem Arm und half mir, den Anhänger zu befestigen. Anschließend hob ich mein Handgelenk und betrachtete das kleine Smartphone, in das mehrere bunte Steinchen eingelassen waren. Den stechenden Schmerz, der sich in meiner Brust festsetzte, ignorierte ich. Vier Wochen auf einer Insel unter Fremden. Für manche mochte das ein wahr gewordener Traum sein, aber ich würde Holly unglaublich vermissen.
Wir waren Anfang zwanzig, bald mit dem College fertig, und vielleicht würde es uns dann in unterschiedliche Himmelsrichtungen verschlagen. Nun war also die perfekte Gelegenheit, sich schon mal an den Gedanken zu gewöhnen, auch wenn dieser wehtat.
»Hey! Jetzt heul bloß nicht, sonst muss ich mitheulen.« Sie stand auf, setzte sich neben mich und stupste mir den Ellbogen in die Seite. Das leise Wimmern in ihrer Stimme konnte aber auch sie nicht unterdrücken.
Hinter meinen Lidern brannte es, doch ich blinzelte die Tränen fort, presste die Lippen aufeinander und nickte. »Nein, hier wird nicht geheult. Wir sind schließlich keine Babys mehr.«
Holly lachte, dann zog sie mich in eine feste Umarmung. »Versprich mir, dass du so oft anrufst, wie es irgendwie geht.«
»Natürlich. Jeden Tag.«
»Gut.« Holly ließ von mir ab – ihre Augen schimmerten glasig. »Du wirst mir fehlen, Blossom.«
»Du mir auch, Bubbles, du mir auch.«
Kapitel 2
Der Boden unter den Sohlen meiner Wanderschuhe war klebrig. Ich wollte gar nicht so genau wissen, was hier schon alles verschüttet worden war. Ohne weiter darüber nachzudenken, rannte ich an etlichen gehetzten Reisenden vorbei. Einige von ihnen riefen mir wüste Beschimpfungen nach, als ich sie versehentlich mit meinem großen Trekkingrucksack anrempelte.
Entschuldigend hob ich die Hand und sprang mit einem Satz auf die Rolltreppe, auf der ich erst mal ordentlich ins Straucheln geriet. Konnte man sich jemals an ein solches Gewicht auf dem Rücken gewöhnen? Nachdem ich die Balance zurückerlangt hatte, nahm ich zwei Stufen auf einmal. Oben angekommen, drehte ich mich unbeholfen im Kreis und blickte mich um.
In wenigen Metern Entfernung baumelte ein altmodisches Metallschild von der Decke. Ein ausgeblichener Pfeil darauf deutete in Richtung Gate sieben.
Ich mobilisierte meine letzten Kraftreserven und setzte zu einem alles entscheidenden Spurt an. Als das Gate endlich in Sicht kam, riss ich die Arme hoch und wedelte mit den Händen über meinem Kopf herum.
»Warten Sie!«, rief ich vollkommen außer Atem. »Ich bin Kimberly Chapman!«
Die Dame, die eben dabei war, die Tür zu schließen, hielt in der Bewegung inne und wandte sich mir zu. Die dunklen Haare hatte sie zu einem strengen Zopf nach hinten gebunden, und durch die spitz gefeilten Fingernägel wies sie eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Raubkatze auf. »Sie sind spät dran. Boarding Pass, bitte.«
»Tut mir leid, der Flieger aus Amsterdam hatte Verspätung, und dann hat der Sicherheitscheck so lange gedauert und …« Ungeduldig trommelte die Mitarbeiterin mit den Nägeln auf den kleinen Arbeitstisch vor sich. Keuchend nahm ich den Rucksack ab, holte Reisepass und Flugticket hervor und reichte ihr beides.
Mit flinken Fingern tippte sie auf der Tastatur herum, scannte den Sicherheitscode und nickte. »Gut. Kommen Sie.«
Schnell schwang ich mir den Rucksack wieder auf den Rücken, wobei ich abermals beinahe das Gleichgewicht verlor, und folgte der Dame durch die Tür. Ich war zwar relativ sportlich, aber ich war es nicht gewöhnt, mit so vielen Kilos auf dem Rücken zu rennen.
Am Ende des Korridors öffnete die Mitarbeiterin eine weitere Tür. Augenblicklich pustete mir unendlich drückende Luft entgegen. Das Gefühl, keinen Sauerstoff in meine Lunge zu bekommen, verflüchtigte sich allerdings, sobald ich die klapprige kleine Propellermaschine sah, die den Anschein erweckte, seit Generationen nicht mehr gewartet worden zu sein. Mir rutschte das Herz in die Hose, und ein Schweißfilm benetzte meine Stirn.
Ich hatte mich darüber informiert, wie wir von Sri Lanka nach Jeopardy Island kommen würden, aber online hatte die Maschine wesentlich moderner ausgesehen.
»Miss Chapman?« Die Dame warf mir einen zugleich besorgten und genervten Blick über die Schulter zu. »Bitte beeilen Sie sich.«
Mechanisch nickte ich. Noch einmal holte ich tief Luft, umklammerte die Rucksackträger fester und beschleunigte meine Schritte.
»Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise«, sagte die Dame, als wir vor der Metalltreppe angekommen waren.
»Danke«, entgegnete ich, woraufhin sie sich umdrehte und wieder Richtung Terminal verschwand. So schnell mich meine Beine trugen, hechtete ich die Stufen hinauf.
Kaum dass ich schnaufend den schmalen Mittelgang betrat, musterten mich zahlreiche Augenpaare. Ich murmelte leise Entschuldigungen, während ich mich zu meinem Platz vorkämpfte – 3A. Dabei schaute ich starr nach oben und versuchte, die verblassten Schilder unter dem Stauraum für Handgepäckstücke zu entziffern.
Meine Lippen formten ein Lächeln, als sich endlich Reihe drei vor mir auftat. Den Blick weiterhin auf das Schild gerichtet, bemerkte ich zu spät, wo ich hintrat. Mit dem Träger blieb ich an der Armlehne eines der Sitze hängen. Schmerzhaft wurde ich zurückgeschleudert. Der Sturz wurde glücklicherweise von dem Rucksack abgefedert, sodass ich mich nicht ernsthaft verletzte, trotzdem war mir die Situation außerordentlich peinlich. Wie eine Schildkröte, die auf dem Panzer lag, versuchte ich, mich wieder aufzurappeln.
»O Gott, ist alles in Ordnung?«, fragte eine Asiatin mittleren Alters in gebrochenem Englisch. Sie beugte sich über mich und griff nach meinen Unterarmen, um mir wieder hochzuhelfen. Hitze stieg mir in die Wangen.
»Danke, ja, alles bestens«, erwiderte ich. Doch eigentlich war gar nichts bestens. Ich war gerade mal einen Tag unterwegs, und bisher war überhaupt nichts nach Plan verlaufen. Und nun machte ich mich vor den rund zwanzig Personen, mit denen ich die kommenden Wochen verbringen musste, auch noch gleich am ersten Tag lächerlich. Hätte der Urlaub besser starten können? Sobald wir gelandet waren, musste ich Holly anrufen und ihr mein Leid klagen.
Die Frau, die mir eben aufgeholfen hatte, lächelte und ging zurück in ihre Reihe. Noch einmal murmelte ich Entschuldigungen, als ich vorsichtig weiterlief. Im Vorbeigehen stieß ich versehentlich einen Mann an, dessen Ellbogen halb im Gang hing.
»Pass doch auf!«, knurrte er. Seine Brauen waren zusammengezogen, und ein paar braune Strähnen hingen lose aus dem nach hinten gebundenen Knoten, den er wohl Zopf nannte. Ein wütendes Funkeln lag in seinen dunklen Augen.
»Mach du dich nicht breiter, als du bist«, entgegnete ich schroff.
»Haben wir wegen dir nicht schon genug Verzögerung? Jetzt Abmarsch!« Mit ausgestrecktem Zeigefinger deutete er nach vorn. Eine weitere bissige Bemerkung lag mir auf der Zunge, aber ich schluckte sie hinunter. Schließlich wollte ich es mir nicht gleich heute mit allen verscherzen. Daher klimperte ich mit den Wimpern und lächelte zuckersüß, woraufhin dieser überaus sympathische Kerl stöhnend die Augen verdrehte und sich mit vor der Brust verschränkten Armen wieder in seinem Sitz zurücklehnte. Na, hoffentlich musste ich nicht mehr Zeit als nötig mit ihm verbringen.
Um den Start nicht noch weiter aufzuschieben – und mir nicht noch mehr Feinde zu machen –, lief ich zügig die letzten zwei Meter bis zu meinem Platz. Neben mir saß die freundliche Dame, die mir eben nach meinem Sturz aufgeholfen hatte. Schnell holte ich mein Journal, Stift und Kopfhörer aus dem Rucksack, ehe ich ihn in das Fach über mir stopfte und mich in das Sitzpolster fallen ließ.
»Ich bin Ayu.« Meine Sitznachbarin neigte den Kopf. »Ayu Yamamoto.«
Ich streckte ihr meine Hand entgegen. »Kimberly, aber nennen Sie mich ruhig Kim.«
Irritiert schaute Ayu auf meine Hand, ehe sie zögerlich ihre hineinlegte. Natürlich, das hatte ich völlig vergessen. In den meisten asiatischen Ländern war ein Händeschütteln zur Begrüßung eher unüblich.
»Sind Sie allein hier?«, fragte ich.
»Nein, mein Mann sitzt zwei Reihen hinter uns«, entgegnete sie lächelnd. »Und du?«
Instinktiv senkten sich meine Mundwinkel, obwohl ich mit einer Gegenfrage hätte rechnen müssen. »Ja, leider. Eigentlich wollte meine beste Freundin mich begleiten, aber ihr ist etwas dazwischengekommen.«
»Das ist sehr schade. Aber ich bin mir sicher, dass du hier schnell neue Freunde finden wirst.«
Neue Freundschaften zu schließen war noch nie meine Stärke gewesen. Ich hatte nie jemand anderen gebraucht als Holly. Es war nicht so, dass ich die Gesellschaft anderer Menschen nicht schätzte, aber es fiel mir schwer, mich Fremden wirklich zu öffnen. Daher waren es meistens nur wir beide gegen den Rest der Welt. Trotzdem hoffte ich, dass Ayu recht behalten würde. Es wäre sicher schön gewesen, jemanden zu haben, mit dem ich mich in den nächsten Wochen austauschen konnte.
»Willkommen an Bord. Mit zwanzigminütiger Verspätung werden wir nun die Reise nach Jeopardy Island antreten. Legen Sie Ihren Sicherheitsgurt an, und bleiben Sie so lange angeschnallt, bis das Symbol über Ihnen nicht mehr leuchtet. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug«, ertönte die knatternde Ansage durch die Lautsprecherboxen.
»Wie aufregend!« Ayu klatschte fröhlich in die Hände. Ihre Euphorie schwappte auf mich über, sodass auch ich grinste, während ich meinen Gurt fester zog.
Ich ließ den Blick aus dem Fenster wandern und stellte fest, dass sich das Flugzeug bereits in Bewegung gesetzt hatte. Langsam rollte die Maschine vorwärts, während die Propeller bei jeder Umdrehung gefährlich schepperten. Ein flaues Gefühl setzte sich in meinem Magen fest. Ich versuchte, die umherkreisenden Gedanken daran, was in der Luft alles geschehen konnte, zu verdrängen.
Zwar gab es für mich kaum etwas Schöneres, als zu reisen und die Welt zu erkunden, aber wann immer ich mein Leben in die Hände eines Piloten legen musste, wurde mir mulmig zumute.
In Tausenden Meilen Höhe war man allem schutzlos ausgeliefert. Mir war bewusst, dass die Wahrscheinlichkeit, bei einem Autounfall ums Leben zu kommen, deutlich höher war, aber hinter einem Lenkrad oder auf dem Beifahrersitz verspürte ich nie diese aufkeimende Panik, die sich nur mit Mühe und Not hinunterschlucken ließ.
Schnell entwirrte ich meine Kopfhörer und steckte sie mir in die Ohren. Meine Finger glitten über mein Handydisplay und klickten sich durch diverse Playlists, bis ich bei meinem Best Of Rock-Album angekommen war.
Die Musik erfüllte mich. Für andere mochte es unvorstellbar sein, doch bei mir galt: Je lauter die Musik, desto besser konnte ich mich konzentrieren. Das war schon immer so gewesen und hatte mir früher die eine oder andere Standpauke meiner Eltern eingebracht. Nach langen Tagen in der Kanzlei wollten sie sich diesen Krach nicht antun müssen. Daher hatte ich mir angewöhnt, Kopfhörer aufzusetzen. Musik an, Welt aus.
Wann immer ich an solche Momente zurückdachte, wünschte ich mir, ein besseres Verhältnis zu meinen Eltern zu haben. Bis zur Middle School waren wir ein Herz und eine Seele gewesen, aber sobald sich herauskristallisiert hatte, dass ich kein Interesse daran hatte, Jura zu studieren und eines Tages die Kanzlei zu übernehmen, hatte sich unsere Beziehung allmählich verändert.
Besonders Mom hatte immer viel Wert darauf gelegt, dass ich etwas aus meinem Leben machte. Was so viel bedeutete, wie in ihre, Dads und Grandpas Fußstapfen zu treten und eine Karriere als Anwältin anzustreben. Dass ich lieber Journalistin werden wollte, konnten meine Eltern nicht verstehen. Doch ich wollte diesen Weg einschlagen und mir nicht von ihnen in meine Zukunft reinreden lassen, egal wie oft sie es auch versucht hatten.
Ich schloss die Augen, atmete tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Das waren Dinge, an die ich im Moment nicht denken wollte.
Erst als die negativen Gedanken fort waren, hob ich die Lider wieder und schaute auf mein Journal. Im Takt der Musik nickend strich ich über den mit grünem Stoff überzogenen Einband. Durch die eingearbeiteten blätterförmigen Goldornamente erinnerte es mich an einen Dschungel, weshalb ich es mir extra für die Reise gekauft und bereits mit zahlreichen Informationen gefüllt hatte.
Ich klappte es auf und überflog die Abläufe der kommenden Tage, um mich schon mal mental darauf vorzubereiten. Zunächst gab es ein mehrtägiges Basistraining, bei dem die Guides uns beibrachten, wie man in der Wildnis am besten zurechtkam. Gänzlich unvorbereitet war ich natürlich trotzdem nicht. Ich hatte viele Stunden investiert, um mir Youtube-Videos zum Thema Survivaltraining und -urlaub anzuschauen.
Außerdem hatten Holly und ich uns jede Realityshow angesehen, die wir finden konnten. Dabei hatten wir Wetten abgeschlossen, welche Teilnehmer es am längsten schafften, in der Wildnis zu überleben, und welche bereits nach wenigen Tagen das Handtuch warfen. Es war unfassbar, wie viele solcher Sendungen es gab. Und ich glaubte, wir hatten jede Einzelne davon inhaliert.
Mit dem Kugelschreiber tippte ich auf den heutigen Ablaufplan. Sollte nichts weiter dazwischenkommen, würden wir anstatt um halb eins nun gegen ein Uhr landen, womit sich kaum etwas verschob. Heute stand lediglich eine kurze Einführung inklusive Kennenlernen der Guides und der anderen Teilnehmer auf dem Plan. Die Pause hatte ich mir gefüllt mit: auspacken, einrichten, PfS, Holly anrufen (und hoffen, dass sie ihr Handy auf laut gestellt hat).
Aufgrund der knapp zwölfstündigen Zeitverschiebung zwischen Jeopardy Island und Bibury würde das mit den Telefonaten schwierig werden, vor allem, da Holly normalerweise nicht vor neun aus dem Bett zu kriegen war. Aber die Tage hier auf der Insel begannen schon gegen sechs, weshalb ich sicherlich jeden Abend tot ins Bett fallen würde. Es blieb also nur, das Beste zu hoffen.
Noch ein letztes Mal schaute ich aus dem Fenster und lächelte beim Anblick des klaren Blaus und der Sonne, die hoch am Himmel stand. Ich schloss das Journal und presste es mir an die Brust, während The Man Who Sold the World von Nirvana an meine Ohren drang.
Das Survivalcamp würde mich an meine Grenzen bringen. Doch ich würde es schaffen, für Holly und auch für mich. Ich war bereit, mich diesem Abenteuer zu stellen.
Kapitel 3
Die knatternd aus den Lautsprechern dringende Stimme des Piloten weckte mich aus meinem kurzen Schlaf. »Wenn Sie nun aus dem Fenster schauen, offenbart sich Ihnen ein einmaliger Blick auf Jeopardy Island von oben.«
Aufgeregtes Gemurmel ging durch die Reihen. Ayu hatte die Nase beinahe gegen die Scheibe gedrückt, weshalb ich nicht die beste Sicht hatte. Doch bereits das wenige, das ich sehen konnte, raubte mir den Atem.
Wir flogen gerade über das Tiefland, das durch mehrere hügelige Grünflächen und dichte Regenwälder bestach. In einiger Entfernung ragten bewaldete Berge in die Höhe, reichten beinahe bis in die Wolken. Bei genauerer Betrachtung erkannte man ein Funkeln zwischen dem Grün. Vermutlich waren das die zahlreichen Bergflüsse.
Zu unserer Rechten erstreckten sich die endlosen Weiten des Ozeans. Das rauschende Meer zerschellte an den Klippen, ehe es sich zurückzog, um sich ein weiteres Mal aufzutürmen.
Meine Liebe zum Meer war schon immer ausgeprägt gewesen, und in Los Angeles hatte ich es glücklicherweise direkt vor der Tür. Aber die Farbe des Wassers zu Hause war nicht ansatzweise vergleichbar mit der des Indischen Ozeans.
»Wunderschön, nicht wahr?« Ayu wandte sich mir zu. Ein Glitzern lag in ihren Augen.
Zu mehr als einem Nicken war ich nicht imstande. Dieser Anblick hatte mir im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen.
Nur wenige Minuten später flog die kleine Maschine über dichten Dschungel, ehe die Räder ruckelnd auf eine Lichtung trafen. Aus dem Augenwinkel sah ich unzählige Bäume an uns vorbeisausen, und ich hoffte, dass wir keinen davon rammen würden.
Noch während das Flugzeug ausrollte, wurde das Innere vom Klacken sich öffnender Gurte erfüllt. Ein Geräusch, das mich erleichtert aufatmen ließ. Der Flug war überstanden.
Erst als die Passagiere der hinteren Reihen ausgestiegen waren, stand auch ich auf und öffnete das Handgepäckfach. Neben meinem schweren Trekkingrucksack befand sich noch ein etwas kleinerer, ebenfalls khakifarbener darin.
»Gehört der Ihnen?«, fragte ich und hielt ihn Ayu entgegen.
»Ja, vielen Dank. Das ist wirklich sehr freundlich.« Ihr warmherziges Lächeln war ansteckend.
Ich schwang mir die Träger über die Schultern, klemmte mein Journal unter den Arm und lief den schmalen Gang entlang. Vor Aufregung spielte ich an den Anhängern meines Armbandes.
Je näher ich dem Ausgang kam, desto mehr beschleunigte sich mein Herzschlag. Ein Steward stand an der Tür und verabschiedete die Passagiere. »Einen angenehmen Aufenthalt.«
»Vielen Dank.« Lächelnd trat ich hinaus. Augenblicklich knallte mir die heiße Mittagssonne direkt ins Gesicht. Es war unfassbar warm, die Luftfeuchtigkeit noch höher als in Sri Lanka, und keine einzige Brise wehte. Der Stoff der dunkelbraunen Wanderhose war wenigstens atmungsaktiv, dennoch brach mir prompt der Schweiß aus.
Langsam ging ich die Stufen hinunter und auf die Menschentraube zu, die sich unter einem Schatten spendenden Baum versammelt hatte. Schräg hinter mir wurden gerade die Koffer aus der Maschine und auf Jeeps geladen. Das mussten die Fahrzeuge sein, die uns ins Camp bringen würden.
Die Lichtung war nicht sonderlich groß, weshalb es erstaunlich war, wie perfekt der Pilot die Maschine hier gelandet hatte. Doch vermutlich war dies nicht sein erster Flug nach Jeopardy Island gewesen.
Ringsherum befand sich das Dschungelgebiet, aus dem die himmlischen Melodien paradiesischer Vögel drangen. Etwas unbeholfen zog ich mein Handy aus der Hosentasche und schoss ein paar Fotos, die ich Holly nachher unbedingt schicken musste, wenn sie schon nicht hier sein konnte. Zwar konnte ich die vielen Stockwerke des Waldes niemals so einfangen, wie ich sie vor mir sah, trotzdem war ich mir sicher, dass die Bilder Holly gefallen würden.
Noch immer war ich nervös. Darüber zu reden, sich allein so weit von zu Hause zu entfernen, und es dann tatsächlich zu tun, waren zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Für einen Moment schloss ich die Augen und atmete tief durch. So lange, bis sich mein Herzschlag allmählich beruhigte.
Als ich die Lider wieder hob, ging es mir schon besser. Ich sah Ayu, die neben einem offenbar gleichaltrigen Mann stand. Während sie mich heranwinkte, lächelte sie. Erleichtert ging ich auf die beiden zu. Auf den ersten Blick schien ich die Einzige zu sein, die allein angereist war. Oder die anderen waren einfach geselliger als ich, was durchaus im Bereich des Möglichen lag.
»Es ist so schön hier!« Aufgeregt wippte Ayu auf ihren Füßen vor und zurück. Dann stupste sie ihrem Mann den Ellbogen in die Seite und funkelte ihn an. »Sei nicht unhöflich, stell dich vor.« Es war offensichtlich, wer in deren Beziehung die Hosen anhatte.
Der Mann neigte den Kopf und versuchte sich an einem Lächeln. »Satoshi Yamamoto. Freut mich, dich kennenzulernen.«
»Kimberly Chapman«, entgegnete ich und lächelte ebenfalls etwas verlegen. Glücklicherweise war Ayu ein so offenherziger Mensch, dass ich mich nicht gänzlich unwohl fühlte.
Sie nahm die Kamera, die um ihren Hals baumelte, und knipste ebenfalls ein paar Bilder, die sie anschließend mit einem anerkennenden Gesichtsausdruck auf dem Display anschaute.
Ein Klatschen ertönte. »Kommt bitte alle etwas näher«, rief ein Mann und hob die Hand. Er trug eine braune Wanderhose, ein beiges Hemd und eine Schirmmütze, die ihm vor der hoch stehenden Sonne Schutz bot. Ein paar wenige dunkle Haare lugten darunter hervor. Es musste sich bei ihm und der brünetten Frau, die neben ihm stand, um unsere Guides handeln.
Die Gruppe lief los, und ich fühlte mich sofort wie in einer Konzertschlange. Von allen Seiten wurde gedrängelt. Hinter mir rangelten zwei Teenager miteinander. Als einer der beiden mir versehentlich seinen Ellbogen in die Seite rammte, taumelte ich einen Schritt nach vorn und stieß gegen den Rücken des Mannes vor mir.
Dieser schaute mich über die Schulter hinweg grimmig an. »Du schon wieder.« Es war der überaus sympathische Kerl aus dem Flugzeug.
»Entschuldigung, ich wurde angerempelt«, versuchte ich mich herauszureden. Am liebsten hätte ich mich selbst geohrfeigt. Normalerweise ließ ich mich nicht so leicht aus der Fassung bringen, aber der Blick aus seinen grün-braunen Augen, der noch immer auf mir ruhte, machte mich nervös. Dass dem Mann eine süßlich-erdige Note von Sandelholz anhaftete, machte die Sache nicht besser.
Kopfschüttelnd drehte er sich wieder um. Ich wünschte, der Erdboden hätte sich in jenem Moment aufgetan. Wir hatten nun wirklich alles andere als einen guten Start gehabt.
»Willkommen auf Jeopardy Island«, begann einer unserer Guides mit der Ansprache, nachdem wir alle nahe genug herangetreten waren. »Mein Name ist George Baxter, und diese wundervolle Dame ist meine Frau, Leah. Wir freuen uns, dass ihr euch entschieden habt, die kommenden Wochen mit uns gemeinsam das Abenteuer eures Lebens anzutreten. Wir werden eure Ansprechpartner für alles sein. Nachdem wir die Anwesenheit kontrolliert haben, werden wir ins Camp aufbrechen, wo nachher noch eine kleine Einführung auf euch wartet. Alles klar so weit?«
»Ja«, ging es durch die Reihen.
Leah Baxter schaute auf das Klemmbrett in ihrer Hand und rief nacheinander Namen auf. Eine bunte Mischung unterschiedlicher Nationalitäten.
»Aidan Rosario?«, sagte sie.
»Hier.« Es war der grummelige Kerl. Der grummelige, gut riechende Kerl. Wenigstens das musste man ihm lassen. Nun hatte ich auch einen Namen zu dem Gesicht.
Es vergingen noch ein paar Minuten, bis Leah am Ende der Liste angekommen war. Für Holly musste es einen spontanen Nachrücker gegeben haben, denn ich hatte zwanzig Personen gezählt – was die maximale Teilnehmerzahl für den Trip war.
»Gut, wir sind vollzählig. Dann teilt euch nun bitte auf die Fahrzeuge auf, damit es gleich losgehen kann.« Sie deutete auf die Jeeps hinter sich und steuerte dann das kleine Flugzeug an, um mit dem Piloten zu sprechen.
Kurz darauf startete die Propellermaschine laut scheppernd den Motor. Wegen der aufgewirbelten Erde kniff ich die Augen zusammen. Wehmütig beobachtete ich, wie die Räder sich in Bewegung setzten, die Maschine abhob und über die Bäume hinweg aus unserem Sichtfeld rauschte.
Nun gab es kein Zurück mehr, denn wie ich der Website entnehmen konnte, wurde die Insel nur angeflogen, um die Teilnehmer abzusetzen und am Ende des Trips wieder einzusammeln. Anschließend gab es eine Woche Pause, ehe die nächste Gruppe nach Jeopardy Island gebracht wurde. Sollte ich also Heimweh bekommen, würde mir nichts anderes übrig bleiben, als ins zweihundertfünfzig Meilen entfernte Myanmar zu schwimmen.
Wie antrainiert schwärmten wir alle aus. Ich stolperte Ayu und Satoshi hinterher, die ein ziemliches Tempo an den Tag legten. Das musste die Vorfreude auf die bevorstehenden Wochen sein. Sie zwängten sich in den nächsten Jeep, der allerdings bereits voll war. Entschuldigend hob Ayu die Schultern.
Vielleicht war das gar nicht so verkehrt, denn so konnte ich noch weitere Campteilnehmer kennenlernen. Also steuerte ich einen anderen Wagen an, nahm den Rucksack ab und quetschte mich ins Innere. Erst als mein Arm warme Haut berührte, wurde mir bewusst, dass jemand neben mir saß. Der Duft, der mir in der Nase kitzelte, verriet auch, wer es war – Aidan.
Gerade als ich den Mund öffnete, um wenigstens freundlich Hallo zu sagen, stöhnte er und schaute aus dem Fenster. Mir klappte die Kinnlade hinunter. Wie konnte ein Mensch nur so unhöflich sein? Nur zu gern hätte ich ihm die Meinung gegeigt, aber dafür war mir meine Energie zu schade. Immerhin hatte ich so schon nach dem ersten Tag massig Gesprächsstoff für Holly parat.
»Hach, wie schön, in ein paar freundliche Gesichter zu blicken. Ich bin Finja.« Eine Frau, die vermutlich kaum älter war als ich, setzte sich uns gegenüber. Ihr Englisch war sehr gut, doch ihrem Akzent nach zu urteilen, vermutete ich, dass sie Skandinavierin war. Ein dünner Schweißfilm benetzte ihre Stirn, an der einzelne blonde Strähnen klebten. Ihre Wangen waren von der Hitze leicht gerötet, was sie aber nicht daran hinderte, über das gesamte Gesicht zu strahlen. Dabei leuchteten ihre Augen wie ein wolkenloser Sommertag.
»Kim«, entgegnete ich lächelnd.
»Es freut mich wahnsinnig, dich kennenzulernen. Du bist mit deinem Freund hier, ja?« Sie deutete auf Aidan, dessen Kopf sofort hochschnellte.
Seine Augen weiteten sich vor Entsetzen. »O Gott, nein.«
Ein einfaches Nein hätte es zwar auch getan, aber was erwartete ich schon von einem so ruppigen Kerl? Ich schluckte einen bissigen Kommentar hinunter und fokussierte mich voll und ganz auf Finja. Auch wenn es schwerfiel, Aidans Präsenz neben mir gänzlich auszublenden.
»Wir haben uns gerade erst kennengelernt.« Das letzte Wort betonte ich absichtlich und warf ihm einen wütenden Seitenblick zu. Bedauerlicherweise bemerkte er ihn nicht, da er den Blick schon wieder in die Ferne aus dem Fenster gerichtet hatte. »Meiner besten Freundin ist leider etwas dazwischengekommen, weshalb ich allein hier bin.«
»Oh, das ist schade.« Ehrlichkeit schwang in Finjas Stimme mit. Sie war mir augenblicklich sympathisch. »Mein Freund hat mich vor ein paar Wochen sitzen gelassen. Eigentlich war geplant, dass er mitkommt, aber nun …« Sie zuckte mit den Schultern. »Jetzt bin ich auch allein hier.«
Diese vollkommene Offenheit einer Fremden gegenüber ließ mich einen Moment innehalten. Ich war es nicht gewöhnt, dass jemand so mit der Tür ins Haus fiel. »Tut mir leid«, entgegnete ich, da ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte.
»Ach, schon gut. Es hat eh nie gepasst.« Finja winkte ab. Sie machte den Eindruck, ein unglaublicher Sonnenschein zu sein, der selbst in schlechten Dingen das Gute sah. Wenn ihr die Trennung doch mehr zu schaffen machte, war sie in der Lage, das sehr gut zu überspielen.
Zwei weitere Männer setzten sich zu uns in den Jeep. Sie stellten sich als Andy und David vor und erzählten uns, dass sie aus Australien stammten. Finja wechselte noch ein paar Worte mit ihnen, ehe der Wagen endlich losfuhr.
Ich schaute an Aidan vorbei aus dem Fenster und bewunderte die Landschaft. Es dauerte nur wenige Momente, da preschte der Wagen einen versteckten Pfad entlang mitten durch den Dschungel.
Leider schaffte Aidan es, meine Begeisterung zu schmälern, indem er einen schmerzverzerrten Laut ausstieß, wann immer sich unsere Arme von den ruckelnden Bewegungen leicht streiften. Als würde meine Berührung ihm körperliche Schmerzen zufügen. Ich verdrehte die Augen. Er war so ein Übertreiber. Auch ich hätte gern woanders gesessen, aber wir mussten uns nun mal mit der Situation arrangieren.
Also versuchte ich, ihn auszublenden und mich stattdessen von Finja und den beiden anderen Männern in ein Gespräch verwickeln zu lassen.
Kapitel 4
Nach einer etwa halbstündigen Fahrt kam der Jeep schließlich zum Stehen. Mein Magen schlug bereits Saltos, denn es war eine ziemliche Holperpartie gewesen.
David öffnete die Tür und stieg dicht gefolgt von Andy aus. Ich hechtete beinahe hinterher und schnappte gierig nach Luft. Allerdings war diese so drückend, dass kaum Sauerstoff in meine Lunge drang.
»Alles in Ordnung?« Ein Lachen war in Finjas Stimme zu hören.
»Ja, alles bestens. Mir ist nur etwas übel geworden.«
Finja nickte. »Verständlich. Zum Glück habe ich noch nicht gefrühstückt, sonst hätte das ein böses Ende nehmen können. Obwohl das Frühstück ja eigentlich die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, und gerade hier auf der Insel wäre es klug, sich gleich morgens mit den nötigen Nährstoffen zu versorgen. Ansonsten kippen wir einfach um, was auch nicht sonderlich sinnvoll wäre.« Erst als ich sie völlig irritiert anblinzelte, hörte sie auf zu reden und zog den Kopf ein. »Entschuldigung, ich weiß auch nicht, warum ich immer das Bedürfnis habe, wahllos mit Fakten oder unnützem Wissen um mich zu werfen.«
Nun musste ich doch lachen. »Schon okay.«
Nach und nach stiegen auch die anderen aus ihren Jeeps. Die Fahrer luden das Gepäck ab. Holly hatte eine knallpinke Schleife um den Griff meines Koffers gebunden, damit ich ihn auf keinen Fall aus den Augen verlor. Bei dem Gedanken daran stahl sich ein Grinsen auf mein Gesicht.
Ich sammelte den Koffer ein und schleifte ihn über den erdigen Untergrund, für den die Rollen absolut nicht gemacht waren. Aber ich würde die meiste Zeit ohnehin meinen Rucksack bei mir tragen, daher war das nebensächlich.
»Leah wird euch an der Rezeption im Foyer eure Zimmerschlüssel aushändigen«, rief George und deutete auf das längliche Blockhaus hinter sich. Die Hütte machte einen rustikalen und etwas heruntergekommenen Eindruck. Ich hatte schon damit gerechnet, dass die Bilder aus dem Internet nicht ganz mit der Realität übereinstimmten, weshalb mich diese Tatsache nicht weiter wunderte.
Das Holz war von außen etwas eingestaubt, und in den Dachschrägen erkannte ich zahlreiche Spinnennetze. Aidan stand nur wenige Meter entfernt, und als auch er den Blick nach oben lenkte, sprang er erschrocken zurück. Um nicht in Gelächter auszubrechen, schlug ich mir schnell die flache Hand vor den Mund.
Finja war allerdings weniger zurückhaltend. Lachend legte sie den Kopf in den Nacken, wobei mir ihr Pferdeschwanz ins Gesicht peitschte. »Du nimmst an einem Outdoor-Trip teil und hast Angst vor Spinnen? Ganz schön paradox, meinst du nicht?«
Aidan schnaubte. »So ein Quatsch.«
»Du bist wie von der Tarantel gestochen zurückgesprungen, als du einen der niedlichen Achtbeiner gesehen hast«, stichelte sie weiter.
Zu gern hätte ich mir die Neckereien der beiden weiter angeschaut, aber Aidan schien das alles überhaupt nicht witzig zu finden. Vermutlich war ihm nicht einmal bewusst, dass er die Hände zu Fäusten ballte und die Zähne fest zusammenbiss. Ein Spaßvogel war er wohl wirklich nicht.
»Nicht einschlafen!«, rief Leah gerade im richtigen Moment aus dem Haus. Aidan ging weiter und verschwand aus unserem Sichtfeld.
»So ein Brummbär.« Finja schüttelte den Kopf. »Schade, dass er so heiß ist. Eine ganz schöne Verschwendung.«
Mir entfuhr ein leises Glucksen.
»Was denn? Du musst zugeben, dass er ein Leckerbissen ist.« Verschwörerisch wackelte Finja mit den Augenbrauen.
Langhaarige Männer waren zwar für gewöhnlich nicht mein Typ, aber sie hatte recht. Da war etwas an Aidan, das durchaus anziehend war. Womöglich lag das an seinem lateinamerikanischen Touch mit dem irischen Akzent. Vielleicht auch an seiner markanten Kiefermuskulatur mit dem leichten Bartschatten. An dem Farbverlauf seiner Augen oder seinem Duft. Ganz vielleicht war es auch eine Kombination aus allem oder einfach die Tatsache, dass er ein Arschloch war. Seltsamerweise fühlten sich Frauen oft zu denjenigen mit Bad-Boy-Image hingezogen, weil sie die Gefahr anziehend fanden. Was davon auf Aidan zutraf, würde sich in den kommenden Wochen sicher noch zeigen. Wobei ich bezweifelte, dass ich sonderlich viel Zeit mit ihm verbringen würde, wo ihm doch meine bloße Existenz zuwider war.
»Kim?«
Ich blinzelte ein paarmal, da ich eben so in meine Gedankenwelt vertieft gewesen war. Ein verschmitztes Lächeln zeichnete sich auf Finjas Gesicht ab. Eines, das deutlich machte, was ihr durch den Kopf ging. Doch anstatt das Thema noch weiter zu vertiefen, nickte sie zum Haus hin, in dem der Rest der Gruppe mittlerweile verschwunden war. Den Koffer hinter mir herschleifend schloss ich zügig auf.
Leah händigte gerade der Familie mit den Teenagerjungs die Schlüssel aus. Kaum hatten diese einen Schritt zur Seite gemacht, winkte sie uns heran. »Ach, wie schön, dass ihr euch bereits kennengelernt habt«, sagte sie und schaute zwischen Finja und mir hin und her. Dann schob sie zwei Schlüssel über die kleine Theke. »Es gibt nur noch Doppel- und Familienzimmer, daher müsst ihr euch eines teilen. Ihr seid die einzigen beiden Frauen, die allein hier sind. Das ist hoffentlich kein Problem?«
»Nein, ganz im Gegenteil!«, stieß Finja aus. Sie rüttelte an meinem Arm und sprang aufgeregt auf und ab. »Ist doch super, oder?«