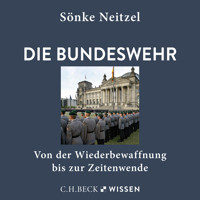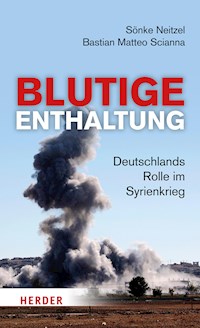13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was dachte die deutsche Generalität während des Zweiten Weltkriegs über Hitler, die Kriegslage und die Siegesaussichten? Was wusste sie über die Kriegsverbrechen? Sönke Neitzel hat die Abhörprotokolle deutscher Stabsoffiziere in britischer Kriegsgefangenschaft ausgewertet und gewährt erstmals unmittelbaren Einblick in das Wissen und Denken der Wehrmachtführung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Abgehört
Sönke Neitzel, geboren 1968, war nach Lehrtätigkeiten in Mainz, Karlsruhe, Bern und Saarbrücken Professor für Modern History an der University of Glasgow und Professor für International History an der London School of Economics (LSE). Seit 2015 hat er den deutschlandweit einzigen Lehrstuhl für Militärgeschichte/ Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Universität Potsdam inne. Zusammen mit Harald Welzer verfasste Neitzel den Bestseller Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben. Zuletzt erschien von ihm und Bastian Matteo Scianna Blutige Enthaltung. Deutschlands Rolle im Syrienkrieg (2021).
»Dieses brisante Buch stellt eine aufschlussreiche Quelle zur Mentalität der Führungsschicht der Wehrmacht dar.«Die ZeitWas dachte die deutsche Generalität während des Zweiten Weltkriegs über Hitler, die Kriegslage und die Siegesaussichten? Was wusste sie über die Kriegsverbrechen? Sönke Neitzel hat die Abhörprotokolle deutscher Stabsoffiziere in britischer Kriegsgefangenschaft ausgewertet und gewährt erstmals unmittelbaren Einblick in das Wissen und Denken der Wehrmachtführung.
Sönke Neitzel
Abgehört
Deutsche Generäle in britischer Kriegsgefangenschaft 1942-1945
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Erweiterte und überarbeitete Ausgabe© Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin 2005/Propyläen Verlag© für das Geleitwort Ian Kershaw 2007Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected] und Konzeption: RME Roland Eschlbeck und Kornelia Rumberg (nach einer Vorlage von Morian & BayerEynck, Coesfeld)Titelabbildung: Stefan FalkeAutorenfoto: © Kai Bublitz Foto-ProduktionE-Book-Konvertierung powered by pepyrusISBN 978-3-8437-3744-9
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Vorwort zur neunten Auflage
Geleitwort von Ian Kershaw
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Einleitung
1. Anmerkungen zur Forschungslage und zu den Quellen
2. Das Abhören von Kriegsgefangenen in Großbritannien und das Gefangenenlager von Trent Park
3. Themenschwerpunkte der abgehörten Gespräche
4. Schlußbetrachtung
Dokumente
Anmerkungen zur Edition
I. Alles verloren? Die unterschiedliche Perzeption von Politik und Strategie und die Gruppenbildung in Trent Park
Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3
Dokument 4
Dokument 5
Dokument 6
Dokument 7
Dokument 8
Dokument 9
Dokument 10
Dokument 11
Dokument 12
Dokument 13
Dokument 14
Dokument 15
Dokument 16
Dokument 17
Dokument 18
Dokument 19
Dokument 20
Dokument 21
Dokument 22
Dokument 24
Dokument 25
Dokument 26
Dokument 27
Dokument 28
Dokument 29
Dokument 30
Dokument 31
Dokument 32
Dokument 33
Dokument 34
Dokument 35
Dokument 36
Dokument 37
Dokument 38
Dokument 39
Dokument 40
Dokument 41
Dokument 42
Dokument 43
Dokument 44
Dokument 45
Dokument 46
Dokument 47
Dokument 48
Dokument 49
Dokument 50
Dokument 51
Dokument 52
Dokument 53
Dokument 54
Dokument 55
Dokument 56
Dokument 57
Dokument 58
Dokument 59
Dokument 60
Dokument 61
Dokument 62
Dokument 63
Dokument 64
Dokument 65
Dokument 66
Dokument 67
Dokument 68
Dokument 69
Dokument 70
Dokument 71
Dokument 72
Dokument 73
Dokument 74
Dokument 75
Dokument 76
Dokument 77
Dokument 78
Dokument 79
Dokument 80
Dokument 81
Dokument 82
II. »Wir haben versucht, ganze Völkerschaften auszurotten.« Kriegsverbrechen in den Gesprächen von Trent Park
Dokument 83
Dokument 84
Dokument 85
Dokument 86
Dokument 87
Dokument 88
Dokument 89
Dokument 90
Dokument 91
Dokument 92
Dokument 93
Dokument 94
Dokument 95
Dokument 96
Dokument 97
Dokument 98
Dokument 99
Dokument 100
Dokument 101
Dokument 102
Dokument 103
Dokument 104
Dokument 105
Dokument 106
Dokument 107
Dokument 108
Dokument 109
Dokument 110
Dokument 111
Dokument 112
Dokument 113
Dokument 114
Dokument 115
Dokument 117
Dokument 118
Dokument 119
Dokument 120
Dokument 121
Dokument 122
Dokument 123
Dokument 124
Dokument 125
Dokument 126
Dokument 127
Dokument 128
Dokument 129
Dokument 130
Dokument 131
Dokument 132
Dokument 133
Dokument 134
Dokument 135
Dokument 136
Dokument 137
Dokument 138
Dokument 139
Dokument 140
Dokument 141
Dokument 142
Dokument 143
Dokument 144
III. Aufstand des Gewissens. Reaktionen auf den 20. Juli 1944
Dokument 145
Dokument 146
Dokument 147
Dokument 148
Dokument 149
Dokument 150
Dokument 151
Dokument 152
Dokument 153
Dokument 154
Dokument 155
Dokument 156
Dokument 157
Dokument 158
Dokument 159
Dokument 160
Dokument 161
Dokument 162
Dokument 163
Dokument 164
Dokument 165
Dokument 166
Dokument 167
IV. Ein »Nationalkomitee West«? Reflexionen über die Kollaboration mit dem Feind
Dokument 168
Dokument 169
Dokument 170
Dokument 171
Dokument 172
Dokument 173
Dokument 174
Dokument 175
Dokument 176
Dokument 177
Dokument 178
Dokument 179
Dokument 180
Dokument 181
Dokument 182
Dokument 183
Dokument 184
Dokument 185
Dokument 186
Dokument 187
Dokument 188
Dokument 189
Bildteil
Kurzbiographien
Abkürzungen
Verzeichnis der Dokumente
Quellen- und Literaturverzeichnis
Danksagung
Anmerkungen
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
Vorwort zur neunten Auflage
Vorwort zur neunten Auflage
Die Abhörprotokolle deutscher Offiziere in britischer Kriegsgefangenschaft haben sich als außerordentlich reiche Quelle für die Forschung zur Wehrmacht, zur Massengewalt im Krieg, zum militärischen Widerstand und zur Geschichte der britischen Nachrichtendienste erwiesen. Vor zwanzig Jahren – im Herbst 2005 – wurden diese Quellen mit dem Buch Abgehört erstmals in einer umfassenden wissenschaftlichen Edition der Öffentlichkeit vorgestellt.1 Es folgten fünf Übersetzungen, darunter die englische Ausgabe Tapping Hitler's Generals, die 2007 erschien.2
In Deutschland wurde das Buch sowohl von der Wissenschaft als auch von der breiten Öffentlichkeit mit großem Interesse aufgenommen. Die fünfteilige ZDF-Dokumentation „Die Wehrmacht“ im Jahr 2007 basierte zu einem erheblichen Teil auf der Reinszenierung der in den Protokollen festgehaltenen Gespräche. Besonderes Interesse weckten die Unterhaltungen über Kriegsverbrechen, den Vernichtungskrieg und das Wissen der Soldaten über den Holocaust: Der Spiegel titelte „Bestien beim Beichten“3, die Bild-Zeitungbeschrieb sie als „Abhörprotokolle des Grauens“4, in der Welt am Sonntag schrieb der Literaturkritiker Fritz Raddatz über „Ansichten einiger Clowns“5und ließ seiner Verachtung der Wehrmachtgeneräle freien Lauf. Am anderen Ende des politischen Spektrums bestritt die Wochenzeitung Junge Freiheit den Wert der Abschriften und behauptete, dass die Generäle absichtlich falsche Angaben gemacht hätten, da die aufgezeichneten Gespräche durch Spitzel ausgelöst worden seien und die Generäle zweifellos gewusst haben mussten, dass sie abgehört würden. Da die Originalaufnahmen nicht mehr existierten, sei es unmöglich, die Echtheit der Abschriften zu bestätigen, weshalb die Junge Freiheit behauptete, sie seien als Quelle nahezu wertlos.6 Timo von Choltitz, der Sohn des Wehrmachtgenerals Dietrich von Choltitz, ließ sogar das Landeskriminalamt Stuttgart die Schrifttypen der Abschriften analysieren, um seinen Verdacht zu bestätigen, dass sie gefälscht seien. Die Untersuchung hat allerdings keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben, was seinen Glauben an die Fälschung dieser Quellen aber wohl nicht erschüttern konnte. Reaktionen dieser Art finden sich auch in den einschlägigen Internetforen zuhauf. Dies zeigt einmal mehr, dass die apologetische Umdeutung deutscher Geschichte auch nach dem Ableben der Zeitzeugengeneration in Deutschland einen festen Platz hat.
Ähnlich wie in der Öffentlichkeit fand auch in der Geschichtswissenschaft vor allem das Kapitel über die Verbrechen der Wehrmacht große Aufmerksamkeit. Andere Aspekte der Studie – wie die Wahrnehmung Hitlers und des Nationalsozialismus durch die gefangenen deutschen Generäle oder die Frage, ob bzw. wann diese mit den Briten kollaborieren sollten – wurden deutlich weniger beachtet. Umso erfreulicher, dass die Transkripte einen Beitrag zur Debatte über Feldmarschall Erwin Rommel und den Widerstand gegen Hitler liefern konnten. Am 1. November 2012 wurde im deutschen Fernsehen (ARD) ein neuer Spielfilm über Rommel ausgestrahlt, in dem ausführlich darüber diskutiert wurde, ob er von dem Attentat auf Hitler gewusst und es sogar gebilligt hatte. Eines der Schlüsseldokumente, die Rommel in die Nähe des militärischen Widerstands rücken, sind die abgehörten Gespräche von General Heinrich Eberbach. Im Gefangenenlager Trent Park sprach er im September 1944 mehrmals über sein Treffen mit Rommel am 17. Juli 1944. Dieser sei überzeugt gewesen, dass Hitler getötet werden müsse. Dieses Gespräch ist insofern besonders wertvoll, weil Eberbach die letzte Person war, mit der Rommel sich austauschte, bevor er am späten Nachmittag des 17. Juli schwer verwundet wurde.
Eberbach hat sich nach dem Krieg durchaus unterschiedlich über dieses Treffen und Rommels Absichten geäußert. Gegenüber Wilhelm Ritter von Schramm meinte er 1952, nach der Lektüre eines Kapitelentwurfs von dessen Buch „Der 20. Juli in Paris“: „Rommels Absicht war ja nicht, Hitler zu ermorden, sondern ihn vor ein Gericht zu stellen.“7 Mehr als 30 Jahre später, wenige Jahre vor seinem Tod, schrieb er an den ihm seit vielen Jahrzehnten freundschaftlich verbundenen Oskar Munzel: „Ob ich mich am 20. Juli beteiligt hätte? Rommel frug mich am 18.7. Ich sagte ihm: Ja, aber wie wollen Sie einen Bürgerkrieg vermeiden? Dem wich er aus, fuhr weg u. wurde auf dieser Fahrt schwer verwundet.“8 Die Wortwahl „20. Juli“ deutet darauf hin, dass die ursprünglichen Aussagen von Eberbach in Trent Park, Rommel habe vom Attentat gewusst und die Absicht gehabt, Hitler zu töten, authentisch waren. Die Relativierung im Schreiben von 1952 scheint mir eher dem Zeitgeist der Fünfzigerjahre geschuldet zu sein, als das Attentat auf Hitler noch mehrheitlich als Verrat gesehen wurde. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die abgehörten Gespräche von Dietrich von Choltitz zeigen, dass er sehr genau über das Attentat Bescheid wusste. In seinen Memoiren wird sein Wissen über den 20. Juli aber mit keinem Wort erwähnt.9 Auch wenn wir nicht mit letzter Gewissheit beweisen können, dass Rommel von dem Attentatsplan wusste, liefern die Abhörprotokolle doch starke Indizien dafür, dass er im Juli 1944 zu den Eingeweihten gehörte.10
Dieses Beispiel zeigt, dass es sich bei den Protokollen um eine durchaus ambivalente und nicht ganz unproblematische Quelle handelt. Bei sorgfältiger Kontextualisierung und dem Abgleich mit anderen Dokumenten ermöglichen sie jedoch weitreichende neue Erkenntnisse und können der Neubewertung allzu liebgewordener Interpretationen dienen. Die in Abgehört veröffentlichten Transkripte haben beispielsweise gezeigt, dass die deutschen Generäle den Krieg sehr unterschiedlich wahrgenommen haben. Obwohl sie alle derselben Funktionselite angehörten, sehr ähnliche Karrieren durchliefen, aus einem ähnlichen sozialen Umfeld stammten und ähnliche Fronterfahrungen gemacht hatten, gingen ihre Ansichten über den Nationalsozialismus, Hitler, den Verlauf des Krieges und die in ihm begangenen Verbrechen weit auseinander. Die Auseinandersetzung zwischen den Generälen Ludwig Crüwell und Wilhelm Ritter von Thoma, die mehr als anderthalb Jahre lang in Trent Park miteinander stritten, ist ein Beispiel für diese Wahrnehmungsdiskrepanzen. Beide wurden Anfang der 1890er-Jahre geboren, kämpften als junge Infanterieoffiziere im Ersten Weltkrieg, befehligten 1941 Panzerdivisionen an der Ostfront und stiegen zu Oberbefehlshabern des deutschen Afrikakorps auf. Und doch haben sie aus ihren Erfahrungen völlig unterschiedliche Lehren gezogen. Während Crüwell fest an den Nationalsozialismus glaubte, war Thoma ein entschiedener Anti-Nazi. Tobias Seidl hat in seiner Dissertation an der Universität Mainz die Heterogenität der Generäle in Trent Park umfassend untersucht und herausgearbeitet. Seine Studie bestätigt den zentralen Befund, dass man zwar in Bezug auf das Handeln der deutschen Generäle von Homogenität sprechen kann, nicht aber in Bezug auf ihre Wahrnehmungen und Interpretationen.11
Die Edition Abgehört war nur der erste Schritt zur Erschließung und Auswertung eines Gesamtbestands von etwa 50.000 Seiten Gesprächsprotokolle deutscher und italienischer Soldaten, die im britischen Nationalarchiv in London lagern. Im Jahr 2006 entdeckte ich noch einen weiteren Bestand ganz ähnlicher Quellen amerikanischer Provenienz. Der US-Nachrichtendienst hörte in den Jahren 1942 bis 1945 etwa 3.000 deutsche Gefangene in Fort Hunt bei Washington D.C. ab. Der Aktenbestand im amerikanischen National Archive umfasst insgesamt 102.000 Seiten an Vernehmungsberichten, Fragebögen, Lebensläufen und in erheblichem Umfang auch Mitschriften heimlich aufgezeichneter Gespräche. Um das britische und amerikanische Material auszuwerten, starteten der Sozialpsychologe Harald Welzer und ich 2007 ein von der Gerda Henkel- und der Fritz Thyssen-Stiftung gefördertes Forschungsprojekt. Bis Ende 2011 haben vier Postdocs, drei Doktoranden und elf Masterstudenten das Material systematisch und aus unterschiedlichen Perspektiven erforscht. Aus dem Projekt gingen sieben Monografien, ein Sammelband sowie zahlreiche wissenschaftliche Aufsätze hervor.12
Ziel des Forschungsprojekts war es, den Referenzrahmen deutscher und italienischer Soldaten zu rekonstruieren und aufzuzeigen, wie die Kriegserfahrung von einem Querschnitt der Soldaten der Achsenmächte wahrgenommen und interpretiert wurde. Harald Welzer und ich veröffentlichten im April 2011 das erste Buch des Projekts (Soldaten: Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben), das bis 2018 in neunzehn Sprachen übersetzt wurde. Während sich Abgehört „nur“ dem Material der höheren Führungsebene der Wehrmacht widmet, wertet Soldaten den gesamten Quellenbestand aus Die Studie zeigt den extrem eingeschränkten Reflexionshorizont der Soldaten, ihre Technikbegeisterung, die Wahrnehmung des Krieges als eine Art Job, den man einfach zu erledigen hatte, die schnelle Gewöhnung an die Massengewalt und schließlich auch den Gefallen an der Gewalt. Wir dokumentieren einmal mehr die weitverbreitete Kenntnis von Kriegsverbrechen aller Art, aber auch die durchaus vorhandene Empörung über den Holocaust und den Massenmord an sowjetischen Kriegsgefangenen.
Die Studie macht weiterhin deutlich, dass die NS-Ideologie im Bewusstsein der meisten Wehrmachtsoldaten allenfalls eine untergeordnete Rolle spielte. Selbstverständlich agierten die deutschen Soldaten während des Dritten Reiches nicht in einem Vakuum. Sie waren Teil der nationalsozialistischen Gesellschaft, akzeptierten und gestalteten deren soziale Rahmenbedingungen. Die Studie zeigt auch, dass es einen harten Kern von Soldaten gab, der Versatzstücke der NS-Ideologie zu einem mehr oder weniger kohärenten Weltbild verband. Und sie weist darauf hin, dass derart ideologisierte Soldaten besonders häufig in der Waffen-SS oder in den Eliteeinheiten der Wehrmacht, wie der Fallschirmjägertruppe, zu finden waren. Soldaten negiert also nicht den Einfluss der Ideologie auf das Handeln oder die Wahrnehmung des einfachen Soldaten, versucht aber, diesen zu relativieren. Praktisch alle Angehörigen der Wehrmacht waren loyal zum NS-Staat, was allerdings nicht mit einer ideologischen Verklärung zu verwechseln ist. Interessant ist auch, dass die Soldaten einen Unterschied zwischen Hitler und dem NS-Regime gemacht haben; für die meisten war Hitler eine Art pater patriae, nicht der nationalsozialistische „Führer“, der für Krieg, Mord und Kriegsverbrechen verantwortlich war.
Viele Soldaten waren tatsächlich Antisemiten und Antikommunisten. Das erleichterte es ihnen zweifellos, dem NS-Staat die Treue zu schwören. Entscheidend bleibt jedoch, dass ihre Wahrnehmung des Krieges, ihre Interpretation der Ereignisse, ihre Erwartungen für die Zukunft usw. nicht in erster Linie von politischen oder ideologischen Mustern im engeren Sinne bestimmt wurden, sondern von ihren Erfahrungen an der Front. Deshalb änderte sich die Zustimmung zum NS-Staat in der Phase der Niederlagen deutlich. Ihre Loyalität zur deutschen Nation und vor allem zur Institution Wehrmacht blieb allerdings ungebrochen. Das war das eigentliche Geheimnis des NS-Staates: Die Loyalität der Soldaten zur Wehrmacht war nahezu unerschütterlich, weil sie diese als eine effiziente und erfolgreiche Organisation wahrnahmen, in der sie ihre Pflicht für das Vaterland erfüllen konnten, unabhängig von ihrer sozialen und politischen Überzeugung.
Soldaten widerspricht damit Omer Bartovs These von der nationalsozialistischen Unterwanderung der Wehrmachtsoldaten.13 Auch relativiert die Studie den Begriff der Volksgemeinschaft, zumindest in seiner extremsten Ausprägung, wie Thomas Kühne sie verwendet hat.14 Kühne vertritt die These, dass die Ausgrenzung der Juden aus der deutschen Gesellschaft und ihre anschließende Ermordung ein entscheidender Faktor für die Schaffung der deutschen Volksgemeinschaft war. Der Massenmord an den Juden hatte ihm zufolge eine integrierende soziale Funktion und stiftete ein Identitätsgefühl sui generis unter den Deutschen. Tatsächlich hat die Täterforschung gezeigt, wie sich Gruppen durch den Akt des Massenmords als Gemeinschaften konstituieren und festigen. Ob die Massenverbrechen, zumal der Holocaust, die Deutschen als Volksgemeinschaft geeint hat, scheint jedoch angesichts der Forschungsergebnisse von Soldaten fraglich zu sein. Zu klein war der Kreis der direkt an diesen Verbrechen beteiligten Täter, zu fragmentiert war das Wissen darüber. Selbst wenn man nur die Ermordung von Zivilisten während der Partisanenbekämpfung oder die Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen und nur die Mitglieder der Wehrmacht betrachtet, lässt sich Kühnes These nicht halten. Für die deutschen Soldaten war die Wahrnehmung des Krieges geprägt von den alltäglichen Erfahrungen an der Front: den überwältigenden Sinneseindrücken des Kampfes, den eigenen Entbehrungen, der Angst, dem endlosen Warten, der Freizeit an der Front, der Technikbegeisterung. Interessanterweise wurden jedoch Gewalttaten, die wir heute eindeutig als Verbrechen und Normverstöße definieren, von den Soldaten oft nicht als solche wahrgenommen und konnten daher auch keine Empathie hervorrufen. Die Erfahrung extremer Gewalt, die Plünderungen, die Zwangsarbeit von Zivilisten, die Vergewaltigungen, die verbrannte Erde und die Massenhinrichtungen schienen oft nicht viel mehr als Ereignisse zu sein, über die man sich keine Gedanken machen musste, weil sie so allgegenwärtig und normal waren. In den heimlich aufgezeichneten Gesprächen deutscher Soldaten beschrieben diese auch die alliierten Bombenangriffe auf deutsche Städte als zwar schreckliche, aber "normale" Gewalttaten in einem Krieg dieser Art, nicht als Verbrechen. Massaker an Juden und die Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener wurden sicherlich anders bewertet, nämlich in der Tat als Grenzüberschreitung, aber die Soldaten zogen keine Konsequenzen daraus und stellten weder den Krieg noch die Wehrmacht oder gar das NS-Regime in Frage. In der Wahrnehmung und Deutung einiger weniger nahmen diese Verbrechen eine zentrale Rolle ein, verdrängten das positive Selbstverständnis und lösten dauerhafte Scham aus. Doch wie in anderen sozialen Gemeinschaften auch, entwickelte die Masse der Wehrmachtsoldaten eine erstaunliche Fähigkeit, kognitive Dissonanzen aufzulösen. Unangenehmes wurde ausgeblendet, als Einzelfall abgetan oder so umgedeutet, dass das eigene Weltbild nicht in Frage gestellt wurde.
Es ist sicher richtig, die Verbrechen der Wehrmacht in den Mittelpunkt der zeitgenössischen Forschung zu stellen, aber wir dürfen nicht den Fehler der analytischen Verengung begehen und das, was wir für ein zentrales Merkmal des Krieges halten, mit dem verwechseln, was die Soldaten empfunden haben. Kriegsverbrechen waren in der zeitgenössischen Wahrnehmung der Wehrmachtsoldaten kein zentrales Thema – und der Holocaust schon gar nicht.
Soldaten wurde in Deutschland bereits wenige Tage nach seinem Erscheinen ein Bestseller. Über das Buch wurde breit diskutiert, von den USA bis nach Australien. Doch interessanterweise sind die eigentlichen Erkenntnisse der Studie vor allem außerhalb Deutschlands oft nicht beachtet worden. Die Normalität, mit der Soldaten über den Krieg sprechen, hat etwas Zeitloses und ist keineswegs nur auf die Wehrmacht beschränkt. Menschen können sich innerhalb kürzester Zeit an den Bezugsrahmen des Krieges gewöhnen und Dinge als völlig normal betrachten, die wir im zivilen Leben als abstoßend, schrecklich oder gar kriminell interpretieren würden. Vielen Lesern außerhalb Deutschlands fiel es schwer, unserer Darstellung der Anpassung der Wehrmachtsoldaten an den Referenzrahmen des nationalsozialistischen Krieges zu folgen, ja sie bedauerten, dass Soldaten nicht einfach eine weitere Sammlung spannender Abhörprotokolle war. Einige waren auch der Meinung, dass man die Analyse der Autoren getrost ignorieren könne, da man bereits alles über die Hintergründe der Wehrmachtverbrechen wisse.
Die Protokolle bieten eine große Chance, die Komplexität von Mentalitäten, in diesem Fall diejenigen von Wehrmachtsoldaten, zu erforschen. Normative Ansätze, die nur darauf abzielen, bereits bestehende Meinungen zu bestätigen, bringen keinen Erkenntnisfortschritt. Berauben wir also diese Quellen nicht ihres komplexen, widersprüchlichen Charakters. Und fragen wir uns vor allem, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es zwischen Wehrmachtsoldaten und den Soldaten anderer Armeen, anderer Zeiten und anderer Länder gibt.15
Diese Dokumente sind allerdings nicht nur eine herausragende Quelle, um etwas über die Abgehörten, ihr Handeln und ihre Mentalität zu erfahren. Es sind ebenso wichtige Zeugnisse für die Geschichte der alliierten Nachrichtendienste. Aus der großen Zahl von Kriegsgefangenen kriegswichtige Informationen zu gewinnen, war zweifellos eines der herausforderndsten Probleme der Intelligencearbeit in den Jahren 1939-1945. Das Abhören war dabei keine neue Technik und wurde bereits im Ersten Weltkrieg praktiziert. Im Zweiten Weltkrieg war es eine gängige Methode der Informationsgewinnung. Es war aber der britische Nachrichtendienst, der das weltweit ausgefeilteste System entwickelte, lohnende Gefangene zu identifizieren und zu befragen und einen ausgewählten Kreis schließlich auch abzuhören. So gewann London Informationen von unschätzbarem Wert, die allerdings mit Kenntnissen aus anderen Quellen – etwa aus der Funkentzifferung – zu einem Gesamtbild zusammengeführt werden mussten. Aus den kleinen Anfängen im Tower of London 1939 und dem Landsitz von Trent Park 1940 entwickelte sich ein globales Netz von Verhör- und Abhörlagern, in das auch die Verbündeten – insbesondere die Vereinigten Staaten – eingebunden waren. Falko Bell hat dieses System in einer 2014 abgeschlossenen Studie mustergültig untersucht.16 Zudem sind mehrere Veröffentlichungen über Thomas Kendrick, der die Abhöraktionen der Abteilung MI 19 des britischen Nachrichtendienstes leitete, und die zumeist deutschen jüdischen Emigranten erschienen, die die deutschen Gefangenen belauschten.17
Die übergeordnete Frage der unterschiedlichen Kulturen der internationalen Nachrichtendienste wurde in einem weiteren Forschungsprojekt untersucht, dessen Ergebnisse 2020 in einem Sammelband vorgelegt wurden.18 Der Vergleich dieser Kulturen in Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Frankreich und Deutschland während der Weltkriege macht deutlich, dass das Deutsche Reich die geringste Affinität von Politik und Militär zu den Nachrichtendiensten aufwies. Dies äußerte sich u.a. darin, dass das Belauschen von Gefangenen in Deutschland eher dilettantisch betrieben wurde und keine vergleichbaren Ergebnisse einbrachte wie in Großbritannien.
Das Herrenhaus von Trent Park, in dem einst deutsche Generäle den Briten unwissentlich als Informationsquelle dienten, war bis 2012 Teil der University of Middlesex. Mittlerweile wird dort ein Museum zur abwechslungsreichen Geschichte des Anwesens eingerichtet, in dem die Abhöraktion des britischen Interrogation Centre einen prominenten Platz einnehmen wird. Im Frühjahr 2026 soll es nach derzeitiger Planung eröffnen.19
Sönke Neitzel, Juni 2025
Geleitwort von Ian Kershaw
Nach 1945 hielt sich lange Zeit die Legende von der »unbescholtenen« Wehrmacht, die vom Verbrechertum des Hitlerregimes und von den Greueltaten der SS angeblich weitgehend unbeeinflußt geblieben war. Das lag teilweise an der dürftigen Forschungslage (und der Neigung, die Militärgeschichte von der Strukturanalyse des NS-Staats zu trennen). Außerdem wurde diese Legende von den Nachkriegsmemoiren führender Militärs gestützt, die die Ehre der Wehrmacht wahren und gleichzeitig sich selbst von aller Schuld freisprechen wollten. Aber auch politische und soziale Faktoren spielten eine Rolle.
Die Legende entsprach sowohl den Interessen der jungen Bundesrepublik (insbesondere nach der Gründung der Bundeswehr im Jahr 1955) als auch denen der Westmächte in der Frühphase des Kalten Krieges. Und nicht zuletzt kam sie der Bereitschaft vieler normaler Menschen (in mancher Hinsicht vielleicht auch der Notwendigkeit) entgegen, zu glauben, daß der Makel des Nazismus nicht alles durchdrungen hatte, daß die Streitkräfte, in denen ihre Ehemänner, Väter, Brüder, Onkel und Freunde gedient hatten, ehrenhaft für ihr Land gekämpft hatten.
Im Lauf der Zeit mußte die Legende fadenscheinig werden. Nur wenige Historiker, die sich mit dem Dritten Reich befaßten, übernahmen sie in vollem Umfang, und spätestens seit den sechziger Jahren wurde in Fachpublikationen aufgezeigt, daß die Wehrmacht in die schlimmsten vom NS-Regime begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt war. Davon drang allerdings vorerst nur wenig ins allgemeine Bewußtsein der Bevölkerung.
Vollends zerfiel der Mythos dann in den neunziger Jahren in einer jener hitzigen, emotionalen Debatten über die NS-Vergangenheit, wie sie in Politik und Kultur der Bundesrepublik regelmäßig ausbrechen. Eine große Ausstellung über die Wehrmacht mit dem Titel »Vernichtungskrieg. Kriegsverbrechen der Wehrmacht 1941–1944«, die ab 1995 in mehreren deutschen Städten zu sehen war, zerbrach das Wunschbild einer Armee, die ihre Hände angeblich sauber gehalten hatte. Vieles, was in der Ausstellung gezeigt wurde, war für das breite Publikum neu und schockierend. Die Kontroverse, die sich dadurch entspann, löste eine Flut von Veröffentlichungen aus, von speziellen Forschungsmonographien bis zu Zeitschriftenartikeln, von schriftlichen Augenzeugenberichten bis zu Fernsehdokumentationen, die es einer jüngeren Generation unmöglich machten, an der Vorstellung einer schuldlosen Wehrmacht festzuhalten, die einen »normalen« Krieg geführt hatte, während NS-Organisationen, allen voran die SS, die Verbrechen begangen hätten. Die jüngeren Deutschen mußten sich der unangenehmen Tatsache stellen, daß auch ihre Großväter, obwohl sie nicht in der SS, sondern in der Wehrmacht gedient hatten, an furchtbaren Greueltaten beteiligt gewesen sein konnten.
Ausgelöst unter anderem von dieser Wehrmachtausstellung, hat in jüngster Zeit eine große Zahl von Forschungsarbeiten das Verständnis der Mentalitäten und Verhaltensmuster innerhalb der Wehrmacht in der NS-Zeit im Allgemeinen und im Zweiten Weltkrieg im Besonderen erweitert und geklärt. Im Mittelpunkt steht dabei vielfach die Frage, inwieweit die Wehrmacht die ideologischen Ziele der Nationalsozialisten übernahm oder ablehnte. Besonders intensiv ist ihre Komplizenschaft bei den schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Osteuropa und auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion und insbesondere beim Genozid an den Juden untersucht worden. Eine Zentralfrage lautete dabei, wie viel Schuld die Wehrmacht trug, vom Oberbefehlshaber bis hinunter zum einfachen Soldaten. Damit im Zusammenhang stand die Schlüsselfrage nach der Haltung der Wehrmacht in der Endphase des NS-Regimes, als feststand, daß der Krieg verloren war. Warum kämpfte sie selbst in diesen letzten schrecklichen Kriegsmonaten, in denen ein Großteil der Gesamtzahl an Kriegsopfern ums Leben kam, weiterhin derart verbissen für eine aussichtslose Sache? Wie stand man in den Streitkräften zu Hitler und seinen Paladinen einerseits und zu denjenigen, die dem Regime ein Ende bereiten wollten (insbesondere die Verschwörer vom 20. Juli 1944), andererseits? Diese Fragen lassen immer noch keine einfachen Schwarzweißantworten zu.
Wenn überhaupt möglich, dann sind die Antworten für diejenigen, die Kommandoposten in den Streitkräften bekleideten und erhebliche Mitverantwortung für das Verhalten der Wehrmacht im Dritten Reich trugen, noch schwerer zu geben als für einfache Soldaten. In ihren Nachkriegsmemoiren waren deutsche Generäle, wie kaum anders zu erwarten, bemüht, sich von Hitler und der NS-Führung zu distanzieren, um ihr »unpolitisches« Streben nach soldatischer Pflichterfüllung und oft auch ihre eigene Zugehörigkeit zum »Widerstand« (oder wenigstens ihre kritische Einstellung gegenüber dem Handeln des Regimes und zugleich ihre Ohnmacht, es zu ändern) hervorzuheben. Persönliche Papiere, Tagebücher und Briefe ermöglichten häufig wertvolle Einsichten in die zeitgenössischen Einstellungen einzelner Personen – soweit sie erhalten geblieben sind; in den meisten Fällen sind sie es nicht. Amtliche Militärakten verraten in der Regel wenig über die wahre politische Haltung derjenigen, die sie angelegt haben. Infolgedessen trifft es wohl zu, daß bei der Erforschung der Mentalitäten der höheren Wehrmachtoffiziere weniger Fortschritte gemacht wurden als im Fall der einfachen Soldaten.
Deshalb ist die hier vorliegende, von Sönke Neitzel zusammengestellte beeindruckende Edition von solch hohem Wert. Neitzel hat eine ungewöhnliche und höchst enthüllende Quelle erschlossen und untersucht: die Niederschriften der abgehörten Privatgespräche deutscher Offiziere in britischer Kriegsgefangenschaft, die vom Combined Services Detailed Interrogation Centre in Trent Park bei Enfield in Middlesex angefertigt worden sind und heute in den National Archives (dem früheren Public Record Office) lagern. Im Gegensatz zu den zahllosen Nachkriegsvernehmungen, in denen die Gefangenen in ihren Antworten auf die ihnen gestellten Fragen vieles verbergen oder verzerrt darstellen konnten, handelte es sich hier um unstrukturierte Gespräche, welche die Deutschen von sich aus untereinander führten, wobei sie auch grundlegende Fragen hinsichtlich ihrer Haltung gegenüber der deutschen Führung und ihr Wissen über die Kriegsverbrechen anschnitten.
Wie Neitzel zeigt, wurden die Gespräche in völliger Offenheit geführt, ohne daß die Gefangenen argwöhnten, daß diese abgehört und aufgenommen wurden. Darüber hinaus wurden die deutschen Offiziere bereits seit 1942 belauscht, also schon zu einem Zeitpunkt, als Hitlers Deutschland noch nicht in Trümmern lag. Es handelt sich hier also nicht um nachträglich geäußerte Ansichten über ein gestürztes Regime, deren Verfechter sorgfältig darauf achteten, inkriminierende, gerichtsverwertbare Äußerungen zu vermeiden. Vielmehr waren es in Unterhaltungen zwischen mehr oder weniger Gleichgestellten ausgetauschte zeitgenössische Meinungen, die einen einzigartigen Einblick in das Denken deutscher Generäle und anderer hochrangiger Offiziere lange vor dem Zusammenbruch des NS-Regimes bieten.
Neitzel weist darauf hin, daß die Kriegsgefangenen, deren Ansichten er in diesem Buch zusammengestellt hat, keinen repräsentativen Querschnitt durch das deutsche Offizierskorps darstellen. Die ersten waren 1942/43 in Nordafrika in Gefangenschaft geraten; nach der Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 kamen bis zu deren Vorstoß ins Deutsche Reich selbst immer neue Gefangene hinzu. Viele der Abgehörten hatten kaum Erfahrungen an der Ostfront, wo die schwersten Kämpfe stattfanden und die schlimmsten Verbrechen (einschließlich der Ermordung der Juden) begangen wurden. Allerdings hatten die meisten an verschiedenen Fronten gekämpft (auch an der Ostfront), und einige waren bereit und in der Lage, über schreckliche Greueltaten zu berichten, deren Zeugen sie geworden waren. Wenn auch nach wissenschaftlichen Maßstäben in keiner Weise repräsentativ, verweisen die in diesem Buch wiedergegebenen Ansichten deutscher Offiziere doch auf ein breites Meinungsspektrum: von unverbesserlicher nationalsozialistischer Mentalität bis hin zu seit langem gehegten oppositionellen Positionen.
Die Polarisierung der Einstellungen zu Hitler und zum Dritten Reich tritt, wie Neitzel zeigt, am deutlichsten an den Ansichten der ersten beiden Gefangenen zutage, der Generäle Thoma (NS-Gegner) und Crüwell (NS-Anhänger). Wie diese beiden Figuren zum Mittelpunkt von einander politisch und ideologisch entgegengesetzten Cliquen wurden, ist eine der faszinierenden Facetten dieses Buchs. Neitzels Erkenntnisse deuten darauf hin, daß für die Stellungnahme pro oder kontra NS-Regime nicht die offensichtlichen soziologischen und konfessionellen Unterschiede entscheidend waren, sondern das jeweilige Kriegserlebnis, zusammen mit der individuellen Bereitschaft, kritisch über die jüngste Vergangenheit nachzudenken.
Daß unter kriegsgefangenen deutschen Offizieren bis zum Ende des Dritten Reichs derart tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Einstellung zum NS-Regime und zu Hitler persönlich existierten, zeigt, wie wenig es in entscheidenden früheren Phasen vor dem Krieg möglich gewesen war, in der Wehrmacht eine verläßliche Widerstandsbasis gegen den Nationalsozialismus aufzubauen. Die Isolation des damaligen Generalstabschefs Ludwig Beck, als dieser während der Sudetenkrise 1938 zurücktrat, und die zögerliche, zweideutige Haltung seines Nachfolgers Franz Halder, als die Krise in den Wochen vor der Münchener Konferenz ihrem Höhepunkt zustrebte, werden leichter verständlich, wenn man hier liest, welche Ansichten Vertreter der militärischen Elite einige Jahre später nach allem, was in der Zwischenzeit passiert war, noch vertraten.
Es ging indes nicht nur um ausdrücklich nationalsozialistische Ansichten eines Teils der Generäle. Tatsächlich waren die NS-orientierten Offiziere in Trent Park, wie in dieser Phase des Krieges sicherlich auch in der gesamten Wehrmacht, in der Minderheit. Weit verbreiteter war eine erhebliche Abneigung gegen das Regime und vorherrschend bemerkenswerterweise ein starkes Nationalgefühl in Verbindung mit preußischen Werten, denen sich das Offizierskorps während des gesamten Dritten Reichs verpflichtet fühlte. Diese Haltung unterschied sich zwar von nationalsozialistischen Ansichten und Sympathien für das Regime, überschnitt sich aber gleichwohl mit jenen in einem ausreichenden Maß, so daß jeder Schritt in Richtung etwaiger Widerstandsaktionen ausgeschlossen war oder zumindest erschwert wurde. Ein Nachhall dessen war bei den Kriegsgefangenen in Trent Park immer noch festzustellen. Während einige zum Beispiel Bedauern darüber ausdrückten, daß Stauffenbergs Attentat fehlgeschlagen war, lehnten andere den Bombenanschlag ab und betrachteten ihn als unvereinbar mit ihrem Ehrgefühl.
Auffallend war die nachhaltige Wirkung des 1934 auf Hitler abgelegten Eides. Selbst wenn die Generäle in britischer Gefangenschaft die Auffassung vertraten, daß sie aufgrund von Hitlers späterem Handeln von ihrem Eid entbunden seien, fühlten sie sich weiterhin durch ein preußisches Ehrgefühl zum Weiterkämpfen verpflichtet. Fast alle waren der Ansicht, daß ein Offizier die Pflicht habe, bis zur letzten Patrone zu kämpfen (auch wenn sich in der Praxis nur wenige an diesen Ehrenkodex hielten). So kritisierten die meisten von ihnen nicht nur General Paulus‘ Kapitulation in Stalingrad, sondern wiesen auch die Idee weit von sich, daß Kommandeure an der Westfront das Feuer einstellen sollten, um den Angloamerikanern den Vormarsch zu erleichtern. Implizit bedeutete dies, daß der Kampf gegen die Sowjets nicht aufgegeben werden dürfte, sondern mit westlicher Hilfe fortgesetzt werden müßte – ein Gedanke, der gegen Ende des Krieges in führenden Nazikreisen an Boden gewann.
Die gefangenen Offiziere weigerten sich, auch nur in Erwägung zu ziehen, sich an Rundfunksendungen der BBC oder anderen antideutschen Propagandaanstrengungen zu beteiligen. In ihren Augen wäre dies immer noch Verrat gewesen. Noch in den allerletzten Tagen des NS-Regimes einigten sich die Generäle mühselig auf den Text eines Briefs an Premierminister Churchill, den sie schließlich erst nach Hitlers Tod abschickten. Darin boten sie (natürlich im eigenen Interesse) an, bei der »Erneuerung« Deutschlands »aus christlich-abendländischem Geist« mitzuwirken.
Die hier vorliegende Auswahl von Abhörprotokollen belegt eindrücklich, daß die deutsche Militärelite sehr genau über die in Osteuropa in großem Ausmaß verübten Greueltaten Bescheid wußte. Das galt auch für diejenigen ihrer Angehörigen, die lange vor Ende des Krieges in Gefangenschaft geraten waren. Die Niederschriften der abgehörten Gespräche enthalten Augenzeugenberichte über Massenerschießungen von Juden (und nicht wenig Nazijargon, der tiefe antijüdische Vorurteile offenbart). Sie enthüllen auch, daß die Offiziere das Ausmaß der Morde sowohl an Juden als auch an Polen, Russen und anderen Verfolgten kannten. Tatsächlich wurde schon in einem Ende 1943 verfaßten Bericht geschätzt, daß bereits bis zu diesem Zeitpunkt drei bis fünf Millionen Juden ermordet worden waren. General von Choltitz, der beim Fall von Paris gefangengenommen worden war (wo er als Stadtkommandant amtiert hatte), gab sogar zu – was bisher nicht bekannt war –, er habe systematisch die Befehle ausgeführt, in seinem Bereich Juden zu liquidieren (wahrscheinlich 1941/42 auf der Krim).
Zumeist gab man jedoch der NS-Führung und vor allem der SS die Schuld. Im Entwurf des Briefs an Churchill räumten die Generäle zwar die Notwendigkeit ein, die Schuldigen an den Verbrechen des Regimes zu bestrafen, behaupteten aber, diese seien »fast ausschließlich« von der SS begangen worden, nur ein kleiner Teil der deutschen Bevölkerung habe davon gewußt und dann auch nur gerüchteweise. In den Diskussionen über diesen Brief erklärte ein General ausdrücklich, daß es nützlich sei, es auf diese Weise auszudrücken; man brauche schließlich einen Sündenbock. Dies zeigt, daß selbst in Gefangenschaft befindliche deutsche Generäle an der Legende von der »unbescholtenen« Wehrmacht mitgestrickt haben, und zwar bereits vor dem Ende des Dritten Reichs.
Es ist das große Verdienst von Sönke Neitzel, durch seine Forschungen diese bisher unerschlossenen reichen Quellen ans Tageslicht gefördert zu haben. Sie ermöglichen neue Einsichten in die Geisteshaltung von Vertretern der deutschen Militärelite – von dem Zeitpunkt an, als sich der Krieg unumkehrbar gegen das Dritte Reich wandte, bis zum Zusammenbruch des Hitlerregimes. Für diese ausgezeichnete Ausgabe der Abhörprotokolle stehen wir tief in Neitzels Schuld.
Ian Kershaw, 2007
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Das vorliegende Buch, im September 2005 erstmals publiziert, ist von der historischen Fachwissenschaft und einer breiten Öffentlichkeit überaus wohlwollend aufgenommen worden. Den hier vorgestellten und kommentierten Quellen spricht man ein hohes Maß an Aussagekraft zu, weil sie die zeitgenössischen Aussagen von hohen Stabsoffizieren ungefiltert wiedergeben. Dies gilt auch und gerade für Zeitzeugen, die die bisherigen Forschungsergebnisse über die Wehrmacht nicht immer in vollem Umfang zu teilen vermochten. Die Akzeptanz dieser durchaus brisanten Quellen findet indes oft dort ihre Grenze, wo die eigene Familie betroffen ist. Erscheint der eigene Vater oder Großvater im Spiegel seiner Gespräche in Trent Park in einem negativen Licht, wird der Wert dieser Quellen aus nachvollziehbaren Gründen gerne angezweifelt. So mag der Sohn von General Dietrich von Choltitz nicht daran glauben, daß sein Vater die ihn belastenden Sätze über die eigene Beteiligung an der Judenvernichtung geäußert hat. »Für ihn bleibt der Vater der strahlende Held, als den er ihn im Internet auf einer Gedenkseite feiert«, schrieb die FAZ am 22. Dezember 2005. »Ins Familiäre dringen Aufklärung und Wissenschaft nur, wenn sie bewußt eingelassen werden.« Freilich gibt es auch hier Ausnahmen. Dr. Bernd Crüwell, Dr. Gottfried Freiherr von der Heydte und Kurt Meyer möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich für die vielen Gespräche danken, die sie mit mir über ihre Väter geführt haben. Sie haben sich offen den Erkenntnissen gestellt, die dieses Buch bereithält.
Seit der Veröffentlichung der Quellenedition sind zahlreiche Nachkommen ehemaliger Trent-Park-Insassen mit dem Verfasser in Kontakt getreten. So konnten dem Aktenfund neue Quellen aus Privatbesitz zur Seite gestellt werden. Obgleich diese Edition keine Kollektivbiographie sein kann und will, lassen sich einige Charaktere durch die privaten Dokumente noch schärfer nachzeichnen.
Konteradmiral Paul Meixner etwa taucht in den Abhörprotokollen nur selten auf. In Trent Park äußerte er sich mal hoffnungsvoll über die Kriegslage, mal kritisierte er die Partei und glaubte, der Krieg sei verloren. Er war im Lager offenbar überaus beliebt, verstand sich sehr gut mit General Ludwig Crüwell, aber auch mit NS-kritischeren Generälen wie Hans Cramer. Durch sein Tagebuch wird klar, daß Meixner eindeutig zur Gruppe um Ludwig Crüwell zu zählen ist. Die selbstkritischen Klagen der Generäle über Krieg und Diktatur empfand er als kleingeistig, geradezu unwürdig. »Unsere Generale sind zum größten Teil Bruch. Erschütternd, wie klein diese Menschen sind«, notierte er in sein Tagebuch.20 Im Mai 1944 in das amerikanische Generalslager Clinton/Mississippi verlegt, kam Meixner dann »übrigens recht klar zur Erkenntnis, wie gut es ist, daß ich aus Trent Park weg bin. Was für ein schlechter Geist, was für ein niedriges Durchschnittsniveau, wie unglaublich wenig ›Liebe‹ war doch dort. Da konnte man sehen, was 1 oder 2 wirklich schlechte Menschen bei einer zu weichen Führung für verheerenden Einfluß gewinnen können.«21
Quellen der amerikanischen Lagerverwaltung bestätigten, daß in Clinton/Mississippi in der Tat eine andere Stimmung herrschte, als in Trent Park. In Clinton fehlten die NS-kritischen Wortführer wie Thoma, Bassenge und Broich. Arnim, Crüwell und die anderen NS-nahen Generäle hatten hier keinen wortgewandeten Gegenspieler. Die NS-kritischen Offiziere – von rund 30 inhaftierten Generälen registrierten die Amerikaner als solche vor allem Kurt Freiherr von Liebenstein, Theodor Graf von Sponeck, Gustav von Vaerst, Botho Elster und Ludwig Bieringer – hielten sich mit ihrer Meinung offenbar zurück.22 Genaueres weiß man nicht, da die Generäle in den Vereinigten Staaten nicht abgehört wurden.
Doch zurück zu den Insassen von Trent Park. Deutlicher als bisher läßt sich auch die weltanschauliche Haltung einer der wenigen Subalternoffiziere darstellen. Leutnant Klaus Hubbuch war von Mai 1943 bis Januar 1944 in Trent Park inhaftiert gewesen. 147 seiner Briefe an Eltern und Geschwister sind erhalten. Sie zeichnen das Bild eines Soldaten, von der Idee des Dritten Reiches begeistert und bereit, für seine Überzeugung zu kämpfen, »wie immer unentwegt, solange noch deutsche Panzer rollen.«23 Hubbuch war damit ein typischer Vertreter einer Generation junger Offiziere, die im Dritten Reich sozialisiert wurden und der NS-Diktatur bedenkenlos gegenüberstanden. Hubbuch akzeptierte diese begeistert, zumindest was den Angriffskrieg und die Rassenideologie anging.24 Sein Wille, sich ohne Wenn und Aber für das Dritte Reich einzusetzen, blieb bis zu seiner Gefangennahme im Mai 1943 nahezu unverändert. Er war weder bereit, seine Führung oder gar sein eigenes Handeln in Frage zu stellen, noch sah er einen Anlaß, am Sinn des Krieges zu zweifeln. Im Gegenteil: Immer wieder rief Hubbuch sich selbst, seine Kameraden sowie seine Familie zu Härte und zum Durchhalten auf, um den Feind endgültig zu besiegen. Diesen galt es zu vernichten, während die eigenen Toten entweder verdrängt oder zu Helden stilisiert wurden. Eine Begründung für das Sterben wurde höchstens in einem höheren Schicksal gesucht, nicht aber in der Verantwortung der Vorgesetzten oder der eigenen Person.
Auch in Trent Park vermochte Hubbuch nicht zu einer kritischeren Sicht auf Krieg und Diktatur zu finden. Über den Weihnachtsgottesdienst eines schwedischen Pfarrers am 24. Dezember 1943 notierte er empört in sein Tagebuch: »Wir sollen in uns gehen und unsere Schuld bekennen! Wie meint er das? Wir verlassen den Raum, war doch schon im Ersten Weltkrieg von unseren Feinden die Kriegsschuldlüge erfunden worden.«25 Noch fünfzig Jahre später war Hubbuch zusammen mit seinem früheren Lagerkameraden Ulrich Boes der Meinung, General Thoma sei eine besonders ehrenrührige Erscheinung gewesen. Beide hielten hartnäckig daran fest, daß Thoma 1942 in Nordafrika zu den Briten übergelaufen sei. Wegen Thomas massiver Kritik am NS-System war seinerzeit in Trent Park das Gerücht in Umlauf gekommen, er arbeite für die Briten.26
Bedauerlicherweise konnte das rund 400 Seiten starke Tagebuch von General von Thoma aus dem Spanischen Bürgerkrieg bislang nicht aufgespürt werden. Die Existenz dieses Dokuments ist belegt, die Spur verliert sich aber bei einem norddeutschen Privatsammler. Um so erfreulicher ist es, daß die Tochter von Generalmajor Paul von Felbert dem Verfasser die in der Gefangenschaft Ende 1945 niedergeschriebenen Erinnerungen und etliche Briefe ihres Vaters zur Verfügung stellte. Dieses Material bestätigt die NS-kritische Haltung Felberts, die auch in den Abhörprotokollen deutlich wird.27 So schrieb er am 5. April 1945 aus Trent Park an seine Schwester: »Es ist ja verbrecherisch, daß immer noch versucht wird, den Krieg, der schon seit langem verloren ist, weiterzuführen. So geht alles zu Grunde, besonders wenn noch den unsinnigen Aufforderungen der Untergrundbewegung, z.B. Werwolf, beizutreten, Folge geleistet wird. So können es ja nur Vollidioten sein, die solchen Irrsinn mitmachen. […] Dieses Ende mit Schrecken ist aber vielleicht besser wie der Schrecken ohne Ende, der uns erwartet hätte, wenn der Krieg nicht gekommen wäre. Es bleibt tief bedauerlich, daß ein fleißiges, anständiges Volk durch seine eigene Führung zugrunde gerichtet wird. Ich hoffe, daß die Leute, die aus den Konzentrationslagern herauskommen, das Volk über vieles, was uns allen unbekannt ist, aufklären werden.«
Bemerkenswert ist Felberts Rolle bei den Geiselerschießungen im Bereich seiner Feldkommandantur von Besançon. »In meiner Tätigkeit als Feldkommandant«, schrieb er in seinen Erinnerungen, »habe ich mich bemüht, das Los der Zivilbevölkerung, das unter fremder Besatzung ja immer recht schwer ist, zu erleichtern. Viele Leute konnte ich von der Todesstrafe retten, viele vor schwerer Freiheitsstrafe bewahren, viele Gewalttätigkeiten untergeordneter Stellen verhindern. Aber man konnte nicht überall sein und nicht alles bekam man zu hören, so daß sicher Dinge vorgekommen sind, die nicht hätten vorkommen sollen.«28
Diese Selbsteinschätzung wird durch französische Zeugenaussagen im Spruchkammerverfahren, aber auch durch amtliche Dokumente gestützt. So wies der Wehrmachtbefehlshaber Nordostfrankreich Felbert am 4. Februar 1944 darauf hin, daß der Feldkommandant nicht König in seinem Reich sei und man sich damit abzufinden habe, daß der SD ihm nicht unterstellt sei und er alles daransetzen müsse, mit diesen Dienststellen gut zusammenzuarbeiten.
Auch der Nachlaß von General Hans Cramer, den seine Tochter, Annemarie Curtius, dankenswerterweise zur Verfügung stellte, ist zweifellos bedeutsam. Cramer war der einzige Insasse von Trent Park, der aufgrund seines Asthmas noch im Krieg repatriiert wurde.29 Nach seiner Entlassung am 26. Februar 1944 gelangte er auf dem Lazarettschiff »Atlantis« von England nach Algier, an Bord des schwedischen Schiffes »Gipsholm« schließlich nach Barcelona. Ein Sonderflugzeug des Oberkommandos der Wehrmacht flog ihn nach Berlin, wo er am 12. Mai 1944 eintraf. »Nicht leicht war es auch«, schrieb er rückblickend im November 1944, »sich wieder in die deutsche Stimmung und Kriegsauffassung hineinzutasten. Ich hatte zu viel erlebt, vielleicht wußte ich auch zu viel von der Gegenseite. In Deutschland sprach man vom totalen Krieg, […] drüben führte man ihn längst.« Damals wollte in Deutschland niemand etwas von Cramer wissen. Erstaunlicherweise interessierte sich keine Dienststelle für die Stimmung der gefangenen Generäle, ihre Eindrücke aus England und die Haftbedingungen. Nur mit Mühe gelang es Cramer Ende Mai 1944 ins Führerhauptquartier nach Berchtesgaden vorgeladen zu werden. Die halbstündige Besprechung mit Hitler und General Schmundt verlief »sehr enttäuschend«, wie Cramer notierte, »da ich das Gefühl nicht los werden konnte, für diesen Krieg abgeschrieben zu sein«. Es folgte ein kurzer Empfang bei Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop und Propagandaminister Josef Goebbels, die nur wenig Verständnis für »meine Sorgen hatten, die aus meinem Wissen über den Feind und aus dem Blick, den ich über unser Vaterland hinaus getan hatte, hervorgingen. Man wollte die Wahrheit nicht hören«. Feldmarschall Wilhelm Keitel und Alfred Jodl, der Chef des Wehrmachtführungstabes und als solcher auch verantwortlich für das Desaster in Afrika, wollten sich mit Cramer erst gar nicht treffen. Anfang Juni reiste er nach Frankreich, traf hier Rommel, der ihm »zunächst befangen, dann aber sehr kameradschaftlich entgegen kam.«30 Man sprach über den Krieg in Tunesien, aber auch über die bevorstehende Invasion. In den Akten der Heeresgruppe B findet sich dazu der Eintrag, daß auch General Cramer den Schwerpunkt der alliierten Landung beiderseits der Somme-Mündung erwartete.31 Nach dem Krieg ist immer wieder behauptet worden, Cramer sei von den Briten bewußt zur Desinformation eingesetzt worden, um von der Landung in der Normandie abzulenken.32 Belegen läßt sich dies freilich nicht.
Im Juni kehrte Cramer in sein Haus in Krampnitz bei Berlin zurück und traf sich mehrmals mit Claus von Stauffenberg, den er von der Kavallerie-Schule in Hannover und aus seiner Zeit im Generalstab des Heeres kannte. Zuletzt waren sich beide 1943 in Tunesien begegnet. Über Stauffenberg kam der Kontakt zu General Olbricht zustande, der Cramer in die Umsturzpläne einweihte. Für den Fall eines Attentats sagte Cramer zu, mit den Truppen des Standortes der Panzertruppenschule Krampnitz das Gebiet um die Siegessäule zu besetzen.
Am Morgen des 20. Juli ging er in die Panzertruppenschule und versicherte sich, daß die Soldaten wie geplant ausrückten und die zugewiesenen Räume besetzten. Nach dem Scheitern des Umsturzes geriet auch Cramer rasch ins Visier der Gestapo. Am 23. Juli wurde er zum ersten Mal verhört, drei Tage später verhaftet und in das berüchtigte Gestapo-Gefängnis in der Berliner Prinz-Albrecht-Straße gebracht. Man beschuldigte ihn, der Verbindungsmann der Engländer zum Widerstand zu sein. Dieser Verdacht wurde zusätzlich dadurch geschürt, daß Cramers Sohn, der als Leutnant in der Normandie kämpfte, am 26. Juli scheinbar spurlos verschwand (er war schwer verwundet worden). Die Verhöre dauerten zehn Tage und blieben ohne konkretes Ergebnis. Schließlich verlegte man Cramer als »Ehrenhäftling« in die Sicherheitspolizeischule in Fürstenberg nördlich von Berlin. Er wurde aus der Wehrmacht entlassen und im September 1944 wegen seines Asthmas schließlich in die Berliner Charité eingeliefert. An Heilig Abend 1944 kam er nach Hause und stand bis Kriegsende unter Hausarrest.33
Viele Leser dieser Quellenedition haben sich gefragt, ob die Generäle nicht doch damit rechneten, belauscht zu werden. In der Einleitung zur Erstausgabe habe ich bereits dargelegt, daß die Gefangenen offenbar diesbezüglich ahnungslos waren. Aus den neu erschlossenen Privatdokumenten geht einmal mehr hervor, daß sie nicht ernsthaft daran dachten, die Briten könnten sie als Informationsquelle »anzapfen«. So hat sich etwa Konteradmiral Meixner, ähnlich wie Ludwig Crüwell, in seinem Tagebuch über politische und militärische Fragen ganz bewußt nicht geäußert, um dem Feind keine Informationen zuzuspielen. In den Gesprächen mit seinen Mithäftlingen legte er diese Zurückhaltung freilich nicht an den Tag.
Auch die privaten Aufzeichnungen legen nahe, daß die Gefangenen Trent Park nicht als ein Verhörlager, sondern eher als einen komfortablen Herrenclub empfanden, wo sie die Briten vermeintlich in Ruhe ließen. So schrieb General Cramer, nach Deutschland zurückgekehrt, einen Brief an die Angehörigen der inhaftierten Generäle. Von den internen Streitereien im Lager war darin keine Rede, und es fehlte auch die leiseste Andeutung darüber, daß der britische Geheimdienst die Gespräche belauscht haben könnte.34
Einen diesbezüglich interessanten Hinweis enthalten die Anfang der 1990er Jahre verfaßten, unveröffentlichten Memoiren von Ulrich Boes, der 1943/44 als Major in Trent Park inhaftiert war. Er habe damals in einigen Zimmern »Wanzen« entdeckt und sich dazu veranlaßt gesehen, einige »Drähte« zu kappen. Weitere Belege für diese Geschichte gibt es nicht, weder in britischen Dokumenten noch in den Erinnerungen anderer Lagerinsassen, etwa von Klaus Hubbuch, der mit Boes kameradschaftlich verbunden war und auch nach dem Krieg mit ihm in Kontakt stand. Hubbuch hat ausführlich über seine Gefangenschaft geschrieben, von Wanzen findet sich bei ihm allerdings kein Wort. Möglicherweise gelang es den Briten, Boes so rasch zu isolieren und nach Kanada abzuschieben, daß sich die Nachricht von versteckten Mikrophonen im Lager nicht verbreiten konnte. Vielleicht wurde Boes auch eher von einer Ahnung getrieben, als daß er Genaueres wußte. Auf jeden Fall waren die Insassen von Trent Park auch nach Boes’ Abgang im Januar 1944 weiterhin sehr gesprächig.
Der einzigartige historische Wert der Abhörprotokolle bestätigt sich einmal mehr, wenn man sie mit der Lagerpost aus Trent Park vergleicht. Die Gefangenenbriefe durchliefen die britische und die deutsche Kontrolle und enthielten daher kaum Informationen über politische oder militärische Angelegenheiten. Generalleutnant Georg Neuffer etwa beklagte sich bei seiner Frau, seine Briefe [müßten] »nach Lage der Dinge so inhaltslos, ja fast gleichlautend ausfallen«.35 Wegen der Zensur ging es in der Korrespondenz vor allem um die landschaftlich schöne Umgebung des Lagers und die alltäglichen Beschäftigungen. Nur wenige wichen von dieser Praxis ab: Am 10. Juli 1943 schrieb Generalleutnant Gotthart Frantz an seine Frau: »Alles wird gut. Eine Nation, die Luther, Kant, Goethe und Beethoven hervorgebracht hat, wird niemals sterben.«36 Je länger der Krieg dauerte, je heftiger die Luftangriffe auf deutsche Städte wurden, desto mehr dominierte in den Briefen Richtung Heimat die Sorge um das Wohlergehen der Angehörigen. Eine Reflexion über Krieg und Diktatur setzte auf dem Postweg – von Ausnahmen abgesehen – erst nach der Kapitulation ein, so etwa bei Heinz Eberbach, der sich bereits in früheren Gesprächen sehr reflektiert gezeigt hatte. In einem Brief an seine Frau vom 17. Juli 1945 heißt es: »Es gibt nicht einen von uns, den man nicht für diese menschliche Tragödie verantwortlich machen kann. Diese Zeit zum Nachdenken, die ich hier genossen habe, war sehr notwendig für mich. Die Bibel, Sophokles, Goethe, Shakespeare, sie alle halfen dabei.«37
Übrigens verdächtigten die Briten die Generäle Arnim, Crüwell und Hülsen, Konteradmiral Meixner sowie die Obersten Buhse und Wolters, mittels geheimer Briefcodes militärische Nachrichten in die Heimat zu schmuggeln. Belegt ist, daß Konteradmiral Paul Meixner am 15. Juli 1944 aus dem amerikanischen Generalslager Clinton in einem Brief an seine Frau Gretl die Nachricht versteckte, daß ein ernster Verdacht bestehe, daß die deutschen »Schluesselmittel voll bei Feind« seien.38 Ob auch die Insassen von Trent Park geheime Nachrichten in der Gefangenenpost versteckten, ist nicht bekannt, aber durchaus möglich. Generalleutnant Kittel meinte jedenfalls am 12. April 1945, daß man über einen geheimen Briefcode unbedingt in Deutschland verbreiten müsse, »wie sich diese Leute, Bassenge, Thoma und Co., benehmen. Die Admiräle [Schirmer und Kaehler] sollen ja so was schon gemacht haben.39
In summa läßt sich festhalten, daß die meisten Abhörprotokolle weit aussagekräftiger sind als die Briefe und Tagebücher der Gefangenen. Nicht zuletzt dieser Vergleich unterstreicht den außerordentlichen Wert einer Quelle, die ein Schlüsseldokument für die noch ausstehende Mentalitätsgeschichte der Wehrmacht darstellt. Will man die zeitgenössischen Wahrnehmungen und Deutungen von Krieg und Diktatur wirklich verstehen, führt an der Auswertung der Abhörprotokolle von Trent Park kein Weg vorbei.
Sönke Neitzel, August 2007
Einleitung
1. Anmerkungen zur Forschungslage und zu den Quellen
Die deutsche Generalität hat sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges der kritischen Reflexion ihrer Rolle im Dritten Reich weitgehend verschlossen. Das Bild, das sie von sich selbst und ihrer Rolle im Dritten Reich zeichnete, läßt sich auf die verkürzte Formel bringen: Man habe einen ehrenvollen Krieg geführt, habe von Kriegsverbrechen größeren Ausmaßes keine oder kaum Kenntnis gehabt, und die militärische Niederlage sei zu einem gut Teil den dilettantischen Eingriffen Hitlers in die Kriegführung zuzuschreiben.40 Ob und in welchem Maße die Publikationen der ehemaligen Generäle das Bild der Wehrmacht in der deutschen Nachkriegsgesellschaft bestimmten, ist bislang empirisch noch nicht untersucht worden. Neuere Darstellungen verweisen darauf, daß schon in den fünfziger Jahren sowohl die Öffentlichkeit als auch einzelne Offiziere die Rolle zumindest der Spitzenmilitärs im Dritten Reich kritisch sahen, das Bild von der »sauberen Wehrmacht« bereits damals Risse hatte.41 Auch die Arbeit des Personalgutachterausschusses der Bundeswehr belegt, daß sich die Militärs seit den frühen Tagen der Bundesrepublik immer noch kritischer mit ihrer Vergangenheit befaßt haben als etwa Juristen, Ärzte oder Verwaltungsbeamte. Dennoch ist unverkennbar, daß eine tiefschürfende und durchgreifende Selbstkritik in den eigenen Reihen nicht geführt worden ist. Angesichts des verheerenden Krieges und einer eher kritischen Haltung der Öffentlichkeit gegenüber den ehemaligen Wehrmachtgenerälen kann dies auch nicht verwundern.
Die historische Forschung der fünfziger und sechziger Jahre mußte sich notgedrungen auf die Veröffentlichungen der ehemaligen Wehrmachtgeneralität stützen, das heißt vor allem auf die Memoirenwerke und die rund 2500 Berichte, die sich die Historical Division der US Army in den Jahren 1946 bis 1948 von hohen Offizieren über ihre Fronterlebnisse anfertigen ließ.42 Erst nach Rückgabe des amtlichen Schriftgutes in den siebziger Jahren43 war man dann in der Lage, die Rolle der Wehrmacht und ihrer Führung während des Zweiten Weltkrieges differenzierter darzustellen. Aus den nun in großer Menge verfügbaren militärischen Dienstakten ließ sich aber meist kein umfassendes Bild der Generalität zeichnen, da diese vor allem die Ergebnisse des engeren militärischen Handelns dokumentierten. Die Innenansicht etwa eines Armee- oder Heeresgruppenstabes kann aus Kriegstagebüchern, Operationsplänen und Lageanalysen meist nicht gewonnen werden. Interne Diskussionen über Anordnungen von »oben«, über politische Überzeugungen oder vermeintlich militärische Notwendigkeiten bleiben dem Historiker bei der Betrachtung amtlicher Quellen fast immer verborgen.44
Um diesem Umstand abzuhelfen, versucht man auf persönliche Quellen wie Briefe und Tagebücher zurückzugreifen. Derartiges Material liegt allerdings nur von einem kleinen Personenkreis vor und ist zudem oft nur beschränkt zugänglich, da es sich in Privatbesitz befindet.45 Die Forschung kann die Fragen, inwieweit ein militärischer Führer das Beziehungsgeflecht von Politik und Verbrechen durchschaute, was er wußte, was er ahnte, was er zu wissen ablehnte, somit nach wie vor nur schwer und nur in Einzelfällen bei besonders guter Quellenlage hinreichend durchleuchten.46 Die Kenntnis über das Wissen und die Gedanken selbst hochrangiger militärischer Persönlichkeiten ist begrenzt. So ist mittlerweile zwar bekannt, daß etwa Großadmiral Karl Dönitz von anderen Marineoffizieren Mitteilung über Massenerschießungen an der Ostfront erhielt. Wie er aber persönlich mit diesen Informationen umging, wie er sie interpretierte, welche Schlußfolgerungen er daraus zog, darüber können allenfalls Vermutungen angestellt werden.47
Im Londoner Public Record Office, das unlängst in den britischen National Archives aufgegangen ist, lagert freilich eine Quelle, die zur Erforschung der Geschichte der Wehrmacht und des Dritten Reiches noch nicht genügend herangezogen worden ist: die umfangreichen Abhörprotokolle deutscher Stabsoffiziere in britischer Kriegsgefangenschaft. Im Gegensatz zur Befragung von Kriegsgefangenen, die immer dem Vorbehalt unterliegt, daß den Verhöroffizieren möglicherweise nicht die Wahrheit gesagt worden ist,48 ermöglichen die heimlich erstellten Protokolle der Gespräche deutscher Kriegsgefangener einen weitgehend unverfälschten Einblick in ihre Gedanken- und Erfahrungswelt, da sie in der zwanglosen Konversation untereinander kaum Rücksichten genommen haben.
Anhand dieser faszinierenden Quellen lassen sich die Gespräche der prominentesten deutschen Gefangenen in Großbritannien zuverlässig nachvollziehen. Wichtige Fragen können nunmehr aufgeklärt werden: Wie beurteilten sie die allgemeine Kriegslage, ab wann hielten sie den Krieg für verloren? Wie reagierten sie auf den 20. Juli 1944? Welche Kenntnis hatten sie von Kriegsverbrechen, sei es durch eigenes Erleben oder durch Berichte anderer? Welchen Stellenwert hatten diese brisanten Themen im Lagerleben? Gab es Meinungsverschiedenheiten oder gar Feindschaften zwischen einzelnen Personen, möglicherweise auch Generationskonflikte? Welche Rolle spielten Dienstränge und Fronterfahrungen?
Die 1996 freigegebenen Abhörprotokolle des Combined Services Detailed Interrogation Center (UK), kurz: CSDIC (UK), hat die Forschung bislang kaum beachtet. Gelegentlich fanden die Lauschberichte über Gespräche deutscher U-Boot-Besatzungen Eingang in Studien über den Seekrieg.49 Die Unterlagen über die Stabsoffiziere sind bislang praktisch unerforscht.50 Erstmalig hat der Verfasser diese Quelle in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte umfassender vorgestellt – aus Platzgründen freilich auf eine Auswahl von 21 Dokumenten beschränkt,51 die den außergewöhnlichen Facettenreichtum der Abhörprotokolle notgedrungen nur unvollständig wiedergibt. Die hier vorliegende Edition von 189 Dokumenten berücksichtigt den gesamten Bestand an Lauschberichten deutscher Generäle in britischer Kriegsgefangenschaft vom Spätsommer 1942 bis zum Herbst 1945. Sie sind mit vier Ausnahmen alle in Trent Park, dem Sonderlager für deutsche Stabsoffiziere, entstanden. Die Dokumente 76, 77 und 135 protokollieren Gespräche der Generäle Walter Bruns und Maximilian Siry, die im April und Mai 1945 in Latimer House (Buckinghamshire) entstanden, also zu einer Zeit, als aus Platzgründen nicht mehr alle gefangenen Stabsoffiziere nach Trent Park gebracht werden konnten. Dokument 152 stammt aus dem Heeresbestand der Abhörprotokolle von Latimer House. Es handelt sich um die Aufzeichnung eines Gespräches zweier Majore im Generalstab, die im August 1944 in Frankreich in Gefangenschaft kamen und sich unter dem Eindruck des Attentates auf Hitler über die allgemeine Kriegslage unterhielten. Dieser Bericht ist insofern eine Besonderheit, als von den in der Normandie gefangengenommenen Offizieren nur wenige Gesprächsmitschnitte zu allgemeinen politischen Fragen vorliegen52 und so ein interessanter Kontrast zu den Bewertungen der Generäle geboten wird.
Inhaltlich gliedert sich die Edition in vier thematische Abschnitte, die in sich chronologisch gegliedert sind: Das erste Kapitel befaßt sich mit allgemeinen Reflexionen der Generäle über den NS-Staat, den Kriegsverlauf und die daraus folgenden internen Differenzen (Dokumente 1–82). Der zweite Teil dokumentiert Gespräche über den Themenkomplex Kriegsverbrechen (Dokumente 83–144). Es folgt ein Abschnitt mit Protokollen über den 20. Juli 1944 (Dokumente 145–167). Das vierte und letzte Kapitel behandelt die Debatte über den Aufbau eines »Seydlitz-Klubs«. Die Frage, ob man dem Beispiel von General der Artillerie Walter von Seydlitz-Kurzbach folgen und in Großbritannien ein Nationalkomitee Freies Deutschland »West« gründen solle, ist in Trent Park vom Frühjahr 1944 bis Kriegsende immer wieder kontrovers debattiert worden.
Der Verfasser hat sich bei der Auswahl der Dokumente darauf konzentriert, Inhalt und Relevanz der in Trent Park aufgezeichneten Gespräche repräsentativ wiederzugeben. Die Aufteilung der hier publizierten Abhörprotokolle in vier Bereiche spiegelt die behandelten Themen maßstabsgetreu wieder.
Abgerundet wird die Edition durch die Kurzbiographien aller 88 Personen, die in den Abhörprotokollen zu Wort kommen. Neben einer knappen Zusammenfassung der militärischen Karriere enthalten diese – so vorhanden – auch Auszüge aus Beurteilungen der Vorgesetzten sowie Auszüge aus den prägnanten Charakterstudien, die das CSDIC (UK) von den meisten Generälen in Trent Park angefertigt hat. Die Gegenüberstellung von deutschen und britischen Quellen läßt die Persönlichkeiten der Generäle deutlicher hervortreten. Freilich sind sowohl die in den Personalakten enthaltenen Beurteilungen als auch die britischen Bewertungen höchst subjektive Einschätzungen. Die in beiden Quellen enthaltenen Angaben über die nationalsozialistische Haltung eines Offiziers ist stets in dem Kontext ihrer Entstehung zu interpretieren. Seit Herbst 1942 mußte bei den Beurteilungen der Heeresoffiziere (für die Luftwaffe galt dies schon seit 1939) neben dem Persönlichkeitswert, der Bewährung vor dem Feinde, den dienstlichen Leistungen und den geistigen sowie körperlichen Anlagen auch die nationalsozialistische Haltung bewertet werden. Dementsprechend fand die Einschätzung »Nationalsozialist« oder »steht auf dem Boden des Nationalsozialismus« geradezu inflationär Verwendung, so daß sich Generalleutnant Rudolf Schmundt im Juni 1943 darüber beklagte, die Begriffe würden so schematisch gehandhabt, daß »eine Wertung daraufhin kaum noch erfolgen kann«.53 Sichere Rückschlüsse auf die politische Haltung erlauben allenfalls stärkere Formulierungen wie »fest fundierter Nationalsozialist, der sein Soldatentum danach ausgerichtet hat« (Ludwig Heilmann) oder »durch und durch Soldat wie Nationalsozialist, vermittelt durch Beispiel und Wort nationalsozialistisches Gedankengut in hervorzuhebender Weise« (Gotthart Frantz).
Die britischen Charakterstudien54 sind sehr wahrscheinlich alle von Lord Aberfeldy erarbeitet worden. Da dies aber nicht mit letzter Sicherheit nachzuweisen ist, wird in den Kurzbiographien neutral vom CSDIC (UK) gesprochen. Bei dieser Quelle ist weiterhin zu beachten, daß der Begriff »Nazi« zumeist keine differenzierte Klassifizierung darstellt. Entsprach ein General in seiner Haltung oder seinem Aussehen den teilweise klischeehaften britischen Vorstellungen von einem preußischen Militär, war man schnell mit der Einordnung »Nazi« zur Hand. Aussagekraft gewinnt diese Bewertung aber in Kombination mit den Beurteilungen aus der Wehrmachtzeit. Von dieser Einschränkung abgesehen, stellen die Charakterbeschreibungen des CSDIC (UK) eine wichtige Quelle dar, weil sie auf den Erfahrungen wochen- und monatelangen Zusammenlebens in Trent Park beruhen und die Persönlichkeit der Generäle plastischer werden lassen.
2. Das Abhören von Kriegsgefangenen in Großbritannien und das Gefangenenlager von Trent Park
Im Zweiten Weltkrieg haben wahrscheinlich alle Kriegsparteien ihre Gefangenen heimlich abgehört. Der Regelfall scheint allerdings gewesen zu sein, daß man Verhöre und Befragungen ausgewählter Personen dokumentierte, nicht jedoch die Gespräche, die sie untereinander führten. Richard Overy hat die Protokolle der Verhöre von NS-Größen 1945/46 veröffentlicht.55 Weitere Belege gibt es für Großbritannien, die USA, Deutschland und die Sowjetunion.56 Nach bisherigem Kenntnisstand waren es die Briten, die diese Methode der Informationsbeschaffung perfektionierten. Bekannt ist, daß die in Farm Hall bei Cambridge internierten deutschen Atomwissenschaftler belauscht wurden, um ihnen das Geheimnis zu entlocken, wie weit Deutschland mit dem Bau der Atombombe vorangeschritten war.57 Daß die Briten ihre Kriegsgefangenen teilweise über Jahre hinweg systematisch abhörten, war bisher indes verborgen geblieben.
Derartige Methoden der Informationsbeschaffung hat der britische Nachrichtendienst seit Kriegsbeginn angewandt. Bereits am 26. Oktober 1939 wurde die Aufstellung des Combined Services Detailed Interrogation Centre angeordnet. Es unterstand zunächst dem MI9 und ab Dezember 1941 der neugegründeten Abteilung MI19 des War Office unter Lieutenant-Colonel A.R. Rawlinson, fiel somit in die Zuständigkeit des Heeres. Alle im CSDIC erstellten Berichte gingen gleichermaßen an die Nachrichtendienstabteilungen von Heer, Luftwaffe und Marine. Hier konnten diese Dokumente zusammen mit anderen Informationen, etwa aus der Funk- oder der Luftaufklärung, zu einem spezifischen Intelligence-Bild zusammengefügt werden.58