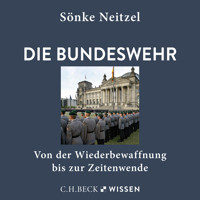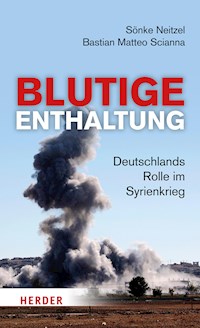16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Leutnant des Kaiserreichs, ein Offizier der Wehrmacht und ein Zugführer der Task Force Kunduz des Jahres 2010 haben mehr gemeinsam, als wir glauben. Zu diesem überraschenden Schluss kommt Sönke Neitzel, der die deutsche "Kriegerkultur" in all ihren Facetten untersucht. Seine Bilanz: Soldaten folgen der Binnenlogik des Militärs, sie sollen kämpfen und auch töten. Das gilt für die großen Schlachten im Ersten Weltkrieg, den verbrecherischen Angriffskrieg der Wehrmacht und aber auch für die Auslandseinsätze der Bundeswehr. In einer großen historischen Analyse durchmisst Neitzel das Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Militär und zeigt, wie sich die Kultur des Krieges über die Epochen veränderte. 75 Jahre nach Kriegsende geht es darum, das ambivalente Verhältnis der Deutschen zu ihrer Armee neu zu bestimmen. Dieses Buch liefert die Grundlagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Soldaten sind Krieger, die kämpfen und auch töten müssen.
Soldaten leben in einer eigenen Welt. Begriffe wie Tapferkeit, Gehorsam und Kameradschaft sind für sie so aktuell wie eh und je. Das Bedürfnis nach authentischen Vorbildern ist groß, das gilt auch für die Bundeswehr. Doch in welcher Tradition stehen deutsche Soldaten?
Der Autor
Sönke Neitzel, geboren 1968, war nach Lehrtätigkeiten in Mainz, Karlsruhe, Bern und Saarbrücken Professor für Modern History an der University of Glasgow und Professor für International History an der London School of Economics (LSE). Seit 2015 hat er den deutschlandweit einzigen Lehrstuhl für Militärgeschichte/ Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Universität Potsdam inne. Zuletzt erschien von ihm und Harald Welzer der Bestseller »Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben«, der in 19 Sprachen übersetzt wurde.
Propyläen wurde 1919 durch die Verlegerfamilie Ullstein als Verlag für hochwertige Editionen gegründet. Der Verlagsname geht zurück auf den monumentalen Torbau zum heiligen Bezirk der Athener Akropolis aus dem 5. Jh. v. Chr. Heute steht der Propyläen-Verlag für anspruchsvolle und fundierte Bücher aus Geschichte, Zeitgeschichte, Politik und Kultur.
Vom Kaiserreich zur Berliner Republik – eine Militärgeschichte
Propyläen
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-2370-1
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020
Karten: Peter Palm, Berlin
Lektorat: Christian Seeger
Umschlaggestaltung: Morian & Bayer-Eynck, Coesfeld
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Einleitung
»Die Wehrmacht ist in keiner Form traditionsstiftend für die Bundeswehr. Einzige Ausnahme sind einige herausragende Einzeltaten im Widerstand. […] Das ist eine Selbstverständlichkeit, die von allen getragen werden muss« – diese deutlichen Sätze sprach Ursula von der Leyen am 3. Mai 2017. In der Krise um den unter Terrorverdacht stehenden Oberleutnant Franco Albrecht galt es, rasch klare Worte zu finden. Jedwede Verdächtigungen, dass der Geist längst vergangener Tage hinter den Kasernenmauern geduldet würde, sollten im Keim erstickt werden. Doch wer sich jenseits der beschwichtigenden Ministerialrhetorik ernsthaft mit den Streitkräften beschäftigte, konnte die Spuren der Vergangenheit kaum übersehen. Die Wehrmacht steckte von Anfang an in der DNA der Bundeswehr, und man kam auch im 21. Jahrhundert nicht ganz von ihr los. Das musste auch die Ministerin zur Kenntnis nehmen, als sie mit ihrer Entourage die Kaserne des Jägerbataillons 291 im elsässischen Illkirch besuchte, wo Franco Albrecht zuletzt Dienst getan hatte. Für die Bundeswehr war es peinlich genug, dass er trotz seiner offensichtlich rechtsextremen Gesinnung nicht vom Dienst suspendiert worden war. Doch damit nicht genug. Von der Leyen registrierte empört, dass ein Aufenthaltsraum der Kaserne mit allerlei Zeichnungen, Sinnsprüchen, Waffen und Ausrüstungsgegenständen aus den Zeiten der Befreiungskriege und der Wehrmacht ausgeschmückt war. Mit der lieb gewordenen Vorstellung vom deutschen Soldaten als global social worker, der als Retter, Vermittler und Beschützer weltweit hilft, Konflikte friedlich beizulegen, hatte diese Raumgestaltung herzlich wenig zu tun. Hier ging es um eine ganz andere Berufsidentität: jene des Kämpfers, der sich in eine weit zurückreichende Ahnenreihe von Kriegern stellt.
Manche halten diejenigen, die Bilder von heldenhaften Landsern in ihre Dienstzimmer hängen, schlicht für Nazis. In der Tat gehen Rechtsradikalismus und Verherrlichung der Wehrmacht fast immer miteinander einher. Doch zur Erklärung soldatischer Identitäten trägt dieser Befund wenig bei. Untersuchungen von Verfassungsschutz und MAD zeigen, dass vielleicht drei Prozent der Soldaten einem rechtsradikalen Milieu zuzuordnen sind und damit ungefähr so viele wie in der Gesamtgesellschaft.1 Weit mehr Bundeswehrsoldaten dürften die Wehrmacht aber nach wie vor für einen legitimen Teil ihrer Tradition halten; wohl auch jene, die in Illkirch den Raum ausschmückten. Das mag man empörend finden, aber warum ist das überhaupt so?
Verständlicher wird diese Haltung, wenn man das Militär als eine Welt mit eigenen Werten und Normen versteht, die zwar von Gesellschaft und Politik mitgeprägt wird, aber doch einen besonderen sozialen Kosmos bildet. Die reale oder potenzielle Erfahrung vom Kämpfen, Töten und Sterben unterscheidet die Streitkräfte fundamental von anderen gesellschaftlichen Gruppen. Aus der Perspektive des Soldaten haben Begriffe wie Tapferkeit, Pflichterfüllung und Kameradschaft eine viel größere Bedeutung als für einen Versicherungskaufmann oder Parlamentarier. Wer das Kämpfen in den Mittelpunkt seiner beruflichen Identität stellt, sucht sich besondere Vorbilder. In der Bundeswehr ist das zwar nur eine Minderheit, weil viele Soldaten aufgrund ihrer Tätigkeiten – als Techniker, Seeleute, Fahrer oder Verwaltungsbeamte – eher zivile Identitäten haben. Aber die Kämpfer sind keineswegs ausgestorben. Im elsässischen Illkirch waren sie 2017 offensichtlich noch zu finden. Hier dienten Männer und Frauen, die sich für den archaischeren Teil des Soldatenberufs entschieden hatten.
Dass sich Soldaten in ihrem Selbstverständnis auf den Krieg ausrichten und dafür die passenden Vorbilder suchen, ist eigentlich eine banale Erkenntnis. Die Deutschen aber haben sich mit ihr nach dem Zweiten Weltkrieg schwergetan. Der Kulturbruch war so tief, die Verbrechen waren so unfassbar, die Niederlage auch moralisch so total, dass sich ihr Verhältnis zum Militär grundlegend änderte. Zu Pazifisten wurden die meisten zwar nicht, aber Gesellschaft und Politik blickten kritischer als zuvor auf ihre Soldaten, suchten sie einzuhegen, ein Stück weit zu zivilisieren und nicht zuletzt von der Vergangenheit abzugrenzen. Freilich sind Wunschbild und Realität zweierlei. Alle deutschen Staaten haben versucht, ihren jeweiligen politisch-gesellschaftlichen Rahmen möglichst umfassend auf ihre Armeen zu übertragen: das Kaiserreich ebenso wie die Weimarer Republik, die Nationalsozialisten ebenso wie die Kommunisten. Das funktionierte mal mehr, mal weniger gut. Vollständig gelang es nie, auch nicht in der Bundesrepublik. Dafür waren die Deutungsangebote, die die Politik für die jeweilige Rolle des Militärs zu bieten hatte, meist zu abgehoben, zu theoretisch; sie entsprangen einer Vorstellungswelt, mit der die Soldaten nicht viel anzufangen wussten. Das Militär blieb immer auch eine Welt für sich, die über die politischen Brüche hinweg erstaunlich beständig war. Zu einem tieferen Verständnis der Streitkräfte wird man nur kommen, wenn man ihre spezifische Kultur analysiert – jene Normen, Werte, Haltungen und Überzeugungen, die ihr Denken, Sprechen und Handeln bestimmen.2 Die internen Debatten über soldatische Tugenden und Traditionen gehören ebenso dazu wie die Art und Weise, wie über Kriege nachgedacht wird – und wie sie geführt werden.
Für die Männer und Frauen, die den Aufenthaltsraum im elsässischen Illkirch gestaltet hatten, waren die ausgestellten Waffen und Leitsprüche gewiss nicht nur dekorative Artefakte; sie hatten Bedeutung für ihre soldatische Gegenwart. Doch was hatte das 2010 aufgestellte Jägerbataillon mit den Soldaten weit zurückliegender Zeiten zu tun? Gibt es überhaupt Kontinuitäten im militärischen Denken und Handeln, die bis tief ins 19. Jahrhundert zurückreichen? Wie unterscheiden sich die institutionellen Normen und Werte der monarchischen Kontingentarmeen, der Wehrmacht und der Bundeswehr? Gab es trotz denkbar unterschiedlicher Erfahrungen in Krieg und Frieden ähnliche Vorstellungen von den Pflichten und Aufgaben des Soldaten? Und sollte man Armeen nicht auch von ihrem professionellen Selbstverständnis her beurteilen? Was haben, so kann man fragen, ein Leutnant des Kaiserreichs, ein im Nationalsozialismus sozialisierter junger Wehrmachtoffizier und ein Zugführer der Task Force Kunduz des Jahres 2010 gemeinsam?
Das vorliegende Buch geht diesen Fragen in einem Längsschnitt nach. Ausgangspunkt ist das Jahr 1871. Die militärischen Traditionen deutscher Armeen reichen zwar noch weiter zurück, zu den preußischen Reformern aus der Zeit der Napoleonischen Kriege und teilweise noch darüber hinaus. Doch die große Zäsur in der modernen deutschen Militärgeschichte stellten zweifellos die Siege in den Einigungskriegen von 1864, 1866 und 1870/71 dar. Sie waren nicht nur eine wichtige Voraussetzung für die Gründung des ersten deutschen Nationalstaats, sondern sie veränderten auch das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Militär grundlegend. Die bürgerlich-liberale Kritik an den Streitkräften wich einer schier grenzenlosen Bewunderung. Die Siege gegen Österreich und Frankreich manifestierten zudem einen German Way of War: Schnelle, blitzartige und risikoreiche Angriffsoperationen waren seit 1866 das Merkmal preußisch-deutscher Kriegführung. In der historischen Forschung wird seit Langem diskutiert, ob die deutsche Militärkultur auch durch eine besondere Gewaltkultur gekennzeichnet sei. Isabel Hull, MacGregor Knox oder Dirk Bönker argumentierten3, Deutschland habe seine Kriege in den Kolonien und in Europa von 1870 bis 1918 radikaler und brutaler geführt als die übrigen europäischen Großmächte. Dadurch seien kulturell tief verankerte Handlungsmuster entstanden, die später der Nationalsozialismus zu nutzen verstand. Der Weg nach Auschwitz begann nach dieser Lesart bereits im Kaiserreich, etwa mit dem Genozid an den Herero. Das Buch wird die deutschen Kriegsverbrechen in eigenen Unterkapiteln behandeln, zur These eines deutschen Sonderwegs eine eigene Position beziehen und auch aufzeigen, wie Bundeswehr und NVA mit dem unrühmlichen Erbe der Wehrmacht-Verbrechen umgegangen sind.
Untersuchungen, die den Kontinuitäten des deutschen Militärs nachspüren, enden zumeist 1945.4 Der heiße Krieg hat stets mehr Aufmerksamkeit gefunden als der Kalte. Dadurch wurden Bundeswehr und NVA in der historischen Forschung auf eigenartige Weise von ihren Vorläufern abgekoppelt. Die vorliegende Darstellung reicht hingegen bis zur Gegenwart. Sollte es so etwas wie eine nationale Militärkultur Deutschlands wirklich gegeben haben, dann ist zu fragen, was mit ihr nach 1945 passierte, was von ihr überdauerte, was geändert oder umgedeutet wurde. Das Trauma zweier verlorener Weltkriege, die Teilung Deutschlands, die Blockkonfrontation und die atomare Bedrohung formten ganz neue und höchst komplexe Rahmenbedingungen. Die Welt der Bundeswehr war eine völlig andere als die ihrer Vorgänger. Sie musste keine Kesselschlachten schlagen, keine Rückzüge organisieren, verübte keine Verbrechen. Dafür musste sie mit einem rasanten gesellschaftlichen Wertewandel5 zurechtkommen und sich fragen lassen, inwieweit sie in Zeiten der potenziellen atomaren Apokalypse überhaupt noch eine Existenzberechtigung hatte. Man probte zwar den Ernstfall, lebte aber im tiefen Frieden. Die Bundeswehr war gewissermaßen in einer doppelten Ambivalenz gefangen: Sollte sie vom Krieg oder vom Frieden her gedacht werden, und sollte sie sich in die lange Tradition deutscher Militärgeschichte stellen oder nicht? Eigentlich schlossen sich beide Optionen aus, dementsprechend heftig wurde um sie gerungen. Um die außenpolitischen Anforderungen des Kalten Krieges zu erfüllen, lief es in der Praxis notgedrungen auf einen Kompromiss zwischen militärischer Binnenlogik und innenpolitischen Vorbehalten hinaus.
Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem vermeintlichen Ende der Geschichte schien sich das Militär in seiner klassischen Form überlebt zu haben. Die doppelte Ambivalenz löste sich auf: Nun ging es nicht mehr darum, sowjetische Panzerarmeen in der norddeutschen Tiefebene zu stoppen, sondern in der Rolle des Entwicklungshelfers oder Polizisten an internationalen Einsätzen teilzunehmen. Auch die Vorbilder aus alten Tagen schienen ausgedient zu haben. Doch mit den heftigen Gefechten in Afghanistan in den Jahren 2008 bis 2011 kehrte der Kämpfer zurück ins Selbstbild der Truppe, mit der Ukrainekrise 2014 dann auch der Kalte Krieger. Und wie sich nicht zuletzt in Illkirch zeigte, war man die Geister der Wehrmacht noch nicht losgeworden.
Die außen- und innenpolitischen Rahmenbedingungen Deutschlands veränderten sich in den vergangenen 150 Jahren mehrfach fundamental. In der Binnenwelt des Militärs gab es bei allem Wandel aber bemerkenswerte Kontinuitäten, etwa im grundsätzlichen Verständnis vom Krieg und dem daraus abgeleiteten Führungsdenken. Es dominierte die Vorstellung, dass sich der Krieg der Rationalität und damit weitgehend auch der Planbarkeit entziehe. Nur der gebildete Generalist, so war man von Moltke d. Ä. bis Beck überzeugt, würde im Ernstfall als Führer den Anforderungen des Krieges gerecht werden können, nur er würde militärische Erfolge erzielen, die es der Politik ermöglichten, als gleichberechtigter Akteur in der internationalen Staatenordnung zu agieren. An dieser Auffassung änderte sich auch in der Bundeswehr grundsätzlich nichts.6 Die Ausbildung von Generalstabsoffizieren zu breit gebildeten Generalisten folgt bis heute diesem Prinzip. Eine Stunde null gab es also für die Streitkräfte ebenso wenig wie für alle anderen Bereiche von Staat und Gesellschaft. Gewiss war die Bundeswehr keine Wehrmacht in neuem Gewande. Die Pervertierung des Opfergedankens gab es nicht mehr, auch keine Weltmachtfantasien und keinen Willen zur totalen Kriegführung. Krieg war aber auch weiterhin ein Handwerk, und so veränderte sich im Führungsverständnis wie auf der untersten taktischen Ebene des Heeres zunächst wenig.
Dieser Befund gilt auch für die Logik der Kohäsion der Streitkräfte, die amerikanische Soziologen im Zweiten Weltkrieg als Forschungsfeld entdeckten. Seither ist heftig darüber gestritten worden, was Soldaten dazu motiviert, ihrem Handwerk nachzugehen. Heute ist weitgehend unstrittig, dass mehrere Faktoren zusammenwirken. Da ist zum einen der Zusammenhalt der sogenannten Primärgruppen – jenes Personenverbunds, zu dem der engste soziale Kontakt besteht. Im Militär werden damit Einheiten bis zur Größe einer Kompanie (rund 120 Mann) beschrieben. Die Befragung von Wehrmachtsoldaten in amerikanischer Gefangenschaft zeigte, dass der Zusammenhalt auf dieser horizontalen Ebene für die Motivation eine wichtige Rolle spielte.7 Zusätzlich gestärkt wurde das Band dieser kleinen Kampfgemeinschaften, wenn die gleiche soziale oder landsmännische Herkunft bestand oder es gemeinsame Erfahrungen in Ausbildung und Einsatz gab. Brachen die Primärgruppen auseinander, etwa durch hohe Verluste, oder wurden Einheiten so schnell aufgestellt, dass sich soziale Bindungen erst gar nicht einstellen konnten, wurde die Bereitschaft zum Kämpfen geschwächt.
Soldaten fochten aber nicht nur für ihre Kameraden. Der amerikanische Soziologe Charles C. Moskos betonte zu Recht die Bedeutung des größeren sozialen Systems: Je enger der Bezug zu Staat, Gesellschaft und zur Institution der Streitkräfte, desto höher die Bereitschaft, für diese in den Kampf zu ziehen. Es spielt also eine Rolle, ob man sich mit dem Staat, dem man dient, identifiziert, ob die Armee als effizient, die Offiziere als tapfer, ihr Verhalten als gerecht empfunden werden. Sodann ist der Auftrag, sind Anlass, Ziel und Erfolgsaussicht des Einsatzes von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Wer glaubt, in einem gerechten Feldzug zu kämpfen, ist anders motiviert als derjenige, von dem die politische und militärische Führung verlangen, in einem offensichtlich sinnlosen oder gar verbrecherischen Krieg sein Leben zu riskieren.8 Und wer glaubt, den Kampf siegreich bestehen zu können, kämpft motivierter als derjenige, der in einer längst verlorenen Schlacht als Kanonenfutter verheizt wird.
Horizontale und vertikale Ebene bilden im Idealfall ein festes Kohäsionsgeflecht, das Soldaten auch in schwieriger Lage motiviert, ihren Auftrag zu erfüllen. Über die Grundstruktur dieses Modells sind sich Soziologen und Geschichtswissenschaftler weitgehend einig. Unterschiedlich bewertet wird nach wie vor die Relevanz einzelner Faktoren.9 So hat Omer Bartov argumentiert, dass für Wehrmachtsoldaten die NS-Ideologie und nicht die Primärgruppen der ausschlaggebende Motivationsfaktor gewesen sei.10 Etliche Historiker – darunter auch der Verfasser – haben dem widersprochen und dafür plädiert, die Bedeutung der Primärgruppen hervorzuheben und den ideologischen Faktor nicht überzubewerten.11 Auch im Falle der Bundeswehr lässt sich trefflich über die Bedeutung einzelner Aspekte dieses Modells streiten.12 Dass beide Kohäsionsebenen ihre Bedeutung haben, wird man angesichts der reichhaltigen internationalen Forschungsergebnisse kaum bestreiten können. Entscheidend ist, dass sich das Grundprinzip des Modells auf alle deutschen Armeen übertragen lässt und so interessante Vergleichsmöglichkeiten eröffnet.
Die Darstellung geht chronologisch vor und nimmt die Streitkräfte des Kaiserreichs, der Weimarer Republik, des NS-Regimes, der Bonner Republik, der DDR und schließlich der Berliner Republik in eigenen Kapiteln in den Blick. Gut die Hälfte des Buches handelt von der Zeit nach 1945. Dieser Zeitabschnitt ist von der Geschichtswissenschaft bislang am wenigsten bearbeitet worden, obwohl es zu ihm die meisten Quellen gibt. Bundeswehr und NVA haben aus den Jahrzehnten des Kalten Krieges mehr Akten hinterlassen, als ein Mensch in seinem Leben lesen kann. Auch kommende Generationen dürften also noch genügend Stoff zum Forschen haben. Für die Zeit nach 1990 ist die Aktenüberlieferung spärlicher, weil die meisten Dokumente einer 30-jährigen Schutzfrist unterliegen und der Forschung noch nicht zur Verfügung stehen. Es ist aber möglich, Unterlagen vorzeitig freigeben zu lassen, und ein guter Geist im Verteidigungsministerium hat mir die allermeisten meiner Anträge auf Akteneinsicht dankenswerterweise genehmigt. Zudem habe ich mit rund 200 Zeitzeugen gesprochen, die mir viel Erhellendes zur Bundeswehr und zu den Auslandseinsätzen berichtet haben. Einige von ihnen konnte ich zitieren, die meisten aber sind noch aktive Soldaten und wollen lieber anonym bleiben.
Jedes der sechs Kapitel untersucht die jeweiligen Streitkräfte aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Zu Beginn werden die von Politik und Zivilgesellschaft gesetzten Rahmenbedingungen skizziert. In jeder Epoche bildeten Verfassung, historische Erfahrung, internationale Machtkonstellationen sowie technische und wirtschaftliche Entwicklung einen ordnenden und organisierenden Referenzrahmen. Er bestimmte darüber, welchen Stellenwert Politik und Gesellschaft den Streitkräften zubilligten, wie viel Geld für die Rüstung ausgegeben, wer aus welchen Gründen rekrutiert wurde. Innergesellschaftlich fächerte sich dieser Referenzrahmen weiter auf; so hatten etwa Sozialdemokraten schon im Kaiserreich einen anderen Blick auf das Militär als Mitglieder konservativer Parteien. Gleichwohl gab es eine epochenspezifische Haltung ihm gegenüber. Wer 1908 oder 1938 oder 1988 seinen Einberufungsbescheid bekam, reagierte darauf zeitbedingt ganz unterschiedlich. 1988 stellte man sich geradezu selbstverständlich die Frage, ob man zur Bundeswehr gehen, Ersatzdienst leisten oder sich die Sache irgendwie ganz ersparen sollte. 1908 oder 1938 stellte sich diese Frage nicht. Alle jungen Männer gingen zum Militär; es war eine Pflicht, die man nicht unbedingt liebte, die zu erfüllen aber praktisch jeder bereit war.
Eine zweite Perspektive widmet sich dem inneren Gefüge der Streitkräfte. Die höheren Stäbe waren mehr oder minder intensiv bemüht, dem Primat der Politik Rechnung zu tragen und die politischen Vorgaben in militärische Verordnungen und Vorschriften zu übertragen. Bereits die mittleren Führungsebenen aber folgten eher einer innermilitärischen Logik und versuchten, allzu störende politische Vorgaben von der eigenen Profession fernzuhalten. Hier trafen Einflüsse von außen, althergebrachte Traditionen sowie pragmatische Anpassungen an die Notwendigkeiten einer Massenorganisation in Krieg und Frieden aufeinander. So entstand ein Referenzrahmen des Militärs, der das Binnengefüge der Streitkräfte strukturierte und organisierte. Jeder, der zum ersten Mal eine Kaserne betrat, lernte die daraus folgenden Regeln schnell und begriff meist nach wenigen Wochen, wie das System funktionierte. Hier geht es darum nachzuzeichnen, welches Bild vom Soldaten, seinen Pflichten und Tugenden die Streitkräfte in den jeweiligen Epochen entwickelten, was oben angeordnet und unten ausgeführt wurde. Alle Kapitel thematisieren beispielsweise das Ausmaß an Drill, Schikane und Missbrauch der Soldaten. Romane wie »Im Westen nichts Neues« oder »08/15« haben dem Typus des Schleifers literarischen Ausdruck verliehen. Es wird danach zu fragen sein, in welchem Maße dieses populäre Bild der Realität entsprach.
Einen bislang kaum beachteten Teil der Binnenstruktur der Streitkräfte bilden die verschiedenen Waffengattungen, ab 1955 Truppengattungen genannt. Sie formten einen eigenen Habitus, schufen eigene Traditionsbilder und Riten, wodurch die soziale Struktur der Streitkräfte zusätzlich ausdifferenziert wurde. Mit Einführung der feldgrauen Uniform 1909 waren die Waffengattungen nur noch durch farblich unterschiedlich gestaltete Schulterstücke, Kragenspiegel und Rangabzeichen zu erkennen. Seither war die Waffenfarbe zur Abgrenzung und damit zur Identitätsstiftung von besonderer Bedeutung. Bis heute ist der Begriff »Fehlfarbe« als Bezeichnung für andere Truppengattungen jedem Bundeswehrsoldaten geläufig. Exemplarisch werden hier Infanterie/Jägertruppe und Kavallerie/Panzertruppe untersucht, die den Kern der Kampfverbände des Heeres bildeten. Ihre Ausrichtung auf das Gefecht formte eine Kriegerkultur, die über alle politisch-gesellschaftlichen Zäsuren hinweg ein hohes Maß an Kontinuität aufwies. Wer die Gestaltung des Aufenthaltsraumes in Illkirch verstehen will, muss hier ansetzen.
In gewisser Weise ähneln die Truppengattungen den tribal cultures amerikanischer Ureinwohner, etwa der Apachen oder Comanchen, deren Untergruppen sich in Lebensweise, Dialekt und sozialer Zusammensetzung abgrenzten, äußerlich voneinander unterschieden und miteinander rivalisierten. Gleichwohl unternahmen sie gemeinsame Kriegszüge und fühlten sich derselben Gemeinschaft zugehörig.13 In den europäischen Armeen der Moderne bildeten sich ganz ähnliche tribal cultures aus.14 Der Begriff tribe ist hier nicht im wörtlichen Sinne als »Stamm«, sondern sinnbildlich zu verstehen. Besondere Bedeutung bei der Ausbildung dieser tribal cultures kam den Regimentern und Bataillonen zu. Hier wurden sie gelebt und je nach Tradition des Verbandes, sozialer Zusammensetzung des Offizierkorps und Garnisonsort weiter ausdifferenziert.15 Für den Zusammenhalt der Streitkräfte waren diese tribal cultures von herausragender Bedeutung. Sie verbanden die Primärgruppen mit der Gesamtorganisation, waren damit eine Art Transmissionsriemen zwischen »oben« und »unten«.
In einer dritten Perspektive wird die handwerkliche Ebene des Militärs beleuchtet. Wie dachte man in den Stäben den Krieg und vor allem: Wie wurde er schlussendlich geführt? Untersucht werden Strategien und Doktrinen, die Fähigkeit, neue Konzepte zu entwickeln, aus Erfahrungen zu lernen und sich den sich wandelnden Rahmenbedingungen in Krieg und Frieden anzupassen. Schon hierüber hätte man ein eigenes Buch schreiben können. Um den Rahmen nicht zu sprengen, beschränkt sich die Darstellung hier auf die wesentlichen Aspekte, räumt etwa mit alten Mythen über die taktische Leistungsfähigkeit der Wehrmacht auf und wirft einen kritischen Blick auf den militärischen Wert der Bundeswehr.
Im Fokus dieses Buches stehen ganz bewusst die Landstreitkräfte. Zweifelsohne wäre es lohnend gewesen, auch Luftwaffe und Marine einzubeziehen. Auch hier gab und gibt es tribal cultures, man denke nur an die habituellen Unterschiede zwischen Kampffliegern, Transportfliegern und Angehörigen der Flugabwehrraketentruppe. Was beim Heer die Fallschirmjäger, waren bei der Marine die Schnellbootfahrer, denen ein besonders robuster Habitus nachgesagt wurde. Die Marine der Bundeswehr hatte ihre ganz eigenen Probleme mit der Tradition. Das reichte vom Umgang mit den in Nürnberg 1946 verurteilten Großadmirälen Erich Raeder und Karl Dönitz bis hin zur unlängst diskutierten Frage, ob in der Aula der Marineschule Flensburg eine Büste von Admiral Rolf Johannesson stehen darf, der kurz vor Kriegsende mehrere Todesurteile unterschrieb.
Für die Schwerpunktsetzung der vorliegenden Untersuchung spricht gleichwohl, dass das Heer in der deutschen Militärgeschichte stets die größte und wichtigste Teilstreitkraft war. Hier zeigen sich auch die deutlichsten Kontinuitätslinien, weil sich das militärische Handwerkszeug im Vergleich zu den anderen Teilstreitkräften am wenigsten veränderte. So ist es nicht verwunderlich, dass die in der Bundesrepublik geführten großen Debatten um Tradition und Identität der Streitkräfte fast immer vom Heer ausgingen. Letztlich ging es stets um die Frage, wie es die Bundeswehr mit dem Kämpfen, Töten und Sterben hielt – eine Frage, die die Landstreitkräfte im Besonderen betraf. Der Buchtitel »Deutsche Krieger« beschreibt diese archaische Seite des Soldatenberufs. Dessen raison d’ètre, der Krieg, ist gewissermaßen der Fixpunkt der vorliegenden Untersuchung.
I.
Auf dem Weg zur Weltmacht. Das Militär im Kaiserreich (1871–1918)
Blut und Eisen
Preußen löste die Deutsche Frage mit seiner Armee. In den siegreichen Kämpfen gegen Dänemark (1864), Österreich (1866) und Frankreich (1870/71) entschied es den lange schwelenden Konflikt um die Gründung eines deutschen Nationalstaats in der Mitte Europas in seinem Sinne: Am 18. Januar 1871, kurz vor Beendigung des Krieges gegen Frankreich, proklamierten die deutschen Fürsten in Versailles den preußischen König zum Deutschen Kaiser. Nach der ersten Reichstagswahl vom 3. März 1871 stimmte die neue Volksvertretung, der Reichstag, mit überwältigender Mehrheit für die neue Verfassung. Das Deutsche Reich war eine konstitutionelle Monarchie, ein monarchischer Bund von 25 Mitgliedern, genauer von vier Königreichen, sechs Großherzogtümern, fünf Herzogtümern, sieben Fürstentümern, drei freien Städten und dem Reichsland Elsaß-Lothringen. Die drei Königreiche Sachsen, Bayern und Württemberg behielten ihre eigenen Armeen, deren Kommandogewalt erst im Kriegsfall auf den preußischen Kriegsminister überging. Die Streitkräfte der kleineren Bundesstaaten standen bereits im Frieden unter preußischem Kommando oder wurden ins preußische Heer eingegliedert. Zwar waren das sächsische, bayerische und württembergische Heer auf dem Papier eigenständig, doch da sich Ausbildung und Ausrüstung überall an den preußischen Standards ausrichteten, lief es de facto doch auf eine Kaiserliche Armee hinaus. Die 1872 aufgestellte Kaiserliche Marine war dann von vornherein eine Institution des Deutschen Reiches und nicht seiner Bundesstaaten.
Der Kaiser hatte gemäß der im April 1871 in Kraft getretenen Reichsverfassung eine überaus starke Stellung: Er war die oberste Instanz des Reiches, ernannte den Kanzler, der nur ihm verpflichtet war. Die Regierung war damit der parlamentarischen Kontrolle weitgehend entzogen, der Reichstag konnte lediglich über das Budgetrecht Einfluss auf die Politik nehmen. Auf das direkt dem Kaiser unterstehende Militär- und Marinekabinett, das alle Personalfragen der Streitkräfte regelte, und auf die Operationsplanung des Generalstabs hatten weder das Parlament noch der Reichskanzler unmittelbaren Zugriff. Hinzu kam, dass sowohl der Generalstabschef als auch die Kommandierenden Generäle über das Immediatrecht beim Kaiser verfügten. In der Reichsverfassung war das Militär somit nicht dem Primat der Politik, sondern dem Primat der Krone unterworfen.
In der Praxis hing viel vom Geschick und Willen des Reichskanzlers ab, sich auch in militärischen Fragen beim Kaiser Gehör zu verschaffen. Der erste Reichskanzler Otto von Bismarck ließ nie einen Zweifel aufkommen, dass er das Staatsschiff lenkte. Das galt nicht nur im Frieden. Auch in den Kriegen 1866 und 1870/71 setzte er sich in allen Streitpunkten gegen die Militärs durch, weil Wilhelm I. ihm stets folgte. Später ignorierte er alle Präventivkriegsforderungen der Generalstabschefs. Unter Wilhelm II. war das Zusammenspiel komplizierter. Die Außen- und Militärpolitik seit 1890 zeigt jedoch, dass auch in dieser Zeit die Kanzler die zentralen Figuren blieben. Alle wichtigen Entscheidungen – etwa die Flottenpolitik seit 1898 oder die Heeresvermehrungen – wurden von den Reichskanzlern ausdrücklich gebilligt oder gar von ihnen vorangetrieben.1 Eines der wenigen Gegenbeispiele ist die Flottennovelle von 1912, die Theobald von Bethmann Hollweg aussetzen wollte, um einen englandfreundlicheren Kurs einzuschlagen. Er konnte sich aber gegen den Leiter des Reichsmarineamtes, Staatssekretär Alfred von Tirpitz, nicht durchsetzen, da dieser die Unterstützung des Kaisers hatte. Diese politische Niederlage blieb jedoch Episode. Der Reichskanzler spielte im Deutschen Reich zwar nicht de jure, aber de facto die Schlüsselrolle, zumal Wilhelm II. nach der Daily-Telegraph-Affäre von 1908 zu größerer politischer Zurückhaltung genötigt wurde.
Während der französische Staatspräsident Raymond Poincaré Überlegungen seines Generalstabs, im Falle eines Krieges mit Deutschland in das neutrale Belgien einzumarschieren, schlicht ablehnte, akzeptierte Bethmann Hollweg ähnliche Planungen seiner Militärs.2 Dass er solchen Überlegungen nicht Einhalt gebot, lag weniger an der überbordenden Macht der Militärs als an seiner zögernden Persönlichkeit. Als versierter Innenpolitiker vertraute er in militärischen wie in außenpolitischen Fragen, in denen er wenig bewandert war, dem Rat von Fachleuten. Staatssekretär Alfred von Kiderlen-Waechter ließ er etwa freie Hand in der Zweiten Marokkokrise 1911. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs hätte Bethmann Hollweg angesichts eines wankelmütigen Kaisers den Angriff auf Belgien verhindern können, wenn er es denn gewollt hätte.
Im Kaiserreich gab es also trotz des von der Verfassung vorgegebenen, auf den Kaiser zugeschnittenen Rechtsrahmens den Primat der Politik. Doch anders als in Frankreich oder Großbritannien musste die konkrete Ausgestaltung stets aufs Neue ausgehandelt werden. Das Militär hatte durch den direkten Zugang zum Kaiser und die beschränkte Zuständigkeit des Parlaments mehr Spielräume als in anderen Ländern, und diese wirkten sich – wie noch zu zeigen sein wird – in den Kolonialkriegen besonders verheerend aus. Und dennoch blieb der Einfluss der Streitkräfte, etwa auf die Außenpolitik des Reiches, begrenzt. Das zeigte sich gerade auch in der Julikrise 1914: Den »Sprung ins Dunkle« beschlossen weder Generalstabschef Helmuth von Moltke noch Kriegsminister Erich von Falkenhayn, sondern Reichskanzler Bethmann Hollweg.3
Nicht folgenlos für das Verhältnis von Politik und Militär blieb die Tatsache, dass sich das Kaiserreich in der politischen Praxis immer mehr in Richtung parlamentarischer Monarchie entwickelte. Im Reichstag wuchs der Einfluss der Sozialdemokratie unaufhaltsam – sie stellte 1912 bereits die größte Fraktion. Es waren insbesondere die Sozialdemokraten, aber auch die Linksliberalen, die in den Parlamentsdebatten das Militär ins Licht der Öffentlichkeit rückten, die internen Missstände, aber auch die brutale Kriegführung in den Kolonien scharf kritisierten. Das Parlament konnte zwar weder den Kriegsminister noch den Generalstabschef entlassen. Aber diese Debatten erregten große öffentliche Aufmerksamkeit und erzwangen 1907 gar eine Reichstagswahl. Politische Führung und Generalität konnten sie also nicht ignorieren, mussten Stellung beziehen, was mal mehr, mal weniger überzeugend gelang. Als Reichskanzler Bethmann Hollweg in Loyalität zum Kaiser die milde Bestrafung übergriffiger preußischer Soldaten im elsässischen Zabern 1913 im Reichstag verteidigte, sprach ihm das Parlament mit großer Mehrheit das Misstrauen aus – ein zuvor undenkbarer Vorgang. Der Kanzler blieb zwar im Amt, aber der Vorfall verdeutlichte das Selbstbewusstsein der Abgeordneten, von denen nur noch die Konservativen in Nibelungentreue Kaiser und Armee zur Seite standen. Angesichts dieser Verhältnisse konnte die Reichsleitung nur noch mit dem Parlament und nicht gegen dieses regieren. »In qualitativer Hinsicht«, so urteilt Frank-Lothar Kroll, »unterschied sich der Deutsche Reichstag der Vorkriegswelt jedenfalls kaum noch von den Volksvertretungen der meisten anderen konstitutionellen oder parlamentarisch verfassten Monarchien in Europa.«4
Die SPD stand der Monarchie traditionell ablehnend gegenüber. Dazu gehörte auch massive Kritik an den Streitkräften.5 Soldatenmisshandlungen beispielsweise wurden von den Sozialdemokraten öffentlichkeitswirksam im Reichstag und in der Presse angeprangert. Doch arrangierte sich August Bebels Partei im Laufe der Zeit mehr und mehr mit dem Militär. Ihre eigene Diktion war von Kampfbegriffen durchsetzt, und sie stand mitnichten den Streitkräften als solchen fern. Gehorsam, Disziplin und die Erziehung zur Wehrhaftigkeit wurden durchaus gutgeheißen. Man wollte aber keine aristokratische Elitetruppe, sondern ein kriegsbereites Volksheer. Man war gegen Paradedrill, aber nicht gegen Gefechtsdrill. Der SPD ging es vor allem um die gesellschaftliche und technische Modernisierung der Armee. Sie unterstützte daher die allgemeine Wehrpflicht und sah in einer demokratischen Heeresverfassung, die Soldatenmisshandlungen und eine spezielle Militärgerichtsbarkeit ausschloss, die Voraussetzung für militärische Schlagkraft. Seit der Jahrhundertwende wich die Fundamentalkritik am preußischen Militär immer mehr einer Kritik im Detail. So stimmte die SPD 1913 der Finanzierung der Heeresvorlage zu.6 In den Schlüsselfragen einer Vergrößerung und Professionalisierung der Armee gingen bürgerliche Offiziere wie Erich Ludendorff und sozialdemokratische Reformer wie Eduard Bernstein gewissermaßen eine Allianz ein. Dieser Wandel der SPD gipfelte in der Zustimmung zu den Kriegskrediten am 4. August 1914.
Den Helden des Krieges von 1870/71 konnte im Kaiserreich niemand entkommen. Noch im kleinsten Dorf gab es ein Denkmal zu Ehren der Gefallenen. Und dies nicht nur in Preußen. Überall im Land erzählte man sich stolze Geschichten über die Schlachten bei Wörth oder Gravelotte. Der Sedantag war nationaler Feiertag, an dem die Kriegervereine illustre Aufmärsche veranstalteten und das siegreiche Volk feierte. Kritische Stimmen waren nirgendwo zu hören. Selbst Theodor Fontane, der als einziger Zivilist umfassend über die Kriege von 1864 bis 1871 schrieb, wagte keinen Widerspruch und verfasste ein für den heutigen Leser unendlich ermüdendes Heldenepos.7
Das hohe Prestige des Militärs wirkte sich auf viele Bereiche des gesellschaftlichen und politischen Lebens aus. Die preußische Hofrangordnung von 1878 legte fest, dass die Feldmarschälle über dem Ministerpräsidenten standen, die Generäle über den Staatsministern. Während Offiziere per se als hoffähig galten, waren zivile Beamte erst ab dem höheren Dienst zugelassen. Die Uniform war in der Öffentlichkeit hoch angesehen, und der Militärdienst war auch für das einst so kritische Bürgertum eine Selbstverständlichkeit. Millionen Deutsche waren in Kriegervereinen organisiert. Kriegsspielzeug für Kinder war populär, ebenso wie der Matrosenanzug als Ausweis der Flottenbegeisterung. Das Husarenstück des Schustergesellen Friedrich Wilhelm Voigt, der sich 1906 als Hauptmann der Garde verkleidet erst einen Trupp Soldaten unterstellte und dann die Stadtkasse von Köpenick raubte, belegt den Vorrang des Militärs vor allem Zivilen eindrucksvoll. Man stelle sich nur vor, heutzutage würde ein Hauptmann des Wachbataillons auf einem Berliner Bürgeramt erscheinen und am Kassenschalter die Herausgabe des Bargelds verlangen. Sehr weit würde er mit einem solchen Ansinnen nicht kommen. Wie sehr militärische Prinzipien von Gehorsam und Unterordnung die deutsche Zivilgesellschaft im Kaiserreich vermeintlich prägten, hat Heinrich Mann in seinem 1914 fertiggestellten Roman »Der Untertan« literarisch verarbeitet. Sein Protagonist Diederich Heßling gilt vielen bis heute als meisterhaft beschriebene Verkörperung einer nationalistischen, antidemokratischen, autoritären und militärhörigen Gesellschaft, die bereits den Nationalsozialismus erahnen ließ.8
Jedoch erscheint das Bild des mit Blut und Eisen geschmiedeten Obrigkeitsstaates, in dem das Militärische von der Zivilgesellschaft Besitz ergriffen hat, doch allzu eindimensional.9 Benjamin Ziemann hat zu Recht angemerkt, dass wir über die Wahrnehmungswelt der breiten Bevölkerung noch viel zu wenig wissen. Kaiserreden, Sedanfeiern und Lehrpläne bieten keine hinreichenden Belege für die Mentalität von Schülern, Lehrern oder Wehrpflichtigen.10 Man muss sich somit davor hüten, vom Sender auf den Empfänger zu schließen, schließlich kann eine Ansprache, die das Militär verherrlicht, auf ganz unterschiedliche Weise verstanden werden.
Es gibt Indizien, die die Vorstellung einer Dominanz des Militärischen in der Zivilgesellschaft des Kaiserreichs fragwürdig erscheinen lassen. Die Streitkräfte umfassten nie mehr als ein Prozent der Bevölkerung – im Verhältnis genauso viel wie in der Bundesrepublik des Kalten Krieges –, und die Hälfte der wehrpflichtigen Männer wurde überhaupt nicht eingezogen. Gewiss, die Kriegervereine hatten drei Millionen Mitglieder11, aber viele Deutsche blieben ohne jede Militärerfahrung. Trotz des Sozialprestiges hatte selbst die Attraktivität der höheren Soldatenlaufbahn klare Grenzen. So gelang es dem Heer nie, den Offiziermangel zu beseitigen. Von 24 000 Posten waren 1913 2000 unbesetzt.12 Die 120 000 Reserveoffiziere zumeist bürgerlicher Herkunft13 wurden lange als eine Art Transmissionsriemen zur Übertragung militärischer Werte in die Zivilgesellschaft betrachtet. Was sie in der Kaserne lernten, gaben sie vermeintlich in Unternehmen, Behörden, Schulen und Universitäten weiter. Carola Groppe hat darauf hingewiesen, dass sich in den Tagebüchern und Briefwechseln deutscher Industriellenfamilien dafür kaum Belege finden lassen. Es ist auch fraglich, ob ein Reserveoffizier, der gerade einmal ein Jahr Wehrdienst leistete und innerhalb von sechs Jahren an drei mehrwöchigen Übungen teilnehmen musste, sich in seinem Denken und Handeln einer militärischen Normenwelt unterwarf.14 Am dezidiert zivilen Habitus scheint die Militärzeit nicht viel geändert zu haben, zumal die aus dem Wirtschafts- und Bildungsbürgertum stammenden Reserveoffiziere schon in ihrer Ausbildung weitgehend unter sich blieben und für sie die gesellschaftlichen Vorzüge des Dienstes in einem der angesehenen Garde- oder Kavallerieregimenter zumeist im Vordergrund standen. Mit der militärfachlichen Qualifikation haben es die Reserveoffiziere nicht immer besonders ernst genommen. Die Begeisterung für Uniformen, Paraden und wilde Reiterattacken war gewiss vorhanden, blieb aber meist auf den Moment beschränkt und drang nicht in den zivilen Alltag ein. So hielt der Unternehmer Paul von Cosman seine 1889 als Leutnant der Reserve abgehaltene Übung für ein »harmloses Kriegsspiel«15 – von der in den Vorschriften geforderten »immerwährenden Erhaltung der Kriegstüchtigkeit« war bei ihm wenig zu spüren.
Die andere Brücke vom Militär in die Zivilgesellschaft bildeten die ehemaligen Unteroffiziere, die nach zwölf Jahren Dienstzeit in der Regel in die mittlere Verwaltungslaufbahn übernommen wurden. Doch sie stellten keineswegs die Mehrheit der Beamtenschaft, und es ist nicht hinreichend untersucht, inwieweit sie ihr neues ziviles Arbeitsumfeld im Sinne ihrer militärischen Erfahrung prägten oder umgekehrt von diesem im zivilen Sinne beeinflusst wurden. Einen weiteren Hinweis, dass das Militärische die gesellschaftlichen Umgangsformen im Kaiserreich kaum dominiert haben kann, offenbart die Anstands- und Benimmliteratur der Zeit, die das Salutieren oder Hackenschlagen vielfach als überflüssig und unschicklich bezeichnete und alles schneidig Stramme bei der Begrüßung ausdrücklich vermieden sehen wollte.16 Die These einer durchgreifenden Militarisierung der Gesellschaft ist also kaum haltbar.17
Die Streitkräfte wurden vom Bürgertum als ein organischer Teil der Gesellschaft betrachtet. Militärdienst galt als Bürgerpflicht. Jeder sollte seinen Beitrag zur Verteidigung von Staat und Nation leisten, und das fiel den Bürgersöhnen angesichts der privilegierten Bedingungen als Einjährig-Freiwillige offenbar nicht besonders schwer. Sie mussten – nach Absolvierung einer Eignungsprüfung – nur ein Jahr Wehrdienst leisten, konnten das Regiment und den Zeitpunkt ihres Dienstantritts frei wählen und sich am Ende ihrer Dienstzeit zum Reserveoffizier qualifizieren. Die Kosten für den Militärdienst mussten sie jedoch selbst tragen. Nur in den ersten Wochen waren die Einjährigen zusammen mit den übrigen Mannschaften untergebracht, dann wohnten sie außerhalb der Kasernen in Privatquartieren. Auch ihre Grundausbildung erfolgte getrennt von den übrigen Soldaten. Offizierkorps und Bürgertum rückten näher zusammen als je zuvor, wozu die Vergrößerung, Professionalisierung und Technisierung der Streitkräfte erheblich beitrugen. Wie im Militär die Ansicht vorherrschte, die Schule der Nation zu sein, sah das Bürgertum seine Leitbilder von Professionalität, Pflichterfüllung und Einsatzfreude im Militär verwirklicht.18 Doch trotz mancher Überschneidung verschmolzen die Milieus nicht – das Berufsoffizierkorps besaß ebenso einen eigenen Werte- und Normenkern wie etwa das Bildungsbürgertum.
Die wachsende Rolle des Bürgertums zeigte sich auch im rasanten sozialen Wandel in den Streitkräften. Waren 1871 noch 75 Prozent der preußischen Offiziere Adelige, so sank dieser Anteil bis 1913 auf rund 30 Prozent. In der bayerischen Armee war er traditionell niedriger, 1913 waren es gerade einmal neun Prozent. Die Geschichte dieses Wandels ist bislang meist als grimmiges Rückzugsgefecht adeliger Hardliner erzählt worden. In der Tat verteidigten diese die Armee als ihre exklusive Bastion gegen eine soziale Öffnung. Nur so glaubten sie die unbedingte Treue zum König und die Zuverlässigkeit im Kampf auch gegen innere Feinde gewährleisten und damit ihren Standesgenossen ein exklusives Betätigungsfeld sichern zu können. 1913 bremste der Kriegsminister sogar die Aufrüstungspläne des Generalstabs, weil er um die soziale Kohäsion des Offizierkorps fürchtete. Auf den sozialen Wandel hatten solche Manöver aber keinen Einfluss, denn die zentrale Richtungsentscheidung war schon 1844 getroffen worden. Seitdem war in Preußen die gymnasiale Primarreife, also die erfolgreich abgeschlossene 11. Klasse, die Voraussetzung für den Einstieg in die Offizierslaufbahn. Es gab zwar allerlei Ausnahmebestimmungen, und von 1861 bis 1872 war die Regelung gar suspendiert. Doch die langfristigen Folgen dieses Schrittes lassen sich gar nicht hoch genug bewerten. Das Militär wurde zum Teil einer Staatselite, zu der nur diejenigen Zugang erhielten, die entsprechende strenge Bildungsvoraussetzungen erfüllten.
Über dieses Privileg verfügten Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem Adelige, erst mit der fortschreitenden Industrialisierung seit den 1880er-Jahren aber auch immer breitere bürgerliche Schichten. Der Kaiser bestärkte diese Entwicklung 1890 mit einem Dekret zur gezielten Öffnung des Offizierkorps für Bürger- und Beamtensöhne.19 Seit der Jahrhundertwende hatten dann immer mehr Offizieranwärter sogar das Abitur, also den Abschluss der 13. Klasse vorzuweisen, 1912 bereits 65 Prozent.20 Zum Vergleich: Nur zwei Prozent eines Schülerjahrgangs machten 1912 Abitur.21 Wie die anderen Angehörigen des Staatsdienstes gehörten Offiziere im Kaiserreich also zur Bildungselite. Da diese am Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr vom Bürgertum dominiert wurde, veränderte sich dementsprechend die soziale Struktur des Offizierkorps. Bis dieser Wandel jedoch auch auf der höchsten Ebene ankam, vergingen noch Jahrzehnte. General wurde man erst mit 50, also nach rund 30 Dienstjahren. 1880 entstammten 51 Prozent der Leutnante der preußischen Armee dem Bürgertum, und es dauerte bis 1913, bis sie die hohen Dienstgrade der Obersten und Generäle erklommen hatten.22 Der Adel hatte in dieser Periode statistisch gesehen keine besseren Karrierechancen.23 Leistung und der Zugang zur Bildung waren somit die entscheidenden Stellschrauben.
Es gab aber auch die Sorge vor einem Zustrom aus unerwünschten Kreisen. So gab es strenge Abschottungstendenzen gegen Juden. Bis 1913 hatten die deutschen Armeen keinen einzigen aktiven jüdischen Offizier und nur eine Handvoll Reserveoffiziere, obwohl Zehntausende Deutsche jüdischen Glaubens als Einjährig-Freiwillige dienten. Im Zarenreich war die Lage ähnlich.24 Die meisten anderen Großmächte, etwa Italien, Frankreich oder Österreich-Ungarn, hatten jüdische Berufsoffiziere, auch wenn diese dort ebenfalls Diskriminierungen unterworfen waren.25
Während die Auffüllung aller freien Offizierstellen nicht gelang, konnte der Mangel an Unteroffizieren seit der Jahrhundertwende durch bessere Bezahlung und gute Beförderungsbedingungen behoben werden.26 Bei der Rekrutierung der Mannschaften gab es – anders als bei Offizieren und Unteroffizieren – ein Überangebot. Obwohl sich die Personalstärke der Armee in 40 Friedensjahren von 425 000 Mann 1875 auf 795 000 Mann 1914 beinahe verdoppelte, wurde nur rund die Hälfte aller jungen Männer eingezogen. Die Auswahlkriterien konnten entsprechend hoch angesetzt werden, auf körperliche Gesundheit wurde besonderer Wert gelegt. Ein überproportionaler Anteil der Mannschaften kam aus ländlichen Gebieten; unter der Stadtbevölkerung war der Anteil der Arbeiterschaft überproportional hoch, besonders unter jenen, die auf dem Land geboren und aufgewachsen waren.27
Eine gezielte soziale Rekrutierung gab es bei den Mannschaften nicht. Relevant war vor allem die physische Qualifikation, obwohl die Militärführung große Sorge vor einer Unterwanderung durch die Sozialdemokratie hatte und den Soldaten den Besitz von sozialdemokratischen Schriften oder den Besuch von politischen Versammlungen verbot. Wie viele Sympathisanten der SPD es in den Reihen der Soldaten gab, ist nicht bekannt. Dass sich ihre Zahl erheblich vermehrte, ist angesichts der vielen Wehrpflichtigen aus dem Arbeitermilieu naheliegend. Allerdings hatte das keine weitergehenden Folgen. Selbst wenn das Militär bei Ausständen zur Unterstützung der Polizei ausrückte, etwa als beim großen Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet 1912 5000 Soldaten nach Dortmund, Hamm und Recklinghausen verlegt wurden, gab es keine Verbrüderung von Soldaten und Arbeitern.28 Die Armee blieb ein zuverlässiges Instrument des Staates. Auch blieben solche Einsätze im Innern die große Ausnahme.29 Meist reichte die Mobilisierung als Drohkulisse aus, um einen Ausstand zu beenden. Der Einsatz der Streitkräfte im Innern war zu jener Zeit in ganz Europa üblich, wobei er in Deutschland zurückhaltender gehandhabt wurde als in Frankreich und vor allem in Russland.30
Kolonien
Das Deutsche Reich wurde zwischen 1883 und 1885 Kolonialmacht in Afrika und erwarb vier sogenannte Schutzgebiete. Um die Jahrhundertwende begannen die Deutschen, in den riesigen Territorien ihren Herrschaftsanspruch mit aller Macht durchzusetzen. In Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, und in Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, Ruanda und Burundi, kam es zu Aufständen, die blutig niedergeschlagen wurden. Für die deutsche Militärgeschichte sind diese Kolonialkonflikte deshalb relevant, weil die Eskalation der Gewalt, etwa bei der Niederschlagung des Herero-Aufstands in Deutsch-Südwestafrika, vor allem von angelsächsischen Autoren als Beleg für einen »German Way of War« interpretiert wird – eine entgrenzte Kriegführung, die sich im Ersten Weltkrieg fortsetzte und in den »Bloodlands« des Zweiten Weltkriegs ihren Höhepunkt erreichte.31 Im Fokus der Betrachtung stehen dabei einerseits die Doktrin der schnellen Vernichtungsschlacht, andererseits die mangelnde Kontrolle des deutschen Militärs durch die Politik.
Als Gouverneur Theodor Leutwein damit scheiterte, dem Aufstand der Herero durch Verhandlungen Einhalt zu gebieten, wurde ihm das Kommando über die Schutztruppe entzogen und im Mai 1904 Generalleutnant Lothar von Trotha übertragen. Dessen Ernennung an sich war schon ein Skandal, da sich sowohl Generalstabschef Alfred von Schlieffen als auch der Reichskanzler gegen ihn ausgesprochen hatten. Für Personalfragen war aber ausschließlich das dem Kaiser unterstellte Militärkabinett zuständig. In Deutsch-Südwestafrika angekommen, ging es Trotha um eine rasche militärische Niederschlagung des Herero-Aufstands. Damit folgte er der gängigen deutschen Militärdoktrin, einen langen Krieg durch eine schnelle Vernichtungsschlacht zu vermeiden. Seit den Erfolgen in den Einigungskriegen war diese Doktrin geradezu ein Dogma, und ihr folgte auch Trotha. Doch die Schlacht am Waterberg im August 1904 wurde kein zweites Sedan. Die Herero konnten aus der Einkesselung entweichen, und Trotha hoffte nun, sie durch eine rasante Verfolgung besiegen zu können. Als auch dies nicht gelang und sich die Überlebenden in die Omaheke-Wüste zurückzogen, schienen seine Pläne gescheitert. Die Herero würden, so glaubte er, dort ausharren oder auf alten Handelspfaden nach Botswana entkommen. Da er in ihnen weiterhin eine Bedrohung sah, erließ er am 2. Oktober 1904 seinen berüchtigten Schießbefehl, mit dem er verhindern wollte, dass die Herero in die deutsche Kolonie zurückkehrten. Auf die männlichen Herero, so der Befehl, sollte das Feuer eröffnet werden, Frauen und Kinder sollten mit Schüssen über ihre Köpfe hinweg zurück in die Wüste getrieben werden.32 Wenn er sie schon nicht militärisch besiegen konnte, wollte Trotha sie zumindest aus der Kolonie vertreiben. So wäre das Problem des Aufstands gelöst und zugleich sein Unvermögen, den Herero auf militärischem Wege beizukommen, geschickt vertuscht worden.
Von August bis Oktober hatte sich die Kriegführung der deutschen Truppen durch eine situative Dynamik bereits massiv radikalisiert. Als Trotha schließlich erkannte, dass die Herero in der Omaheke-Wüste elendig zugrunde gingen, unternahm er nichts und überschritt damit endgültig die Grenze zum Genozid. Die Doktrin der Vernichtungsschlacht kann diese Eskalation freilich nicht hinreichend erklären. Wäre die Schlacht am Waterberg so verlaufen, wie Trotha es gehofft hatte, wäre der Krieg schnell beendet gewesen. Erst als sich der Erfolg nicht einstellte, begannen die Dinge aus dem Ruder zu laufen. Zu bedenken ist auch, dass andere Offiziere wie der entmachtete Gouverneur Leutwein oder Ludwig von Estorff, einer der Abteilungskommandeure der Schutztruppe, Trotha für seine radikale Kriegführung scharf kritisierten. Sie strebten eine Verhandlungslösung an. Estorff gehörte vor seiner Versetzung nach Südwest immerhin zum erlauchten Kreis der Offiziere im Großen Generalstab.
Welcher dieser Männer war nun typisch für das deutsche Militär? Zweifellos war Trotha der entscheidende Faktor für die Eskalation der Kriegführung, wie Matthias Häussler auf Grundlage von dessen erstmals vollständig zugänglichen Tagebüchern kürzlich nachwies.33 Und angesichts von Trothas Disposition für radikale Lösungen wirkte es sich fatal aus, dass er nur dem Generalstab unterstellt war. Der Reichskanzler war freilich nicht ganz aus dem Spiel. Der Gouverneur der Kolonie unterstand der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amts, das wiederum Kanzler Bernhard von Bülow verantwortlich war. Insofern hatte dieser durchaus eine Handhabe, sich in den Gang der Dinge einzumischen. Trotha vermochte vor Ort zwar Gouverneur Leutwein an den Rand zu drängen34, doch Bülow konnte er auf Dauer nicht ignorieren, auch wenn der Kaiser ihm versprochen hatte, nur vom Generalstab Anweisungen zu empfangen. Die verworrenen Befehlsverhältnisse führten freilich dazu, dass das politische Berlin erst im Oktober 1904 erfuhr, dass die Kriegführung in der Kolonie außer Kontrolle geraten war. Der Reichskanzler erwirkte daraufhin die Aufhebung des Schießbefehls vom 2. Oktober. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Herero aber bereits in der Omaheke-Wüste verendet. Bemerkenswert ist, dass Trotha trotz seiner verheerenden Kriegführung nicht abgelöst wurde, sondern erst ein Jahr später, im November 1905, ein geordneter Wechsel von Gouverneur und Schutztruppenkommandeur stattfand. Trotha wurde sogar mit dem höchsten preußischen Orden ausgezeichnet, dem Pour le Mérite, dann aber aus dem aktiven Dienst entlassen. Man kann argumentieren, dass sein Verhalten in Berlin offenbar nicht als so außergewöhnlich angesehen wurde, dass eine sofortige Ablösung gerechtfertigt erschien.35 Das mag auch daran gelegen haben, dass er der Kandidat des Kaisers war, den man nicht desavouieren wollte.
Es lässt sich gewiss anführen, dass die imperiale Kriegführung der Europäer stets sehr grausam und die Zahl genozidaler Verbrechen erheblich war. Man denke nur an die Ausrottung der tasmanischen Urbevölkerung durch britische Siedler in den 1830er-Jahren oder an die Indianerkriege in Nordamerika im 18. und 19. Jahrhundert. Doch will man das Verbrechen an den Herero einordnen, helfen derart allgemeine Vergleiche nicht weiter, man muss vielmehr auf ähnlich gelagerte Kriegszüge zur selben Zeit blicken. Bei der Niederschlagung des Matabele-Aufstands 1896/97 im heutigen Simbabwe durch britische Truppen, im Burenkrieg 1899 bis 1902 oder während der französischen Pazifizierung der Elfenbeinküste zwischen 1893 und 1911 kam es zwar zu exzessiven Gewaltakten. Es gab auch Militärs, die wie Trotha zu allem fähig waren.36 Es gab aber keine genozidale Gewalt, und dies ist ein gewichtiger Unterschied. In all diesen Konflikten ging es darum, den Widerstand des Gegners zu brechen, ihn aber als Entität zu erhalten. Das lag ganz entscheidend daran, dass in Frankreich und Großbritannien sowohl das Kolonialministerium als auch der zivile Gouverneur vor Ort eine wesentlich stärkere Stellung als in den deutschen Kolonien hatten und das Militär straff kontrollierten. Zeitraum, Ziele und Methoden der kolonialen Kriegführung wurden von den zivilen Instanzen vorgegeben, die ein eminentes Interesse an der Erhaltung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kolonien hatten. Somit war der letzten Stufe der Gewalteskalation ein Riegel vorgeschoben. Dieses Sicherungselement gab es auf deutscher Seite nicht. Die Kolonialabteilung im Auswärtigen Amt war schwach und mit der Stellung des britischen Kolonialministeriums nicht zu vergleichen.
Die Kolonialkriegführung 1904/05 im heutigen Namibia ist ein prägnantes Beispiel für die besondere Stellung des Militärs im Deutschen Reich. Indem Kaiser Wilhelm II. die Bekämpfung des Aufstands in die Hände des Generalstabs in Berlin legte, war der Politik die Kontrolle über das Geschehen in der Kolonie in den entscheidenden Wochen entzogen. Gewiss war die Zivilmacht nicht gleichbedeutend mit einem Ende der Gewalt. So starben in den zivil kontrollierten Internierungslagern ab Herbst 1904 Tausende der überlebenden Herero und Nama. Aber eine solche Radikalisierung, wie sie Trotha betrieb, wäre unter zivilem Kommando nicht vorstellbar gewesen.
In Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, schlug die Schutztruppe zur selben Zeit den Maji-Maji-Aufstand nieder. Dabei kamen sogar noch mehr Menschen ums Leben als bei der Niederschlagung des Herero-Aufstands. Die Opferzahlen werden auf bis zu 250 000 geschätzt. Und doch folgte die Kriegführung hier einer anderen Logik als in Deutsch-Südwestafrika. Die zivilen Instanzen wurden hier nie entmachtet, den Rebellen stand es frei, sich zu ergeben, und an einer Ausrottung der Bevölkerung hatten die deutschen Kolonialherren kein Interesse, weil sie diese als Arbeitskräfte ausbeuten wollten. Einer der wichtigsten Katalysatoren der Brutalisierung ging zudem nicht von der Metropole – dem Eingreifen des Generalstabs –, sondern von einer situativen Anpassung an die Gewaltkultur der Region aus. Die Aufstandsbekämpfung wurde von einer afrikanischen Söldnertruppe durchgeführt, die den Kampf nach eigenen Regeln eines vorkolonialen Raub- und Beutekriegs führte, in dessen Folge die meisten Opfer verhungerten, weil sie sich nicht mehr mit Lebensmitteln versorgen konnten. Die Schweizer Historikerin Tanja Bührer prägte hierfür den Begriff der »Afrikanisierung« der Gewalt.37
Die deutsche Kolonialkriegführung war gewiss brutal und grausam. Sie offenbart, dass die Eskalation beziehungsweise Eindämmung von Gewalt von einem Wechselspiel aus konstitutionellen Rahmenbedingungen, Dispositionen der men on the spot, militärischen Doktrinen und vor allem einer situativen Gewaltdynamik bestimmt wurde. Anders gesagt: Es gab gewiss nationale Spezifika, doch diese waren immer nur einer von vielen Faktoren, die über das jeweilige Ausmaß von Gewalt entschieden. Insofern führt kein direkter Weg von der Schlacht am Waterberg und Trothas Schießbefehl nach Auschwitz.
Armee
Inneres Gefüge
Das Kaiserreich war ein Land im Wandel, modern und rückwärtsgewandt zugleich. Was das Militär betrifft, so war am beständigsten wohl das Selbstbild der Armee als Schule der Nation, die die Staatsbürger zu Kaisertreue, Vaterlandsliebe, Gottesfurcht, Gehorsam und Pflichttreue erzog. Erklärter Gegner der Armee war die Sozialdemokratie, und die Streitkräfte sahen es nicht zuletzt als ihre Aufgabe an, den wachsenden Einfluss der SPD einzudämmen. »Wer zu den Sozialdemokraten desertiert, verschreibt seine Seele dem Bösen!« Treue müsse auch »gegen Wühler und Volksverführer« bewiesen werden, hieß es in einem Kommentar zu den Kriegsartikeln von 1902.38 Die sich seit Langem vollziehende Metamorphose der SPD von der Revolutionspartei, die Monarchie und Kapitalismus abschaffen wollte, zu einer staatstragenden Partei, die eine eher pragmatische Politik verfolgte, um die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verbessern, wurde von den meisten Militärs nicht erkannt.
Es gibt keine verlässlichen Angaben zur politischen Haltung deutscher Soldaten im Kaiserreich, zumal während des Wehrdienstes das aktive Wahlrecht ruhte. Jedoch ist es aufgrund der Ergebnisse der Reichstagswahlen mehr als wahrscheinlich, dass die Zahl der Soldaten mit einer politischen Affinität zur Sozialdemokratie massiv anstieg. Alle Maßnahmen, dies zu verhindern – etwa der gezielte Einsatz von Militärpfarrern oder ein vaterländischer Geschichtsunterricht –, scheiterten. In der Praxis interessierten sich die jungen Rekruten weder sonderlich für christliche Werte noch für die Heldengeschichten einer hohenzollerischen Meistererzählung. Auch fehlte den meisten jungen Offizieren die politische und pädagogische Bildung, um eine solche Erziehungsaufgabe leisten zu können. Als General Hermann von Eichhorn 1905 im XVIII. Armeekorps in Frankfurt/Main sozialpolitischen Unterricht abhalten ließ, kritisierten viele Offiziere einen solchen Versuch der Einflussnahme als von vornherein wirkungslos und fürchteten, dass redegewandte Sozialdemokraten unter den Soldaten die Offiziere bloßstellen könnten. Schließlich verbot der Kaiser im Januar 1910 diese Form des Unterrichts in den Streitkräften.39 Auch der Geschichtsunterricht scheint nicht besonders erfolgreich gewesen zu sein. So hielt der Kommandierende General des II. Bayerischen Armeekorps im Dezember 1894 fest, der »größte Teil der Offiziere« halte sich »mehr oder weniger mechanisch an den toten Buchstaben der verschiedenen für diesen Unterricht bestehenden Lehrbücher« fest. Man brächte nur an den Mann, was dieser zur »äußerlichen Erfüllung seiner Pflichten zu wissen […] hat«.40
In den Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs rückte das Heer zunehmend von der Idee ab, die Schule der Nation zu sein. Die politischen Erziehungsversuche wurden aufgegeben, die Ausbildung konzentrierte sich nun ganz auf das militärische Handwerk. Man hatte erkannt, dass es trotz aller Bemühungen nicht gelang, einen nennenswerten politischen Einfluss auf die Rekruten auszuüben. Offensichtlich stellten sozialdemokratische Soldaten auch keine Gefahr für die Streitkräfte dar. Im Gegenteil, sie waren oft überdurchschnittlich gebildet und leistungsfähig.41 Die Ausbildungsvorschriften wurden liberaler, zielten vor allem auf ein besseres Miteinander in den Kompanien und rückten von der übermäßigen Betonung von Drill und Regelwerk ab. Im Mittelpunkt stand der »kriegerische Geist« der Soldaten, ob diese nun gottesfürchtig und kaisertreu waren oder nicht.42 Dieser Wandel vollzog sich vor allem in den Kompanien und Bataillonen. Teile der Militärpublizistik und sicher auch etliche Generäle blieben bei der allzu idealistischen Vorstellung, durch die Dienstzeit die Liebe zu Gott, Kaiser und Reich zu fördern oder bereits Irregeleitete wieder auf den rechten Weg zu führen.43
Versuche, die Werte der Staatsordnung auf die Soldaten zu übertragen, sind in allen deutschen Wehrpflichtarmeen zu finden. Im Kaiserreich waren sie wenig erfolgreich.44 Im Alltag motivierten die Soldaten keine wohlmeinenden Vorträge und kein Kasernendienst, sondern Sport und militärisches Handwerk. Der Malergeselle Wilhelm Janeke, der von 1892 bis 1894 seinen Wehrdienst im sächsischen Jägerbataillon Nr. 12 ableistete, war immer froh, wenn es ins Feld hinausging. »Es war mitunter eine wahre Lust, wenn man an einem duftenden, schönen Sommermorgen singend durch eine romantische Gegend marschierte, umgeben von tatkräftiger, gesunder, lachender Jugend, die, von keiner Sorge bedrückt, sich ihres Lebens freute, die infolge guter Kameradschaft dennoch manch’ sauren Dienst zu fröhlichem Spiel gestaltete«, schrieb er in seine Memoiren. Diebisch freute er sich, dass es ihm auf einer Übung einmal gelang, einer Ulanenpatrouille die Pferde wegzunehmen, »die wir jedoch für ein kleines Lösegeld in einem nahen Gasthaus wieder herausgaben«.45
Seine Kameraden und er wollten Vorgesetzte, die fachliche Vorbilder waren, sich um die alltäglichen Bedürfnisse kümmerten und sie nicht mit übertriebenem Formalismus schikanierten. So hatten die Männer den Ehrgeiz, in der Ausbildung die beste Inspektion zu sein und ihrem Oberjäger zur ausgelobten Prämie von 30 Mark zu verhelfen, denn der war »kein schlechter Mensch« und hat »uns nie unnötig gequält«.46 Und als sie am 23. April 1893 am Geburtstag des sächsischen Königs zur Parade nach Dresden kommandiert waren, »galt es unserem Jungführer Leutnant v. B., ein Mensch von hoher, edler Gesinnung, zu zeigen, daß auch wir seiner würdig seien. Wir wußten, daß er zum Divisionsgeneral in einem Verwandtschaftsverhältnis stand. Hierauf bauend beschlossen wir, beim Vorbeimarsch alles herzugeben, was Beine und Stiefel vermöchten«, erinnerte sich Janeke.47
In der Theorie der Vorschriften sollte der Militärdienst Mut, Tapferkeit, Ehre, Wagemut, Kaltblütigkeit, Entschlossenheit und Willensstärke vermitteln.48 Inwieweit dies wirklich erreicht wurde, ist für eine Friedensarmee kaum zu beantworten, zumal jeder Soldat solche Normen und Tugenden wohl auch anders interpretierte. Als Wilhelm Janeke in einer Übung einmal die Führung seiner Gruppe übernehmen musste und sich in einer schwierigen taktischen Situation sogleich wagemutig unter Hurra-Gebrüll dem Manöverfeind entgegenwarf, war das wohl eher seinem Temperament und seiner Naivität zu verdanken als der Indoktrination seiner Vorgesetzten. Sein Leutnant kommentierte in »ergötzlichen Worten« seinen Angriff mit vernichtender Kritik.49
Viele der jungen Männer scheinen sich der militärischen Welt problemlos angepasst zu haben. Statt über Kaiser, Religion oder das Verhältnis von Verfassung und Militär nachzudenken, wollten sie, so Janeke, schlicht »tüchtige Jäger« sein.50 Zeitgenössische Stimmen stellten die Dienstzeit als eine wichtige Phase der Charakter- und Persönlichkeitsbildung im Übergang von der Jugend zum Erwachsenenalter heraus. Die körperlichen Belastungen und das Gefühl der Kameradschaft erfüllten viele mit Stolz. Man gehörte nun dazu, hatte »gedient«. Freilich gelang es nicht allen, die Belastungen des Militärdienstes ohne Weiteres wegzustecken. Für manche war diese Zeit die schlimmste ihres Lebens. Körperliche Schinderei, psychische Demütigung, Stumpfsinn, Langeweile, aber auch die Herausforderung, mit Männern unterschiedlicher Schichten auf engstem Raum ohne Privatsphäre zusammenzuleben51, waren zuweilen geradezu traumatische Erfahrungen. In den ersten Wochen durften die Rekruten die Kasernen nicht verlassen. »Wohl waren etliche unter uns, die diese Freiheitsbehinderung nicht drückte«, schrieb Janeke über seine ersten Wochen als Wehrpflichtiger im November 1892. »Andere hingegen empfanden es als Schmach, fühlten sich als Gefängnisinsassen, und zu letzten gehörte auch ich.«52
Der kanadische Soziologe Erving Goffman hat solche Negativerfahrungen in den 1960er-Jahren beschrieben. Er prägte dafür den Begriff der Totalen Institution. Die Verhinderung einer individuellen Lebensgestaltung, die Reduktion auf die neue soziale Rolle, die Disziplinierung durch Demütigungs- und Entmündigungsrituale führten zur Abtötung des alten und zum Aufbau eines neuen Ich. Goffman hatte ursprünglich geschlossene psychiatrische Anstalten untersucht, zählte zu Totalen Institutionen aber auch Gefängnisse oder das Militär.53 Etliche Soziologen sind ihm gefolgt und haben seine Theorie verfeinert und ausgebaut.54 Jedoch ist fraglich, ob der Prozess der Entindividualisierung hinter den Kasernenmauern in geradezu totaler Wirkungsmächtigkeit stattfand.55 Auf den ersten Blick mochte dies durch Uniform, Gemeinschaftsunterkunft und genormten Tagesablauf so erscheinen. Auch das endlose Exerzieren war im Kaiserreich ganz bewusst darauf ausgerichtet, Gehorsam und innere Ordnung zu erzwingen.56 Und dennoch konnte die Institution Militär die Männer wohl nur äußerlich und nur für die ersten Wochen wirklich umfassend beherrschen. Sie behielten während des Wehrdienstes zweifellos ihre Persönlichkeit, nahmen in der Zwangsgemeinschaft soziale Rollen ein, übernahmen vielfältige Aufgaben mit unterschiedlichem sozialem Prestige – als Hilfsausbilder, MG-Schütze oder Gehilfe des Kompaniefeldwebels. Schon die bald vergebenen Spitznamen für Kameraden und Vorgesetzte ließen die Individualität stets durchschimmern, und rasch bildete sich eine soziale Hierarchie auch bei den Mannschaften heraus. Der Kasernenhof wurde nicht zum Schmelzofen der Identitäten.57 Das belegen auch die ganz unterschiedlichen Deutungen des Militärdienstes in den kaiserlichen Armeen, wie sie etwa Ute Frevert herausgearbeitet hat. Gewiss empfanden viele die ersten Wochen als harten Einschnitt.58 Danach aber waren die Erfahrungen sehr unterschiedlich – abhängig von der Einheit, in der man den Dienst leistete, von Kameraden, Vorgesetzten, aber auch von der eigenen Einstellung zum Militär und der Kompetenz, sich in einem neuen sozialen Umfeld zurechtzufinden.
Insbesondere die Lebensrealität der zumeist aus vermögenden und gebildeten Familien stammenden Einjährig-Freiwilligen ist mit dem Begriff der Totalen Institution nicht treffend beschrieben. Die privilegierten Bedingungen, unter denen sie ihren Dienst ableisten konnten, verdeutlichen, dass die Klassenschranken der wilhelminischen Gesellschaft auch im Militär omnipräsent waren. Richard von Kühlmann, der spätere deutsche Außenminister, leistete seinen Wehrdienst 1893 als Einjähriger bei den Bamberger Ulanen ab, wo zur selben Zeit schon etliche nähere und fernere Verwandte als Offiziere Dienst taten. Die Einheit war eines der drei vornehmsten Regimenter in Bayern, und der Spitzname »Sekt-Ulanen« zielte nicht ganz zu Unrecht auf ein finanziell abgesichertes, ausgiebiges Kasinoleben. Kühlmann bemerkte in seinen Memoiren gleichwohl, dass die ersten Wochen in der Armee »nicht leicht« gewesen seien. Die körperliche Anstrengung und die ungewohnten Eindrücke der Mannschaftsquartiere blieben ihm im Gedächtnis. Als er dann ein Zimmer außerhalb der Kaserne bezog und sich an die neue Umgebung gewöhnt hatte, gehörten Exerzieren, Felddienst oder Schießen bald zum Alltag, der durch viele Ausritte und ein gutes Verhältnis zu den Offizieren des Regiments nicht allzu fordernd war. Kühlmann fühlte sich der Gemeinschaft des Regiments dann auch zeit seines Lebens verbunden.59 Die normalen Rekruten leisteten ihren Dienst unter weit weniger angenehmen Bedingungen. Kühlmanns Militärzeit unterschied sich zweifellos signifikant von derjenigen Wilhelm Janekes.60
Tribal cultures
Wie das Beispiel Richard von Kühlmanns zeigt, war Militär nicht gleich Militär. Die militärischen Aufgaben und Traditionen, die soziale Zusammensetzung und das Alltagsleben der Streitkräfte wiesen eine feine Binnendifferenzierung auf. Ganz offensichtlich galt dies zunächst für die beiden großen Teilstreitkräfte Heer und Marine, die im Kaiserreich auch organisatorisch vollkommen getrennt waren und eigene Welten darstellten. Aber auch innerhalb des Heeres bildeten die Waffengattungen von Infanterie, Kavallerie und Artillerie sowie die Pionier-, Nachrichten- und Versorgungstruppen eigene Kulturen aus. Diese Gemeinschaften unterschieden sich in ihren Ritualen, ihrem Habitus, ihrem Prestige und grenzten sich nach außen durch eigene Uniformen und Abzeichen voneinander ab. Sie schworen einen Eid auf ihren Landesfürsten, aber auch auf den Kaiser, und fühlten sich – über landsmannschaftliche Unterschiede hinweg – als deutsche Soldaten verbunden. Zugleich bildeten sie eine Art tribal culture, eine identitätsstiftende Kultur, die in den Regimentern durch Tradition, soziale Zusammensetzung des Offizierkorps und das gesellschaftliche Leben am Garnisonsort weiter ausdifferenziert wurde.61