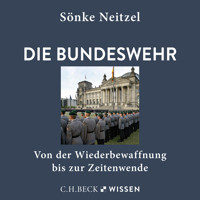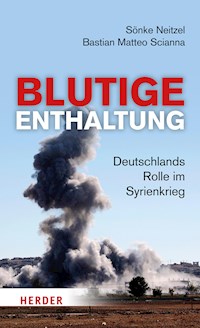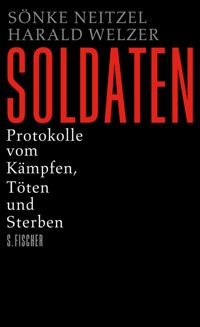
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch legt auf einer einzigartigen Quellengrundlage erstmals eine überzeugende Mentalitätsgeschichte des Krieges vor. Auf der Grundlage von 150.000 Seiten Abhörprotokolle deutscher Soldaten in britischer und amerikanischer Gefangenschaft wird das Wissen um die Mentalität der Soldaten auf eine völlig neue Basis gestellt. In eigens eingerichteten Lagern wurden Kriegsgefangene aller Waffengattungen und Ränge heimlich abgehört. Sie sprachen über militärische Geheimnisse, über ihre Sicht auf die Gegner, auf die Führung und auch auf die Judenvernichtung. Das Buch liefert eine Rekonstruktion der Kriegswahrnehmung von Soldaten in historischer Echtzeit - eine ungeheuer materialreiche Innenansicht des Zweiten Weltkriegs durch jene Soldaten, die große Teile Europas verwüsteten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 785
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Sönke Neitzel | Harald Welzer
Soldaten
Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben
Über dieses Buch
Dieses Buch legt auf einer einzigartigen Quellengrundlage erstmals eine überzeugende Mentalitätsgeschichte der Wehrmacht vor. In eigens eingerichteten Lagern wurden deutsche Kriegsgefangene aller Waffengattungen und Ränge in britischer und amerikanischer Gefangenschaft heimlich abgehört. Sie sprachen über militärische Geheimnisse wie Waffentechnik oder taktische und operative Details, aber auch – und das macht die Quelle so außergewöhnlich – über ihre Sicht auf die Gegner, auf den Krieg, auf die SS und auch auf die Vernichtung der europäischen Juden.
Auf der Grundlage von 150.000 Seiten Protokolle dieser Gespräche zeichnen die Autoren ein Bild vom Krieg, vom Kämpfen und von der Vernichtung, das das Wissen um die Mentalität der Soldaten auf eine völlig neue Grundlage stellt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Sönke Neitzel, geboren 1968, Lehrtätigkeit in Mainz, Karlsruhe und Bern; 2010 Senior Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen, ist seit 2012 Inhaber des Lehrstuhls für International History an der London School of Economics (LSE). Bekanntgeworden ist Neitzel mit »Abgehört. Deutsche Generäle in britischer Kriegsgefangenschaft 1942 – 1945« (2005).
Harald Welzer, geboren 1958, ist Professor für Transformations-Design an der Universität Flensburg und Direktor von FuturZwei. Stiftung Zukunftsfähigkeit. In den S. Fischer Verlagen sind von ihm u.a. erschienen: »›Opa war kein Nazi‹. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis« (zus. mit S. Moller und K. Tschuggnall, 2002); »Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden« (2005), »Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird« (2008). Seine Bücher sind in 15 Sprachen übersetzt worden.
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
© 2011 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400792-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Prologe
Prolog 1: Sönke Neitzel
Prolog 2: Harald Welzer
Worüber die Soldaten sprechen
Den Krieg mit den Augen der Soldaten sehen: Referenzrahmenanalyse
Basale Orientierungen: Was geht hier eigentlich vor?
Kulturelle Bindungen
Nicht-Wissen
Erwartungen
Zeitspezifische Wahrnehmungskontexte
Rollenmodelle und -anforderungen
Deutungsmuster: Krieg ist Krieg
Formale Verpflichtungen
Soziale Verpflichtungen
Situationen
Persönliche Dispositionen
Soldatenwelt
Der Referenzrahmen des »Dritten Reiches«
Der Referenzrahmen des Krieges
Gesellschaft
Wehrmacht
Kämpfen, Töten und Sterben
Abschießen
Autotelische Gewalt
Abenteuergeschichten
Ästhetik des Zerstörens
Spaß
Jagd
Versenken
Kriegsverbrechen – Töten als Besatzer
Verbrechen an Kriegsgefangenen
Front
Lager
Vernichtung
Referenzrahmen der Vernichtung
Mitschießen
Empörung
Anständigkeit
Gerüchte
Gefühle
Sex
Technik
Schneller, weiter, größer
Wunderwaffen
Siegesglaube
Blitzkrieg (1939–1942)
Von Stalingrad bis zur Invasion (1943/44)
Das letzte Kriegsjahr
Führerglaube
Der Führer
Und wenn der Krieg verlorengeht?
Der Führer ist nicht mehr er selbst
Der Führer versagt
Ideologie
Das Meinungsspektrum
Kohärente Weltbilder
Militärische Werte
Bis zur letzten Patrone
»Mit Anstand zu sterben verstehen«
»Ich hätte keinen gerammt. Blödsinn. Das bissl Leben, an dem hängt man doch.«
Italiener sind »schlapp«, und »der Russe ist ein Biest«.
»Feigheit« und »Fahnenflucht«
Erfolge
Auszeichnungen
Italiener und Japaner
Waffen-SS
Rivalitäten
Tapferkeit und Fanatismus
Verbrechen
Resümee: Der Referenzrahmen des Krieges
Wie nationalsozialistisch war der Krieg der Wehrmacht?
Wer getötet wird
Die Definition der Gegner
Rache für das, was uns angetan wurde, wird und werden könnte
Keine Gefangenen machen
Krieg als Arbeit
Die Gruppe
Ideologie
Militärische Werte
Gewalt
Anhang
Die Abhörprotokolle
Dank
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Prologe
Prolog 1: Sönke Neitzel
Es war ein typischer englischer Novembertag: tief hängende Wolken, Nieselregen und acht Grad. Wie oft zuvor war ich mit der District Line bis nach Kew Gardens gefahren, an der pittoresken U-Bahn-Station im Südwesten Londons ausgestiegen und zum britischen Nationalarchiv gehastet, um mich dort in alte Akten zu vergraben. Der Regen war diesmal noch unangenehmer als sonst und trieb mich zur Eile. Im Eingangsbereich stand – wie immer – eine beeindruckende Zahl von Aufsichtspersonen, die flüchtig meine Tasche durchwühlten. Es ging vorbei an dem kleinen Buchladen zur Garderobe, dann die Treppe hinauf in den Lesesaal, wo mich spätestens der stechend grüne Teppich darin versicherte, dass sich hier seit dem letzten Besuch nichts verändert hatte.
In jenem Herbst 2001 arbeitete ich als Gastdozent an der Universität Glasgow und hatte mir einen kurzen London-Besuch genehmigt. Wenige Wochen zuvor war ich auf das Buch Michael Gannons über die Wende in der Atlantikschlacht im Mai 1943 gestoßen. Darin waren auch einige Seiten Abhörprotokolle deutscher U-Boot-Fahrer abgedruckt – und das hatte mich neugierig gemacht. Dass es Verhörberichte über deutsche Gefangene gab, war mir bekannt, aber von geheimen Lauschberichten hatte ich noch nie gehört. Dieser Spur wollte ich unbedingt nachgehen. Allzu Aufregendes erwartete ich freilich nicht. Worum konnte es sich schon handeln? Einige wenige Seiten unzusammenhängender Gespräche, irgendwo von irgendwem aufgenommen. Unzählige Male hatten sich hoffnungsvolle Hinweise auf vermeintlich neue Quellen als Sackgasse erwiesen.
Doch diesmal war es anders: Auf meinem kleinen Arbeitstisch lag ein dickes Aktenbündel, vielleicht 800 Seiten stark, zusammengehalten nur durch einen Bindfaden. Die dünnen Blätter lagen noch fein säuberlich geordnet übereinander; ich muss einer der Ersten gewesen sein, der sie in Händen hielt. Mein Blick glitt über endlose Gesprächsprotokolle deutscher Marinesoldaten, U-Boot-Fahrer meist, Wort für Wort transkribiert. 800 Seiten allein vom Monat September 1943. Wenn es Berichte vom September gab, musste es auch welche vom Oktober und vom November 1943 geben. Und was war mit den übrigen Kriegsjahren? Und tatsächlich, auch von anderen Monaten existierten dicke Bände. Mir dämmerte allmählich, dass ich auf die Spitze eines Eisberges gestoßen war. Aufgeregt bestellte ich mehr und immer mehr Akten; offenbar waren nicht nur U-Boot-Fahrer, sondern auch Luftwaffen- und Heeressoldaten abgehört worden. Ich las mich in den Gesprächen fest, wurde geradezu hineingesogen in die Innenwelt des Krieges, die sich vor mir ausbreitete. Man hörte die Soldaten förmlich reden, sah sie gestikulieren und debattieren. Vor allem die Offenheit, mit der sie über das Kämpfen, Töten und Sterben sprachen, überraschte mich. Mit einigen Kopien interessanter Textstellen im Gepäck flog ich zurück nach Glasgow. Im Historischen Institut traf ich am nächsten Tag zufällig Professor Bernard Wasserstein und erzählte ihm von meinem Fund. Ich sagte, dass das wohl eine ganz neue Quelle sei und man darüber vielleicht eine Dissertation vergeben könne. »You want to give it away?«, fragte er erstaunt. Dieser Satz wirkte noch lange in meinen Gedanken nach. Nein, er hatte recht: Diesen Schatz musste ich selber heben.
Wieder und wieder fuhr ich fortan nach London und begann zu begreifen, worauf ich eigentlich gestoßen war: Die Briten hatten während des gesamten Krieges Tausende deutsche und einige hundert italienische Gefangene systematisch abgehört, besonders interessant erscheinende Gesprächspassagen auf Wachsplatten aufgenommen und davon Abschriften angefertigt. Sämtliche Protokolle hatten den Krieg überdauert und waren 1996 freigegeben worden. In den folgenden Jahren hat aber niemand die Bedeutung dieser Quellen erkannt – unentdeckt schlummerten sie in den Magazinregalen vor sich hin.
2003 veröffentlichte ich erste Auszüge, zwei Jahre später folgte eine Edition mit knapp 200 Abhörprotokollen deutscher Generäle. Die Auswertung dieser Quellen war damit aber nur ein kleines Stück vorangeschritten. Kurze Zeit später stieß ich in den National Archives in Washington auf einen ganz ähnlichen Bestand, doppelt so groß wie der britische, also noch einmal 100 000 Seiten dazu. Es war unmöglich, diese schier unübersehbare Menge an Akten allein auszuwerten.
Prolog 2: Harald Welzer
Als Sönke Neitzel mich anrief und mir von seinem Quellenfund berichtete, war ich sprachlos: Bislang mussten wir unsere Forschungen zur Gewaltwahrnehmung und Tötungsbereitschaft auf sehr problematische Quellen stützen – auf Ermittlungsakten, Feldpostbriefe, Augenzeugenberichte, Memoiren. Alle diese Quellen teilen ein riesiges Problem: Die Aussagen, Berichte, Beschreibungen, die hier gegeben werden, sind ganz bewusst verfasst und richten sich alle an jemanden – einen Staatsanwalt, eine Ehefrau zu Hause oder an ein Publikum, dem man aus ganz unterschiedlichen Gründen die eigene Sicht der Dinge mitteilen möchte. Wenn die Soldaten in den Lagern miteinander sprachen, geschah das absichtslos – keiner hätte auch nur im Entferntesten daran gedacht, dass seine Erzählungen und Geschichten irgendwann mal eine »Quelle« sein könnten, geschweige denn gedruckt erscheinen würden. Ermittlungsakten, Autobiographien und Zeitzeugeninterviews bestehen zudem aus Berichten von Erzählern, die wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist, und die ihre Erlebnisse und Sichtweisen längst mit diesem nachträglichen Wissen überschrieben haben. Hier, in Neitzels Fund, sprachen Männer in Echtzeit über den Krieg und was sie darüber dachten – eine Quelle, die einen ganz einzigartigen und neuen Einblick in die Mentalitätsgeschichte der Wehrmacht, ja vielleicht des Militärs überhaupt eröffnete. Ich war elektrisiert, und wir verabredeten uns sofort. Es war völlig klar, dass ich als Sozialpsychologe das Material ohne profunde Kenntnisse über die Wehmacht nie würde auswerten können; umgekehrt würde man allein in historischer Perspektive die Gesprächsprotokolle in all ihren kommunikativen und psychologischen Aspekten nicht entschlüsseln können. Wir hatten beide schon zuvor intensiv über die Zeit des »Dritten Reiches« gearbeitet, und doch blickten wir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf die Dialoge der Gefangenen. Nur durch die Kombination unserer Fachgebiete – der Sozialpsychologie und Geschichtswissenschaft – würde man einen angemessenen Zugang zu dieser einzigartigen mentalitätsgeschichtlichen Quelle bahnen und die Sicht auf das Handeln der Soldaten neu justieren können. Wir konnten die Gerda-Henkel-Stiftung und die Fritz-Thyssen-Stiftung von unserem Vorhaben überzeugen, sofort ein größeres Forschungsprojekt zu starten; so hatten wir schon bald nach unserem ersten Treffen die Mittel zur Finanzierung einer Forschungsgruppe[1] , die sich über die unüberschaubare Menge von Texten hermachte. Das britische Korpus und große Teile des amerikanischen Materials konnten digitalisiert und mittels einer inhaltsanalytischen Software ausgewertet werden. Nach über drei Jahren intensiver und spannender Zusammenarbeit, in der wir selbst viel Neues gelernt haben und auch von Überzeugungen Abstand nehmen mussten, die sich angesichts unserer Quelle als nicht haltbar erwiesen, ist es nun an der Zeit, erste Ergebnisse vorzulegen.
Worüber die Soldaten sprechen
SCHMID: Ich habe da mal einen Fall gehört von zwei fünfzehnjährigen Bengels. Die hatten Uniform an und schossen da wild mit. Wurden aber gefangen. [...] Dass der Russe auch junge Burschen bei sich hat, sogar Zwölfjährige an der Musik zum Beispiel, die eingekleidet waren, das habe ich selbst gesehen. Wir hatten mal ein russisches Musikkorps – aber das machte eine Musik, du! Also, da bist du zunächst mal vollkommen fertig. So was Stilles, was über der Musik liegt, so was Sehnsuchtsschweres – ich möchte sagen, die ganze russische Weite kommt dir in den Sinn. Das ist furchtbar. Das hat mir einen Heidenspaß gemacht. Das war so eine Militärkapelle. [...] Also, jedenfalls die beiden jungen Burschen sollten nach dem Westen tippeln – sollten sich genau an die Straße halten. In dem Moment, wo sie versuchen, bei der nächsten Biegung in den Wald reinzuhuschen, da kriegen sie was auf den Latz geknallt. Und kaum sind sie außer Sichtweite, da schleichen sie weg von der Straße – husch, husch, weg waren sie. Da wurde gleich ein größeres Kontingent aufgeboten und musste suchen. [...] Und dann haben sie die beiden erwischt. Das waren die zwei, du. Nun waren sie so anständig und haben die nicht gleich erschlagen, sie haben die nochmals vor den Regimentskommandeur gestellt. Nun war es ja klar, nun hatten sie ihr Leben verwirkt. Da mussten sie ihr Grab schaufeln, zwei Löcher, dann wurde der eine erschossen. Der fällt nicht ins Grab, der fällt vorne über. Da sagt man dem anderen, er sollte den Ersten ins Loch reinwerfen, bevor er selbst erschossen wird. Das hat er mit lächelnder Miene gemacht! Ein fünfzehnjähriger Bengel! Das ist ein Fanatismus oder Idealismus – da ist was dran![1]
Diese Geschichte, die Oberfeldwebel Schmid am 20. Juni 1942 erzählt, ist typisch dafür, wie Soldaten in den Abhörprotokollen sprechen. Wie in jedem anderen Alltagsgespräch wechselt der Erzähler mehrmals assoziativ die Themen – mittendrin fällt Schmid beim Stichwort »Musik« ein, wie sehr er die russische Musik mag, beschreibt diese kurz, dann erzählt er die eigentliche Geschichte weiter. Die fing harmlos an, aber ihr Ende ist böse: Es geht um die Erschießung zweier russischer Soldaten im Jungenalter. Der Erzähler berichtet, dass die Jungen nicht einfach erschossen wurden, sondern sie sich selbst ihr Grab schaufeln mussten, bevor man sie ermordete. Bei der Erschießung gibt es eine Komplikation, und die führt dann zur eigentlichen Moral der Geschichte: Der zu tötende Junge erweist sich als »fanatisch« oder »idealistisch« – und der Oberfeldwebel gibt seiner Bewunderung darüber Ausdruck.
Wir haben hier eine auf den ersten Blick spektakuläre Kombination vieler Themen – Krieg, feindliche Soldaten, Jugendliche, Musik, russische Weite, Kriegsverbrechen, Bewunderung – vor uns, die alle nicht zusammenzugehören scheinen, aber trotzdem in einem einzigen Atemzug erzählt werden. Das ist das Erste, was man festhalten kann: Die Geschichten, von denen hier die Rede ist, sind anders, als man es erwarten würde. Sie folgen nicht den Kriterien von Geschlossenheit, Konsistenz und Logik, sondern sie sollen Spannung erzeugen, interessant sein, Raum und Anschlussmöglichkeiten für Kommentare oder eigene Geschichten der Gesprächspartner geben. In dieser Hinsicht sind sie wie alle Alltagsgespräche sprunghaft, aber interessant, voller Abbrüche, neuer Anknüpfungen von Erzählfäden, vor allem auf Konsens und Übereinstimmung ausgelegt. Menschen unterhalten sich nicht nur, um Informationen auszutauschen, sondern um eine Beziehung zu bilden, Gemeinsamkeiten herzustellen, sich zu versichern, dass man an ein- und derselben Welt teilhat. Diese Welt ist der Krieg, und das nun macht die Gespräche ganz unalltäglich, aber nur für heutige Leserinnen und Leser, nicht für die Soldaten.
Die Brutalität, Härte und Kälte des Krieges sind ein alltägliches Moment dieser Gespräche, und das frappiert immer wieder, wenn man die Dialoge heute, also mehr als 60 Jahre nach den Ereignissen liest. Unwillkürlich schüttelt man den Kopf, ist erschüttert, nicht selten geradezu fassungslos – aber von derlei moralischen Regungen muss man sich frei machen, sonst versteht man nur die eigene Welt, nicht aber die der Soldaten. Die Normalität des Brutalen zeigt ja nur eins: Das Töten und die extreme Gewalt gehören zum Alltag der Erzähler und ihrer Zuhörer, sind eben nichts Außergewöhnliches. Sie unterhalten sich stundenlang darüber, aber zum Beispiel auch über Flugzeuge, Bomben, Radargeräte, Städte, Landschaften und Frauen.
MÜLLER: Als ich in Charkow war, war alles bis auf die Innenstadt zerstört. Eine herrliche Stadt, eine herrliche Erinnerung. Alle Leute sprachen etwas Deutsch – in der Schule gelernt. Auch in Taganrog – herrliche Kinos und wundervolle Strandcafes. [...] Dort, wo Don und Donetz zusammenfließen, da sind wir viel geflogen, da war ich überall. Schön ist die Landschaft – im LKW war ich überall. Da sah man nichts als Frauen, die Pflichtsarbeitsdienst machten.
FAUSST: Ach, du Scheiße!
MÜLLER: Straßen haben die gemacht, mordsschöne Mädels – da sind wir vorbeigefahren, haben sie einfach in den PKW hereingerissen, umgelegt und dann wieder rausgeschmissen. Mensch, was haben die geflucht![2]
So sind Männergespräche. Die beiden Soldaten, ein Gefreiter und ein Feldwebel der Luftwaffe, unterhalten sich über die touristischen Aspekte des Russlandfeldzugs – von »herrlichen Städten« und »herrlichen Erinnerungen« ist die Rede. Plötzlich handelt die Geschichte von spontanen Vergewaltigungen von Zwangsarbeiterinnen; der Gefreite erzählt das wie eine kleine, beiläufige Anekdote und fährt dann fort mit seiner Reisebeschreibung. Das beschreibt den Raum des Sagbaren und des Erwartbaren in den abgehörten Gesprächen: Nichts von der berichteten Gewalt gegen andere verstößt gegen Erwartungen der Zuhörer. Geschichten vom Erschießen, Vergewaltigen, Rauben gehören in den Alltagsbereich der Kriegserzählungen; fast nie kommt es bei solchen Themen zu Auseinandersetzungen, moralischen Einwänden, gar Streitigkeiten. Die Gespräche, so gewaltvoll ihre Inhalte oft sind, verlaufen stets harmonisch; die Soldaten verstehen sich, teilen dieselbe Welt, tauschen sich aus über die Geschehnisse, die sie beschäftigen, und Dinge, die sie gesehen oder getan haben. Diese erzählen und interpretieren sie in historisch, kulturell und situativ spezifischen Rahmen: den Referenzrahmen.
Die wollen wir in diesem Buch rekonstruieren und beschreiben – um zu verstehen, was die Welt der Soldaten war, wie sie sich selbst und ihre Gegner gesehen haben, was sie über Adolf Hitler und den Nationalsozialismus dachten, warum sie weiterkämpften, auch dann noch, als der Krieg bereits verloren schien.
Und wir wollen untersuchen, was an diesen Referenzrahmen »nationalsozialistisch« war – ob man es also bei diesen meist freundlichen und gutmütigen Männern in den Gefangenenlagern mit »Weltanschauungskriegern« zu tun hat, die ausgezogen sind, um in einem »Vernichtungskrieg« unterschiedslos rassistische Verbrechen zu begehen und Massaker zu verüben. Inwieweit entsprechen sie dem in den 1990er Jahren von Daniel Goldhagen gezeichneten Bild von den »willigen Vollstreckern« oder dem differenzierteren, das die beiden »Wehrmachtausstellungen« des Hamburger Instituts für Sozialforschung sowie eine Unzahl historischer Einzelarbeiten zu den Verbrechen der Wehrmacht erarbeitet haben? Gegenwärtig herrscht der Eindruck vor, dass die Wehrmachtsoldaten Teil einer gigantischen Vernichtungsmaschinerie waren und somit Akteure, wenn nicht Exekuteure eines beispiellosen Massenverbrechens. Zweifellos ist zutreffend, dass die Wehrmacht an allen Verbrechen – von der Erschießung von Zivilisten bis zur systematischen Ermordung jüdischer Männer, Frauen und Kinder – beteiligt war. Das sagt aber nichts darüber aus, ob und wie die einzelnen Soldaten in Verbrechen involviert waren, und vor allem nichts darüber, welches Verhältnis sie selbst dazu hatten – ob sie solche Verbrechen willig oder mit Abscheu oder auch gar nicht verübten. Darüber gibt unser Material detailliert Auskunft, und zwar auf eine Weise, dass die festgefügten Bilder über »die Wehrmacht« in Bewegung geraten.
Dabei muss man sehen, dass Menschen alles, was ihnen begegnet, niemals unvoreingenommen, sondern immer durch spezifische Filter hindurch wahrnehmen. Jede Kultur, jede historische Epoche, jede Wirtschaftsform, kurz: jedes Sein prägt Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, die die Wahrnehmung und Interpretation der Erlebnisse und Ereignisse anleiten. Die Abhörprotokolle bilden in Echtzeit ab, wie die Soldaten den Krieg sehen und sich darüber verständigen. Wir werden zeigen, dass ihre Betrachtungen und Unterhaltungen anders sind, als man sich das gemeinhin vorstellt – unter anderem, weil sie im Unterschied zu uns Heutigen nicht wissen, wie der Krieg ausgehen und was aus dem »Dritten Reich« und seinem »Führer« werden wird. Für uns ist ihre erträumte und reale Zukunft schon längst Vergangenheit, für sie aber noch ein offener Raum. An Ideologie, Politik, Weltordnung und dergleichen sind die meisten kaum interessiert; sie führen keinen Krieg aus Überzeugung, sondern weil sie Soldaten sind und Kämpfen ihre Arbeit ist.
Viele sind Antisemiten, aber das ist nicht identisch damit, »Nazi« zu sein. Und es hat auch nichts mit ihrer Tötungsbereitschaft zu tun: Nicht wenige hassen zwar »die Juden«, sind aber empört angesichts der Judenerschießungen. Einige sind dezidierte Anti-Nazis, befürworten aber ausdrücklich die anti-jüdische Politik des NS-Regimes. Etliche sind erschüttert, dass Hunderttausende russische Kriegsgefangene dem Verhungern preisgegeben werden, zögern aber nicht, Kriegsgefangene zu erschießen, wenn es ihnen zu lästig oder gefährlich erscheint, sie zu bewachen und abzuliefern. Einige halten es für ein Problem, dass die Deutschen zu »human« seien, und erzählen im selben Atemzug en détail, wie sie die Einwohner ganzer Dörfer niedergemacht haben. Und: In vielen Erzählungen wird ganz offensichtlich angegeben und geprotzt, aber nicht nur, wie in heutigen Männergesprächen, mit der eigenen Leistungsfähigkeit oder der des Autos. In den Gesprächen der Soldaten wird auch mit extremer Gewalttätigkeit angegeben, mit Vergewaltigungen, Abschüssen, Versenkungen von Handelsschiffen. Gelegentlich können wir nachweisen, dass die Berichte nicht stimmen – aber gerade dann frappiert, womit die Soldaten Eindruck machen wollten, zum Beispiel mit der Versenkung eines Kindertransports. Der Raum des Sagbaren und Gesagten ist hier also ein anderer als heute, und damit auch die Dinge, mit denen man Anerkennung ernten oder dies zumindest hoffen kann – gewalttätig zu sein gehört ganz offensichtlich dazu. Und: Die meisten Erzählungen erscheinen auf den ersten Blick extrem widersprüchlich. Dies aber nur dann, wenn man davon ausgeht, dass Menschen entsprechend ihren »Einstellungen« handeln und dass solche Einstellungen viel mit Ideologien, Theorien und großen Überzeugungen zu tun hätten.
In Wahrheit handeln Menschen, und das wird dieses Buch zeigen, so, wie sie glauben, dass es von ihnen erwartet wird. Und das hat viel weniger mit abstrakten »Weltanschauungen« zu tun als mit ganz konkreten Einsatzorten, -zwecken und -funktionen und vor allem mit den Gruppen, von denen sie ein Teil sind.
Um also verstehen und erklären zu können, warum deutsche Soldaten fünf Jahre lang einen Krieg mit bis dato unbekannter Härte geführt haben und für eine Gewalteruption sorgten, der 50 Millionen Menschen zum Opfer fielen und die einen ganzen Kontinent verwüstete, muss man wissen, mit welchen Augen sie ihn, ihren Krieg, gesehen haben. Im folgenden Kapitel wird es zunächst ausführlich um die Faktoren gehen, die die Sichtweisen der Soldaten anleiten und bestimmen: um die Referenzrahmen also. Leserinnen und Leser, die sich nicht für den Referenzrahmen des »Dritten Reichs« und den des Militärs interessieren, sondern neugieriger auf die Erzählungen und Dialoge der Soldaten über Gewalt, Technik, Vernichtung, Frauen oder den »Führer« sind, sollten direkt auf S. 83 weiterlesen. Nach einer detaillierten Beschreibung der Sicht der Soldaten auf das Kämpfen, Töten und Sterben vergleichen wir den Krieg der Wehrmacht abschließend mit anderen Kriegen, um zu klären, was an diesem Krieg »nationalsozialistisch« war und was nicht. Unsere Ergebnisse, das kann man schon an dieser Stelle sagen, werden manchmal überraschend sein.
Den Krieg mit den Augen der Soldaten sehen: Referenzrahmenanalyse
»Das Entsetzen, wissen Sie, das Entsetzen, das wir am Anfang verspürt haben, dass ein Mensch so mit einem anderen umgehen kann, das hat sich dann irgendwie gelegt. Ja, so ist das eben, nicht wahr? Und ich hab’s ja dann auch an mir selbst gesehen, dass wir dann eigentlich relativ cool geworden sind, wie man heute so schön sagt.«
Ehemalige Anwohnerin des Konzentrationslagers Gusen
Menschen sind keine Pawlow’schen Hunde. Sie reagieren nicht mit konditionierten Reflexen auf vorgegebene Reize. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es bei Menschen etwas Hochspezifisches, das ihr Bewusstsein ausmacht und die menschliche Gattung von allen anderen Lebewesen unterscheidet: Menschen deuten, was sie wahrnehmen, und erst auf der Grundlage dieser Deutung ziehen sie Schlussfolgerungen, entscheiden und agieren sie. Deshalb handeln Menschen, anders als die marxistische Theorie annahm, nie auf Basis objektiver Bedingungen, und sie handeln auch nicht, wie die »Rational Choice«-Theoretiker in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften lange glauben machen wollten, allein mit Blick auf Kosten-Nutzen-Kalküle. Ein Krieg geht so wenig in Kosten- und Nutzenerwägungen auf wie er aus objektiven Verhältnissen entstehen muss. Ein Körper fällt immer entsprechend den Fallgesetzen und nie anders, aber was Menschen tun, können sie immer auch anders tun. Es sind auch nicht so magische Angelegenheiten wie »Mentalitäten«, die Menschen so oder so handeln lassen, obwohl auch psychische Formationen zweifellos bedeutsam für das sind, was Menschen machen. Mentalitäten gehen Entscheidungen voraus, determinieren sie aber nicht. Auch wenn Menschen in ihrem Wahrnehmen und Handeln an gesellschaftliche, kulturelle, hierarchische und biologische bzw. anthropologische Bedingungen gebunden sind, finden sie doch jeweils Deutungs- und Handlungsspielräume vor. Deuten und entscheiden zu können setzt freilich Orientierung voraus und Wissen darüber, womit man es gerade zu tun und welche Konsequenzen welche Entscheidung hat. Und diese Orientierung liefert eine Matrix von ordnenden und organisierenden Deutungsvorgaben: der Referenzrahmen.
Referenzrahmen sind historisch und kulturell höchst variabel: Orthodoxe Muslime ordnen sittliches und verwerfliches Sexualverhalten in andere Referenzrahmen ein als weltliche Bewohner des Abendlandes. Aber kein Mitglied einer der beiden Gruppen deutet, was er sieht, frei von Referenzen, die nicht er selbst gewählt und ausgesucht hat und die seine Wahrnehmungen und Interpretationen prägen, anleiten und in beträchtlichem Ausmaß steuern. Das heißt nicht, dass es in besonderen Situationen nicht auch Überschreitungen des gegebenen Referenzrahmens gäbe und dass Neues gesehen und gedacht wird, aber das ist relativ selten der Fall. Referenzrahmen gewährleisten Handlungsökonomie: Das allermeiste, was geschieht, lässt sich in eine bekannte Matrix einordnen. Das wirkt entlastend. Kein Handelnder muss immer wieder bei null beginnen und stets aufs Neue die Frage beantworten: Was geht hier eigentlich vor? Der allergrößte Teil der Antworten auf diese Frage ist voreingestellt und abrufbar – ausgelagert in einen kulturellen Orientierungs- und Wissensbestand, der weite Teile der Aufgaben im Leben in Routinen, Gewohnheiten, Gewissheiten auflöst und den Einzelnen kolossal entlastet.
Umgekehrt bedeutet das aber: Wenn man das Handeln von Menschen erklären will, muss man rekonstruieren, innerhalb welcher Referenzrahmen sie gehandelt haben – was ihre Wahrnehmungen geordnet und ihre Schlussfolgerungen nahegelegt hat. Für diese Rekonstruktion sind Analysen objektiver Bedingungen völlig unzureichend. Mentalitäten erklären ebenfalls nicht, warum jemand etwas getan hat, zumal dann, wenn es unter Angehörigen derselben mentalen Formation zu ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen und Entscheidungen kommt. Hier liegt die systematische Grenze von Theorien über Weltanschauungskriege oder auch totalitäre Regime: Die Frage bleibt ja immer, wie sich »Weltanschauungen« und »Ideologien« in individuelle Wahrnehmungen und Deutungen übersetzen, wie sie im Handeln der Einzelnen wirksam werden. Um das zu verstehen, verwenden wir das Verfahren der Referenzrahmenanalyse, ein Instrument für die Rekonstruktion der Wahrnehmungen und Deutungen von Menschen in bestimmten historischen Situationen, hier von deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg.
Das Verfahren der Referenzrahmenanalyse geht auf die Überlegung zurück, dass man die Deutungen und Handlungen von Menschen nicht verstehen kann, wenn man nicht rekonstruiert, was sie »gesehen« haben – innerhalb welcher Deutungsmuster, Vorstellungen, Beziehungen sie Situationen wahrgenommen und wie sie diese Wahrnehmungen interpretiert haben. Ohne die Berücksichtigung des Referenzrahmens müssen wissenschaftliche Analysen vergangener Handlungen zwangsläufig normativ ausfallen, weil als Grundlage des Verstehensprozesses die normativen Maßstäbe der jeweiligen Gegenwart herangezogen werden. Deshalb erscheinen historische Geschehnisse im Zusammenhang von Krieg und Gewalt oft als »grausam«, obwohl Grausamkeit ganz und gar keine analytische Kategorie ist, sondern eine moralische. Und deshalb erscheint das Verhalten von Menschen, die Gewalt ausüben, oft schon von vornherein als anormal oder pathologisch, obwohl es – wenn man die Welt aus ihrer Sicht rekonstruiert – plausibel und nachvollziehbar ist, dass sie Gewalt ausüben. Es geht uns also darum, mit Hilfe der Referenzrahmenanalyse einen unmoralischen, nämlich nicht-normativen Blick auf die Gewalt zu werfen, die im Zweiten Weltkrieg ausgeübt wurde – um zu verstehen, was die Voraussetzungen dafür sind, dass psychisch ganz normale Menschen unter bestimmten Bedingungen Dinge tun, die sie unter anderen Bedingungen nie tun würden.
Wir unterscheiden dabei Referenzrahmen unterschiedlicher Ordnung:
Referenzrahmen erster Ordnung umfassen das soziohistorische Hintergrundgefüge, vor dem Menschen in einer jeweiligen Zeit handeln. So wie sich kein Bundesbürger beim Lesen der Zeitung darüber Rechenschaft ablegt, dass er zum christlich-abendländischen Kulturkreis zählt und seine Bewertungen etwa eines afrikanischen Politikers an die Normen dieses Kulturkreises gebunden sind, so ist sich in der Regel niemand über die Orientierungsfunktion solcher Rahmen erster Ordnung bewusst. Rahmen erster Ordnung sind das, was Alfred Schütz die »assumptive world« genannt hat, das als selbstverständlich vorausgesetzte So-Sein einer gegebenen Welt, was darin als »gut« und »böse«, als »wahr« oder »falsch« betrachtet wird, was zum Bereich des Essbaren gehört, welchen Körperabstand man beim Sprechen einhält, was als höflich oder unhöflich gilt usw. Diese »gefühlte Welt« ist weit eher auf einer unbewussten und emotionalen Ebene wirksam als auf einer reflexiven.[1]
Referenzrahmen zweiter Ordnung sind historisch, kulturell und meist auch geographisch konkreter: Sie umfassen einen soziohistorischen Raum, den man in den meisten Hinsichten eingrenzen kann – auf die Herrschaftsdauer eines Regimes zum Beispiel, auf die Geltungsdauer einer Verfassung oder die Geschichte einer historischen Formation wie zum Beispiel der des »Dritten Reiches«.
Referenzrahmen dritter Ordnung sind nochmals spezifischer: Sie umfassen einen konkreten soziohistorischen Geschehenszusammenhang, in dem bestimmte Personen handeln, zum Beispiel also einen Krieg, in dem sie als Soldaten kämpfen.
Referenzrahmen vierter Ordnung sind die jeweils besonderen Eigenschaften, Wahrnehmungsweisen, Deutungsmuster, gefühlten Verpflichtungen etc., die eine Person in eine Situation mit hineinbringt. Auf dieser Ebene geht es um Psychologie, um persönliche Dispositionen und um die Frage der individuellen Entscheidungsfindung.
Wir werden in diesem Buch Referenzrahmen zweiter und dritter Ordnung analysieren, weil unser Material vor allem dazu einen Zugang erlaubt.
Es geht also um die Welt des »Dritten Reiches«, aus der die Wehrmachtsoldaten kommen, und um die Analyse der konkreten Situationen in Krieg und Militär, in denen sie handeln. Über die Persönlichkeiten der einzelnen Soldaten – den Rahmen vierter Ordnung – wissen wir dagegen oft nichts und immer zu wenig, um zum Beispiel erklären zu können, welche biographische Begebenheit und welche psychische Disposition dafür verantwortlich war, dass jemand gern getötet hat und jemand anderes Abscheu davor hatte.
Bevor wir aber mit der eigentlichen Analyse beginnen, sollen zunächst die verschiedenen Bestandteile von Referenzrahmen dargestellt werden.
Basale Orientierungen: Was geht hier eigentlich vor?
Am 30. Oktober 1938 unterbricht der amerikanische Radiosender CBS sein Programm mit einer Sondermeldung: Auf dem Mars habe sich eine Gasexplosion ereignet, in deren Folge sich eine Wasserstoffwolke mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde zu bewege. Mitten in ein Interview hinein, das ein Reporter dann mit einem Astronomie-Professor führt, um über die drohende Gefahr Klarheit zu gewinnen, platzt die nächste Nachricht: Seismographen hätten eine Erschütterung von der Stärke eines heftigen Erdbebens verzeichnet, vermutlich handele es sich um einen Meteoriteneinschlag. Jetzt überschlagen sich die Sondermeldungen. Schaulustige suchen die Einschlagstelle auf; aus der steigen nach kurzer Zeit Außerirdische, die die Zuschauer angreifen. Weitere Objekte schlagen an anderen Stellen ein, Scharen von Außerirdischen greifen Menschen an. Das Militär wird eingesetzt, allerdings mit geringem Erfolg, die Außerirdischen bewegen sich in Richtung New York. Die Armee setzt Kampfflugzeuge ein, die Menschen beginnen, aus der Gefahrenzone zu fliehen. Panik bricht aus.
An dieser Stelle findet ein Wechsel des Referenzrahmens statt: Bis zu der Episode mit den Kampfflugzeugen gibt die Beschreibung lediglich den Verlauf eines Hörspiels wieder, das Orson Welles aus dem Roman »Krieg der Welten« von H. G. Wells gemacht hatte; die panisch fliehenden Menschen aber gab es wirklich. Von den sechs Millionen Amerikanern, die an diesem denkwürdigen Tag die Radioübertragung hörten, nahmen zwei Millionen den Angriff der Außerirdischen für bare Münze. Einige packten sogar hektisch ihre Sachen und liefen auf die Straßen, um vor dem befürchteten Gasangriff der Außerirdischen zu fliehen. Die Telefonleitungen waren stundenlang blockiert. Es dauerte Stunden, bis sich herumgesprochen hatte, dass der Angriff bloß eine Fiktion war.[1] Dieses legendäre Ereignis, das den Ruhm von Orson Welles begründete, führt eindringlich vor Augen, dass der Sozialpsychologe William I. Thomas recht hatte, als er 1917 das folgende Theorem formulierte: »Wenn Menschen Situationen als real interpretieren, dann sind diese in ihren Folgen real.« Eine Realitätseinschätzung kann so falsch oder irrational sein, wie sie will – die Schlussfolgerungen, die aus ihr gezogen werden, schaffen nichtsdestoweniger ihrerseits neue Wirklichkeiten.
So wie die Hörerinnen und Hörer, die die Ansage nicht mitbekommen hatten, dass es sich beim »Krieg der Welten« um ein Hörspiel handelte, die Invasion für Wirklichkeit hielten. Man muss sich dabei übrigens vergegenwärtigen, dass die Kommunikationsmöglichkeiten damals eine schnelle Realitätsprüfung nicht zuließen – und unten auf der Straße sahen sich die Flüchtenden eines Wohnblocks in einer Menge anderer Menschen, die genau dasselbe taten wie sie selbst. Wie konnte da der Verdacht entstehen, einer Täuschung aufgesessen zu sein? Menschen versuchen, ihre Wahrnehmung und Deutung von Wirklichkeiten an der Beobachtung dessen zu bestätigen, was die anderen tun – insbesondere in Situationen, die wegen ihrer Unerwartetheit und Bedrohlichkeit zunächst starke Orientierungsprobleme mit sich bringen: Was geschieht hier? Was soll ich tun?
So entsteht zum Beispiel das berühmte »Bystander«-Phänomen: Wenn mehrere Personen Zeugen eines Unfalls oder einer Schlägerei werden, hilft selten jemand. Denn keiner der Zuschauer weiß sicher, was in diesem Augenblick die richtige Reaktion wäre, weshalb sich alle wechselseitig aneinander zu orientieren versuchen – und da niemand zu reagieren scheint, bleiben alle stehen und schauen. Keiner hilft, aber nicht – wie das dann in den Medien gewöhnlich kommentiert wird – aus »Herzlosigkeit«, sondern aus Orientierungsmangel und aufgrund eines fatal ablaufenden Prozesses der wechselseitigen Bestätigung im Nicht-Handeln. Die Beteiligten schaffen sich einen gemeinsamen Referenzrahmen, und ihre Entscheidungen fallen innerhalb dieses Rahmens. Menschen, die allein sind, wenn sie damit konfrontiert werden, helfen zu sollen, greifen in der Regel ein, ohne groß nachzudenken.
Das Beispiel »Krieg der Welten« ist spektakulär. Es zeigt aber lediglich, was grundsätzlich der Fall ist, wenn Menschen sich zu orientieren versuchen. Insbesondere moderne Gesellschaften setzen in der Fülle ihrer Funktionsbereiche, Rollenanforderungen und komplexen Situationen eine beständige Interpretationsarbeit ihrer Mitglieder voraus: Was geht hier vor? Welche Erwartung habe ich zu erfüllen? Das meiste davon wird einem nie bewusst, weil der größte Teil dieser beständigen Orientierungsarbeit von Routinen, Gewohnheiten, Skripts und Regeln übernommen wird, also gleichsam automatisch abläuft. Aber im Fall von Funktionsstörungen, kleinen Unfällen, Täuschungen oder Irrtümern wird einem bewusst, dass nun explizit erforderlich ist, was man sonst implizit andauernd macht: nämlich das gerade Geschehende zu deuten.
Solche Deutungsarbeit findet selbstverständlich nicht im luftleeren Raum statt und setzt nicht jedes Mal bei null an: Sie ist wiederum gebunden an »Rahmen«, also an aus vielen Bestandteilen zusammengesetzten Optiken, die der gerade zu machenden Erfahrung eine organisierende Struktur geben. Erving Goffman hat in Anlehnung an Gregory Bateson[2] und Alfred Schütz[3] eine Fülle solcher Rahmen und ihrer Eigenschaften beschrieben und dabei herausgearbeitet, in welch umfassender Weise solche Rahmen nicht nur unsere Alltagswahrnehmungen und -orientierungen organisieren, sondern wie sie auch – je nach Kontextwissen und Beobachterstandpunkt – höchst unterschiedliche Deutungen vorgeben. Für einen Betrüger etwa ist der Rahmen seiner Handlung ein »Täuschungsmanöver«, für den Betrogenen geht das vor sich, was vorgetäuscht wird.[4] Oder, wie Kazimierz Sakowicz notierte: »Für die Deutschen bedeuten 300 Juden 300 Feinde der Menschheit, für die Litauer sind es 300 Paar Schuhe, 300 Hosen.«[5]
In unserem Zusammenhang ist ein Aspekt besonders wichtig, der Goffman nicht sonderlich interessiert hat: wie nämlich die Referenzrahmen gebildet werden, die die Interpretation einer Situation anleiten, steuern und organisieren. »Krieg« bildet zweifellos einen anderen Referenzrahmen als »Frieden«, lässt andere Entscheidungen und Begründungen als angemessen erscheinen, verschiebt die Maßstäbe dafür, was richtig oder falsch ist. Auch Soldaten folgen in ihren Wahrnehmungen und Deutungen von Situationen, in denen sie sich befinden, nicht beliebigen Hinweisen, sondern operieren in einer höchst spezifischen Gebundenheit an Muster, die ihnen nur ein begrenztes Spektrum an individuellen Interpretationen erlauben. Jeder Mensch ist an ein Set kulturell imprägnierter Wahrnehmungs- und Deutungsweisen (»belief systems«) gebunden – das gilt nicht nur für Soldaten.
Besonders in pluralen Gesellschaften ist dabei der jeweilige Orientierungsbedarf und damit die Differenziertheit der Rahmen besonders ausgeprägt. Moderne Menschen müssen beständig zwischen unterschiedlichen Rahmenanforderungen – als Chirurg, als Vater, als Kartenspieler, als Sportler, als Mitglied einer Eigentümergemeinschaft, als Bordellbesucher, als Patient im Wartezimmer etc. – hin- und herwechseln und die mit jeder Rolle verbundenen Anforderungen bewältigen können. Dazu gehört auch, dass man das, was man im Rahmen der einen Rolle tut, aus der Sicht der anderen Rolle distanziert betrachten und beurteilen kann – dass man also zu unterscheiden in der Lage ist, wo Emotionslosigkeit und professionelle Kälte gefragt sind (bei einer Operation) und wo nicht (beim Spiel mit den Kindern). Und diese Fähigkeit zur »Rollendistanz«[6] stellt sicher, dass man in der jeweiligen Rolle nicht aufgeht und für die Bewältigung anderer Rollenanforderungen unfähig wird – mit anderen Worten: dass man flexibel zwischen den unterschiedlichen Referenzrahmen wechseln, die variierenden Anforderungen richtig deuten und nach diesen Deutungen handeln kann.
Kulturelle Bindungen
Stanley Milgram hat einmal formuliert, dass ihn interessiere, warum Menschen es vorziehen, in einem Haus zu verbrennen, anstatt ohne Hose auf die Straße zu rennen. Objektiv betrachtet ist das selbstverständlich eine irrationale Handlungsweise, subjektiv zeigt sie aber lediglich, dass in bestimmten Kulturen Schamstandards Hürden vor lebensrettenden Strategien aufbauen, die nur äußerst schwer zu überspringen sind. Japanische Soldaten töteten sich im Zweiten Weltkrieg lieber selbst, da sie nicht in Gefangenschaft geraten wollten. In Saipan stürzten sich sogar tausende Zivilisten von den Klippen, um den Amerikanern nicht in die Hände zu fallen.[1] Auch wenn es um das eigene Überleben geht, spielen also kulturelle Bindungen und Verpflichtungen oft eine größere Rolle als der Selbsterhaltungstrieb, weshalb zum Beispiel Menschen auch bei dem Versuch umkommen, einen Hund vor dem Ertrinken zu retten, oder es für sinnvoll halten können, sich als Selbstmordattentäter in die Luft zu sprengen (vgl. S. 330).
Fälle des Scheiterns ganzer Gesellschaften zeigen, wie kulturelle Bindungen großflächig funktionieren. So sind die normannischen Wikinger, die um das Jahr 1000 herum Grönland besiedelten, daran gescheitert, dass sie die aus Norwegen mitgebrachten Anbau- und Essgewohnheiten auch in Grönland nicht ablegten, obwohl dort ganz andere klimatische Bedingungen herrschten. So aßen sie zum Beispiel keinen Fisch, der in Hülle und Fülle vorhanden war, sondern versuchten Viehwirtschaft zu treiben, wofür die Weidesaison in Grönland allerdings viel zu kurz war.[2] Dass ein Überleben unter diesen Umweltbedingungen trotzdem möglich war, zeigen die Inuit, die Grönland schon zu Zeiten der Wikinger besiedelten und heute noch dort leben. Das berühmteste Beispiel für das Scheitern von Gesellschaften aufgrund kultureller Verpflichtungen liefern die Osterinsulaner, die so viel Ressourcen in die Produktion gigantischer Skulpturen zu Statuszwecken investierten, dass sie damit schließlich ihre eigenen Überlebensgrundlagen unterminierten und untergingen.[3]
Kulturelle Verpflichtungen (zu denen selbstverständlich auch religiöse zählen) scheinen auch in Scham- und Ehrgefühlen und -begriffen auf und generell in der Unfähigkeit, »rationale« Lösungen für Probleme zu ergreifen, obwohl diese aus der Beobachterperspektive so nahezuliegen scheinen wie im Fall der Wikinger, die sich nur von Fleisch auf Fisch hätten umstellen müssen.
Das kulturelle Gepäck kann unter Überlebensgesichtspunkten gelegentlich schwer und manchmal auch tödlich werden. Oder anders gesagt: Was in all diesen Fällen als Problem wahrgenommen wird, ist gar nicht die Gefährdung des eigenen Überlebens, sondern die Gefahr, symbolische, tradierte, status- oder befehlsgebundene Verhaltensvorschriften zu verletzen – und eine solche Gefahr kann offenbar so schwerwiegend sein, dass in der Perspektive der Akteure gar keine andere Möglichkeit zu sehen ist. Auf diese Weise werden Menschen zu Gefangenen ihrer eigenen Überlebenstechniken.
Habituelle kulturelle Bindungen und selbstverständliche kulturelle Verpflichtungen machen einen erheblichen Teil von Referenzrahmen aus und sind gerade deshalb so wirksam und oft geradezu zwingend, weil sie die Ebene der Reflexion gar nicht erreichen. Es ist offensichtlich die kulturelle Lebensform selbst, die ausschließt, dass bestimmte Dinge gesehen oder schädliche Gewohnheiten und unsinnige Strategien geändert werden können. Aus der Außenperspektive erscheint daher oft als völlig irrational, was aus der Binnensicht der Akteure die Qualität höchster, weil selbstverständlichster Vernünftigkeit besitzt. Dabei zeigt das Wikinger-Beispiel auch, dass kulturelle Bindungen nicht nur in dem bestehen, was die Mitglieder einer Kultur wissen, sondern vor allem auch in dem, was sie nicht wissen.
Nicht-Wissen
Das Beispiel des jüdischen Jungen Paul Steinberg, der als 16-Jähriger in Frankreich von einer Nachbarin denunziert und daraufhin nach Auschwitz deportiert wurde, gibt einen Einblick in mögliche Wirkungen des Nicht-Wissens. So wurde Steinberg in Auschwitz auf ein fatales Defizit in seinem Referenzrahmen aufmerksam, und zwar beim Duschen:
›Wie kommst du denn hierher?‹, fragte ein Kürschner aus dem Faubourg-Poissonnière. Ich sah ihn verdutzt an. Er zeigte mit seinem Finger auf meinen Schwanz, rief die Gefährten herbei und schrie: ›Der ist ja gar nicht beschnitten!‹ Ich wusste so wenig über Beschneidung wie über die jüdische Religion im Allgemeinen. Mein Vater hatte es unterlassen – ganz sicher aus einer schwachsinnigen Scham heraus –, mich mit diesem fesselnden Thema bekannt zu machen. Ich war und bleibe wohl auch der einzige deportierte Jude aus Frankreich und Navarra, der unbeschnitten in Auschwitz anlangte, ohne diese Trumpfkarte ausgespielt zu haben. Die Ansammlung um mich herum wurde immer größer, die Kerle lachten sich halb tot. Am Ende hat mich einer von ihnen als den allerletzten Trottel bezeichnet![1]
Paul Steinberg konnte seine Chance, unterzutauchen, aus kulturellem Nicht-Wissen heraus nicht nutzen – für die meisten anderen jüdischen Männer war es zur NS-Zeit ein tödliches Zeichen, beschnitten zu sein, und alle waren peinlich darauf bedacht, dieses Erkennungszeichen zu verbergen. Besonders in den besetzten Gebieten wurden Juden mit einem Blick auf das beschnittene Glied identifiziert – und so betrachtet hatte Steinberg seinen entscheidenden Vorteil nicht ausgespielt.
Dies ist ein Beispiel für die Fatalität individuellen Nichtwissens, das gleichwohl zum in diesem Fall maßgeblichen Referenzrahmen und die an ihn gebundenen Interpretationen und Handlungen gehört. Insofern hängt, was man tut, davon ab, was man wissen und nicht wissen kann. Aber nicht nur deshalb ist die Erforschung dessen, was Menschen zu einem früheren Zeitpunkt gewusst haben, ein schwieriges Unterfangen. Denn Geschichte wird nicht wahrgenommen, sie geschieht. Und erst später wird von Historikern festgestellt, was aus einem Inventar von Geschehnissen »historisch«, also in irgendeiner Weise für den Lauf der Dinge bedeutsam gewesen ist. Im Alltag werden schleichende Veränderungen der sozialen und physikalischen Umwelt meist nicht registriert, weil sich die Wahrnehmung an die Veränderung ihrer Umwelten permanent nachjustiert. Umweltpsychologen nennen dieses Phänomen »shifting baselines«. Beispiele von der Veränderung von Kommunikationsgewohnheiten bis zur radikalen Verschiebung normativer Standards etwa im Nationalsozialismus zeigen, wie wirkungsvoll solche shifting baselines sind. Man hat den Eindruck, alles bliebe im Großen und Ganzen gleich, obwohl sich Fundamentales verändert hat.
Erst nachträglich wird ein für die Wahrnehmung langsamer Prozess durch Begriffe wie etwa »Zivilisationsbruch« auf ein abruptes Ereignis verdichtet – dann nämlich, wenn man weiß, dass eine Entwicklung radikale Konsequenzen gehabt hat. Die Interpretation dessen, was Menschen vom Entstehen eines Prozesses wahrgenommen haben, der sich erst sukzessive zur Katastrophe auftürmte, ist also ein äußerst vertracktes Unterfangen – vertrackt auch deswegen, weil wir unsere Frage nach der zeitgenössischen Wahrnehmung im Wissen darum stellen, wie die Sache ausgegangen ist, das aber die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen logischerweise gar nicht haben konnten. Man blickt also vom Ende einer Geschichte auf ihren Beginn und müsste gewissermaßen das eigene historische Wissen suspendieren, um für einen jeweiligen Zeitpunkt angeben zu können, was man damals gewusst hat. Norbert Elias hat es deshalb als eine der schwierigsten Aufgaben der Sozialwissenschaften bezeichnet, die Struktur des Nichtwissens zu rekonstruieren, die zu anderen Zeiten vorgelegen hat.[2] Man kann das mit Jürgen Kocka auch als die Aufgabe der »Verflüssigung« von Geschichte bezeichnen, also »das Rückverwandeln von Faktizität in Möglichkeiten«.[3]
Erwartungen
Am 2. August 1914, dem Tag nach der deutschen Kriegserklärung gegen Russland, notiert Franz Kafka in Prag in seinem Tagebuch: »Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. – Nachmittag Schwimmschule.« Das ist lediglich ein besonders prominentes Beispiel dafür, dass Ereignisse, die die Nachwelt als historische zu bewerten gelernt hat, in der Echtzeit ihres Entstehens und Auftretens nur selten als solche empfunden werden. Wenn sie überhaupt zur Kenntnis genommen werden, dann als Teil eines Alltags, in dem noch unendlich viel mehr anderes wahrgenommen wird und Aufmerksamkeit beansprucht. So geschieht es, dass selbst außergewöhnlich intelligente Zeitgenossen einen Kriegsausbruch mitunter nicht bemerkenswerter finden als den Umstand, dass man am selben Tag seinen Schwimmkurs absolviert hat.
In dem Augenblick, in dem Geschichte stattfindet, erleben Menschen Gegenwart. Historische Ereignisse zeigen ihre Bedeutung erst im Nachhinein, nämlich dann, wenn sie nachhaltige Folgen gezeitigt haben oder sie sich, mit einem Begriff von Arnold Gehlen, als »Konsequenzerstmaligkeiten« erwiesen haben: also als präzedenzlose Ereignisse mit Tiefenwirkung für alles, was danach kam. Damit ergibt sich ein methodisches Problem, wenn man die Frage stellt, was Menschen eigentlich von solch einem heraufdämmernden Ereignis wahrgenommen bzw. gewusst haben bzw. wahrnehmen und wissen konnten. Denn Erstmaligkeitsereignisse werden in der Regel gerade deshalb nicht wahrgenommen, weil sie neu sind, man also das, was geschieht, mit den verfügbaren Referenzrahmen zu erfassen versucht, obwohl es sich um ein präzedenzloses Geschehen handelt, das selber erst eine Referenz für spätere vergleichbare Ereignisse liefern kann.
So kann man aus historischer Perspektive feststellen, dass die Weichen für den Vernichtungskrieg längst gestellt waren, als die Wehrmacht am 22. Juni 1941 die Sowjetunion angriff. Gleichwohl darf bezweifelt werden, dass die Soldaten, die am frühen Morgen dieses Tages ihre Anordnungen erhielten, wirklich begriffen, welch ein Krieg ihnen bevorstand. Sie erwarteten einen raschen Vormarsch, so wie in Polen, Frankreich und auf dem Balkan, keinen Vernichtungskrieg, der auch in der Hauptkampflinie mit bislang beispielloser Härte geführt werden sollte. Und schon gar nicht erwarteten sie, dass im Rahmen dieses Krieges systematisch Personengruppen vernichtet werden würden, die mit dem Kriegsgeschehen im engeren Sinn gar nichts zu tun hatten. Der Referenzrahmen »Krieg« sah das nämlich bis dato überhaupt nicht vor.
Aus demselben Grund haben viele der jüdischen Deutschen nicht die Dimension des Ausgrenzungsprozesses erkannt, deren Opfer sie wurden. Die nationalsozialistische Herrschaft wurde als kurzlebiges Phänomen betrachtet, »das man durchstehen müsse, oder als einen Rückschlag, auf den man sich einstellen konnte, schlimmstenfalls als Bedrohung, die einen zwar persönlich einengte, aber immer noch erträglicher war als die Fährnisse eines Exils«.[1] Die bittere Ironie liegt im Fall der Juden gerade darin, dass ihr Referenzrahmen Antisemitismus, Verfolgung und Beraubung aufgrund leidvoller historischer Erfahrungen ohne weiteres umfasste, er es ihnen aber gerade dadurch unmöglich machte zu sehen, dass nun etwas geschah, was anders, nämlich absolut tödlich, war.
Zeitspezifische Wahrnehmungskontexte
Am 2. Juni 2010 kamen bei einem Entschärfungsversuch einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Göttingen drei Männer des Kampfmittelräumdienstes ums Leben – ein Ereignis, über das alle Medien ausführlich berichteten und das erhebliche Betroffenheit auslöste. Wären 1944 oder 1945, als die Bombe abgeworfen wurde, dabei drei Personen getötet worden, wäre das keinerlei Aufmerksamkeit über den Kreis der Angehörigen hinaus wert gewesen. Der zeitgenössische Kontext hieß Krieg; noch im Januar und Februar 1945 wurden in Göttingen ca. 100 Menschen durch Bombenangriffe getötet.[1]
Ähnliches gilt für einen anderen Geschehenszusammenhang, die Massenvergewaltigungen, wie sie zu Kriegsende vor allem durch die Soldaten der vorrückenden Roten Armee begangen wurden. Die eindrücklichen Schilderungen der Anonyma,[2] die vor einigen Jahren publiziert wurden, lassen erkennen, dass es für die Wahrnehmung und Verarbeitung selbst von körperlicher Gewalt einen erheblichen Unterschied macht, ob man als einzelne Person davon betroffen ist oder ob es sehr viele andere gibt, die dasselbe erleiden. Die Frauen sprachen zu dieser Zeit über die Vergewaltigungen, und sie entwickelten Strategien, sich und besonders die jungen Mädchen vor Übergriffen zu schützen. Die Anonyma etwa ging ein Verhältnis mit einem russischen Offizier ein, was sie vor willkürlichen sexuellen Übergriffen durch andere sowjetische Soldaten schützte. Aber schon der Umstand, dass es einen kommunikativen Raum gibt, in dem man sich über das Leid, aber auch über Strategien des Entkommens austauschen kann, bedeutet einen erheblichen Unterschied für die Wahrnehmung und Deutung solcher Ereignisse.
Im Zusammenhang von Gewalt ist außerdem zu berücksichtigen, dass Gewalt historisch sehr unterschiedlich ausgeübt und erlebt wird. Die außerordentlich große Gewaltabstinenz moderner Gesellschaft und die weitgehende Absenz von Gewalt im öffentlichen – und eingeschränkter im privaten Raum – gehen auf die zivilisatorische Errungenschaft der Gewaltenteilung und Gewaltmonopolisierung aufseiten des Staates zurück. Das ermöglicht die enorm große Sicherheit, die zum Leben in modernen Gesellschaften gehört, während es in vormodernen Zeiten erheblich wahrscheinlicher war, zum Opfer direkter körperlicher Gewalt zu werden.[3] Auch die Präsenz von Gewalt im öffentlichen Raum, etwa im Zusammenhang von Strafen und Hinrichtungen, war erheblich größer als heute,[4] so dass man davon ausgehen kann, dass die Referenzrahmen und damit das Erleben von ausgeübter wie erlittener Gewalt historisch höchst variabel sind.
Was gerade für »Zeiten« herrschen, in welche Normalitätsvorstellungen Ereignisse also fallen, was für gewöhnlich und was für extrem gehalten wird, bildet ein wichtiges Hintergrundelement von Referenzrahmen. In »Krisenzeiten« sind etwa politisch andere Maßnahmen gerechtfertigt als in »normalen«, unter Katastrophenbedingungen wiederum andere, und im Krieg ist, einem bekannten Sprichwort zufolge, »jedes Mittel erlaubt«, jedenfalls viele, die unter Friedensbedingungen streng geahndet würden.
Rollenmodelle und -anforderungen
Einen sehr weiten Bereich, besonders in modernen, funktional differenzierten Gesellschaften bilden die bereits erwähnten Rollen, die jede für sich ein bestimmtes Set an Anforderungen an diejenigen stellen, die sie ausfüllen möchten oder müssen. Rollen nehmen eine mittlere Ebene zwischen den kulturellen Bindungen und Verpflichtungen und den gruppenspezifischen und individuellen Deutungen und Handlungen ein. Es gibt eine Reihe von Rollen, bei denen wir uns nicht bewusst sind, dass wir ihren Normen entsprechend handeln, obwohl wir das ganz selbstverständlich tun. Hierzu zählen etwa alle Rollen, nach denen Soziologen Gesellschaften differenzieren: Geschlechts-, Alters-, Herkunfts- oder Bildungsrollen. Die damit verbundenen Sets von Anforderungen und Normen können zwar bewusst wahrgenommen und auch hinterfragt werden, müssen es aber nicht und werden es gewöhnlich auch nicht. Diese selbstverständlichen lebensweltlichen Rollen prägen nichtsdestotrotz Wahrnehmungen, Deutungen und Handlungsoptionen – und sie unterliegen, besonders deutlich beim Geschlecht und beim Alter, normativen Regeln: Von einer betagten Dame wird sozial ein anderes Verhalten erwartet als von einem Jugendlichen, und zwar ohne dass es dafür einen Regelkatalog oder gar ein Gesetzbuch gäbe. Als Mitglied einer Gesellschaft »weiß« man so etwas implizit.
Anders verhält es sich mit explizit eingenommenen Rollen, die – etwa im Lauf der Karriere – schon deutlich mit neuen und zu erlernenden Sets von Anforderungen einhergehen: Wenn jemand gerade noch Mathematikstudent war und nun als Versicherungsmathematiker zu arbeiten beginnt, wechselt sein Anforderungsset erheblich: von den Kleidungsnormen über die Arbeitszeit bis hin zur Kommunikation und den Dingen, die wichtig oder unwichtig sind. Andere tiefgreifende Übergänge finden sich dort, wo jemand Mutter oder Vater wird oder als Rentner aus dem Berufsleben ausscheidet. Und dann gibt es noch jene radikalen Rollenwechsel, wie sie etwa mit dem Übertritt in »totale Institutionen«[1] verbunden sind: in ein Kloster zum Beispiel, in ein Gefängnis oder – für unseren Zusammenhang besonders wichtig – ins Militär. Hier ergreift die Institution, zum Beispiel die Wehrmacht oder die SS, die vollständige Verfügung über die Person: Sie bekommt einheitliche Kleidung und Frisur, verliert damit die Kontrolle über ihre Identitätsausstattung, sie kann nicht mehr über die eigene Zeit verfügen, unterliegt in jeder Weise äußeren Zwängen, Drill, Schikanen, drakonischen Strafen bei Regelverletzungen. Totale Institutionen funktionieren gerade deshalb als hermetische Welten eigener Art, weil sie Zwecke der Zurichtung verfolgen: Soldaten sollen nicht nur die Handhabung einer Waffe oder das Bewegen im Gelände lernen, sondern auch Gehorsam, die unbedingte Einfügung in Hierarchien und das jederzeitige Handeln auf Befehl. Totale Institutionen etablieren eine bestimmte Form der Vergemeinschaftung, in der Gruppennormen und -zwänge einen größeren Einfluss auf die Einzelnen ausüben als unter gesellschaftlichen Normalbedingungen, einfach deshalb, weil die Kameradschaftsgruppe, zu der man zählt, zwar nicht frei gewählt, aber trotzdem die alternativlose Bezugsgruppe ist. Man gehört zu ihr, weil man ihr zugeteilt wurde.[2]
Es ist bezeichnend, dass eine totale Institution ihre Klienten insbesondere während der Ausbildungszeit in jeder Hinsicht völlig der eigenen Kontrolle zu berauben versucht und erst danach rangspezifische Freiheitsgrade und Handlungsspielräume eröffnet. Die Literatur über die Weitergabe der zum Teil demütigenden Zwangserfahrungen der Älteren an die Jüngeren gehört zu der Vergemeinschaftungsform solcher Institutionen; ihr Horror ist vielfach Gegenstand der Literatur geworden.[3] Dies alles wirkt schon im Frieden in eklatantem Ausmaß, mehr noch aber im Krieg: Wenn Kampfhandlungen aus dem Status der Simulation in den der alltäglichen Wirklichkeit wechseln und es nicht zuletzt vom Funktionieren des eigenen Kommandos abhängt, ob man überlebt oder nicht. Hier wird aus der totalen Institution die totale Gruppe und die totale Situation,[4] und beide lassen den Akteuren nur die durch den Rang und die Befehlslage genau definierten Handlungsspielräume. Der Referenzrahmen eines Soldaten im Krieg ist daher verglichen mit jeder Rolle im Zivilleben durch Alternativlosigkeit bestimmt. Einer der abgehörten Soldaten formulierte es im Gespräch mit seinem Kameraden so: »Wir sind wie ein MG. Eine Waffe, um Krieg damit zu führen.«[5]
Was und mit wem man als Soldat wann etwas tut, unterliegt nicht der eigenen Wahrnehmung, Deutung und Entscheidung; der Raum, in dem ein Befehl nach eigener Einschätzung und Kompetenz ausgelegt werden kann, ist meist extrem klein. In diesem Sinn variieren die Rollenanteile von Referenzrahmen sehr stark: Ihre Bedeutung kann unter den pluralen Bedingungen des Zivillebens verschwindend gering oder unter den Bedingungen des Krieges oder anderer Extremsituationen total sein.
Dabei können sich Bestandteile unterschiedlicher Rollen im militärischen Kontext auch überlagern, und zwar in zwei Richtungen: Die Kompetenz eines Landvermessers kann bei der Orientierung im Gelände äußerst hilfreich sein, und umgekehrt können zivile Tätigkeiten im Kontext von Krieg und Massenvernichtung plötzlich tödlich werden. Man denke hier etwa an den Ingenieur Kurt Prüfer von der Erfurter Firma Topf & Söhne, der mit großer Energie an der Entwicklung effizienterer Krematoriumsöfen für Auschwitz arbeitete, die es ihrerseits erlaubten, die Zahl der täglich zu Ermordenden zu steigern.[6] Einen anderen Fall von Rollenüberlagerung berichtet eine Frau, die Stenotypistin beim Kommandeur der Sicherheitspolizei in Warschau gewesen ist: »Wenn ein oder zwei Deutsche in Warschau erschossen wurden, ordnete der Kommandeur der Sicherheitspolizei Hahn bei Kriminalrat Stamm an, dass eine bestimmte Zahl von Polen zu erschießen sei. Stamm wies dann die Damen seines Vorzimmers an, aus den einzelnen Referaten geeignete Akten kommen zu lassen. Im Vorzimmer lag dann ein großer Haufen Akten. Wenn nun z.B. 100 Akten dalagen und nur 50 erschossen werden sollten, dann lag es an den Damen, wie sie nach Gutdünken die Akten herauszogen. Es kann in Einzelfällen auch gewesen sein, dass der Referatsbearbeiter noch hinzugefügt hat: ›Der und der muss weg. Weg mit dem Dreck‹. Solche Äußerungen sind sehr oft gefallen. Ich habe oft tagelang nicht schlafen können wegen der Vorstellung, dass es von den Vorzimmerdamen abhing, wer erschossen wurde. So sagte z.B. die eine Dame zur anderen: ›Ach, Erika, wollen wir den oder den noch mitnehmen?‹«[7]
Eine an sich harmlose Tätigkeit kann plötzlich mörderisch werden, wenn ihr Bezugsrahmen wechselt. Schon Raul Hilberg hat auf dieses Potential arbeitsteiliger Vollzüge hingewiesen: Jedes Mitglied der Ordnungspolizei konnte »Aufseher eines Ghettos oder eines Eisenbahntransports sein. Jeder Jurist des Reichssicherheitshauptamts kam dafür in Frage, die Leitung einer Einsatzgruppe zu übernehmen; jeder Finanzsachverständige des Wirtschafts-Verwaltungshauptamts wurde als natürliche Wahl für den Dienst in einem Vernichtungslager betrachtet. Mit anderen Worten, alle notwendigen Operationen wurden mit dem jeweils verfügbaren Personal durchgeführt. Wo immer man den Trennungsstrich der aktiven Teilnahme zu ziehen gedenkt, stets stellte die Vernichtungsmaschinerie einen bemerkenswerten Querschnitt der deutschen Bevölkerung dar.«[8] Übertragen auf den Krieg heißt das: Jeder Mechaniker konnte Bomber reparieren, die mit ihrer tödlichen Fracht Tausende von Menschen töteten; jeder Metzger konnte als Mitglied der Versorgungsbetriebe an der Ausplünderung der besetzten Gebiete teilnehmen. Lufthansapiloten wurden mit ihren Verkehrsmaschinen vom Typ FW200 auch im Krieg für Langstreckenflüge eingesetzt, doch diesmal nicht, um Passagiere zu befördern, sondern um britische Handelsschiffe im Atlantik zu versenken. Da die Tätigkeit an sich nicht wechselt, haben die Rollenträger in der Regel keine Veranlassung, moralische Erwägungen anzustellen oder gar ihre Arbeit zu verweigern. Die bleibt ja dieselbe.
In totalen Institutionen ist, wie gesagt, der gegebene Referenzrahmen nahezu alternativlos. Das gilt schon für den Soldaten im Militärdienst, aber noch mehr im Krieg, und nochmals mehr im Kampf. Man muss dabei bedenken, dass ein so lang andauernder, umfassender und in vielerlei Hinsicht präzedenzloser Krieg wie der Zweite Weltkrieg an sich schon »den Charakter eines außerordentlich komplexen, schwer überschaubaren Geschehens« hat.[9] Für den Einzelnen, der sich an irgendeiner Stelle dieses Geschehens befindet, ist es enorm schwer, sich angemessen zu orientieren – daher werden der Befehl und die Gruppe auch subjektiv wichtiger: Sie gewährleisten Orientierung, wo sonst keine wäre. Die Wichtigkeit der Kameradschaftsgruppe für die eigenen Orientierungsbedürfnisse wächst mit der Bedrohlichkeit der Situation, in der man sich gerade befindet. Die Gruppe wird zur totalen Gruppe.
Vor dem Hintergrund der Rollentheorie sind Fragen danach, wieso jemand im Krieg Menschen getötet oder sich an Kriegsverbrechen beteiligt hat, sinnvollerweise zunächst keine moralischen, sondern empirische Fragen. Moralisch können sie sinnvoll nur dann gestellt werden, wenn die Handlungsspielräume der Einzelnen greifbare Alternativen enthielten, die nicht gewählt wurden. Wie man weiß, gilt das zum Beispiel für die Verweigerung der Teilnahme an sogenannten Judenaktionen, was ohne juristische Konsequenzen blieb,[10] und für die unendlich zahlreichen Fälle von lustvoller Gewaltausübung, die uns in diesem Buch noch begegnen werden. Aber für viele andere Geschehenszusammenhänge im Krieg muss man nüchtern konstatieren, dass die Wahlmöglichkeiten und Handlungsalternativen, die die Pluralität der Rollen im zivilen Alltag bereithält, nicht existieren.
Deutungsmuster: Krieg ist Krieg
Eng geknüpft an die Anforderungssets, die jede Rolle vorsieht, sind spezifische Deutungsmuster: Als Arzt betrachtet man eine Krankheit anders als der Patient, als Täter die Tat anders als das Opfer. Deutungsmuster leiten die Interpretation konkreter Situationen an, sind gewissermaßen Mikro-Referenzrahmen. Es war oben schon die Rede vom Nicht-Wissen: Jedes Deutungsmuster schließt natürlich ein ganzes Universum alternativer Deutungen aus, bedeutet also immer auch Nicht-Wissen. Das ist schlecht im Fall von Situationen, die so neu sind, dass für deren Bewältigung Erfahrungen nicht nützlich, sondern hinderlich sind,[1] sehr funktional aber im Kontext des Gewohnten, weil nicht jedes Mal komplizierte Überlegungen darüber angestellt werden müssen, womit man es gerade zu tun hat und welches das richtige Rezept für die Lösung eines Problems ist. Deutungsmuster als typisierte und routinisierte Rahmen der Einordnung dessen, was gerade geschieht, strukturieren das Leben in außerordentlich hohem Maße. Sie reichen von Stereotypen (»Der Jude ist ...«) bis hin zu ganzen Kosmologien (»Gott wird Deutschland nicht untergehen lassen«), sind indes historisch und kulturell höchst spezifisch. Deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg typisieren ihre Gegner nach anderen Kriterien und Merkmalen als Soldaten im Vietnamkrieg, aber der Vorgang des Typisierens und die Funktion, die er hat, sind identisch.
Auch die Dinge, die ein Soldat erlebt, gehen nicht pur in seine Erfahrung ein. Vielmehr werden diese Erlebnisse durch vorhandene – aus Ausbildung, Medien und Erzählungen gebildete – Deutungsmuster präformiert und gefiltert. Überraschung zum Beispiel tritt dann auf, wenn das Erlebte vom Erwarteten abweicht – Joanna Bourke zitiert einen Soldaten, der überrascht ist, dass der von ihm getroffene Gegner nicht wie im Kinofilm aufschreit und umfällt, sondern mit einem Grunzen zusammenbricht.[2] In den meisten Fällen hilft das Deutungsmuster aber, das Erlebte einzuordnen und zu verarbeiten und Orientierungssicherheit herzustellen.
Für die Frage, wie die Soldaten den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, spielen Deutungsmuster – über die »Anderen«, die eigene Mission, über den Kampf, über die »Rasse«, über Hitler, die Juden etc. – eine besonders wichtige Rolle. Sie statten den Referenzrahmen gewissermaßen mit Vordeutungen aus, in die das Erlebte einsortiert werden kann. Dazu gehören auch Muster, die aus anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen kommen und in die Kriegserfahrung importiert werden – besonders deutlich wird dies am Topos »Krieg als Arbeit«, der äußerst wichtig für die Selbstdeutung dessen ist, was die Soldaten tun. Das lässt sich nicht nur in den immer wieder auftauchenden Begriffen ablesen – wenn etwa von »Drecksarbeit« die Rede ist oder davon, dass die Luftwaffe »ganze Arbeit geleistet« habe. Harald Turner, Chef der Militärverwaltung in Serbien, schreibt am 17. Oktober 1941 an den Höheren SS- und Polizeiführer Richard Hildebrandt: Ich habe »in den letzten 8 Tagen 2000 Juden und 200 Zigeuner erschiessen lassen nach der Quote 1:100 für bestialisch hingemordete deutsche Soldaten. Und weitere 2200, ebenfalls fast nur Juden, werden in den nächsten 8 Tagen erschossen. Eine schöne Arbeit ist das nicht!«[3] Auch in Ernst Jüngers berühmter Bezeichnung des Soldaten als »Arbeiter des Krieges« scheint die Wirksamkeit industriegesellschaftlicher Deutungsmuster für das Erleben und die Verarbeitung der Kriegserfahrung auf – der Krieg erscheint als ein »von Gefühlen des Entsetzens wie der Romantik gleichweit entfernter rationaler Arbeitsprozess sowie die Bedienung der Waffe als Verlängerung der gewohnten Tätigkeit an der heimischen Werkbank«.[4]
Und tatsächlich weisen ja betriebliche Arbeit und Kriegsarbeit vielfältige Verwandtschaften auf: Beide sind arbeitsteilig organisiert, setzen sich aus technischen Teil- und Spezialqualifikationen zusammen und sind hierarchisch strukturiert. In beiden Fällen hat man mit dem Endprodukt, das hergestellt wird, nichts zu tun, man führt Anordnungen aus, über deren Sinn man sich keine Gedanken zu machen braucht. Verantwortung bezieht sich immer nur partikular auf den unmittelbaren Tätigkeitsbereich oder ist grundsätzlich delegiert. Routine spielt eine große Rolle, man macht immer wieder dieselben Handgriffe, folgt denselben Anweisungen. Auch in einem Bomber arbeiten Piloten, Bomben- und Heckschützen mit unterschiedlicher Qualifikation in unterschiedlichen Teilvollzügen an einem Gesamtprodukt, nämlich der Zerstörung eines vorgegebenen Zieles, ganz gleich, ob es sich um eine Stadt, eine Brücke oder eine Truppenansammlung auf freiem Feld handelt. Massenerschießungen wie die sogenannten Judenaktionen werden nicht nur von den Schützen durchgeführt, sondern ebenso von den Lastwagenfahrern, den Köchen, Waffenwarten und »Zuführern« und »Packern«, also denen, die die Opfer an die Grube bringen und denen, die sie aufeinanderschichten, mithin also hoch arbeitsteilig.
Alf Lüdtke hat an vielen Stellen die Verwandtschaft von Industrie- und Kriegsarbeit herausgestellt und deutlich gemacht, dass man gerade in proletarischen Schichten als »Arbeit« ansah, was man in anderer Funktion tat, etwa als Soldat oder Reservepolizist. In den autobiographischen Zeugnissen solcher Männer, also in Feldpostbriefen und Tagebüchern aus dem Zweiten Weltkrieg, finden sich vielfältige Analogsetzungen von Krieg und Arbeit, was sich etwa in der Disziplin verkörpert, in der Monotonie von Vollzügen, sich aber auch in Bemerkungen äußert, »in denen eine militärische Aktion, d.h. das Zurückwerfen oder Vernichten des Gegners – also das Töten von Menschen und Zerstören von Material als gute Arbeit gilt.« Lüdtke fasst zusammen: »Gewalteinsatz, Gewaltandrohung, das Töten oder doch Schmerzzufügen ließ sich als Arbeit begreifen und damit als sinnvoll, zumindest als notwendig und unvermeidbar erfahren.«[5]
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Deutungsmuster auch die Funktion der Sinnstiftung haben: Wenn ich etwa die Tötung von Menschen als »Arbeit« interpretiere, ordne ich sie nicht in die Kategorie »Verbrechen« ein, normalisiere den Vorgang also. Die Rolle, die Deutungsmuster in den Referenzrahmen des Krieges spielen, wird anhand solcher Beispiele klar. Das, was unter den Normalbedingungen des zivilen Alltags als Abweichung, mithin als erklärungs- und legitimationsbedürftig betrachtet würde, wird hier zum normalen und konformen Verhalten. Das Deutungsmuster automatisiert gewissermaßen die moralische Prüfung und schützt Soldaten davor, sich schuldig zu fühlen.