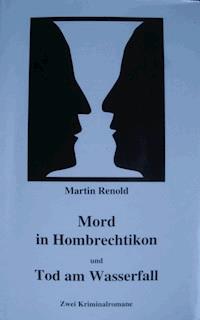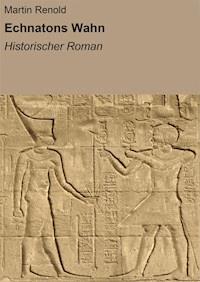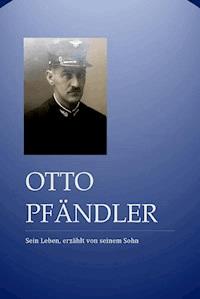Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman beschreibt spannend den abenteuerlichen Auszug Abrahams mit seiner Frau Sara und dem Neffen Lot von der Stadt Ur in Mesopotamien nach Palästina und seine Flucht vor einer Hungersnot nach Ägypten, wo Abraham Sara als seine Schwester ausgibt, weil der Pharao sie für sich beansprucht, der sie aber später Abraham wieder zurückgibt. Nach der Rückkehr siedelt sich Abraham in Hebron an. Lot entzweit sich mit Abraham und zieht nach der Stadt Sodom, deren Untergang er überlebt. Der Roman ist nicht in erster Linie ein religiöses Buch. Der Autor versucht die biblische Geschichte in das historische Umfeld Mesopotamiens zur Zeit von Hamurapi und auch Ägyptens einzufügen. Daraus entseht ein interessantes farbiges Bild jener Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Renold
Abraham
Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Terachs Traum von Freiheit
Die Sonne verfinstert sich
Abram will mehr wissen
Haran und Abram
Schicksalsschläge
Milka
Terachs Traum wird wahr
Von Ur nach Babylon
Von Babylon nach Haran
An der Wegscheide
Im Lande Kanaan
In Ägypten
Sarai am Hof des Pharaos
Streit zwischen den Hirten
Lot zieht nach Sodom
Mamre
Lots Rettung
Hagar
Das Leben in Sodom
Gott schließt einen Bund mit Abram
Sodom und Gomorra
Lots Töchter
Abimelech
Abrahams Söhne
Abrahams Bund mit Abimelech
Isaak
Saras Tod
Ismael
Nahor und seine Nachkommen
Abraham und Ketura
Rebekka
Isaak begegnet Ismael
Esau und Jakob
Impressum neobooks
Terachs Traum von Freiheit
Die Stadttore von Ur im Land Aram-Naharaim, dem Land der zwei Ströme, waren geschlossen. Es war eine mondlose Nacht. Schwarz und gespenstisch ragten die Mauern, hinter denen die Bewohner schliefen, in die Höhe, unüberwindlich für jeden Feind. Die Soldaten von Sin-Aschar, dem Statthalter des Königs Rim-Sin, der in Larsa herrschte und dem auch Ur untertan war, hielten Wache auf den Zinnen. In den dunklen Gassen war es ruhig. Nur hie und da hätte ein später Heimkehrer, wenn es denn einen solchen gehabt hätte, das Kläffen eines Hundes, den leisen Zuruf eines Soldaten an einen Kameraden auf der Mauer oder die Schritte der Wächter, die durch die Gassen patrouillierten, gehört. Doch niemand wagte sich um diese Zeit aus den Häusern. Die Türen waren verriegelt.
Bis zum Aufgang der Sonne herrschte ein strenges Ausgehverbot. Obwohl die Stadt schon vor Jahrzehnten von den Herrschern aus Larsa besetzt worden war und von ihnen regiert wurde, traute der König dem Volk der Chaldäer nicht. Es waren eigensinnige Leute, die sich gerne die vergangene Zeit zurückwünschten. Und Rim-Sin waren die Aufstände gegen frühere Herrscher wohl bekannt. Wie viel hatte er schon für dieses Volk getan! Er hatte die Kanäle in der Stadt erneuert und neue gebaut, er hatte die Bewässerungsanlagen auf den Feldern verbessert, hatte die Stadtmauern und Tore verstärkt, aber das Volk dankte es ihm nicht. Die Chaldäer wollten nicht unter der Herrschaft von Larsa leben. Doch sie mussten endlich verstehen, dass die große Zeit der Könige von Ur vorbei war.
Die alte Königsburg, die jetzt von Sin-Aschar, König Rim-Sins, vom Volk ungeliebtem Statthalter, bewohnt wurde, war Tag und Nacht streng bewacht. Und auch durch die breite, gepflasterte Hauptstraße und die engen, von Abfall und Kot übel riechenden Nebengassen, die sich zwischen die aneinandergebauten Häuser hineindrängten, gingen die Wächter des Nachts, mit Speeren und Äxten bewaffnet. Und nicht selten kam es vor, dass sie an eine Tür klopften, um zum Rechten zu sehen.
Auch in dieser dunklen Nacht schritten zwei Soldaten, von der Burg her kommend, durch die leicht gebogene Hauptstraße, schauten links und rechts in jeden Winkel, ob sie etwas Verdächtiges entdeckten, gingen bis zu dem Platz, von dem aus fünf Straßen sternförmig auseinanderliefen, blieben eine Weile stehen und horchten in alle Richtungen, schritten dann nach Osten weiter, um eine Ecke, und noch eine, und bogen schließlich in ein schmales Gässchen ein.
Die Gasse mündete in einen kleinen Hinterhof, der kaum mehr als doppelt so breit wie die Gasse war. Dort schreckten sie zwei Hunde auf, die sich um den Abfall stritten, der von den Bewohnern auf den Hof geschüttet worden war. Sie erschraken selbst, wollten sich zurückziehen, hörten aber hinter einer verschlossenen Tür auf einmal laute Stimmen. Sie konnten jedoch nichts verstehen.
Sie gingen an den Hunden, die den beiden Soldaten weiter keine Beachtung schenkten, vorbei und traten auf das Haus zu, aus dem die Stimmen kamen.
»Was meinst du«, fragte der eine Soldat den andern, »sollen wir eingreifen? Vielleicht braut sich eine Verschwörung zusammen. «
»Die würden nicht so laut reden, wenn sie etwas Schlimmes im Schilde führten«, meinte der andere, der lieber einer unnötigen Auseinandersetzung aus dem Weg ging.
»Wir sollten doch ... Ich will dann nicht meinen Kopf hinhalten ...«, sagte der erste und hob seine Hand zu einer abweisenden Bewegung, die sein Kamerad wegen der Dunkelheit dieser mondlosen Nacht aber kaum wahrnehmen konnte.
Es war ein Haus wie jedes andere in diesem Viertel. Sie standen eng zusammengebaut, zwei- und dreistöckig. Sie hatten Türen, aber keine Fenster auf die Straße hinaus. Das Tageslicht gelangte über kleine Innenhöfe in die Gebäude. Die Bewohner waren zumeist Handwerker, die im Erdgeschoss neben einem Wohnraum ihre Werkstatt hatten. In den oberen Geschossen befanden sich die Schlafgemächer des Hausherrn und seiner Gattin und jene ihrer Kinder. Hier in diesem Viertel der Stadt hatten die Männer meistens nur eine Frau. Nur Adelige und reiche Bürger, die in einem vornehmeren Stadtteil wohnten, leisteten sich manchmal eine Nebenfrau oder eine Geliebte und Gesinde, das für die Hilfe in Küche und Haushalt benötigt wurde.
Im Haus von Terach ging es an diesem Abend ungewöhnlich laut zu und her, genauer gesagt, in der Werkstatt, die einen eigenen Eingang besaß. Terach hatte seine drei Söhne Abram, Nahor und Haran, die zusammen mit ihrer Stiefmutter Sia und deren Tochter Sarai im Wohnzimmer gesessen hatten, gebeten, mit ihm in die Werkstatt zu gehen. Er wollte mit ihnen allein reden. Da er schon am Tag vorher angedeutet hatte, worum es gehe, hatte er guten Grund anzunehmen, dass es eine hitzige Diskussion geben könnte. Deshalb wollte er seine Frau nicht dabei haben. Sie würde sich doch nur aufregen.
Sie hatten schon eine geraume Weile gestritten, und es war immer lauter geworden. Besonders Haran, der Jüngste, hatte sich kaum mehr beherrschen können.
»Könnt ihr das denn wirklich nicht verstehen?«, fragte Terach. »Mein Vater war ein Nomade. Er hatte Schafe und Ziegen und zog durch das Land, stellte sein Zelt einmal da auf und einmal dort, unter dem freien Himmel, im Schatten einer Tamariske oder unter Dattelpalmen. Am Tag sah man über die grünen Weiden, über die gelben Getreidefelder, sah den Euphrat, hörte sein Rauschen, und des Nachts leuchteten der Mond und die Sterne, und man hörte das Heulen der Wölfe, und am Morgen weckte einen der Gesang der Vögel. Und was sieht man hier? Am Tag nur die Mauern der Häuser rund um einen herum und des Nachts gar nichts. Ein kleines Stück Himmel, wenn’s hoch kommt zwei, drei Sterne und nur eine Ahnung vom Licht des Mondes. Wann habt ihr zum letzten Mal den Mond gesehen? «
»Was brauch ich den Mond zu sehen?«, antwortete Nahor. »Hier in der Stadt sehe ich Menschen, Freunde, da brauch ich den Mond nicht.«
Er schüttelte den Kopf. Wie konnte sein Vater nur auf eine solche Idee kommen. Er hielt ihn für einen Träumer. Warum sollten er und sie, seine Söhne, alles aufgeben, ihr Handwerk, die Sicherheit, die ihnen das Haus und die Stadt boten, tauschen gegen eine ungewisse Zukunft in Zelten, die keinen sicheren Schutz boten vor Unwettern, vor wilden Tieren oder Räubern und Dieben?
»Auch ich habe meine Freunde«, sagte Haran. »Draußen vor der Stadt kennst du niemand. Da bist du allein. Und wenn es regnet und stürmt, soll ich dann tagelang im Zelt sitzen und lauschen, wie der Regen auf das Zeltdach prasselt oder warten, bis das Wasser hereinströmt? Das ist nichts für mich.«
»Doch, Vater, ich verstehe dich«, sagte Abram. »Ich glaube, auch ich habe Nomadenblut in den Adern. Manchmal, wenn ich vor die Stadt hinaus gehe und Schafherden sehe oder die Vögel singen höre, dann wird mir das Leben in der Stadt auch zu eng. Höre ich hier etwa das Gezwitscher der Rohrsänger im Schilf oder gar das Jubilieren einer Nachtigall? Nein, nur ab und zu das gurgelnde Gurren einer Taube. Oder sehe ich frei lebende Tiere außer Ratten und streunenden Hunden? Nein, nur durch die Gassen getriebene Esel mit ihren Lasten oder die Schafe, die auf den Markt zum Schlachten geführt werden. Und vom Mond und den Sternen will ich gar nichts sagen. Noch weniger von der würzigen Luft. Wird euch nicht manchmal übel von dem Gestank in den Gassen?«
Abram war ja noch der größere Träumer als der Vater. Woher nur kannte er die Namen dieser Vögel? Was haben wir denn von ihrem Gezwitscher!? Abram, das mussten seine Brüder zugeben, war der Klügste von ihnen. Er wusste viel. Doch was würde ihm all sein Wissen nützen als nomadisierender Schafhirte? Gegen seine Argumente kamen sie ohnehin nicht auf. Also schwiegen sie lieber.
»Aber sag«, fuhr Abram, als keiner seiner Brüder eine Antwort gab, nach einer kurzen Atempause weiter, »warum hat denn unser Großvater die Zelte verlassen und ist in die Stadt gezogen?«
»Er war alt und des Umherziehens müde. Er kannte einen, der diese Werkstatt besaß. Aber der hatte keinen Sohn, dem er sie hätte übergeben können. Bei ihm lernte ich sein Handwerk. Ich sollte es lernen, damit ich später meinen alten Vater und die Familie ernähren konnte. Als es so weit war und der Besitzer gestorben, zogen wir in das Haus. Ich tat mich schwer. All die Jahre musste ich an die Zeit draußen zurückdenken, an die Freiheit, die Ungebundenheit.«
»Aber warum willst du gerade jetzt dies alles aufgeben und wieder als Nomade herumziehen?«, fragte Haran. »Ich fühle mich wohl in der Stadt.«
Und er schaute Nahor hilfesuchend an mit einem fragenden Blick, der besagen sollte: »Sag doch auch, dass du das nicht willst.«
Nahor verstand ihn. »Auch ich möchte nicht hinaus aus der Stadt«, unterstützte er seinen jüngeren Bruder. Dann wandte er sich an den ältern: »Und du, Abram?«
»Wie ich schon sagte, ich glaube, ich könnte auch draußen leben«, antwortete er. »Die Stadt ist zwar groß, es leben viele Menschen in ihr. Aber manchmal ist sie mir doch auch zu eng. Es müsste schön sein auf den Feldern, mit den Tieren herumzuziehen«, und im fahlen Licht des Öllämpchens nahm Terach einen hellen Glanz in Abrams Augen wahr, wie das Leuchten in den Augen eines Verliebten. Wenigstens einer, der ihn in seinem Plan unterstützte.
»Ich kenne einen, der die Werkstatt übernehmen würde. Er hat eine Herde Schafe und Ziegen und Zelte, die er gegen das Haus tauschen würde«, erklärte Terach und erwartete von seinen Söhnen Zeichen der Zustimmung.
Doch Nahor und Haran, die merkten, dass es ihrem Vater ernst war, wagten nicht mehr, ihm zu widersprechen.
»Wir reden morgen weiter darüber«, sagte Terach, wünschte eine gute Nacht und stieg in den oberen Stock hinauf, wo seine Frau auf ihn wartete.
Die Söhne aber stritten sich noch eine Weile.
Abram war nicht nur der Älteste. In den Augen der Brüder war er auch der Liebling des Vaters. Auch wenn Abram selbst dies nicht so sah. Doch Söhne empfinden es meistens so, während unter Töchtern eher die jüngste als Liebling der Mutter gilt. In Terachs Haus war dies allerdings kein Problem, denn Sarai war die einzige Tochter. Und weil Sia, ihre Mutter, nur die Stiefmutter der Brüder war, akzeptierten diese stillschweigend, dass Sarai von ihr mehr als sie mit Liebe und Zuneigung bedacht wurde.
»Du stehst nie auf unserer Seite«, warf Haran Abram vor. »Du willst dich doch nur bei unserm Vater beliebt machen. Auf uns Jüngere hört er ja nie.«
»Haran hat recht«, sagte Nahor. »Unterstütz doch Vater nicht noch in seinem unsinnigen Vorhaben.«
»Er hört ohnehin nicht auf mich. Wenn er etwas im Sinn hat, dann setzt er es durch, ob wir einverstanden sind oder nicht«, verteidigte sich Abram.
»Dann braucht er uns ja nicht zu fragen«, schrie Haran.
So ging es noch eine ganze Weile hin und her. Sie erkannten schließlich, dass sie sich wenigsten in dem einig waren: Terach würde wohl auch nicht auf Abram hören. Ja, er hört überhaupt auf keinen, nicht einmal auf Sia. Wenn er auszieht, dann fragt er uns nicht. Wir müssen ihm gehorchen.
»Ich will aber nicht«, protestierte Haran laut, als jemand plötzlich wie mit einem harten Gegenstand an die Tür aus massivem, verziertem Holz klopfte, die am Tag wie ein kostbares Schmuckstück in dem eher trostlos lehmgrauen Mauerwerk aussah.
»Aufmachen!«, rief einer mit einer Stimme, der man anhörte, dass es keine andere Wahl gab.
Die drei Brüder verstummten und sahen sich gegenseitig an. Allen stand der Schreck im Gesicht geschrieben. Nahor und Haran wichen einen Schritt zurück.
Abram, der sich als Erster gefasst hatte, ging zur Tür und öffnete sie einen Spalt.
Draußen standen zwei bewaffnete Soldaten. Sie sahen in dem spärlichen Licht, das aus der Werkstatt auf sie fiel, wirklich schreckerregend aus. Finstere, tiefliegende Augen stachen aus ihren fahlen Gesichtern hervor. Beide trugen auf der Brust über dem bis zu den Knien reichenden grobleinenen Rock ein Wams aus Ziegenfell. Einer trug einen Speer, an dessen oberen Ende ein spitzer Stein befestigt war. Der andere hielt eine Axt in der Hand. An den hölzernen Stiel der Axt war kreuzweise mit einem ledernen Riemen ein flacher, scharf zugeschliffener Stein gebunden.
»Wer seid ihr?«, fragte jener mit dem Speer.
»Wir sind Terachs Söhne«, antwortete Abram. »Ich heiße Abram, und das sind meine Brüder Nahor und Haran.« Und er zeigte auf die beiden, die aus Angst kein Wort herausbrachten.
»Warum lärmt ihr so?«, fragte der Soldat weiter.
»Wir haben uns gestritten«, antwortete Abram.
»Worüber?«
»Nur eine kleine Familienangelegenheit«, erwiderte Abram und hoffte, das würde den beiden Soldaten genügen. Der Grund ihres Streits ging niemanden was an.
»Seid ihr allein?«, fragte der andere Soldat, der mit der Axt.
»Vater und Mutter und unsere Schwester sind oben in ihrer Kammer«, sagte Abram.
Die beiden Soldaten drängten Abram zur Seite und traten in den Raum. Sie sahen sich überall um. In der Werkstatt roch es nach Holz. Kleinere und größere Holzstücke lagen herum, halb fertige Hocker und Schemel, und auf einem Gestell standen hölzerne Götterstatuen in verschiedenen Größen. Auf andern Gestellen lagen Werkzeuge aus hartem Zedernholz und Bronze, Schnitzmesser, Schaber, verschiedene zugeschliffene Steine und in Tongefässen feiner Sand, der zum Polieren gebraucht wurde.
Als die Söhne erklärt hatten, dass diese Werkzeuge alle zum Herstellen der Holzgegenstände, vor allem auch für die Götterstatuetten, vor denen die Soldaten kurz ehrfurchtsvoll stehen blieben, benötigt werden, und als die beiden grimmig dreinschauenden Hüter der Ordnung und des Gesetzes sahen, dass keine Waffen hergestellt wurden und dass außer den dreien sonst niemand anwesend war, gaben sie sich zufrieden und zogen sich zurück.
Abram schloss hinter ihnen die Tür.
Alle drei atmeten hörbar erleichtert auf.
»Ich denke, wir sollten uns nun auch schlafen legen«, empfahl Abram.
Als sie sich in ihre Kammer begaben, kam Terach und fragte, wer geklopft habe.
Sie erzählten es ihm.
»Seht ihr«, antwortete Terach, »auch das ist ein Grund, warum ich ausziehen will. Im Zelt kann uns kein ungebetener Gast an die Tür klopfen.«
Am nächsten Morgen ging Terach schon früh hinaus, ohne mit seinen Söhnen gesprochen zu haben. Er schritt mit einem Stecken in der Hand durch das Südtor an den Wachen vorbei. Es war noch früh. Das Tor war eben erst geöffnet worden.
Auf der rechten Seite vor dem Tor war eine gefasste Wasserquelle. Ein paar Stufen führten zu dem Becken hinunter, in dem das Wasser sich sammelte. Um den Brunnen herum standen schon eine Anzahl Männer, einige davon mit Schafen, für die sie Wasser in die Tränkrinne schöpften. Sie alle hatten gewartet, bis das Tor geöffnet wurde, um in die Stadt hineinzugehen und auf dem Markt ihre Waren und Tiere zu verkaufen. Hinter Terach drängten die ersten schon durch das Tor, während andere immer noch ihre Tiere trinken ließen. Je mehr Wasser sie im Bauch hatten, umso mehr Getreide würde es geben, wenn die Tiere gegen das Korn aufgewogen wurden.
Wenn die Händler das Tor passiert haben würden, kämen schon bald die Töchter der Stadt mit ihren Krügen zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Die Wasserkanäle der Stadt, die durch die vornehmeren Viertel gingen, waren nur dazu bestimmt, um die Abwässer und Fäkalien wegzuschwemmen.
Nachdem Terach eine Weile gegangen war, blieb er stehen. Er reckte sich und atmete die frische Morgenluft ein. Wie rein war sie hier im Gegensatz zu der stickigen Luft in der Stadt! Und wie weit schweifte hier der Blick, fast bis in die Unendlichkeit! Die Sonne stand noch nicht weit über dem Horizont. Terach füllte seine Lungen mit der nach würzigen Kräutern duftenden Luft und hob seine Arme seitwärts empor, so dass sein Stecken zum Himmel zeigte. Vor ihm zur Linken wuchsen in einem riesigen Hain Dattelpalmen in den wolkenlosen Himmel, rechts sah er in der weiten Ebene den Euphrat, dessen Lauf sich, hell schimmernd vom Licht der noch tief stehenden Sonne, in der Ferne verlor, und er hörte das Rauschen des Flusses. Er schloss die Augen, als wollte er das, was er gesehen, gehört und gerochen hatte, in sich verschließen, um es ewig in sich zu bewahren und nie zu vergessen.
Als er weiterschritt, flatterten vor ihm Vögel auf vom Weg und aus dem taufrischen Gras. Terach schaute ihnen nach und dachte bei sich, bald werde er so frei sein wie sie.
Er wollte jenen Mann aufsuchen, mit dem er vor einigen Tagen gesprochen hatte. Wenn der nun auf seinen Handel einging, würde er bald nicht mehr in die Stadt, die sich hinter den grauen und abweisenden Mauern verbarg, zurückkehren. Noch hatte jener nicht eingeschlagen. Aber Terach war zuversichtlich. Bald, so die Götter es wollten, würde er sich nicht mehr wie ein gefangenes Tier fühlen. Ihm war jetzt schon, als zerspringe seine Brust. Ein Gefühl von lang ersehnter Freiheit erfüllte ihn.
Als er vor sich die Zelte des Nomaden erkannte, verzögerte er die Schritte. Was würde sein, wenn er nun doch nicht auf seinen Vorschlag einginge? Eine leise, bange Ahnung beschlich ihn. Er wusste nicht, sollte er eilen, um so schnell wie möglich sein Glück ergreifen zu können, oder sollte er seine ihm vielleicht bevorstehende Enttäuschung möglichst lange hinauszögern.
Die Zelte standen inmitten einer kleinen Gruppe von Tamarisken. Terach trat auf das größte zu und rief nach dem Mann. Der trat heraus zu ihm, und sie begrüßten sich wie alte Freunde. Und doch schien Terach, der andere sei nicht gerade erfreut über den Besuch. Er zeigte ein verschlossenes Gesicht, wie einer, der etwas verbergen oder verheimlichen will und einem nicht geradeaus in die Augen zu schauen wagt.
Sie sprachen lange über das Wetter, über den schönen Morgen, den blauen Himmel, die Schafe, über Terachs Söhne, deren ablehnende Haltung dieser jedoch verschwieg. Doch keiner wollte auf den eigentlichen Grund des Besuches eingehen.
»Du bist gekommen wegen deines Vorschlags«, begann nach einer Weile des Schweigens dann doch der Nomade.
Terach nickte zustimmend.
»Hast du es dir überlegt?«, fragte er.
»Ich bin alt und werde bald sterben«, sagte jener. »Dein Vorschlag hat mir eingeleuchtet. Aber dann bin ich in die Stadt hineingegangen. Bis jetzt hatte ich immer einen Bogen um sie gemacht. Zuerst, als ich durch das große Tor kam, hab ich gestaunt. Ich war überwältigt von der Größe der Häuser, von der breiten Straße, von den vielen Menschen. Aber als ich weiter in die Stadt hineinging und in die engen Gassen, da fühlte ich nur noch Beklemmung. Und dann dieser Gestank! Nein, Terach, in dieser Stadt könnte ich nicht leben, und wäre es auch nur um zu sterben. Du weißt, ich habe keinen Sohn mehr, aber ich habe eine Schwiegertochter und Enkeltöchter, die mit ihren Männern bei mir wohnen. Ich könnte ihnen das nicht antun. Ich verstehe dich ja, dass du hinaus willst aus der Stadt. Aber mir erginge es auch so. Und auch meinen Nachkommen. Ich kann sie nicht einsperren in diese Mauern. Wir sind Nomaden, wie dein Vater einer war. Ich habe ihn nie verstehen können.«
Terach stand ihm stumm gegenüber und nickte nur. Er sah, es hätte keinen Sinn, weiter zu verhandeln.
Auf einmal sah die Welt für ihn ganz anders aus. Er fühlte einen heftigen Schmerz in seiner Brust.
»Es tut mir leid«, sagte der andere.
Wieder nickte Terach stumm.
»Leb wohl«, sagte er dann und wandte sich um. Mit schweren Schritten, als wären Steine an seine Füße gebunden, ging er davon.
Er hörte keine Vögel mehr singen. Vielleicht war es zu heiß geworden. Sie hatten sich im Schatten versteckt oder waren zum Fluss gezogen. Auch den hörte er nicht mehr rauschen. Die Brust, die am Morgen noch zu zerspringen drohte, war in sich zusammengefallen. Der Stecken in seiner Hand zeigte nicht mehr nach dem Himmel. Er stieß nur noch auf den harten, trockenen Boden.
Jetzt leuchteten nicht mehr die hellen, sonnenbeschienenen Zelte des Nomaden vor ihm, nur noch die dunklen, drohenden Mauern der Stadt.
Seine Söhne würden sich freuen, vor allem Haran, aber auch Nahor. Nur Abram würde vielleicht seine Enttäuschung teilen.
Er ging langsam auf die Stadt zu wie einer, der eine Todesnachricht überbringen muss.
Wie das große geöffnete Maul eines riesigen Tieres, das ihn zu verschlingen drohte, sah er vor sich das Tor, auf das er zuschritt. Wie ein aus dem Gefängnis Entflohener, der ein wenig die Freiheit geschnuppert hat und dann von den Häschern in seine enge Zelle zurückgeführt wird, fühlte er sich.
Die Wache ließ ihn passieren. Fast wie ein Blinder ging er durch die Menge der Leute hindurch, die Rufe der Händler drangen nicht zu ihm durch, die Handwerker, die unter ihren Türen saßen und ihn grüßten, sah er nicht.
»Was ist mit Terach los?«, dachten jene, die ihn kannten.
Er bog nicht in die Gasse ein, die zu seinem Haus führte. Er ging weiter bis zum Straßenkreuz, ging in eine Schänke und ließ sich einen kleinen Krug Bier bringen. Die Wanderung an der Sonne hatte ihn durstig gemacht. Der trübe Gerstensaft rann kühlend seine Kehle hinunter. Doch als er den bitteren Satz des Bieres, der auf dem Grund des Kruges schwamm, in sich hineinschlürfte, ekelte es ihn, und er spuckte ihn auf den Boden.
Endlich raffte er sich auf, zahlte mit einem Silberplättchen, nahm seinen Stecken und verließ die Schänke.
Vor seinem Haus holte er noch einmal tief Atem, bevor er die Tür zur Werkstatt öffnete und eintrat. Er wollte jetzt nicht in die Wohnung zu Sia gehen. Doch arbeiten mochte er auch nicht. Er saß nur auf seinem Schemel und drehte ein Schnitzmesser in seiner Hand herum.
Seine Söhne hatten, als sie am Morgen in die Werkstatt gegangen waren und ihren Vater nicht bei der Arbeit antrafen, geahnt, was er vorhatte. Sie hatten sich an ihre Plätze gesetzt und zu arbeiten begonnen. Haran hatte noch eine Weile über das Vorhaben seines Vaters gemotzt. Als seine Brüder aber nicht darauf eingegangen waren, verstummte er bald. Bis zum Mittag hatten sie stumm ihre Arbeit verrichtet, bis die Mutter zum Essen rief. Sia war erstaunt, dass Terach nicht da war. Im Wohnraum warteten sie auf ihn.
Endlich hörten sie die Tür zur Werkstatt gehen. Abram stand auf, um ihn zum Essen zu holen.
Als er in die Werkstatt trat, merkte Abram gleich, dass mit seinem Vater etwas nicht in Ordnung war.
»Hast du getrunken?«, fragte er.
»Er hat nicht eingeschlagen«, sagte Terach, ohne aufzublicken.
Abram wusste, was er damit meinte.
»Nimm es nicht so schwer«, tröstete er seinen Vater. »Eines Tages werden wir die Stadt verlassen, und dein Traum geht in Erfüllung.«
»Abram ist ein guter Sohn«, dachte Terach. »Er will mich aufmuntern. Er glaubt an meinen Traum von der Freiheit. Vielleicht ist mein Traum wirklich auch sein Traum.«
»Komm, das Essen ist bereit«, forderte Abram seinen Vater auf.
»Lass mich noch eine Weile. Ich komme nach«, erwiderte Terach.
Abram verließ die Werkstatt und ging über den Hof zum Wohnraum, wo seine Stiefmutter, Sarai und die Brüder beisammensaßen, und berichtete, was er vernommen hatte.
Nahor und vor allem Haran freuten sich.
»Aber zeigt eure Freude nicht unserm Vater«, mahnte Abram, »es würde ihn schmerzen.«
Sia ging hinüber in die Werkstatt zu Terach. Sia war seine zweite Frau. Er hatte sie genommen, nachdem die Mutter seiner drei Söhne gestorben war. Sie war noch jung und schön. Auch Sarai, ihre Tochter, war lieblich anzusehen und stand gerade in dem Alter, wo sie sich wie eine Knospe zur Blume entfaltete.
Sarai und die Söhne warteten im Wohnraum, bis Sia mit Terach zurückkam. Doch keiner wagte, den Vater zu fragen, wo er gewesen sei und was er draußen vor der Stadt gemacht habe. Noch nie waren sie beim Essen so schweigsam gewesen. Bei einem Totenmahl ging es lustiger zu.
Nur als das Essen zu Ende war, sagte Terach:
»So, nun aber alle an die Arbeit!«
So blieb denn Terach mit seinen Angehörigen weiter in der Stadt Ur, hinter den hohen grauen Mauern, die sie wie ein Gefängnis umgaben. Nur seine Gedanken und Sehnsüchte vermochten sie zu übersteigen. Er träumte weiter von der Freiheit eines Nomadenlebens.
Die Sonne verfinstert sich
Haran war froh, dass der Handel seines Vaters mit dem Nomaden nicht zustande gekommen war. Er liebte die zumindest tagsüber vom Leben pulsierende Stadt und hätte sich ein seiner Meinung nach langweiliges Dasein auf dem Land nicht vorstellen können.
»Ich brauche Menschen um mich, nicht Schafe«, hatte er unmissverständlich zu Abram gesagt. Vor seinem Vater Terach aber verheimlichte er seine Freude. Der sprach nicht mehr zu seinen Söhnen über seinen Traum, den er weiter in seiner Brust bewahrte. Eines Tages würde er wohl doch noch in Erfüllung gehen.
Haran war schon immer ein aufgewecktes, fröhliches Kind gewesen. Auch als junger Mann hatte er seine Lebenslust behalten. So oft er sich von der Arbeit in der Werkstatt drücken konnte – es gab nicht immer gleich viel zu tun –, benutzte er die Gelegenheit und ging hinaus unter die Leute, wo er meistens einen Kumpel traf, mit dem er sich dann auf dem Markt oder in Kneipen herumtrieb.
Terach sah dies nicht gern. Vor allem vor den Kneipen hatte er seinen Sohn gewarnt. Denn die wurden meist von lasterhaften Frauen geführt, die über der Kneipe ihren Gästen in separaten Kammern junge Frauen gegen Silber in Form von Plättchen oder Ringen anboten, oft aber auch selber zu bezahlten Liebesdiensten bereit waren. Haran, so fürchtete sein Vater, könnte sich leicht verführen lassen. In seinem jugendlichen Ungestüm hatte er noch zu wenig Lebenserfahrung. Für seine beiden älteren Söhne brauchte er sich hingegen keine Sorgen zu machen.
Abram, der älteste der drei Brüder, war ernster, gewissenhafter. Auch wenn einmal kein Auftrag erledigt werden musste, gab es immer etwas zu tun, aufzuräumen, den Boden zu kehren, das in der Gegend so rare und darum auch teure Holz zu besorgen, Sand vom Euphrat zu holen oder einfach sich Neues auszudenken. Terach schätzte seinen Fleiß. Für seine Brüder war er, als sie noch klein waren, ein Vorbild gewesen, doch als sie älter wurden, ärgerten sie sich manchmal über ihn, der glaubte, die Vaterrolle übernehmen und zum Rechten sehen zu müssen, wenn Terach einmal das Haus verließ. Nur Sarai, seine kleine Schwester, schaute immer noch voll Verwunderung zu dem großen Bruder auf, der so viel wusste und immer bereit war, sie vor den andern Brüdern zu beschützen.
»Abram ist mir am ähnlichsten«, dachte Terach oft. Eigentlich hätte er von Haran am ehesten erwartet, dass er sich für das Nomadenleben begeistern ließe, er, der doch so oft aus der engen Werkstatt ausbrechen wollte. Für ihn war die Werkstatt ein Gefängnis, aber in dem äußeren Gefängnis innerhalb der Stadtmauern fühlte er sich offenbar wohl. Abram hingegen, der fast nie ohne guten Grund aus dem Haus ging, hatte sich von den dreien als Einziger enttäuscht gezeigt. Und wenn Abram auch kaum etwas sagte, so fühlte Terach doch, dass sein Ältester, wie er selbst, davon träumte, einmal aus dieser Engnis auszubrechen. Wenn Abram die Werkstatt verließ, dann nicht nur, um wie Haran durch die Stadt zu streifen. Meistens hatte er draußen eine Aufgabe zu erfüllen. Und das tat er besonders gern. Denn jedes Mal ging er mit ähnlichen überströmenden Gefühlen, wie Terach an jenem Tag, hinaus vor die Mauern, schaute über das Land und den Fluss hinweg in die Weite, bis an den flimmernden Horizont und stellte sich die Welt dahinter vor. Sie steckte doch voller Geheimnisse. Wohin floss der Euphrat? Natürlich ins Meer, das er nur vom Hörensagen kannte. Aber was war hinter dem Meer? Was war hinter den Hügeln und den Bergen? Andere Hügel und Berge? Und dahinter? Ein anderes Meer? Und auch hinter jenem Meer, nichts? Und oben der blaue Himmel mit seinen Wolken. Woher kamen sie? War da auch etwas über dem Himmel, an dem die Gestirne hingen? Fragen über Fragen, über die er so oft nachdachte, die aber ohne Antworten blieben. Und dennoch, Abram fühlte in solchen Augenblicken in sich ein großes Staunen über die Welt und ihre Geheimnisse, das ihn glücklich machte.
Wenn er dann in den Auen des Flusses den feinsten Sand, den er finden konnte, in einen Sack gefüllt hatte, kehrte er, beinahe berauscht von der Luft, die er geatmet hatte, von dem Gesang der Vögel und den Bildern, die er mit seinen wachen Augen aufgenommen hatte, zurück, und das Glück, das er in sich trug, dauerte über Tage fort.
Oft, wenn Terach seinen ältesten Sohn heimlich und mit väterlichem Stolz bei der Arbeit beobachtete, sah er in seinem Gesicht dieses Glück aufleuchten.
Nahor, der Mittlere der drei, war anders, nicht wie Abram, aber auch nicht wie Haran. An Fleiß stand er Abram zwar nicht nach. Er arbeitete am liebsten in der Werkstatt. Abram überließ er gerne seine Ausflüge an den Euphrat. Und dass Haran die Botengänge zu den Kunden so gerne übernahm, enthob Nahor von der unangenehmen Pflicht, sich mit ihnen freundlich zu unterhalten, um sie für spätere Aufträge nicht abgeneigt zu machen. Nahor war verschlossen, dem Herzen seines Vaters von all dessen Söhnen am wenigsten nah. Er gab seine Gedanken nicht preis, und Terach verstand sie nicht aus seinem Gesicht, seinen dunklen Augen zu lesen. Das machte den Vater, der alle seine Kinder gleich liebte, manchmal ein wenig traurig. Früher hatte er gedacht, Nahor habe den Tod seiner Mutter nicht verkraftet. Aber das war nun schon so viele Jahre her, und an Sia, seine Stiefmutter hatte er sich doch gewöhnt. Nein, aus ihm wurde er nicht klug.
Eines Tages kam Haran aufgeregt nach Hause und erzählte, was er erlebt hatte. Er hatte, nachdem er einem Kunden ein kleines Möbelstück abgeliefert hatte – die Götterstatuetten brachte Terach selber den Auftraggebern –, einen Freund getroffen und hatte ihn auf einigen Umwegen begleitet.
»Sin-Aschar hat Herolde ausgesandt«, berichtete er. »Sie sind durch alle Straßen und Gassen gegangen und haben verkündet, dass morgen Mittag die Sonne vom Himmel verschwinden wird. Alles Volk soll sich vor Mittag beim Tempel des Mondgottes Nanna versammeln.«
Nein, Terach und die Brüder hatten noch nichts vernommen, auch Sia und Sarai nicht. Sie alle waren überrascht und wussten nicht, was das zu bedeuten hatte.
Die Erste, die etwas sagte, war Sarai:
»Wird es dann immer Nacht sein, wenn die Sonne verschwindet?«
»Eigentlich verschwindet die Sonne gar nicht. Es ist nur so, dass sich Mond und Sonne am Himmel begegnen«, erklärte Haran, ein wenig stolz, dass er Bescheid wisse, denn er hatte dies auf seinem Streifzug durch die Straßen vernommen. Eine kleine Gruppe von Neugierigen hatte sich um einen alten weisen Mann geschart, der angeblich einen Astrologen kannte und nun seine Kenntnisse vor den Unwissenden ausbreitete. Auch Haran und sein Freund hatten sich unter diese Wissbegierigen gemischt. Aber was bei der Begegnung von Sonne und Mond geschehen würde, wusste der Alte auch nicht.
»Die Astrologen im Tempel haben es vorausgesagt«, fuhr Haran fort, »dass sich morgen die Sonne verfinstert. Ist das nicht großartig, dass sie es vorhersehen können? Wie machen sie das nur? Wären wir nun draußen auf den Feldern, würden wir das nicht erfahren.«
Abram warf ihm einen vorwurfsschweren Blick zu. Das hätte er nun nicht sagen sollen. Doch Terach fühlte sich nicht gekränkt. Ein Lächeln flog über sein Gesicht.
»Die Astrologen sind Priester«, erklärte Terach, »die Götter werden es ihnen im Traum eingegeben haben.«
Haran erzählte weiter, was er auf der Straße gehört hatte. Es gefiel ihm, so im Mittelpunkt zu stehen und mehr zu wissen als seine Brüder.
»Die Priester fordern das Volk auf, morgen zum Tempel des Mondgottes Nanna zu gehen und ihn zu bitten, dass er seinen Sohn, den Sonnengott Schamasch, nicht vom Himmel stürze«, sagte er. »Ich habe mit den Leuten geredet. Sie fürchten sich. Sie meinen, das sei der Weltuntergang. Andere sagen, auch wenn Nanna den Schamasch nicht vom Himmel stoße, so sei sein Zorn auf ihn doch so groß, dass er das Land mit Kriegen und Überschwemmungen oder einer Hungersnot überziehe.«
»Was glaubst du«, fragte Nahor seinen Vater, »haben wir Grund, uns zu fürchten?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Terach. »Ich habe noch nie erlebt, dass die Sonne verschwindet. Aber mein Vater hat erzählt, dass das früher schon geschehen ist und dass dann immer etwas Schlimmes passierte, ein Krieg oder eine Seuche oder Hungersnot.«
»Warum sollten die Götter uns Menschen strafen, wenn sie Streit unter sich selbst haben. Und Krieg hat es schon zu allen Zeiten gegeben«, sagte Abram, »auch ohne dass die Sonne vom Himmel verschwunden ist. Vor sieben Jahren hat Rim-Sin, wie er behauptet, mit der Hilfe der Götter Anu und Enlil die Königsstadt Isin erobert. Da hat sich die Sonne auch nicht verfinstert, obwohl Schamasch allen Grund gehabt hätte, sein Gesicht zu verhüllen. Und erleben wir nicht alle paar Jahre, dass der Euphrat das Land überschwemmt?«
»Aber unheimlich ist es doch. Vielleicht wollen Schamasch und der Mondgott Nanna uns damit etwas kundtun«, meinte Nahor. Doch was Abram gesagt hatte, leuchtete ihm ein. Abram wusste doch immer eine Erklärung oder einen Rat, was zu tun sei, wenn die andern nicht weiter wussten. Er bewunderte deshalb seinen großen Bruder.
Haran hingegen ärgerte sich über Abrams weises Gerede. Immer glaubte der, alles besser zu wissen.
Am meisten Angst hatte Sarai. Sie schmiegte sich fest an ihre Mutter. Hoffentlich hatte ihr großer Bruder, den sie so sehr bewunderte recht. Doch so richtig glauben konnte sie ihm noch nicht.
Sie sprachen auch nach dem Essen noch lange über das bevorstehende Ereignis, bis Sia fand, es sei nun genug geredet, sie sollten sich schlafen legen.
Aber alle waren sich einig, dass sie am nächsten Tag zum Tempel des Nanna gehen würden, um mit dem Volk zu beten und das unvorstellbare Geschehen zu erwarten.
Die drei Brüder schliefen lange nicht. Es waren so viele Fragen, auf die es keine Antworten gab. Nur eines wussten sie: Etwas Unheimliches stand bevor, das sie noch nie erlebt hatten. Sollte tatsächlich gar die Welt untergehen?
Abram beschwichtigte: »Ihr habt doch gehört, was Vater gesagt hat. Das ist auch schon in früherer Zeit geschehen, und die Welt ist nicht untergegangen.«
»Aber die Leute fürchten sich«, flüsterte Haran, um die Eltern im Nebenzimmer nicht zu wecken, die wohl schon schliefen.
»Am meisten werden sich Rim-Sin, der König, und sein Statthalter fürchten«, vermutete Nahor. »Sie wissen, dass das Volk sie nicht liebt. Sie sind Fremde, keine von uns. Vielleicht deutet das Himmelszeichen den Sturz von Rim-Sin an.«
»Wer sollte ihn stürzen?«, fragte Abram. »Wir sind nicht stark genug. Wir haben keine Waffen. Fremde Mächte müssten uns helfen. Doch was hätten wir davon? Die Hethiter oder die Babylonier oder wer es auch sein würde, wären nicht besser als Rim-Sin und sein Statthalter.«
Als das Gespräch endlich verstummte, konnten sie immer noch nicht schlafen. Abram hörte, wie Haran und Nahor sich auf ihrem Lager drehten und wendeten und wie der Strohsack, auf dem sie lagen, raschelte.
Ab und zu fragte einer seine Brüder leise: »Schlaft ihr schon.« Doch niemand gab Antwort, aber jeder wusste, dass die andern noch wach waren.
Auch Abram ging alles im Kopf herum, was er gehört hatte. Was hatte das zu bedeuten? Zürnten die Götter vielleicht doch? Was hatten sie mit den Menschen vor? Ach, sie waren so weit weg, diese Götter. Zwar gab es Statuen von ihnen in den Tempeln. Doch das gemeine Volk, zu dem auch er gehörte, hatte keinen Zutritt zu ihnen. Aber die Statuen im Tempel waren ja auch nur Abbilder der Götter, genauso wie die kleinen Statuen, die er mit seinem Vater und den Brüdern herstellte. Wer kennt schon die Götter? Wer weiß, wo sie sind? Wer sind sie überhaupt? Hat sie schon je einer gesehen?
Nahor war der erste der drei Brüder, der Schlaf fand. Haran war noch zu aufgewühlt. Das würde ein Ereignis werden morgen, wenn das Volk zum Tempel strömt! Widerstrebende Gefühle kämpften in seiner Brust. Halb bangte ihm vor dem morgigen Tag, halb freute er sich in Erwartung dessen, was kommen würde. Wie würde es sein, wenn die Sonne verschwand, nein, sich nur verfinsterte? Was würde danach sein? Wäre das Leben noch wie zuvor? Was würde über Ur, seine geliebte Stadt, hereinbrechen? Unter all den Menschen und in den Mauern der Stadt aber würde er sich sicher fühlen. Wie froh war er, dass er das ganze Geschehen nicht draußen, irgendwo auf dem Feld oder in der Wüste erleben müsste. Ein Schauer durchfuhr seinen Körper, als er sich vorstellte, wie er, ohne darauf vorbereitet zu sein, plötzlich sähe, wie die Sonne vom Himmel verschwindet. Er würde glauben, die Welt gehe unter. Aber ganz wohl war ihm auch jetzt nicht, obschon...
Und schließlich übermannte ihn doch der Schlaf. Aber schreckliche, angstvolle Träume verfolgten ihn. Einmal stand er am Ufer des Euphrats. Der Himmel hatte sich verfinstert. Die Sonne war verschwunden. Der Fluss stieg höher und höher. Er wollte wegrennen, aber seine Füße waren wie angewachsen am Boden. Das Wasser überflutete das Ufer und stieg an seinen Beinen hoch über die Knöchel, dann bis zu den Knien. Endlich konnte er sich bewegen. Er wollte dem Wasser entfliehen. Aber er fiel um, und der Strom riss ihn mit. Er konnte nicht schwimmen. Die Wellen schlugen über ihm zusammen. Und er erwachte mit einem Schrei.
Hatte er wirklich geschrien? Seine Brüder schienen zu schlafen. Sie hatten nichts gehört. Wieder wälzte er sich lange hin und her, bis er endlich ruhig einschlummerte.
Am nächsten Morgen sprach niemand im Haus von dem Ereignis. Keiner wollte den Anschein erwecken, dass er sich vor dem kommenden Unbekannten fürchte. Es wollte aber auch sonst kein Gespräch in Gang kommen.
Terach hantierte in der Werkstatt. Es war aber keine eigentliche Arbeit, die er verrichtete. Er nahm ein Werkzeug von einer Stelle weg, betrachtete es, wendete es hin und her, rieb mit einem Finger daran, als wäre es schmutzig oder als prüfe er, ob es stumpf sei und er den Stein schon wieder schleifen müsse, und legte es wieder zurück. Seine Söhne erschienen auch nicht zur Arbeit. Haran und Nahor liefen zusammen aus dem Haus. Terach rief ihnen nach, sie möchten bald zurückkehren und nicht schon zum Tempel gehen.
Abram saß bei Sarai und seiner Stiefmutter.
Sarai machte einen ängstlichen Eindruck.
»Es wird schon nichts geschehen«, munterte Abram sie auf.
Er wünschte, er könnte Sarai die Angst nehmen. Er mochte seine kleine Schwester. Obwohl er der älteste der Brüder war und sie zehn Jahre jünger als er, hatten sie sich immer gut verstanden. Ohne es sich eigentlich bewusst zu sein, hatte er stets die Beschützerrolle übernommen. Und Sarai bewunderte ihn, weil er der Vernünftigste unter den Brüdern war. Er hatte sie nie ausgelacht wie die andern, als sie noch klein war, oder, wenn sie geweint hatte, noch mehr gereizt und sie dann wegen ihres lauten Geschreis verspottet.
Nahor und Haran gingen durch die Stadt. Überall standen Leute in kleinen Gruppen herum. Die Sonne hatte sich bereits über die Mauern der Stadt erhoben und schickte wie immer ihr strahlendes Licht vom wolkenlosen, blauen Himmel herab und warf ihre Schatten in die engen Gassen.
Niemand konnte sich vorstellen, dass dies bald nicht mehr so sein würde. Und nichts deutete auf das bevorstehende Ereignis hin.
Als die Zeit allmählich herankam, da sie zum Tempel aufbrechen sollten, schickte Terach Abram auf die Straße, um zu sehen, wo seine Brüder blieben und ob die andern Leute schon zum Gott Nanna unterwegs seien.
Abram verließ das Haus und ging über den kleinen Hof und durch das verwinkelte enge Gässchen bis zur großen Straße. Es strömten schon viele dem Tempel zu. Hatten sich Nahor und Haran ihnen angeschlossen? Der Vater hatte doch gesagt, dass sie vorher zurückkehren sollten.
Da sah er sie, wie sie sich eilig durch den bereits fließenden Menschenstrom drängten und auf ihn zukamen.
»Kommt! Beeilt euch!«, riefen sie. »Die Leute sind schon alle unterwegs zum Tempel.«
Abram lief zurück ins Haus und rief Vater und Mutter.
»Wo sind deine Brüder?«, fragte Terach, ängstlich und zugleich verärgert.
»Sie warten bei der Straße vorn«, antwortete Abram.
Terach trat nun mit Sia, Abram und Sarai aus dem Haus. Er tadelte Haran und Nahor, weil sie so lange ausgeblieben waren.
Terach schritt mit Sia voraus. Abram ging beschützend an Sarais Seite. Hinter ihnen kamen, ein wenig beschämt wegen des Tadels, Abrams jüngere Brüder.
Es war ein weiter Weg durch die Stadt bis zum Tempel. Sie ließen sich von dem Menschenstrom mittreiben bis auf den großen Tempelplatz, der von den Häusern der Priester und Tempeldiener umrahmt war. Hoch erhoben sich die Mauern des aus gebrannten Lehmziegeln erbauten Tempels stufenförmig zum Himmel empor.
Eine lange Treppe führte von vorne über eine kleine, vorgelagerte Terrasse hinweg zu einem Tor, einem eckigen Vorbau der Grundmauer. Auch von links und rechts ging je eine Treppe mit über siebzig Stufen zu einem Tor in diesem Vorbau. Kam man durch eines der drei Tore, so konnte man auf einer kleinen Treppe noch weiter zur ersten Terrasse hinaufsteigen, die rund um eine weitere, quadratisch auf die Terrasse aufgebaute Mauer lief. Auf der linken und der rechten Seite waren wieder kleine Vorbauten, durch deren Tore die Eingeweihten in verschiedene Tempelräume eintreten konnten. Von dieser ersten großen Terrasse ging nur noch eine einzige Treppe mit vierzig Stufen zu einer zweiten Terrasse, von der aus man wieder über eine Treppe mit dreißig Stufen zu einer dritten gelangte, in deren Mitte der hohe, viereckige Hochtempel aufgebaut war. Ein schmales, hohes Tor mit rundem Bogen führte in diesen fensterlosen Tempel hinein.
Von der alten Königsburg, in der jetzt Sin-Aschar, der Statthalter Rim-Sins, residierte, bis zur mittleren Treppe des Tempels hatten mit Speeren bewaffnete Soldaten, die ähnlich aussahen wie jene, die bei Abram und seinen Brüdern angeklopft hatten, eine Gasse gebildet, durch die der Vizekönig mit seinen Hofleuten zum Tempel schreiten würde.
Vor den Treppen auf der linken und der rechten Seite standen ebenfalls bewaffnete Soldaten und sorgten für Ordnung. Denn das Volk strömte herbei zu den seitlichen Treppen. Viele brachten eine Opfergabe, die bei den ersten Stufen von den Tempeldienern in Empfang genommen wurden. Auch Terach hatte ein Krüglein mit Öl abgegeben.
Der Platz vor dem Tempel füllte sich immer mehr. Es mussten Zehntausende sein. Man stand dicht nebeneinander. Die zuletzt Gekommenen mussten sich, oft unter Murren und anderen Missfallensäußerungen, durchdrängen, um ihre Opfergabe bei den Treppen abgeben zu können. Die Tempeldiener trugen diese Gaben, Bier, Brote, Honig, Sesamsamen oder Öl, die Treppen hinauf bis zur ersten Terrasse. Dort wurden sie den Priestern übergeben, die sie über die zweite Terrasse bis zur dritten hinauftrugen. Es war ein faszinierendes Schauspiel, das auch Abrams Familie staunend beobachtete, wie die unzähligen Tempeldiener und Priester in ihren festlichen Gewändern mit den Opfergaben in langer Reihe die Treppen hochstiegen, dann wieder herunterkamen, um neue Opfergaben heraufzuholen. Auf der obersten Terrasse wurden die Opfergaben von den Hohepriestern in Empfang genommen und in das Innere des Hochtempels gebracht, wo sie die Speiseopfer auf Tische legten und die Trankopfer in große Gefäße schütteten. Der Erste Hohepriester nahm das Feuer, das zwei andere Priester entfacht hatten, entgegen, ging damit in den Hochtempel hinein und entzündete in einer Schale das Harz einer Zeder, hob die Hände vor der goldenen Statue des Gottes Nanna empor und lud ihn zum Opfermahl, das ihn versöhnlich stimmen sollte, damit er das Unheil von der Stadt und vom ganzen Land abwende.
Diese Zeremonie war natürlich dem gemeinen Volk verborgen. Nur die Hohepriester auf der dritten Terrasse, die vor dem offenen Tor standen, konnten den Ersten Hohepriester bei diesem kultischen Ritual beobachten.
Alle Blicke waren auf den Tempel gerichtet. Von hier unten, wenn man nicht zu nahe stand, was aber durch die Soldaten ohnehin verhindert wurde, sah man bis hinauf zum eigentlichen Tempel, dem Hochtempel, in dem der Mondgott Nanna thronte. Nachdem alle ihre Opfergaben abgegeben hatten, verteilten sich die Priester in ihren weißen Gewändern auf den Terrassen. Die meisten stellten sich auf der ersten Terrasse hinter der Brüstung auf. Einige blieben auf der zweiten und verteilten sich dort hinter der Mauer. Nur ihre Oberkörper ragten über die Brüstung hinaus. Auf der dritten Terrasse stellten sich die Hohepriester auf, mit dem Rücken zum Volk, das Gesicht zum Tor des Hochtempels gewandt.
Nur der Erste Hohepriester des Nanna blieb während der ganzen Zeit im Sakralraum des Heiligtums.
Unten vor dem Tempel wurden nun keine neuen Opfergaben mehr angenommen. Der Weg wurde freigemacht für den Statthalter des Königs.
Sin-Aschar, begleitet von Wächtern und Hofleuten, trat nun unter dumpfem Trommelklang in vollem Ornat und mit der spitzen Haubenkrone auf dem Haupt, die ihn als Stellvertreter des Königs auswies, aus dem Burgtor heraus. Würdevoll schritt er durch die von den spalierstehenden Soldaten gebildete Gasse bis zur mittleren Treppe des Tempels. Die Wächter und Hofleute blieben unten an der Treppe zurück. Sin-Aschar aber schritt majestätisch die Treppe empor, hinter ihm zwei Trommler. Diese blieben auf dem Vorbau bei der ersten Terrasse zurück. Nur der eintönige Trommelklang begleitete ihn bis hinauf zu der obersten Terrasse vor dem Hochtempel. In diesem Augenblick, als Sin-Aschar die Terrasse erreichte und die Hohepriester ihn in ihre Mitte nahmen, verstummten die Trommeln.
Sin-Aschar schaute hinunter auf das Volk. Als er die Menge mit erhobenen Händen grüßte, gingen alle auf Knie, bis er seine Arme senkte. Dann drehte er sich um und wandte wie die Hohepriester sein Gesicht dem Hochtempel zu.
Haran hatte in der Menge eine junge Frau bemerkt, die er schon öfter gesehen hatte und die ihn mit ihrer Schönheit bezauberte. Beinahe vergaß er, warum er hier vor dem Tempel stand, als er sah, dass die junge Frau mit ihrer Familie, nachdem auch sie ihre Opfergaben abgegeben hatten, in seine Nähe kam. Jetzt stand sie neben ihm. Sein Herz klopfte nun noch heftiger, als es schon wegen des bevorstehenden Ereignisses tat. Er glaubte es zu hören, so stark war seine Erregung. Wenn sie mit ihren Leuten nur nicht weiterging, wünschte er sich.
Haran schaute sie an, und als sie bemerkte, dass sein Blick auf ihr ruhte, lächelte sie. Er grüßte sie und war glücklich, als er sah, dass sie ihren Vater am Arm fasste und ihn zurückhielt, als er weitergehen wollte. Nun stand sie ganz nahe bei ihm. Die Götter hatten seinen Wunsch erfüllt. Er tat einen Schritt zur Seite und flüsterte ihr zu:
»Ich hab dich schon oft gesehen. Du bist schön. Wie heißt du?«
»Mein Name ist Lea«, antwortete sie und errötete.
»Ich heiße Haran.«
»Ein schöner Name«, erwiderte Lea.
Sie hatte eine weiche, fast singende Stimme. Hätte er sich nicht schon wegen ihrer schönen Gestalt und ihres hübschen Gesichts in sie verliebt, so würde ganz sicher diese süße, verführerische Stimme ihn dazu bewegen.
Haran und Leas Angehörige standen stumm und starrten auf den Tempel und bemerkten nicht, dass die beiden einen Schritt zurückgewichen waren und andere Neugierige und Fromme, die zum Gott beten wollten, sich zwischen sie und ihre Eltern und Geschwister gedrängt hatten.
Niemand wagte laut zu reden. Die Stimmen der vielen tausend Menschen vermischten sich zu einem Summen und Brummen, das wie ein andauerndes fernes Donnergrollen hinauf zu den Priestern auf den Zinnen drang.
Endlich gab ein Priester auf der obersten Terrasse ein Zeichen. Daraufhin ertönten wieder dumpfe Trommelschläge von der kleinen vorgelagerten Terrasse herab. Die Menge wurde still. Auch Haran schwieg. Er hatte bereits herausbekommen, wo Lea wohnte und wer ihre Eltern waren. Und mit Befriedigung hatte er festgestellt, dass Lea selbst nicht abgeneigt schien, ihn näher kennen zu lernen.
Die Trommelklänge schwollen an und wurden wieder leiser. Eine unheimliche Beklemmung bemächtigte sich der Menschen.
Plötzlich verstummten die Trommeln.
Die Priester auf allen drei Terrassen, dicht nebeneinanderstehend, erhoben die Hände betend zum Himmel. Das Volk sah nur ihre Rücken. Auch in der Menge begannen nun einige, dann immer mehr, am Ende alle, ihre Hände zu erheben. Ein Murmeln ging durch die Menge, das wie das Brausen des Meeres anschwoll und wieder verebbte und wieder anschwoll, unaufhörlich, bis irgendwo in der Menge der Ruf erschallte: »Die Sonne verschwindet.«
Alle Blicke waren zum Himmel gerichtet. Doch wegen des blendenden Lichts konnte niemand genau sehen, was vor sich ging. Einige hielten sich Tücher vor die Augen und konnten so erkennen, dass ein Schatten über die Sonnenscheibe heraufzog.
Es war auf einmal totenstill geworden in der Menge. Es war, als breche bereits um diese Mittagsstunde die Abenddämmerung herein. Selbst die Vögel, die gerade noch herumgeflattert waren, hatten sich auf die Äste der Bäume, die den weiten Platz umgaben, gesetzt, versteckten sich zwischen den Blättern und hörten auf mit ihrem sonst so fröhlichen Gesang. Als der letzte kleine Strahl der Sonne verschwunden war, wurde es düster. Es war, als hielte die ganze Welt den Atem an.
Alle Blicke waren nun zum Himmel gerichtet, dorthin, wo gerade noch der letzte Strahl der Sonne geleuchtet hatte. Jetzt aber war nichts mehr zu sehen. Die Menschen schwiegen, das leiseste Flüstern war verstummt.
Haran hatte unwillkürlich nach Leas schmaler Hand gegriffen und hielt sie fest. Lea hatte nicht versucht, sie zurückzuziehen.
Auch Sarai klammerte sich an ihre Mutter. Selbst Terach hatte seine Arme um Abrams und Nahors Schultern gelegt und zog die beiden Söhne an sich heran.
Doch plötzlich leuchtete wieder ein Strahl auf.
Die lautlose Stille wurde von dem Gezwitscher der Vögel unterbrochen, die als Erste von dem Fortgang des Lebens Kunde gaben. Klang ihr Gesang so laut, weil sie das Versäumte nachzuholen schienen, oder war es, weil die Menschen ihren Gesang noch nie so bewusst und in dieser jubilierenden Fröhlichkeit wahrgenommen hatten wie in diesem Augenblick?
Und da ging auch durch die Menge ein hörbares Aufatmen, das allmählich in Jubel überging. Und immer größer und stärker wurde das Licht, so dass man nicht mehr hinschauen konnte, ohne geblendet zu werden.
Und dann war es wieder so hell wie zuvor, und die Welt war nicht untergegangen. Die Stadt Ur und ihre Bewohner lebten weiter. Wieder reckten sich Hände zum Himmel, diesmal zum Dankgebet für Schamasch, den Sonnengott, der gestorben und wiedergeboren war, und für Nanna, der seinen Sohn nicht vom Firmament hinab in die Unterwelt gestoßen hatte.
Und nun ertönten wieder die Trommeln, nicht mehr so dumpf wie vorher. Unter ihrem hellen Klang schritt Sin-Aschar die Treppen herab. Bei der untersten Treppe schlossen sich die Trommler an und stiegen fünf Stufen hinter ihm hinunter. Der Statthalter und seine Beamten gingen gemessenen Schrittes durch die spalierstehenden Soldaten über den Platz. Auf einmal ertönte der Ruf:
»Lang lebe Sin-Aschar!«, und noch einmal: »Lang lebe Sin-Aschar!«
Zögernd stimmte das Volk mit ein.
Keiner wollte den Eindruck erwecken, ein Gegner des Vizekönigs zu sein. Man wusste ja nicht, ob der unbekannte Nachbar nicht ein Spitzel war.
Als sich das Tor der Burg hinter dem Statthalter des Königs verschloss und die Trommeln verstummt waren, verlief sich allmählich die Menge.
Manche standen noch in kleinen Gruppen beisammen. Was würde nun geschehen? War wirklich alles vorbei und wieder so wie zuvor, oder war dies der Anfang einer neuen, schrecklichen Zeit?
Haran und Lea hatten sich losgelassen. Freudig stellte Haran fest, dass sein Vater Terach mit Leas Vater redete. Die beiden schienen sich zu kennen. Es stellte sich heraus, dass sie schon geschäftlich miteinander zu tun gehabt hatten. Sanherib, so hieß Leas Vater, hatte bei jeder Geburt seiner vier Kinder bei Terach eine kleine Götterstatue in Auftrag gegeben, die als persönlicher Gott das kleine Kind schützen und ihm später als Mittler zu Marduk, Schamasch oder den anderen höheren Gottheiten dienen sollte.
Eine kurze Strecke gingen die beiden Familien nebeneinander her, bis sich ihre Wege trennten. Haran hob nur seine Hand zum Abschied und setzte ein Gesicht auf, das seinen ganzen Trennungsschmerz, aber zugleich auch seine Hoffnung auf ein Wiedersehen zum Ausdruck bringen sollte. Und Lea warf ihm einen verliebten Blick zu, der ihm alles Glück verhieß.
Noch am Abend desselben Tages nahm Haran seinen Vater beiseite.
»Ich möchte mit dir etwas besprechen«, sagte er geheimnisvoll. Seine Brüder sollten nichts davon hören.
Sie gingen hinüber in die Werkstatt.
Haran wusste nicht, wie er beginnen sollte.
»Was hast du auf dem Herzen?«, fragte Terach seinen Sohn, als er sah, dass dieser sich herumdrückte und keine Worte fand.
»Ich möchte mir eine Frau nehmen«, begann Haran. »Ich bin nun alt genug.«
»Aber deine beiden Brüder sind älter als du und haben noch keine Frau«, erwiderte Terach.
»Das ist ihre eigene Schuld«, sagte Haran. »Sie kennen ja kaum jemand. Wenn sie mehr in die Stadt gehen würden, hätten sie auch mehr Gelegenheit, eine Frau zu finden.«
»Hast du denn deine schon gefunden?«, fragte Terach.
»Ich glaube schon«, antwortete Haran. »Es ist Lea, die Tochter deines Bekannten, den du heute auf dem Tempelplatz getroffen hast.«
Vielleicht wäre es gut, wenn sein Sohn sich eine Frau nähme, dachte Terach. Es könnte sein, dass er dann ein wenig ruhiger und verantwortungsvoller wird und nicht mehr so viel mit seinen Kumpeln in der Stadt herumstreicht.
Ein wenig fühlte sich Terach beschämt, weil er sich nicht selber schon für seine Söhne nach Frauen umgesehen hatte, wie das viele andere Väter üblicherweise taten. Doch er meinte, sie wären alt genug, um sich eine Frau zu suchen, wenn sie die Zeit dazu für gekommen hielten.
»Gut, ich werde mit Leas Vater verhandeln«, sagte er. »Wenn er bereit ist, sie dir zu geben, so soll es sein.«
Haran fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das hatte er, seit er ein Kind war, nie mehr getan.
Ein paar Tage später war Terach ausgegangen, ohne jemandem zu sagen, wohin. Er blieb länger weg als gewöhnlich, wenn er eine Götterstatue einem Kunden brachte. Als er endlich zurückkehrte, teilte er seinem Sohn mit, er sei bei Sanherib gewesen. Der erwarte, dass er am nächsten Tag noch einmal mit seinem Sohn vorbeikomme, damit man auch ihn kennen lerne und man, wenn er, Sanherib, ihn für würdig befinde und Lea auch einverstanden sei, einen Ehevertrag aushandeln könne.
Haran ging am Nachmittag des nächsten Tages mit seinem Vater zu Sanheribs Haus. Das Klopfen seines Herzens war fast so laut wie Terachs Klopfen an der Tür.
Ein Diener öffnete, bat die beiden Männer mit einer untertänigen Handbewegung herein und führte sie in den Wohnraum, wo Leas Eltern auf sie warteten.
»Du möchtest also meine Tochter Lea zur Frau nehmen«, begann Sanherib, nachdem sie sich ausgiebig begrüßt und sich dann in einer Ecke auf den Boden gesetzt hatten. »Ich kenne deinen Vater als einen ehrbaren Mann. Er hat mir gesagt, dass du in seiner Werkstatt arbeitest und in der Lage bist, eine Frau zu ernähren.«
»Ich kann dir, ehrenwerter Sanherib, versprechen, deiner Tochter Lea ein guter Ehemann zu sein. Ich werde sie lieben und beschützen.«
»Nach dem Besuch deines Vaters hat auch Lea mir versichert, dass sie deine Frau werden möchte.« Und zu seiner Frau sagte er, sie möchte jetzt Lea hereinholen, damit Haran und Lea ihr Eheversprechen vor beiden Vätern bestätigen sollten.
Lea trat mit gesenktem Blick vor ihren und Harans Vater, die sich beide, wie auch Haran, erhoben hatten. Heimlich warf sie Haran mit einem zwinkernden Auge einen Blick zu, ohne den Kopf zu heben.
Nachdem sie bekräftigt hatten, einander zu lieben und treu zu sein und Lea wieder in ihr Zimmer geschickt worden war, setzten sich die Männer wieder, und die beiden Väter begannen über die Mitgift zu verhandeln, während Leas Mutter hinausging, um Früchte zu holen, die sie in einer Schale neben den Männern auf den Boden stellte. Dann zog auch sie sich zurück.
Alles, was die beiden Väter vereinbart und mit einem Handschlag bekräftigt hatten, sollte bald bei einem Notar in einen Ehevertrag gefasst und beurkundet werden.
Nun griffen die drei Männer zu den Früchten. Eine Weile redeten sie noch miteinander und Haran beantwortete höflich die Fragen seines zukünftigen Schwiegervaters.