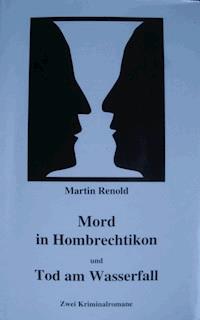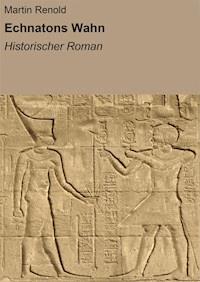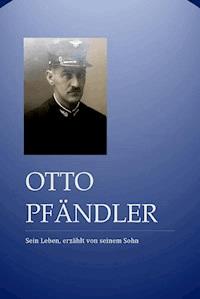Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Angelo ist ein Jugend- und Entwicklungsroman für Erwachsene und die reifere Jugend. Der Schweizer Autor hat den ersten Teil dieser berührenden Geschichte kurz nach dem Krieg geschrieben, als er bei seinen häufigen Aufenthalten in Rom die Straßenkinder sah, die bei der Straßenbahn oft zu dritt oder viert hinten auf der Kupplung saßen oder standen und irgendwo in einem Schlupfwinkel hausten. Unter dem Eindruck dieses Elends schrieb er die Geschichte des kleinen Angelo, der mit seinen beiden Freunden Mario und Lorenzo aus dem Waisenhaus entflieht. Wir begleiten Angelo in seine Höhle, auf seine Streifzüge in Rom, werden Zeugen einer innigen Freundschaft und sind glücklich mit Angelo, wenn er auf der Spanischen Treppe seine "Mamma" findet, eine junge Frau, die den auf den Tod kranken Jungen ins Krankenhaus bringt und ihn, nachdem er wieder gesund ist, zu sich nach Hause nimmt. Im zweiten Teil, den der Autor Jahre später schrieb, erleben wir, wie Angelo die Schule besucht, mit Margherita, seiner "Mamma", die Sommerferien am Meer verbringt und in einer Kirche den lieben Gott zu sehen glaubt. Doch es ist ein Mönch, der nun Angelos musikalisches Talent fördert. Enrico, der Opernsäger wird zum Freund des heranwachsenden Jungen wie auch der alte Kupferstecher Filippo, der Angelo seine Geige schenkt. Nun ist aus dem liebenswürdigen Straßenjungen ein talentierter junger Mann und bekannter Geiger geworden. Der Autor schildert mit viel Einfühlungsvermögen und leisem Humor die Entwicklung des verwahrlosten Strassenjungen zum sympathischen rechtschaffenen Mann. Wer Rom und die Kinder liebt, sollte auch dieses entzückende Buch lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Renold
Angelo
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
ERSTER TEIL
Im Waisenhaus
Die Flucht
Endlich in Freiheit
Die Höhle
Wer kann besser zählen?
Angelo hat einen neuen Freund.
Mario weiß, wie man zu Geld kommt.
Angelo lernt lesen.
Kommt der Frühling bald?
Eine Mutter
Im Petersdom
Ein arbeitsfreier Tag
Der Papst, der liebe Gott und die Polizei
Was geschah mit Lorenzo?
Das Mädchen auf der Spanischen Treppe
Was Angelo in der Kirche des heiligen Paulus erlebt.
Das seidene Tuch
Angelo begegnet dem lieben Gott.
Angelo ist krank.
Mario holt Hilfe.
ZWEITER TEIL
Im Spital
Endlich daheim
Angelo gerät in Bedrängnis.
Angelo, das Meer und die Feinde
Bei Giuseppe daheim
Mario und Lorenzo besuchen Angelo und seine Freunde.
Angelo geht zur Schule.
Angelo geht zum lieben Gott.
Filippo und seine Mäuschen
Ein seltenes Weihnachtsgeschenk
Viele neue Freunde
Rico Vitale, der Opernsänger
Filippos Geige
Angelo ist erwachsen.
Impressum neobooks
ERSTER TEIL
Er hieß Angelo.
Wer ihm diesen Namen gegeben hatte, und warum er so hieß, wusste er nicht. Aber er kümmerte sich nicht darum, fragte nicht danach. Solange er sich erinnerte, hatten ihn seine Kameraden so genannt, und er war stolz darauf; denn Angelo war der schönste Name, den er sich denken konnte.
Aber es gab noch vieles, das der kleine Angelo nicht wusste, vieles, was andere Kinder in diesem Alter sonst wissen, ausgenommen seine Kameraden, die mit ihm aufwuchsen. So wusste Angelo nicht, wer sein Vater und auch nicht, wer seine Mutter war. Er hatte beide nicht gekannt. Ja nicht genug: Seinem kindlichen Verstand war es lange gar nicht bewusst gewesen, dass Kinder wie er sonst eine Mutter und einen Vater haben. Doch auch später, als er davon wusste, glaubte er, es sei ein besonderes Vorrecht, oder vielleicht auch ein Nachteil, Vater und Mutter zu haben, ein Vorrecht, das manche Kinder besitzen und manche, wie er und seine Kameraden, nicht. Vielleicht aber, und das war gewiss nicht ausgeschlossen, würde auch er einmal einen Vater und eine Mutter bekommen. Seine dunklen Augen konnten strahlen, sie waren voller Liebe, wenn er so dachte. Und sein Mund konnte sich zu einem schelmischen Lächeln verziehen, wenn er so siegesbewusst auf die Erfüllung seiner heimlichen Sehnsucht hoffte.
Ja, Angelo hatte entbehren müssen, was gewöhnlichen Kindern sonst zur nächsten Umgebung gehört, sind doch das liebevoll lächelnde Gesicht der Mutter und das glücklich freundliche Antlitz des Vaters den Augen eines Kindes das Vertrauteste von der Zeit an, da sie als Formen erkennen, was ihnen zuvor ein buntes Gewirr von Licht und Farben war. Angelo wusste nichts davon. Die ganze Vergangenheit seiner kleinen, aber doch so wichtigen Person war gleich schwarz und undurchsichtig wie die dunkle Nacht. Und wer hätte sie ihm erhellen können? Es wusste ja niemand mehr über ihn als er selber. Ist es da verwunderlich, dass ihm der Ort, wo er zur Welt kam, unbekannt war? Wahrscheinlich war dieser Ort irgendwo in einem schmutzigen Haus in der engen, übel riechenden Gasse der sonst so glanzvollen Stadt Rom, die sich die Ewige nennt. Noch weniger verwunderlich ist es unter diesen Umständen, dass er auch darüber keine Auskunft zu geben wusste, wie lange er schon auf dieser Erde weilte, von der er sich gar keinen Begriff machen konnte. Ihm war, als sei er schon immer hier gewesen. Und dass man einmal geboren wird, irgendwo in einem schmutzigen Haus in einer übel riechenden Gasse, war eine Tatsache, die es in seinem Bewusstsein nicht gab. Es interessierte ihn auch nicht im Geringsten, wie alt er in Wirklichkeit war; denn die meisten seiner Kameraden waren über ihr Alter gleich unwissend wie er. Und darum schwieg man darüber. Und wenn ihn doch einmal jemand fragte, so sagte er einfach, er sei gleich alt wie Lorenzo, und der behauptete wenigstens, er sei sieben Jahre alt. Angelo sagte dies, weil er gleich groß war wie Lorenzo. Also musste er doch auch gleich alt sein. Manchmal hatte es Streit gegeben, wenn ein Kamerad ihm nicht hatte glauben wollen. Aber diese Zwiste waren immer bald vergessen. Oft hatte Mario geschlichtet. Aber die Streitfrage hatte auch er nicht lösen können. Die konnte überhaupt niemand lösen.
Dies war nun schon lange her, als Angelo noch nicht sein eigener Herr und Meister war. Jetzt fragte ihn niemand mehr nach seinem Alter und seiner Herkunft. Die spielen keine Rolle mehr, wenn man eine eigene Wohnung hat, und eine solche hatte er jetzt. Allerdings nicht allein, sondern zusammen mit Mario und Lorenzo. Jetzt sorgte er für sein Leben allein. Manchmal schon auch zusammen mit Mario und Lorenzo. Oft aber doch meistens ganz allein.
Aber was war nicht immer so gewesen.
Im Waisenhaus
Angelo erinnerte sich nicht mehr an jene Zeit, da er erst mit seinem schwachen, zarten Körper in dieser harten, unbarmherzigen Welt gelebt hatte, seine Seele aber noch in der anderen Welt, aus der wir alle herkommen, zu weilen schien. Aber an die Zeit, die jener folgte, konnte er zurückdenken. Wenn er dies tat, ungern zwar, dann sah er sich im Kreis von ein paar Dutzend Kindern. Viele waren gleich groß wie er, andere waren älter, schon große Knaben, die Angelo mit Achtung und Bewunderung betrachtete; denn sie kannten viele Dinge, die er damals noch nie gesehen hatte. Sie waren schon oft in der Stadt gewesen, manchmal im Geheimen, und sie erzählten den Jüngeren davon mit leuchtenden Augen. Angelo hätte auch gar so gerne einmal den Petersdom aus der Nähe gesehen und die vielen andern schönen Sachen, die es in der Stadt zu bewundern gab. Mario erzählte ihm oft davon, und Angelo war stolz, dass er zu den Bevorzugten gehörte, die ihm zuhören durften. Viele der Kinder waren aber noch kleiner als Angelo. Manche konnten noch gar nicht gehen und schrien den ganzen Tag hindurch und oft auch in der Nacht.
Da waren auch zwei alte Frauen, immer schwarz gekleidet mit langen, faltigen Röcken. Sie hatten strenge Gesichter, und beide trugen Brillen mit runden Gläsern vor ihren Augen. Angelo fürchtete sich vor ihnen. Auch die andern Knaben und Mädchen hatten Angst; denn es gab viel Schläge und wenig Essen. Manchmal, wenn sie nicht gehorsam waren, wurden sie mit dem Stock bestraft, und dann mussten sie obendrein erst noch ohne Nachtessen ins Bett. Dabei hatten sie doch schon den ganzen Tag gehungert. Ihr bloßer Aufenthalt in diesem Haus wäre schon Strafe genug gewesen. Dies glaubten wenigstens Einige von ihnen.
Außer den beiden Frauen war auch noch ein lieber Gott da. Doch Angelo hatte ihn noch nie gesehen. Aber die Kinder mussten immer vor dem Essen den lieben Gott um das Brot bitten und ihm danken für das Wenige, das sie bekamen. Dazu mussten sie immer die Hände falten und ein ernstes Gesicht machen. Keiner durfte dabei lachen.
In einigen Zimmern waren Bilder aufgehängt. Auf vielen war eine Frau zu sehen, die fast immer einen blauen, weiten Mantel trug und in ihren Armen ein Kind hielt. Das war Maria, die Mutter Gottes. Angelo wusste nicht, was das bedeutete. Man hatte ihm nur gesagt, dass das Kind nicht der liebe Gott sei – das hatte er sich auch nie vorgestellt –, sondern das Christkind. Und sein Vater war der liebe Gott. Und die Frau mit dem blauen Mantel war die Mutter des Christkindes und des lieben Gottes. Aber das war viel zu schwer zu verstehen. Wie sollte er, Angelo, dies verstehen, wenn es nicht einmal seine älteren Kameraden verstanden?
Manchmal kam ein Mann, der war so alt wie die beiden Frauen. Auch er war ganz schwarz gekleidet. Er trug einen langen Roch – nicht wie die gewöhnlichen Männer – und war auch immer ernst und machte ein böses Gesicht. Die Knaben waren froh, wenn er wieder ging. Er sagte ihnen nämlich, sie sollten gehorsam sein und sich nicht mit den Mädchen streiten. Die beiden Frauen waren immer freundlich, wenn der schwarze Mann da war. Der konnte doch nicht der liebe Gott sein. Denn es gab noch viele solche, die wie er in schwarzen Röcken herumliefen. Angelo hatte sie schon oft gesehen, drunten in den Straßen. Überall traf man sie. Der konnte also ganz gewiss nicht der liebe Gott sein. Zudem hatte er ihnen noch nie Brot gebracht. Und der liebe Gott hätte wohl kaum ein so böses Gesicht mit so stechendenden Augen, vor denen einem bangte.
Angelo hatte einmal Lorenzo gefragt, wer denn der liebe Gott sei, aber Lorenzo hatte es auch nicht gewusst. Dann hatten sie Mario gefragt, und der hatte ihnen gesagt, sie sollten doch nicht glauben, dass der liebe Gott das Brot bringe. Das sei ein Märchen. Er habe selber schon oft beim Bäcker Brot holen müssen. Es gebe überhaupt keinen lieben Gott. Er wenigstens habe ihn noch nie gesehen. Lorenzo hatte es zuerst nicht glauben wollen. Ob er nicht doch zur Sicherheit noch den schwarzen Mann fragen sollte? Aber er getraute sich nicht. Auch Angelo wolle lieber nicht fragen. Der wisse es doch auch nicht, meinte Mario. Er würde ihnen gewiss nicht die Wahrheit sagen. Die großen Leute sagen überhaupt selten die Wahrheit.
Von da an glaubten auch Lorenzo und Angelo nicht mehr daran, und oft zwinkerten sie sich während des Gebetes über den Tisch zu. Sie wussten es besser, und ihnen konnte man nichts vormachen. Doch trug es ihnen viele Püffe und Schläge ein, wenn es die Frauen sahen, und einmal waren sie vom Tisch weggeschickt worden. Die Frauen hatten sie nach dem Grund ihres spöttischen Lachens gefragt, und Lorenzo hatte geantwortet, sie wüssten schon, dass es keinen lieben Gott gebe. Da hatten die beiden Frauen getobt und die drei Knaben als Sünder vor die anderen Kinder hingestellt. Als der schwarze Mann wieder einmal gekommen war, hatten sie es ihm gesagt. Der hatte etwas von kindlichem Unverstand gemurmelt und hatte ihnen dann eine lange Rede gehalten und ihnen gesagt, sie müssten es glauben, dass es einen lieben Gott gebe. Der habe die Welt erschaffen und alles, was auf dieser Welt lebt. Angelo wusste nicht mehr, was er sonst noch alles erzählt hatte. Sie hatten nicht auf ihn gehört. Sie wussten es ja besser. Aber sie sagten nichts mehr, damit sie nicht wieder Prügel bekamen. Von da an galten sie als die schwärzesten Schafe in der sonst schon dunklen Herde.
Einmal waren drei Knaben durchgebrannt. Da waren die beiden Frauen sehr zornig gewesen. Und die Kinder hatten sich vor ihrem Zorn gefürchtet.
Am dritten Tag waren zwei der Ausreißer reumütig wieder zurückgekehrt in das muffige Haus. Aber sie hatten ihre Reue noch nicht sogleich bekannt, sondern waren stillschweigend mit den anderen Kindern am Tisch gesessen. Aber nicht lange, so waren sie bemerkt worden, und sie hatten den Stock heftig zu spüren bekommen. Dann hatten sie ins Bett gehen müssen und nichts zu essen erhalten, obwohl sie den ganzen Tag noch kein Stückchen Brot oder sonst etwas gegessen hatten.
Den dritten Flüchtling hatte nach einer Woche die Polizei zurückgebracht. Sie hatten ihn erwischt, als er bei einem Bäcker ein Brot hatte stehlen wollen. Auch er bekam Schläge und wurde drei Tage lang in ein dunkles Zimmer gesperrt, wo er fast nichts zu essen bekam.
Mario war dieser drei Ausreißer wegen schlecht gelaunt. Auch er hatte Fluchtpläne gehabt, aber nun musste er vorderhand von ihrer Ausführung absehen – nur vorderhand, wie er behauptete und einigen eingeweihten Freunden, darunter auch Angelo und Lorenzo, erklärte. Sobald der Vorfall vergessen sei und die Frauen nicht mehr so streng auf Schloss und Riegel achteten, würde er gehen.
Mario hatte schon vor längerer Zeit Lorenzo versprochen, ihn mitzunehmen. Aber jetzt schien er auf einmal nichts mehr davon wissen zu wollen. Im Gegenteil – jetzt war er oft zornig gegen Lorenzo, weil der ihn immer wieder drängte, ihn mitzunehmen.
„Du verrätst noch meinen Plan, wenn du immer davon sprichst“, sagte ihm Mario.
Im Stillen tadelte Mario die drei Ausreißer, die wieder zurückgekehrt waren und sich von der Polizei hatten erwischen lassen. Die drei hatten seine eigenen Fluchtpläne durchkreuzt. Sie waren ihm zuvorgekommen. Es war ihm eine große Enttäuschung, dass das, was er im Geheimen geplant hatte, von anderen durchgeführt worden war, und dazu auf eine so unwürdige und schmachvolle Weise. Ihm wäre die Flucht sicher geglückt. Man müsse allein fliehen, behauptete er jetzt, und seine Zeit genau wählen. Auf Kameraden sei kein Verlass. Zudem könne man sich besser verbergen, wenn man allein sei. Lorenzo versuchte ihn jedes Mal, wenn er so redete, an sein Versprechen zu erinnern. Aber Mario wollte nichts mehr davon wissen. Er habe jetzt gesehen, wie es gehe. Mario musste es ja wissen, er war der Ältere. Angelo glaubte ihm, aber Lorenzo schickte sich nur ungern darein. Er werde es ihm nie vergessen, dass er sein Wort gebrochen habe. Ein wahrer Freund würde das nie tun.
Am ersten Abend, als Mario so sprach, hatte Angelo auf seiner dünnen Matratze geweint; denn im Stillen hatte er gehofft, auch mit Mario fliehen zu dürfen, wenn es einmal so weit sei. Aber nun war alles aus für ihn und auch für Lorenzo. Nur Mario, so wusste er, würde es dennoch schaffen. Eines Tages würde sein großer Freund verschwunden sein.
Die Flucht
Mit der Zeit sprach niemand mehr von jener missglückten Flucht, aber umso mehr dachte nun Mario an seine Pläne. Auch Lorenz drang wieder in ihn, bis sie sich schließlich einigten. Mario gab Lorenzo das Recht, gleichzeitig mit ihm zu fliehen, aber dann sollte jeder seine eigenen Wege gehen. Lorenzo war glücklich, aber es war ihm doch nicht so recht behaglich, wenn er daran dachte, dass er allein in der großen Stadt leben sollte, die er nur aus Marios Schilderungen kannte. Aber er wollte tapfer sein und sich von niemandem auffinden lassen.
Es war noch einige Zeit vergangen, bis alles bereit gewesen war. Mario war oft in die Stadt gegangen und hatte einige Schlupfwinkel ausgekundschaftet.
Und dann war es auf einmal so weit gewesen. Eines Tages hatte Mario ganz im Vertrauen zu Angelo und Lorenzo gesagt, dass morgen die Flucht durchgeführt werde.
Angelo musste schwören, dass er zu keinem Menschen ein Wort davon sagen wolle. Als Angelo den Schwur getan hatte, fasste er Mario am Arm und flüsterte ihm leise ins Ohr:
„Mario, wenn ihr fort seid, dann werde ich ganz allein sein. Ich möchte lieber auch mit euch gehen. Darf ich nicht mit euch fliehen?“
„Angelo, das ist unmöglich“, sagte Mario, „du weißt ja, dass wir uns nach der Flucht trennen müssen, Lorenzo und ich. Dann werden auch wir allein sein. Draußen hättest du überhaupt niemanden mehr. Du müsstest ganz allein für dich sorgen. Ich kann dich nicht mitnehmen, und um allein zu fliehen bist du noch viel zu klein...“
„Lorenzo ist nicht größer als ich“, erwiderte Angelo. Es verdross ihn, dass Mario ihm vorhielt, er sei zu klein. Nein, er war gewiss groß genug. Er wollte alles versuchen, um auch fliehen zu können. Mario und Lorenzo sollten nicht glauben, er könne weniger als sie.
„Aber Lorenzo ist stärker als du“, antwortete Mario, „ er erträgt es besser, im Freien zu schlafen. Weißt du, im Winter ist es dann kalt, auch wenn du krank wirst, bist du verloren.“
„Im letzten Winter haben wir alle auch gefroren, und da bin ich auch nicht krank geworden. Ich will stark sein, und ich werde gewiss nicht krank werden. Nehmt mich doch mit!“, bettelte Angelo.
„Hast du keine Angst?“, fragte Mario. „Wenn du in der Nacht, wenn es dunkel ist, Angst bekommst, dann bleibst du besser hier.“
„Ich werde ganz gewiss keine Angst haben“, beteuerte Angelo.
„Ich will es mir überlegen“, sagte Mario mit wichtiger Miene und zog sich mit Lorenzo in eine stille Ecke zurück. Dort flüsterten sie lange miteinander. Angelo hörte nicht, was sie sprachen, aber er wusste, dass dort über seine Freiheit oder die Fortsetzung seiner Gefangenschaft entschieden wurde. Sein Herz pochte heftig vor Erwartung.
Mario und Lorenzo in ihrer Ecke kamen vorerst überein, nun doch miteinander zu fliehen und immer beisammen zu bleiben; denn es war Krieg im Lande, jener große Krieg, in dem die Engländer und die Amerikaner gegen die Deutschen kämpften. Und Italien war mittendrin. In der Stadt herrschte große Unruhe, da die amerikanischen Truppen, die Rom von den deutschen Unterdrückern befreien sollten, schon vor den Toren standen. Mario hatte dies aus ganz sicherer Quelle erfahren, und er erwartete, dass Rom schon am nächsten Tag befreit werde. Darum hatte er die Flucht auf diesen Tag festgesetzt. An diesem Tag würde gewiss so viel Unordnung und Verwirrung in der Stadt sein, dass sie ungehindert fliehen könnten. Diesem Umstand hatte es denn Lorenzo zu verdanken, dass er mit Mario fliehen durfte, diesem Umstand allein – nicht der Angst vor dem Alleinsein, nicht einer plötzlichen Verzagtheit wegen, und am allerwenigsten etwa, weil Mario Lorenzos Hilfe brauchte. Nein, ganz allein deshalb, weil es günstiger war, als Mario vorhergesehen hatte. Mario betonte dies ganz besonders.
Da sie nun schon beschlossen hatten, zusammenzubleiben, konnte man es sich ja überlegen, ob man auch Angelo mitnehmen solle. Sie kamen schließlich überein, dass sie es ihm nicht verwehren wollten, falls er wirklich darauf bestand. Aber er sollte nur unter der Bedingung mitkommen dürfen, dass er nie zurückkehren würde. Es wäre eine Schande und eine Schmach für sie alle. Auch dürfe er keine Angst haben, und vor allem dürfe er ihr Versteck keinesfalls verraten, wenn man ihn erwische. Dies galt übrigens auch für Lorenzo und Mario selber. Sie versprachen es sich gegenseitig, und auch Angelo versprach alles fest und heilig. Er wolle alles tun, was sie von ihm verlangten. Wenn er nur mit ihnen gehen dürfe.
Die Flucht würde leicht sein. Sie brauchten nur von zu Hause wegzugehen, möglichst weit weg, und nicht mehr zurückzugehen. Schwerer würde es sein, sich nicht auffinden zu lassen.
Mario hatte alles richtig vorausgesehen.
Der Kanonendonner, den man schon seit Tagen im Süden vernahm, war auf einmal ganz nahe. Manchmal war er so nahe, dass einem beinahe das Trommelfell zersprang. Angelo lief den ganzen Tag mit offenem Mund umher. Mario hatte das gesagt, dass man den Mund offen halten müsse, wenn in der Nähe geschossen werde. Mario wusste immer, was man tun musste.
In den Straßen war reges Leben. Die Deutschen schienen sich aus der Stadt zurückzuziehen. Angelo aber sah nichts davon. Die Fensterläden waren geschlossen worden. Man hörte es nur. Manchmal zitterte das Haus, in dem man sich eingeschlossen hatte, und drunten auf der Straße dröhnte es unheimlich über das Pflaster. Manchmal war ein Rasseln, als ob man schwere Eisenketten über die Straße schleifte. Und dann war es wieder ruhig, unheimlich ruhig, und auf einmal war wieder ein Rasseln und Zittern. Aber die lauten Schüsse aus den Kanonenrohren hatten aufgehört. Und auf einmal war großer Jubel auf der Straße. Die Läden wurden aufgeschlossen. Irgendwoher kam ein beißender Rauch. Man eilte auf die Straße hinunter. Da war ein Drunter und Drüber. Fremde Menschen waren da, Soldaten in braunen Uniformen saßen auf seltsamen Raupenfahrzeugen. Das waren die Amerikaner. Mario war stolz, dies zu wissen. Alle Leute waren fröhlich.
Am Abend blieben die Schlafplätze der drei kleinen Ausreißer leer.
Endlich in Freiheit
So wie sich die Vögel ihr Nest zusammentragen, so hatten Mario, Lorenzo und der kleine Angelo all das herbeigeschafft, was sie für ihre Bequemlichkeit brauchten: ein Häufchen Stroh, Säcke und Lumpen, eine alte zerrissene Decke. Alles, was sich finden ließ, hatten sie in den heimlichen Schlupfwinkel getragen.
Der Schlupfwinkel: Lorenzo hatte ihn am dritten Tag entdeckt. Die ersten beiden Nächte hatten sie sozusagen unter freiem Himmel geschlafen. Das ganze Forum Romanum, den Circus Maximus, diese alte römische Arena, den Palatin hatten sie abgesucht. Am Abend waren sie in einer feuchten Grotte eingeschlafen. Am Morgen hatte sie die Sonne geweckt. Sie waren aufgestanden, hatten sich umgesehen, und da sie Hunger verspürten, waren sie aufgebrochen, etwas Essbares zu suchen. In der zweiten Nacht hatten sie am gleichen Ort geschlafen, und am Morgen des dritten Tages, als sie aufwachten, hatte Lorenzo den Schlupfwinkel entdeckt. Das war so zugegangen:
Lorenzo hatte am Tag zuvor von einem amerikanischen Soldaten ein kleines, rundes Brot erhalten. Er hatte es neben sich gelegt, bevor er eingeschlafen war, damit er am Morgen gleich das Essen bereit habe. Als er sich erwachend drehte und reckte, stieß er mit dem Arm an das Brot; das Brot fiel von dem Stein, auf dem es lag, herunter und rollte gegen die Wand der Grotte, wo ein dorniger Strauch aus dem felsigen Boden herauswucherte, und verschwand. Ja, es verschwand. Lorenzo hatte, noch halb im Schlaf, dem davonrollenden Brot nachgeschaut. Eben hatte er es noch gesehen, mit verschleierten Augen zwar, nicht klar, aber doch so deutlich, dass er wusste, dass es dort unter dem Strauch hindurchgerollt war. Aber jetzt war es fort. Lorenzo war plötzlich hellwach geworden. Er sprang auf, eilte dem Brot nach und suchte unter dem Strauch. Das Brot blieb verschwunden. Lorenzo griff zwischen den dornigen Ästen hindurch und – griff ins Leere. Ja, er griff ins Leere, als ob er die Hülle der Erde durchstieße und ins Weltall hinaus, in die Ewigkeit hinauslange. Sein ganzer Arm versank, und seine Hand griff – nichts, kein Wasser, keine Erde, nichts Fassbares. Lorenzo zog seinen Arm erschauernd zurück und ging seine beiden Kameraden zu wecken.
„Es muss eine Höhle sein“, erklärte Lorenzo ganz aufgeregt und berichtete, wie sein Brot hinter dem Strauch verschwunden war, und wie er das Loch entdeckt hatte.
Mario und Angelo traten herbei, und Lorenzo streckte den Arm wieder zwischen den Zweigen hindurch, aber nicht mehr so weit. Man kann ja nie wissen. Vielleicht wohnt ein wildes Tier in einer solchen Höhle, das einem den ganzen Arm abfressen könnte.
Mario drängte Lorenzo auf die Seite, und auch er streckte den Arm in das Loch, ein wenig beherzter als Lorenzo.
„Wir müssen den Strauch ausreißen“, sagte Angelo und griff nach den Ästen, aber er fuhr gleich wieder zurück; denn er hatte mitten in die Dornen gegriffen.
„Lass es nur!“, sagte Mario, „vielleicht können wir uns in dem Loch verbergen; dann sind wir froh, wenn uns der Strauch verdeckt.“
Sie drückten nun sorgfältig die Äste auseinander, und Mario kroch in das Loch. Die Öffnung war gerade so groß, dass er noch gut durchschlüpfen konnte, wenn er sich ganz flach auf den Boden drückte.
„Es ist ganz finster“, sagte er und kroch weiter. Schon war nichts mehr von ihm zu sehen.
„Es ist eine richtige Höhle“, rief er, und seine Stimme klang dumpf und hohl.