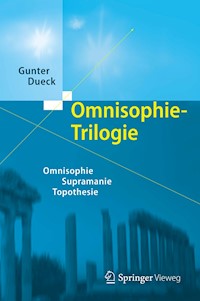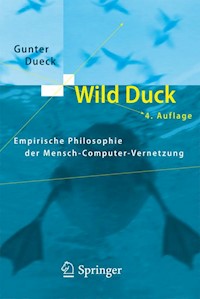Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der ehemalige Mathematikprofessor und IBM-Chefstratege Gunter Dueck entwirft ein Modell für eine wertorientierte ökonomische Vernunft Wenn Unternehmensgewinne wachsen, Steuereinnahmen sprudeln und Löhne steigen, geben Manager, Politiker und Arbeitnehmer das Geld mit vollen Händen aus. Naht der Abschwung, heißt es Gürtel enger schnallen: Personal freisetzen, Steuererleichterungen streichen und jeden Cent auf die hohe Kante legen. Und auch emotional fallen wir von einem Extrem ins andere: Im Aufschwung sind wir zuversichtlich, fair und kreativ, in der Krise regieren Darwin und Wirtschaftskrieg, ziehen Angst, Stress und Vorsicht in die Köpfe. Den Menschen ernst nehmen, heißt, diese Emotionen ernst nehmen, sagt Gunter Dueck. Was immer wir über die Wirtschaft denken, ist abhängig von unserem Bauchgefühl. Je nach Stresslevel halten wir unterschiedliche Dinge für richtig. Trotzdem operiert man in der Wirtschaft mit dem Modell von einem Homo oeconomicus, der stets rational handelt und auf immer gleiche Weise durch Geld und Nutzen zu motivieren ist. Das ist falsch, folgert Gunter Dueck und fordert eine ökonomische Vernunft, die den Menschen in den Blick nimmt und uns lehrt, in fetten Jahren Maß zu halten und in mageren gelassen zu bleiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gunter Dueck
Abschied vomHomo Oeconomicus
Warum wir eine neuewirtschaftliche Vernunft brauchen
Campus Verlag GmbH
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Copyright © 2020 Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main.
Die Originalausgabe erschien 2008 im Eichborn Verlag GmbH, Frankfurt am Main.
Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, Köln
Lektorat: Waltraud Berz
ISBN 978-3-593-44581-6
Kontaktinformationen zum Autor Gunter Dueck finden sichauf dessen Homepage www.omnisophie.com
www.campus.de
Inhalt
Gibt es stabile Ökonomie?
Die Wirtschaftstheorien und das Alltagsreale
Räuber und Beutetiere – Fresse, wer kann!
Menschen als Jäger nach der Beute namens Verdienst
Strebt der Markt in ein Gleichgewicht?
Unter Stress zum Prekariat
Wie der Stresslevel so der Mensch
Der Schweinezyklus
Der Instinkt im Bierspiel
Die Effizienz und die Industrieschweine
Es trickst, wer sonst untergeht
Wo betrogen wird, verliert das Ehrliche an Wert
Erst Armani oder ALDI – zum Schluss der Basar
Signaling, Screening & Co. gegen den Niedergang
Die Entstehung der Klassen
Wirtschaftszyklen und Life Cycles
Lebenszyklen überall
Kondratieff-Wellen
Das Auf und Ab im Körper
Darf Arbeit Spaß machen?
Welche (Bio-)Chemie stimmt?
Aggressive Typ-A- und entspannte Typ-B-Menschen
Hirnwellenlängen
Life Cycle der ökonomischen Anschauungen
Wachstum und Boom
Sättigung und Reife des Marktes – bis zum Gipfel
Crash oder Schrecksekunde am Höhepunkt
Intermezzo – Warum sich alles wieder umkehrt
Nutzenbetrachtung der Arbeit – Konzentration auf Effektivität und Standards
Kostenbetrachtung der Arbeit – Konzentration auf Effizienz und Leistungsmessung
Craze um das Neue und eventuell ein Crash
Intermezzo – Gedanken über das Neue
Profitbetrachtung der Arbeit – Konzentration auf Gewinnsteigerung
Der neue Zyklus beginnt
Der Dow Jones Index im letzten Zyklus
Lieblingstheorien im Wandel des Wirtschaftswachstums
»Phasic Instinct« und die Wirtschaftstheorien
Das Theoriedilemma der Gefangenen und das Vertrauen
Gefangenen-Dilemmata im Management
Ethik oder der Zwiespalt des Einzelnen
Physiologie und Dynamik der verschiedenen Wirtschaftsphasen
»Bluttemperaturen« verschiedener Wirtschaftskulturen
Das Menschenbild im Zyklus
Zeitgemäße Managertypen
Up & Down in den Unternehmen
Zeit – voranschreiten oder wegrennen
Raum – Expansion oder Schrumpfung
Mensch & Motivation – extrinsisch oder intrinsisch
Personalwesen
Produkte und ihre Qualität
Service und Kunden
Märkte, Marken und Marketing
Vertrieb und Kunden
Identität und Imagepflege
Innovation
Finanzen
Gewerkschaften
Am Ende steht immer die Manie
Up-Management als Technik zum Down
Auf der Suche nach Spitzenleistungen
Benchmarking und Scorecards
Ranking und Rankism
»Kundenorientierung«
Fokus
Ceteris-Paribus-Schrauben
Black-Box-Ökonomie
Black-Box-Menschen
Economy-Mitarbeiter als Allzweckmaschinen
Als Economy-Kunde in Multiple-Choice-Segmenten
Struktur erzeugt strukturierten Inhalt
Effizienz erzeugt den effizienten Menschen
Lemon Lemmings
Kann sich etwas zum Guten ändern?
Ökonomie sieht nur bis zum Tellerrand
Philosophisch-ökonomische Wahrheit
Ökonomie 2.0
Leadership und Vertrauen
Kooperative Infrastrukturen
Kaizen oder Maßhalten
Rekapitulation und Ausblick
Der mittlere Weg
Ökonomie und »Phasic Instinct«
Management heute und morgen
Quo vadis, Ökonomie?
Gibt es stabile Ökonomie?
Eigentlich sollte sich alles im Gleichgewicht befinden, wenn man an Theorien glaubt. Die Preise und die Märkte, Angebot und Nachfrage. Ist das so?
Nein, die Ökonomie fährt Achterbahn. Sie verzeichnet Schweinezyklen und Lehrerschwemmen, Sparwut und Innovationsmangel. Die Ausschläge der Märkte werden in letzter Zeit heftiger. »Die Volatilität steigt«, sagen wir. »Die Welt befindet sich in einem unaufhörlichen, immer schnelleren Wandel.« Auf nichts ist Verlass, alles ändert sich. Jeder muss sich anpassen, um nicht unterzugehen. Werden wir noch unsere erhoffte Rente bekommen? Alles ist ungewiss, wir fürchten oft, dass wir das alles in vielerlei Sinne nicht gut überleben. Immer stärker spüren wir heute den Stress in allen Poren. Wie wird es unseren Kindern ergehen? Können wir uns überhaupt Kinder leisten? Die alternde Bevölkerung schrumpft schon – es ist nicht mehr für so viele Menschen Platz oder Arbeit da.
Die Wirtschaftstheorien und das Alltagsreale
Darf ich Sie einmal zurückbitten? Auf Zeitreise? In den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts begann mein eigenes Arbeitsleben. Die Löhne und Gehälter stiegen damals jedes Jahr um sechs, sieben Prozent, einmal gab es nach langem Streik deutlich über zehn Prozent. Das Wort »Profit« war ein Schimpfwort. Selbst die Unternehmen vermieden es schamhaft und versteckten heimlich ihre nötigen Gewinne durch überhöhte Abschreibungen, so gut sie konnten. Jede Stadt erbaute eine große neue Universität zur Investition in die Zukunft. Grundlagenforschung wurde großgeschrieben. Ich erinnere mich an Naturwissenschaftler, die nach ihren Vorträgen auf die Frage nach der Anwendbarkeit ihrer Forschungsergebnisse antworteten: »Ich hoffe nie!« oder »Da bin ich sicher, ich lasse mir da von Ihnen überhaupt nichts vorwerfen!« Wer etwas Nützliches erforschte, stand nämlich im Verdacht, ein Knecht oder Büttel der Großindustrie zu sein und die Wissenschaft zu verraten. Wissenschaft sollte nie wieder die Baupläne für Atombomben oder die Unterdrückung der Arbeiterklasse liefern. Soziologen und Politologen der 68er-Bewegung palaverten fremdwortwütig über die Abschaffung des Establishments, und ich erinnere mich noch an meinen Schrecken, als man mich auf dem Göttinger Universitätscampus anpöbelte, weil ich ein Handelsblatt unter dem Arm trug.
Denken Sie sich noch einmal eine Weile in diese Denkstimmungen hinein! Heute plagt uns die Sorge um das Morgen, den Arbeitsplatz, die Ausbildung der Kinder. Damals beschäftigte uns das Ringen um die Utopie einer bestmöglichen Zukunft, die uns das unendliche Wachstum durch Technologie bescheren würde.
Und in Ihr Denken hinein stelle ich Ihnen die Frage: Wohin führt es, wenn wir alle so wie heute oder alle so wie damals denken? Warum dachten wir damals so positiv und schwelgten in Utopien? Warum jammern wir heute und verzagen so sehr, dass uns der Optimismus fast vom Arzt verordnet werden muss?
In den sechziger- und siebziger Jahren entstand in uns die Vorstellung einer sozialen Marktwirtschaft. Heute versprechen wir uns mehr vom Neo-Kapitalismus. Früher stand der weltberühmte fleißige Deutsche im Zentrum unseres Weltbildes, heute ist es der stinkfaule verwöhnte Deutsche mit seinen 30 Tagen Jahresurlaub, die weltweit seine Weltfremdheit gegenüber der Arbeit dokumentieren.
Was ist da in unseren Köpfen oder vielleicht Bäuchen los? Warum denken wir über das Gleiche mal so und mal so? Ist es das Gleiche? Sind wir die Gleichen? Haben wir in guten Zeiten wunderschöne Wirtschaftstheorien und in schlechten Zeiten eben drakonisch harte? Ist es ökonomisch sinnvoll, unser Denken dem Kneifen im Bauch anzupassen?
Nach den Wirtschaftstheorien sind wir Menschen ja angeblich ein Homo oeconomicus, ein Mensch, der ausschließlich von Erwägungen wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit geleitet wird. Ein Mensch, der streng rational auf seinen eigenen Vorteil sieht und seinen Nutzen maximiert. Unsere Wirtschaftstheorien nehmen dazu noch regelmäßig an, dass jeder Mensch genaue Präferenzen oder Nutzenfunktionen hat, die über die Zeit einigermaßen stabil bleiben.
Doch das sind Märchen, um einfache Theorien für nette Vorlesungen zu erhalten! Eingeweide sind nicht stabil.
Ich möchte es »Phasic Instinct« nennen, was uns da aus dem Bauch heraus unser Denken diktiert. Je nach Lage dort draußen leben wir in Gottes bestmöglicher Welt oder in einer, die von Darwin erschaffen scheint. Gott hatte doch wohl einen Weltbauplan, aber Darwin setzt auf die faktische Macht des Zufallsprinzips. Wir glauben mal dies, mal das, je nachdem wie unsere Eingeweide sich in der jeweiligen Zeit anfühlen.
Dieses Phänomen will ich hier im Buch erhellen und beschreiben. Ich möchte Ihnen das Oszillieren des Denkens vorführen und mit Ihnen die Gründe dafür suchen. Ich beschreibe die verschiedenen Denkweisen der verschiedenen Zeiten, in denen des
→ Aufbaus einer neuen Ordnung (Neubesiedlung eines Landes, »Silicon Valley«),
→ Entstehens von Utopien in Zeiten des Luxus,
→ Zerfalls von zu üppig und weich gewordenen Strukturen,
→ Überlebenskampfes nach dem Aufbrauchen aller Reserven.
Ich werde mit Ihnen durchgehen, wie Sie in diesen verschiedenen Zeiten denken, agieren oder planen. Sie werden Ihre Anschauungen über die Ökonomie an sich wechseln. Ist Wirtschaft zum Wohlergehen der Gemeinschaft gedacht oder als Kampffeld aller Einzelnen? Geht es immer nur um Geld und Macht oder doch auch wieder um Ehre, Ethik, Sinn und Würde? Eigentum verpflichtet, heißt es in der deutschen Verfassung. Und dort weiter: Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Gilt diese Verfassung auch in schlechten Zeiten? Muss der Gebrauch von wirtschaftlicher oder politischer Macht ebenfalls dem Allgemeinwohle dienen? Oder nur dem eigenen Machterhalt? Verpflichtet auch Erfolg?
Die Fragen und die Antworten wechseln je nach den Umständen die Richtung und die Farbe. Sie und ich gehen da irgendwie mit, auch wenn wir uns einigermaßen gefestigt vorkommen. Die Herrschenden aber werden als Personen ausgewechselt. Zu manchen Zeiten herrschen Priester, ein andermal Krieger und dann wieder Ehrenbeamtete, die sich um uns kümmern. Einige wollen in die Geschichte eingehen, andere nur an der Macht bleiben. Jede Zeit hat ihre eigenen Regeln, die durch die jeweils Herrschenden verkörpert werden.
»Phasic Instinct«: Die herrschenden Ansichten und Menschen ändern sich. Wir sehen dann alle für eine gewisse Zeit anders auf Gewinn, Verteilung, Marketing, Ethik, Qualität, Arbeitnehmerrecht, Verpflichtung, Verantwortung, Verantwortlichkeit, Gemeinwohl, Kommunikation, Struktur, Service, Kundenzufriedenheit, Personalwesen. Immer anders, je nachdem ob wir aufbauen, genießen, Ordnung schaffen wollen oder kämpfen.
Krass ausgedrückt: Unsere Eingeweide wollen je nach Stresslevel etwas Unterschiedliches, was immer das ist. Und dann wird der Kopf beauftragt, den Willen zu befriedigen, so gut er das kann.
Stress kann in Sekunden Ihren Chef im Ganzen verändern und in anderen Bahnen laufen lassen. Eine einzige richtige Pleite erschüttert in Zehntelsekunden das Vertrauen der Märkte in die Zukunft. Ein dritter Platz mit Heimvorteil bei der Fußball-Weltmeisterschaft leitet den Umschwung der deutschen Wirtschaft ein. Oh nein, wir sind kein Homo oeconomicus. Wir sind eher eine große Masse von leicht erregbaren Individuen, die wie Lemminge hin und her rasen, je nachdem, wohin der Trend zeigt. Wir finden vor allem das rational, was die anderen auch tun. Und weil das so ist, weil wir alle mal hierhin, mal dorthin stürzen – anderen nach, ohne weiteres Überlegen, deshalb schwankt alles unsinnig hin und her. Auf und ab: vom seligen Gleichheitstraum im Luxus-Sozialismus bis hin zur krass entgegengesetzten Verachtung von Low Performern, die wir aus Abscheu einfach ihrem verdienten Schicksal überlassen.
Wir sollten Abschied nehmen vom Gedanken, dass wir überwiegend rational handeln und ein Homo oeconomicus wären. Das sind wir nicht. Wir könnten nachdenken, ob wir einer werden sollten. Das ist gar nicht so einfach, sage ich Ihnen hier im Buch.
Stellen Sie sich vor, ein Mensch unter nur Klugen ist dumm und schadet den anderen erheblich durch seine Dummheit. Was kann man tun? Nun, die Klugen müssen den Dummen irgendwie »einnorden«, oder? Das ist sonnenklar.
Es gibt aber noch eine andere Lösung. Die Klugen können ebenfalls alle dumm werden und sich gleichmäßig gegenseitig schaden. Das wäre in gewisser Weise sogar eine einfachere Lösung. Logisch einwandfrei?
Das glauben Sie nicht. Dann schauen Sie zum Beispiel auf die Tour de France. Angenommen, das Doping von Radfahrern ist so effektiv, dass ein einziger Betrüger gegen sonst nur Ehrliche ohne weiteres gewinnen kann. Angenommen, einer betrügt die anderen und fügt ihnen dadurch einen erheblichen Schaden zu. Was kann man tun? Den Betrüger »einnorden«, das ist sonnenklar. Es gibt aber noch eine andere Lösung: Alle dopen und betrügen und fügen sich gegenseitig und sich selbst einen Schaden zu. Die Chancen sind für alle wieder genau wie vorher, nur sterben sie alle früh qualvoll als Sportinvaliden und die Bevölkerung will einfach keinen Radsport mehr sehen.
Lustimpulse und Hammelherdenverhalten prägen die Ökonomie. Die Theorien aber versuchen listige Klimmzüge und erklären, dass Doping kurzfristig schlau oder »rational« ist, nur eben langfristig nicht. Was, bitte, ist dann »rational«? Ist Rationalität an Weisheit grenzende Klugheit oder gierige Nächstsekundenschläue? Stammen »Nutzen« oder »Vorteil« aus umsichtiger Erwägung oder aus Testosteron? Das wird lieber nicht wirklich diskutiert oder definiert, weil die Wissenschaft heute noch keine komplizierten Theorien vertragen kann.
Die Theorien erklären in den Menschen Arten von leicht mathematisierbarer Rationalität hinein, wo keine ist. Besser wäre es, sie würden ihn die Rationalität lehren, denke ich. Wir sollten uns von der Vorstellung des schon real existierenden Homo oeconomicus verabschieden. Danach könnten wir uns einen neuen überlegen, der wir sein wollen. (Hier im vorletzten Kapitel.)
So. Das war das einleitend Leidenschaftliche. Jetzt erkläre ich alles eine Stufe gründlicher.
Zuerst gebe ich Ihnen ein Gefühl für dieses Auf und Ab in Lemmingmanier anhand eines Beispiels. Gewiss handelt das Beispiel von Tieren und nicht von hochgeistigen Menschen. Aber Sie bekommen schon einmal ein mächtiges Vorstellungsbild von dem, was die Wirtschaft ins Auf und Ab treibt.
Räuber und Beutetiere – Fresse, wer kann!
In der Biologie kennt man den unendlichen Zyklus der »Räuber-Beutetier-Beziehung«. Man bezeichnet damit im Tierreich immer wiederkehrende wilde Schwankungen. Sie entstehen durch unterschiedliche Vermehrungsrhythmen. Es kommt dadurch zu dem Phänomen, dass eine Lebensgemeinschaft über ihre Verhältnisse lebt, nicht wirklich gegensteuert und daran zugrunde geht.
Also: Raubtiere fressen Pflanzenfresser, oder allgemeiner: Räuber fressen Beute. Die Wellenbewegung der beiden Populationen sehen Sie beispielhaft in der folgenden Skizze.
Schema der »Räuber-Beute-Beziehung«
Sie müssen jetzt näher an die Zeichnung heran und genau hinsehen. Die Spitzen der hohen Kurve (Beute) sind zeitlich immer ein wenig vor den Spitzen der niedrigen Kurve (Räuber). Die aufgezeigten Wellen entstehen auf folgende Weise: Angenommen, Beutetiere vermehren sich auf einer großen Insel. Es werden ihrer mehr und mehr. Raubtiere können nun immer leichtere Beute machen. Es wimmelt von Nahrung. Deshalb vermehren auch sie sich stark. Irgendwann stößt die Vermehrung der Beutetiere an Grenzen: An die Grenzen der Insel, die der Nahrungspflanzen oder die der Raubtiere an sich, die zu viel fressen. Erst vermehren sich die Beutetiere sehr stark, dann folgt die rasante Vermehrung der Räuber. In dem Augenblick aber, in dem die Zahl der Beutetiere nicht mehr zunimmt, sind noch Unmengen schwangerer Räuber im Land. Die Zahl der Räuber nimmt also auch dann noch lange zu, wenn die Vermehrung der Beutetiere schon stockt. Nun fressen die noch immer mehr werdenden Räuber mehr Beute als es ihrer gemeinschaftlichen Zukunft angemessen wäre.
»Die Räubergemeinschaft lebt über ihre Verhältnisse.« Deshalb sinkt die Anzahl der Beutetiere, während immer mehr Räuber geboren werden. Die Zahl der Beutetiere stürzt ab, weil die vielen Räuber alles kahl fressen. Jetzt bekommen bald noch viel mehr Räuber weniger Nahrung. Weil es zu wenig Nahrung für alle gibt, gebären die Räuber nicht mehr so gut. Beide Arten sind nun auf dem gemeinsamen Höllengang des Aussterbens.
Es kommt zu einer Todesspirale des »Abschwunges«, weil es eine lange, lange Zeit immer zu viele Räuber für zu wenig Beute gibt, während im »Aufschwung« immer so viele Beutetiere geboren wurden, dass die wenigen Räuber die Vermehrung nicht durch Fressen aufhielten.
Zum bitteren Ende hin gibt es nur noch ganz wenige Beutetiere. Daran sterben die Räuber fast aus. Die wenigen Beutetiere verteilen sich über die ganze Insel. Nach einiger Zeit erholt sich die Beutepopulation. Wieder etwas später vermehren sich die Beutetiere schnell. Die Vermehrung der Räuber erfolgt in der Zeit versetzt. Es ist, als wäre ein Weltkrieg zu Ende und alle bauten wieder auf.
In der Natur ist es meistens so, dass sich die Beutetiere schneller wieder vermehren als die Räuber (die Sparer schneller als die Bankräuber). Diesen Sachverhalt nennt man in der Biologie Drittes Volterra-Gesetz. Für Beutetiere ist ja das schnelle Vermehren ein wichtiger Überlebensfaktor. Raubtiere sollten sich nicht so stark vermehren, da sie ja ihr eigenes Revier brauchen. Wenn Sie zum Beispiel Schädlinge im Garten durch Totalchemie vernichten, so töten Sie auch viele der Räuber mit dem gleichen Vernichtungsmittel. Deshalb sterben neben »den Blattläusen« direkt durch dasselbe Gift oder indirekt durch Nahrungsentzug auch »die Marienkäfer«. Beute und Räuber verschwinden gleichzeitig. Nach dem Volterra-Gesetz aber erscheinen zuerst wieder Massen von Blattläusen, erst dann wachsen die Marienkäfer nach. Deshalb verschlimmert man durch Schädlingsbekämpfung oft die Lage im Garten, weil die Schädlinge schneller wiederkommen als die Nützlinge. Man verstärkt die Schwankungen durch Eingriffe!
Wenn Räuber nicht so dumme Tiere wären, sondern so klug wie Menschen, würden sie sich nur so schnell vermehren wie es die Vermehrung der Beutetiere erlaubt. Oder?
Die Indianer in Amerika lebten stets weitsichtig im Rhythmus der Büffelherden. Es ging! Sie töteten nur zum Essen, nicht zum Überfluss. Sie hungerten notfalls, um die Büffel nicht zu stark zu dezimieren. Sie versuchten, die Schwankungen selbst durch Maßhalten kleiner zu halten, die durch das Wetter und durch die Natur nie ganz vermieden werden können. Indianer träumen natürlich von einem Leben ganz ohne irgendwelche Schwankungen, denn diese sind das Harte im Leben. Indianer träumen von den ewigen Jagdgründen, in denen es immer gerade genug Büffel gibt. Ich betone: gerade genug. Sie träumen nicht von einer Lust, Millionen Büffel abzuschlachten, um Moschus zu ernten oder nur das Filet zu essen. Indianer sind weise!
Es geht relativ schnell, alle Büffel, also alle Beutetiere, »aus Lust« zu töten. Dann aber haben die Räuber, hier die Indianer, keine Lebensgrundlage mehr und sterben aus. Das dritte Volterra-Gesetz hat hier wieder ganz Recht, denn die Büffel werden sich schneller wieder von dem Schlag erholen als die Menschen. Deshalb versuchen Indianer nicht, sich wie Tiere zu benehmen und den entsprechenden Fluch der Naturgesetze zu ernten. Indianer sind weise, weil sie die Natur mit sich selbst im Einklang halten. Sie halten ihre Büffel heilig und wissen, dass sie für Büffel ihrem Manitu dankbar sein müssen.
»Gib weniger aus, als du nachhaltig verdienen kannst.« Das hört ein jedes Kind, das ein rationaler Mensch oder gar ein Homo oeconomicus werden soll.
Im Urlaub haben wir Kalifornien bereist, auch Monterey. Dort kennen Sie vielleicht die Cannery Row, die Straße der Ölsardinen aus dem Roman von John Steinbeck. Fabrik an Fabrik, heute alles verwaist, damals voller niedrigst bezahlter Arbeitskräfte. Auf einer der historischen Tafeln, die wir dort fanden, war die Fangmenge der Sardinen von 1900 bis 1950 aufgezeichnet. Sie stieg ungeheuerlich an, mit traumhaften Wachstumsraten. Mitte der fünfziger Jahre kollabierte aber bekanntlich der Fischfang innerhalb ganz kurzer Zeit. »Die Strömung im Meer änderte sich plötzlich. Es gab lange keine Sardinen mehr, gar keine – wegen der Strömung. Die Strömung hat sich heute wieder zurückgebildet und ist wie einstmals, heute sind wieder Sardinen da.« So erklärte es uns die Reiseleiterin. Die Fische sind wieder da, die Menschen dahin. Auf der Tafel in Monterey stand auch, es sei denkbar, dass der Kollaps durch Überfischung zustande gekommen sei. Wer aber will das wissen? Monterey ist heute Tourismuszentrum mit »historical attractions«, in dem die schönen Ruinen der Fabriken direkt am Meer zu bewundern sind. »Alle aussteigen! Eine Stunde Zeit zum Ansehen! Die Toilette ist am linken Ende der Straße.«
»Nimm alles mit, was du bekommen kannst. Wer weiß, was es morgen noch gibt.« Das sagt man nicht so laut, weil es nicht offiziell rational ist, aber immerhin so rational, dass man tatsächlich so handelt. Wir bekennen uns als Gemeinschaft nicht zur besten Gemeinschaftslösung. Wir sehen zu, dass der Einzelne seinen Vorteil mitnimmt und mit den sofort folgenden Nachahmern zusammen alles in die Tiefe zieht.
Menschen als Jäger nach der Beute namens Verdienst
Die Menschen jagen ihrem Glück nach. Sie suchen nach Schätzen, Büffeln und guten Arbeitsplätzen. Wenn die Konjunktur gut ist, wachsen die Arbeitsmöglichkeiten. Die Produktion und der Service expandieren. Die menschliche Beute – das sind die Verdienstmöglichkeiten – vermehrt sich wie von selbst.
Jetzt vermehren sich auch die Menschen, die der Arbeit nachjagen. Einwanderer aus armen Weltgegenden kommen herbei. Die Heimischen wollen mehr Arbeit, bessere Arbeit, mehr Verdienst. Sie und die Zuwanderer saugen gemeinschaftlich an der Beute, am großen Kuchen, von dem jeder ein größeres Stück will.
Als die Deutschen in den sechziger Jahren zuviel Arbeit hatten, luden sie Gastarbeiter ein. Ludwig Erhard begann mit seinen berühmten Maßhaltepredigten (1963), die man allgemein etwas albern fand und zum Teil glatt verlachte. »Lebt nicht über eure Verhältnisse!« Viele Menschen strömten nach Deutschland, erst aus Italien, dann aus Jugoslawien, Spanien und später aus der Türkei. In den USA wandern heute noch immer kaum gehemmt Latinos über die Grenzen ein. Die deutschen Ehefrauen, die damals typisch Hausfrau waren, wurden erst in den Arbeitsmarkt gedrängt und kamen nach positiven Erfahrungen immer zahlreicher von selbst.
Irgendwann aber vermehrt sich die Arbeit nicht mehr, weil die Gier zu groß geworden ist und zu viele Menschen nun zu wenige Verdienstmöglichkeiten unter sich zu verteilen haben. Dann bricht die Konjunktur ein.
Bei den Räubern und Beutetieren würde das Sterben beginnen. Die Beutetiere würden schneller und schneller gefressen – und weniger und weniger Räuber könnten davon leben.
In der Wirtschaft sinken die Verdienstmöglichkeiten, um die sich viel zu viele Menschen bewerben. Diese Menschen nehmen nun alles, was sie »noch zu fressen finden«. Dadurch sinken die Verdienstmöglichkeiten immer weiter, denn die Menschen kaufen nicht mehr so viel und die Arbeitgeber zahlen nicht mehr so viel. Es bildet sich ein Teufelskreis nach unten. Die Verdienstmöglichkeiten schwinden immer schneller, die Anzahl der Arbeitslosen wächst.
Die großen Wirtschaftstheorien suchen in schwierigen Zeiten wie heute stets nach Antworten auf die Frage, wie in solchen Katastrophen reagiert werden könnte. Die Keynesianer, Anhänger der Theorien von John Maynard Keynes, schwören auf staatliche Stützungsprogramme und Zinssenkungen. Der Staat soll notfalls Schulden aufnehmen (deficit spending, geprägt vom amerikanischen Ökonomen Abba P. Lerner) und die Wirtschaft durch gezielte Nachfrageerhöhung stützen. Der Staat kann auch neue Stellen schaffen und Arbeitsprogramme auflegen oder neue Beamte ernennen. Dadurch soll ein Abgleiten der Wirtschaft verhindert werden. Im Unglück trägt die Gemeinschaft Sorge.
Ich halte dieser Idee einmal Logik entgegen. Die Aufwärtsbewegung hat in Euphorie dazu geführt, dass die Menschen in rosaroten Zukunftserwartungen schwelgten und eben weit über ihre Verhältnisse lebten. Das muss sich früher oder später rächen und wieder einrenken. Deshalb muss die Wirtschaft wieder hart auf den Boden zurück, einen Bereich, in dem nachhaltig und zufrieden gelebt werden kann. Wenn nun der Staat schon beim ersten Jammer nach dem Hochmutsfall eingreift und die Not mildern will, so versucht er damit doch, das Leben über die Verhältnisse weiterhin möglich zu machen! Geht das? Natürlich nicht. Deshalb versagen zu frühe Staatsprogramme, die den Luxus oder einen zu hohen Besitzstand festhalten wollen. Klar? Die Keynesianer scheinen nicht ganz falsch zu argumentieren, aber sie sagen nicht, wo die Unterstützungslinie sein soll. Keynes selbst, anders als die Keynesianer, hat auch gar nie »deficit spending« gewollt, sondern eine antizyklische staatliche Nachfragepolitik gefordert. Die soll in guten Zeiten Rücklagen aufbauen und in schlechten Zeiten notwendige Investitionen nachholen.
In meinen Worten: Wenn die Konjunktur hochschnellt, wenn also die einzelnen Menschen leicht verrückt werden und sich mehr leisten, als sie können, dann soll der Staat wenig investieren, keine Beamten einstellen, keine Autobahnbrücken bauen und keine neuen Waffenprogramme genehmigen. Er soll das Geld dafür zurücklegen. Wenn anschließend die Wirtschaft und die Menschen aus dem Rausch abstürzen, soll der Staat diese Investitionen »nachholen« und damit die Schwankungen im System dämpfen.
Keynes will, dass der Staat vernünftig ist, weil es die Wirtschaft und die Individuen anscheinend nicht sein können. Selbst wenn der Staat vernünftig ist – reicht das?
Indianer sagen: Wenn es sehr, sehr viele Büffel gibt, so isst man trotzdem nur so viel wie sonst. Aber wenn die Menschen über ihre Verhältnisse leben und sich Lohnerhöhungen und Gastarbeiter leisten – werden sie sich dann in einer Demokratie eine vernünftige Regierung wählen? Sie wählen sich doch sicher eine mit den größten Versprechungen. Und die spart niemals für die Not danach. Keynes will in einer Zeit der euphorischen Unvernunft und im Kater danach Vernunft regieren lassen. Keynes war Mathematiker wie ich. Ich verstehe gut, wie er denkt. Es hilft aber nichts.
Die klassische Theorie von Adam Smith lehrt dagegen das Gesetz des Marktes. Dieses Gesetz regiert nach Smith die Wirtschaft, und nichts sonst. Eingriffe der Vernunft erscheinen den Ökonomieklassikern erstens überflüssig und nutzlos, ja, viele sagen, menschliche Eingriffe verzögerten nur den natürlichen Lauf der Dinge. Staatliche Eingriffe würden die Leiden des Marktes im Abschwung eher verlängern und verstärken. (So wie oben geschildert, verpuffen die Eingriffe ja auch wirklich und hinterlassen Schulden.) Adam Smith argumentiert mit seiner berühmten »unsichtbaren Hand«, die das Marktgeschehen weise hin und her führt und immer wieder ins Gleichgewicht zurückbringt. Die Gutsbesitzer essen doch immer gleich viel, auch wenn sie von Gier getrieben sind! Smith schreibt 1759 in Theorie der ethischen Gefühle, seinem ersten Werk: Auch unter ihrer natürlichen Selbstsucht und Raubgier geschieht dies: Von einer unsichtbaren Hand werden sie dahin geführt, beinahe die gleiche Verteilung der zum Leben notwendigen Güter zu verwirklichen, die zustande gekommen wäre, wenn die Erde zu gleichen Teilen unter alle ihre Bewohner verteilt worden wäre; und so fördern sie, ohne es zu beabsichtigen, ja ohne es zu wissen, das Interesse der Gesellschaft.
Der Markt selbst ist hier anscheinend die Vernunft, eben die unsichtbare Hand, die zum Gleichgewicht zurückführt.
Im seinem berühmten Hauptwerk Der Wohlstand der Nationen (1776) geht Smith näher auf das Gleichgewicht ein:
Der Wohlstand eines Staates steigt also mit der (arbeitsfähigen) Einwohnerzahl. Um den Faktor Arbeit zu vermehren, muss die Nachfrage nach Arbeit (und damit die Lohnhöhe) so weit steigen, dass die unteren Schichten mehr Kinder aufziehen können. Steigt der Lohn über die zur Aufzucht ausreichender Arbeitskräfte nötige Höhe, so wird ihn die übermäßige Vermehrung bald wieder auf die nötige Höhe herabdrücken. Dies funktioniert auch umgekehrt: Vermehrt sich die »Spezies Mensch« zu stark, so wird ihr durch Nahrungsmittelknappheit eine Grenze gesetzt. Dies geschieht dadurch, dass die meisten der in den fruchtbaren Familien der unteren Schichten geborenen Kinder sterben.
Adam Smith akzeptiert, dass das Gleichgewicht über Tod und Leben der Armen herbeigeführt wird.
Adam Smith starb 1790. Er war mit dem Erfinder James Watt befreundet. Smith erlebte nicht mehr, wie dessen Dampfmaschine auf die in den unteren Schichten geborenen Kinder wirkte.
Mit dem letzten Zitat von Adam Smith will ich Ihnen natürlich grell vor Augen führen, dass das Auf und Ab der Jagd nach den Verdienstmöglichkeiten sehr wohl mit dem Auf und Ab der Räuber und der Beutetiere zu tun hat. Geht es der Wirtschaft gut, vermehren sich Arbeit und Menschen. Geht es ihr schlecht, wird Arbeit zu knapp und Menschen verhungern.
Ist das so zu lautstark? Heute geht es Europa nicht gut. Die Ehen bleiben zunehmend kinderlos oder kinderarm, weil alle arbeiten müssen, um der Not zu begegnen. »Bekommt Kinder!«, appelliert die Regierung an die langfristige Vernunft der Individuen und Paare. »Hilf uns, Staat!«, bitten die in Not Geratenen. Der Staat hat nicht vorgesorgt, er ist verschuldet. Die Einzelnen haben nicht gedacht, dass sie je in Not gerieten.
Wir reden heute ganz verwundert vom entstehenden Prekariat, der neuen Armut bzw. der neuen Unterschicht, die sich gerade im so empfunden Überlebenskampf des globalen Wettbewerbs bildet. »Prekariat« – dieses Wort ist bestimmt ein Kandidat für das Unwort des Jahres. Es gibt heute wieder Arbeitsplatzbesitzer und Gelegenheitslöhner, so wie damals Gutsbesitzer und Tagelöhner. Wir erleben eine Zweiteilung der Gesellschaft in neuen Reichtum und neue Armut. Die da oben werden finden, die Verhältnisse sind für sie stabil. Allen da oben geht es gut. Die Gehälter für Manager und Top-Experten, für Stars und Sportler steigen ins Unermessliche. Denen da unten, die »offenbar nicht arbeiten wollen«, wird der Geldhahn zugedreht, denn »sie können nicht unendlich als Schmarotzer durchgefüttert werden«.
Wieder einmal ist es zu spät. Der Kampf um das Überleben im Abschwung wird mit Tunnelblick geführt.
Die Anstrengung der Vernunft ist hauptsächlich im Aufschwung zu leisten. Im Abschwung sind nur noch die Konsequenzen früherer Unvernunft auszubaden. Wer aber ausbadet, ist nicht vernünftig.
Im Kindergarten wird uns aus der Bibel vorgelesen. Wir hören dort alle dies (Genesis 41):
Joseph antwortete Pharao: [ …] Das ist nun, wie ich gesagt habe zu Pharao, dass Gott Pharao zeigt, was er vorhat. Siehe, sieben reiche Jahre werden kommen in ganz Ägyptenland. Und nach denselben werden sieben Jahre teure Zeit kommen, dass man vergessen wird aller solcher Fülle in Ägyptenland; und die teure Zeit wird das Land verzehren, dass man nichts wissen wird von der Fülle im Lande vor der teuren Zeit, die hernach kommt; denn sie wird sehr schwer sein. [ …] Nun sehe Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze, und schaffe, dass er Amtleute verordne im Lande und nehme den Fünften in Ägyptenland in den sieben reichen Jahren und sammle alle Speise der guten Jahre, die kommen werden, dass sie Getreide aufschütten in Pharaos Kornhäuser zum Vorrat in den Städten und es verwahren, auf dass man Speise verordnet finde dem Lande in den sieben teuren Jahren, die über Ägyptenland kommen werden, dass nicht das Land vor Hunger verderbe.
So agieren die Keynesianer faktisch nicht – denn sie wollen erst in der Not Getreide borgen, wenn keines da ist. So agieren die Gutsbesitzer im Sinne der Klassik nach Adam Smith auch nicht – sie zahlen Hungerlöhne und entlassen.
Besonnenheit und Maß im Aufschwung, das wäre es. Die Beutetiere müssten frühzeitig das Jagen einschränken. Das sagt die Vernunft. Tatsächlich aber herrscht der Instinkt, die Gier und die Euphorie im Auf, der Verdrängungskampf im Ab. Phasic Instinct.
Strebt der Markt in ein Gleichgewicht?
Gibt es ein Gleichgewicht zwischen Räubern und Beutetieren? Die Kurve der Bestandsläufe zeigt ein regelmäßiges Auf und Ab. Es gibt die beiden Extreme: Das Hoch, in dem die maximale Zahl von Beutetieren eine noch wachsende Zahl von Räubern anlockt. Das Tief, in dem beide Arten am Ende eines langen qualvollen Niedergangs angelangt sind.
Im Durchschnitt ist die Zahl der Räuber und Beutetiere konstant.
Die im entsprechenden Abschnitt gezeigte Kurve zeigt ein Auf und Ab zwischen den Extremen. Am oberen Punkt vermehren sich die Populationen gerade noch nach Herzenslust, vermehren sich stark, stürzen ab. Am Boden zermürbt erholen sie sich viel später. Was sagt da der Durchschnittswert? Ist er ein Gleichgewicht? Eine gerechte Mitte? Nein, denn der Durchschnitt wird ja förmlich nach unten oder oben durchbrochen, er hat im Prozess des Auf und Ab keine inhaltliche Bedeutung.
Die Extreme sind Endpunkte einer übertreibenden Bewegung. Zwischen ihnen pendelt alles hin und her. Die Bewegung strebt keineswegs auf ein physikalisches Gleichgewicht zu. Im Sinne der Physik ist ein Gleichgewicht ein Zustand der Stabilität. In der Physik bezeichnet »das Gleichgewicht« ein System mit nur kleinen Schwankungen. In der Ökonomie bedeutet »Gleichgewicht« den Ausgleich von Angebot und Nachfrage, der sich automatisch »durch die unsichtbare Hand« über den Preis in effizienten Märkten bildet. Der freie Markt mit dem ausgleichenden Preisregulativ führt also nicht zu einem stabilen Punkt oder einem physikalischen Gleichgewicht, sondern das sofortige Ausgleichen von Angebot und Nachfrage führt zu einer schnelleren Pendelbewegung in den Märkten. Das Hin und Her funktioniert reibungslos!
Die meisten Menschen »des Westens« empfinden diese Schwankungen nicht so extrem, weil sie als Einwohner der Industrieländer traditionell (noch) nicht zur impliziten Manövriermasse des Auf und Ab zählen. Die Gutsbesitzer, die von Adam Smith studiert wurden, sehen natürlich das Leben und Sterben der Unterschichtkinder nur von Ferne, wenn sie aus dem Fenster ins Dorf schauen. Ihre eigenen Einnahmen schwanken nur schwach um einen mittleren Wert, den sie wohl die stabile Mitte oder den Durchschnittswert nennen würden, um den alles pendelt. Daraus kann man eine schöne Gleichgewichtstheorie machen – gerne. Wenn ich aber die Welt aus der Sicht der Unterschichtkinder oder gar aus der Sicht der hungernden Dritten Welt betrachte? Diese Welt schwankt zwischen den Extremen »gutes Leben« und »nackter Tod«. So wie das Wetter im Jahr zwischen Frost und schwüler Hitze schwankt. Natürlich kommen die Temperaturen im Frühling und Herbst kurz am mittleren Wert, der Durchschnittstemperatur vorbei, aber deshalb sind sie nicht ein »physikalisches Gleichgewicht«, das von der unsichtbaren Hand angestrebt wird.
Die Wirtschaftswissenschaften teilen sich in Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Die Betriebe gehen haushälterisch (oikos wie Haushalt, nomos wie Gesetz, zusammen Ökonomie) und wirtschaftlich mit den so viel besprochenen »knappen Gütern« um. Die Volkswirtschaft bemüht sich um das Verständnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge auf allen Ebenen (Mikro-, Makroökonomie). Wie kann das ökonomische Handeln des Menschen verstanden werden? Welches Handeln bringt den größten Nutzen für den Einzelnen? Darüber denken »alle« nach.
Eine viel wichtigere Frage für mich ist: Können wir gemeinschaftliche Richtlinien oder Handlungsmaximen vereinbaren, unter denen die todbringenden Schwankungen gedämpft werden? Können wir jeden Einzelnen zu Selbstverantwortung und Selbstdisziplin führen? Zum Beispiel: »Iss nur so viele Büffel, wie es weise ist.« In heutigen Vokabeln ausgedrückt: Wie vermeide ich »Phasic Instinct«? Wie schaffen wir dauerhaftes »stabiles Wachstum«? Konsens? Gemeinsamkeit? Was wären gute Rahmenbedingungen dafür?
Wie rüsten wir in fetten Jahren für die mageren?
Bevor ich darüber mit Ihnen nachdenke, zeige ich Ihnen erst, wie wir die Abwärtsbewegungen selbst herbeiführen. »Die Zeiten drehen sich! Es kommt eine schlechte Zeit! Nehmt schnell noch mit, was irgendwo noch greifbar ist!«, sagen wir. Im Grunde schießen wir die letzten Büffel, würden die Indianer sagen. Voller Angst werden die letzten Sardinen in Monterey gefischt, werden heute die letzten Thunfische aus dem Meer geholt. Es ist der Punkt, an dem die fetten Jahre zu Ende zu gehen scheinen. Stress!
Unter Stress zum Prekariat
Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie lang anhaltende Stresszustände die Ökonomie fast nach einem feststehenden Programm zerbröseln. Wir werden von vernünftigen Menschen zu solchen, die alle Ethik vergessen und sich sehr kurzfristig (bis zur Blindheit oder Verblendung) um den eigenen »Erfolg« kümmern und alle anderen ebenfalls mit in den Strudel reißen. Das ist ein Dauerthema des Buches: Der rationale Homo oeconomicus ist allenfalls ein Kunstgedanke für halbwegs gute Zeiten, in denen Rationalität sogar kurzfristig nützt. In schlechten Zeiten regiert die Kopflosigkeit. Kennt die Wirtschaftstheorie Tunnelblick-Menschen? In Lehrbüchern nicht, aber um mich herum wuseln sie gerade.
Wie der Stresslevel so der Mensch
Unter Stress sind wir ungeduldig und eilig. Wir leiden unwissentlich unter einem Tunnelblick nur für das, was jetzt gerade unbedingt getan werden muss. Kein Gedanke mehr an ein Morgen! In dieser Stimmung nehmen wir die Welt nur noch schwarz-weiß wahr und sehen keine Grautöne mehr geschweige denn Farben.
Unter Stress teilt sich alles:
→ in Freund und Feind.
→ in wichtig und unwichtig.
→ in ja und nein.
→ zum Schluss in reich und arm.
Merken Sie es heute schon um uns herum? Das Mittlere verschwindet. Die mittlere Qualität in den Läden siecht dahin: Armani oder Aldi bleiben. Die mittleren, normalen Menschen braucht man nicht mehr so recht. Premium-Leistungsträger werden gesucht und viele, viele Aushilfskräfte je nach Bedarf.
Unter dem Dauerdruck von Stress und hoher Arbeitsbelastung kommt es zu aggressivem Verdrängungswettbewerb. Er ist wie Krieg. Es gibt wenige Sieger und viele Verlierer. Unter Stress sagen wir: »Ich hatte es so sehr eilig – aber keiner wollte mich vorlassen! Alle sind so rücksichtslos. Das merke ich mir, ich will jetzt auch rücksichtslos sein. Ich kann es mir offenbar nicht leisten, nicht rücksichtslos zu sein.« Das ist schon wie der Beginn von Kriegshandlungen. Sie führen zu gegenseitigen zermürbenden Verlusten. Diese Teufelsspirale ist Thema dieses Kapitels. Sie führt zum Niedergang bzw. zur Bildung eines großen Prekariats.
Ich beginne in diesem Abschnitt ganz harmlos mit ein paar Beispielen aus dem Alltag. Die sind noch »neckisch«. Aber Sie drücken schon das Typische aus, wie ich es Ihnen im wirtschaftlichen Leben darstellen möchte. Fangen wir an:
Sonntag. Sie wollen duschen, es ist schon spät. Die Sonne scheint. Der Duschhebel steht noch in der optimalen Stellung vom Samstag – genau die richtige Temperatur. Sie schalten an, das Wasser rauscht. Es ist noch zu kalt, da räumen Sie noch ein bisschen, finden sich im Spiegel attraktiv, vergessen ein bisschen die Zeit – ach ja! Duschen! Es ist schon wohlig warm – optimal. Sie duschen und summen ein Lied.
Montag. Monday, Monday! Sie wollen duschen, es ist schon spät. Der Duschhebel steht noch vom Sonntag optimal! Das Wasser ist aber noch zu kalt, als Sie blitzschnell und mürrisch in die Duschkabine springen. Schnell! Mist, zu kalt! Sie reißen den Hebel auf Heiß. Es wird augenblicklich wärmer. Dann sehr heiß. Mist, die Haut schmerzt. Sie pegeln hinunter. Mist! Zu kalt. Es ist zum Verzweifeln!
Ich will sagen: Wie Sie duschen, hängt von Ihrem Instinkt, Ihrem gefühlten Stress oder Ihrem Gelassenheitsgrad ab. Am Sonntag sind Sie eher zu sorglos, trödeln ein bisschen und verschwenden Wasser. Am Montag soll alles sehr schnell gehen, und Sie brechen die Sache übers Knie. Das machen Sie jeden Montag Ihres Lebens. Haben Sie schon einmal nachgedacht, was »optimal« wäre? Sie können es versuchen, aber das schnelle Einstellen auf eine gewünschte Temperatur ist ein auch mathematisch sehr anspruchsvolles Problem. Es ist so irre schwer, dass es sich nicht lohnt, viel Geist daran zu verschwenden. Das tun die Mathematiker aber sehr wohl, wenn sie zum Beispiel Hochöfen auf die richtige Temperatur anheizen. Dazu kocht man das Erz einen Tick zu schnell an, so dass die Temperatur ein bisschen höher schießt als gewünscht. Das spart Zeit – und dann wird Schrott hinzu geworfen, damit sich die Erzmischung um das Bisschen zuviel abkühlt. Es ist aber auch dort ein Kunsthandwerk, möglichst schnell alles bereit zu haben. Im Stahlwerk bedeutet das optimale Anheizen viel Geld – das versteht sich von selbst!
Solche Beispiele kann ich zuhauf anführen. Am Sonntag bei Sonne fahren die Sonntagsfahrer gemütlich umher und betrachten relaxt die schöne Landschaft. Sie wenden Zeit für Seelenruhe auf. Am Montag fahren sie in großer Eile Rennen, was zu Staus führt. Immer am Montag sind die Staus am größten! Am Freitagnachmittag auch! Hupen, drängeln, jeder der Erste im Stau! Es gibt Untersuchungen, wie man optimal fahren könnte – etwa ganz ruhig im Tempo 90, wie es in Amerika üblich ist. Nein, wir fahren je nach Stimmung! Hinfahrten sind oft ein Martyrium, weil das pünktliche Eintreffen wichtig ist. Die Rückfahrt ist stressfrei, weil es nicht so darauf ankommt, wann wir zu Hause sind. Dauert die stressfreie Rückfahrt länger? Ich glaube nicht.
Neulich durfte ich einmal ein paar Flugminuten das Fliegen eines Jumbos 777 im Flugsimulator der Lufthansa im Frankfurter Flughafen üben. Der Fluglehrer hat uns gesagt, wir sollen starten. Das ist einfach. Ich bin schon nach einigen Sekunden ganz euphorisch geworden. Ich bin oben in der Luft eine Runde geflogen, das war schön und ganz einfach. Dann sollte ich landen. Unten an der Landebahn sieht man von ganz weitem sechs Scheinwerfer. Wenn drei davon leuchten, ist das Flugzeug optimal in der Einflugschneise. Wenn mehr oder weniger aufleuchten, ist das Flugzeug zu hoch oder zu tief. Ich muss dann als Pilot gegensteuern. Ich hab das genau wie beim Duschen angestellt. Hochreißen! Runterdrücken! Hoch! Runter! Ich habe gedacht, der Jumbo ist so ähnlich wie ein Auto, das ja auf Lenkversuche sofort reagiert. Ein Jumbo reagiert erst gar nicht, aber dann doch! Er ist schwerfällig wie ein Flugzeugträger oder eben eine Dusche. Ich verlor die Kontrolle. Zuerst über das Flugzeug. Es bockte wie bei einem Rodeo. Überall begannen Lämpchen zu blinken. Warntöne! Es wurde hektisch und laut. Ich drehte innerlich durch. Der Fluglehrer war der einzige, der noch wusste, dass wir im Simulator saßen. Mir wurde physisch bange. Dann crashte ich den armen Jumbo auf der Frankfurter Landebahn. Mensch, da war mir ganz anders, sage ich Ihnen! Der Trainer lächelte. Ich fühlte mich vernichtet und musste einen neuen Versuch starten. Beim zweiten Mal war ich beim Landeanflug wieder falsch dran, ich tippte das Steuer ein klein wenig, der Jumbo gehorchte wie gewünscht! Ich konnte das Flugzeug buchstäblich ganz entspannt »mit einem Finger« sicher landen. Es reagiert mit einer Verzögerung wie ein Auto. Fliegen ist kinderleicht! Ich war erneut ganz euphorisch. Ich war plötzlich ganz sicher, dass ich es wie im Film auch mit einem echten Flugzeug schaffen würde. Es war ja praktisch »ein echtes Flugzeug« im Simulator. Der Trainer sagte: »Sie müssen jahrelang üben, bis Sie wirklich gut sind. Aber der Lernhöhensprung vom ersten zum zweiten Mal ist irre groß. Nach dem ersten Aha lernen Sie nie mehr so viel in einem einzigen Augenblick. Dann müssen Sie jedes kleine bisschen Erfahrung lange üben.« – »Jahrelang?«, fragte ich. Und da flogen wir noch eine dritte Runde im Nebel mit starkem Seitenwind, plötzlichen Böen und so weiter, so dass uns die schiere Angst packte. Wieder ein Crash. Okay, wir lernen doch besser noch jahrelang.
Sorglosigkeit ist nicht so gut, wenn es optimal laufen soll. Verbiesterung auch nicht. Das »echte« Optimum muss man irgendwie in den Körper bekommen. »Ins Gefühl.« Das mathematische Optimum aber ist selbst für einen Computer schwer zu finden.
Fliegen können Sie lernen! Duschen auch. Ich kann Ihnen außerdem erklären, dass Sie vor dem Aufzug in großer Eile ausschließlich den Knopf »Hoch« beim Aufzug drücken sollten, wenn Sie hoch wollen. Sie sollten aber nicht auch noch »Hinunter« drücken! Entweder ist ein Aufzug frei, dann kommt er, weil Sie hoch wollen. Oder es ist keiner frei, dann aber hält einer zusätzlich, der gerade hinunterfährt und denkt, er nimmt sie noch mit. Dadurch kommt es zu einem unnützen zusätzlichen Halt, der die Anlage belastet. Wenn viele Leute beide Knöpfe drücken, arbeitet die Anlage zu großen Prozentsätzen unsinnig. Leider kommen die meisten Leute erst auf die Idee, beide Knöpfe zu drücken, wenn sie das Gefühl haben, dass die Anlage bereits überlastet ist. Sie sind ungeduldig wie beim Duschen. Wenn also die Anlage zu 90 Prozent ausgelastet ist, drücken viele Leute beide Knöpfe, damit die Anlage noch 20 Prozent mehr arbeiten muss. Verstehen Sie? Ich stehe vor einem Aufzug, vor dem sich mehrere Menschen sammeln, weil er überlastet ist. Plötzlich zuckt eine ungeduldige Hand hervor und drückt auch nach unten. Zwei Drittel der Wartenden stöhnt innerlich auf. Dumm! Jemand sagt: »Es geht dadurch nicht schneller!« Die Antwort ist: »Langsamer bestimmt auch nicht!« Dumm!
In diesem Beispiel steckt viel Erkenntnis über die Ökonomie an sich. Ein bisschen Dummheit, Ungeduld oder Raserei (wie beim Autofahren) überall und ein überlastetes System bricht zusammen. Ein überholender LKW in kritischer Verkehrslage kostet Tausende Menschen eine Stunde ihres Lebens. Ein kleiner Prozentsatz von Ladendieben beschert uns Überwachungskameras wie in einem Polizeistaat. Nur ein paar Mörder kosten Unsummen an Kriminalbeamten. Das Unsolidarische, Unethische, Schlaue, Trickreiche, Listige kostet uns Unmengen von Geld! Ein paar gerissene Geduldsfaden, erlittene Ungerechtigkeit, Protest in Not oder der Terror überlastet das System bis zum Crash … Viele Strategien im Management sind schlau, überlisten den Wettbewerb, schlagen der Konkurrenz ein Schnippchen, laden Arbeitslose auf das Staatssäckel ab. Alle agieren einzeln vermeintlich klug, manche überklug – es ist heute en vogue, an die Grenzen zu gehen oder sie zu überschreiten, wenn gerade keiner zuschaut. Leider kommt es dadurch zu einem Crash des Systems … Alle reißen – bildlich gesprochen – an den Duschhebeln in einem Hotel, an dem um acht Uhr morgens die Warmwasseranlage überlastet ist. Ist Wirtschaft meistens »wie Montag«?
Beim Duschen, Autofahren, Fliegen, Managen gibt es optimale Lösungen für das Ganze. Kennt die jemand? Kümmern sie jemanden? Und schlimmer noch: Hilft das Wissen um das Optimale überhaupt, wenn es nicht alle wissen oder wenn manche trotz des Wissens ausscheren aus »Schlauheit« oder List? Kann ein Unternehmer weise wirtschaften, wenn alle Welt sonst durchdreht? Können Sie im Stau vernünftig fahren? Je mehr Menschen beteiligt sind, umso stärker hängt das System von der durchschnittlichen Intelligenz ab! Nicht mehr von Ihrer eigenen! Große Dummheiten kosten Unsummen, etwa globale Dummheiten in einer globalisierten Welt. Hohe Intelligenz hat Mühe, überhaupt erkannt zu werden (siehe Aufzugbeispiel).
Auch wenn feststeht, wie etwas bestmöglich zu tun wäre – wenn wir unter Stress stehen, suchen wir einen Trick, eine Abkürzung, eine Schummelei oder etwas Schmerzfreies. Es ist Not! Es handelt sich um eine Ausnahme! Weil aber alle unter Stress so handeln, ist die Welt so herzlich mäßig, wie sie ist. Karriere, Autofahren, Parkplatzsuche, Schlangestehen, Aufsatzschreiben, Sex, Gesundheit – immer gibt es so etwas wie einen richtigen Weg und dann einen für den Fall, dass es die Eingeweide ganz eilig haben.
Im normalen Leben gibt es immer etliche Egoisten, Stress hin oder her, die stets machen, was sie wollen. Aber unter Stress fühlen wir uns so ziemlich alle zu einer Ausnahmehandlung berechtigt. Leider funktioniert dann bei allgemeinem Stress das System nicht mehr. Ein Einzelraser kommt irre schnell ans Ziel. Wir fluchen. »Er fährt einfach so bei Rot!« Ein einzelner Egoist rafft alles an sich. Ein Chef erzählt, er allein habe alles geleistet. Wir sind neidisch. Einzelne haben Erfolg, weil sie das System missbrauchen oder sich nicht an die kulturellen Regeln halten. Wir sehen jeden Tag, dass Menschen unter Stress eine Ausnahme für sich geltend machen und damit besser abschneiden. »Ich konnte wegen Überlast nicht kommen. Schön, dass ihr jetzt meine Arbeit mit erledigt habt! Danke!« Ladendiebe lassen etwas mitgehen, Einzelne erschwindeln Arbeitslosenunterstützung, Studenten schreiben bei Prüfungen ab, Große drängeln sich vor. »Entschuldigung, es ist so ein Stress!«, argumentieren sie. Die Stressfreien scheinen die Zeche zahlen zu müssen. Sie fühlen sich wie »der Dumme«. Der Schummler aber »war schlau«.
Wenn »wir Ehrliche« dem Treiben und dem Erfolg des Egoismus ein bisschen zugesehen haben, dann reißt uns irgendwann auch der Geduldsfaden. Wir sagen: »Jetzt will ich so rücksichtslos sein wie alle.« Wie schon gesagt, in diesem Augenblick, wo alle rücksichtslos sein wollen, beginnt der Krieg.
Unter Hochdruck pervertiert das Denken. Das Ganze wird verdrängt, das Egoistische dominiert.
Ich verdeutliche Ihnen diese einfachen Gedanken nun im echten Wirtschaftsalltag. Ich beginne mit der Schilderung des normalen Schweinezyklus, der aus naivem Egoismus im Auf und gestresstem Bremsen im Ab entsteht. Dann kommen die Manager der Schweinefabriken und verstärken diese Tendenzen, indem sie noch mehr Stress auf das System laden. Am Ende gibt es Gammelfleisch und Polizeikontrollen, Betriebszusammenbrüche und Hungerlöhne.
Der Schweinezyklus
Das Wort Schweinezyklus kennen wir, seit 1928 Arthur Hanau seine Dissertation Die Prognose der Schweinepreise