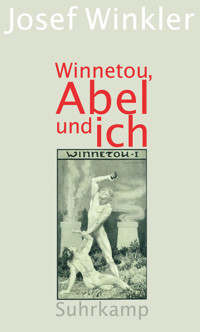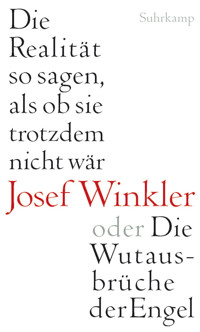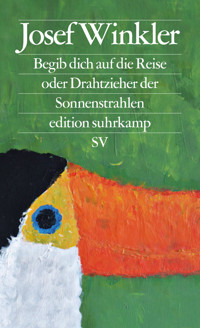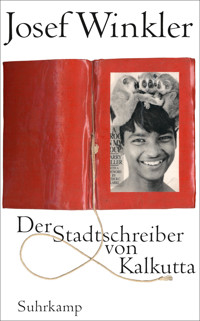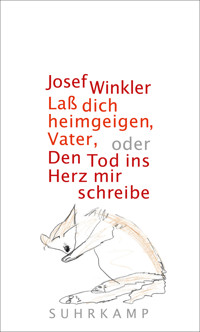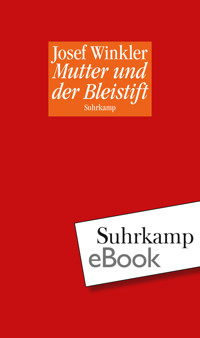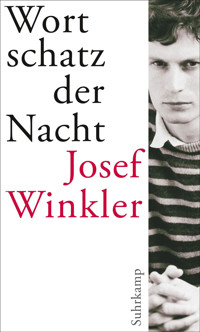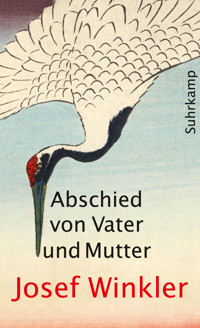
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Abschied von Vater und Mutter vereinigt die beiden Requiemtexte Roppongi – Requiem für einen Vater (2007) und Mutter und der Bleistift (2013). Als Josef Winkler sich im Jahre 2004 eine Zeitlang in Tokio im Stadtteil Roppongi aufhält, ereilt ihn die Nachricht vom Tod seines fast hundertjährigen Vaters. Noch ein Jahr zuvor hatte der Alte ihn beschworen, seinem Begräbnis fernzubleiben, weil der Sohn nicht müde geworden war, den seligen Frieden seines Kärntner Heimatdorfes mit seiner Schreibhand zu durchkreuzen. Eine Zeit danach erscheint die Erinnerungsgeschichte Roppongi – Requiem für einen Vater, die den Leser an Schauplätze in Japan, Kärnten und Indien führt. Das Requiem für Josef Winklers im Jahre 2011 verstorbene Mutter Mutter und der Bleistift, in dem die Mutter ihren am Küchentisch kritzelnden linkshändigen Sohn immer wieder auffordert, den Bleistift in die rechte Hand zu nehmen, entsteht in Südfrankreich, Indien und Kiew. „Reisen, um heimatlos zu werden“, heißt es bei Henri Michaux. Nach dem Tod von Vater und Mutter ist der Linkshänder, der mit der rechten Hand schreiben gelernt hat, seine Heimat losgeworden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
In der österreichischen Botschaft in Tokio, im Stadtteil Roppongi, wo man mir das Ableben meines Vaters mitteilte, schaute ich, vor einer großen Glasscheibe stehend, auf einen Teich hinaus, an dessen Rand soeben ein Reiher aufsetzte. Der tote Vater läßt sich also, dachte ich in diesem Augenblick der Trauer und des Glücks, in der Gestalt eines weißen Reihers noch einmal bei mir blicken, bevor er unter die Erde geschaufelt wird mit seinen langen, dünnen roten Beinen, mit seinem erdig gewordenen spitzen, langen Schnabel, auf der Suche nach den Würmern seines zukünftigen Grabes in Roppongi. Der Tod des fast hundertjährigen Vaters kam wie gerufen, sein Fluch ging in Erfüllung, ich reiste nicht zurück zu seinem Begräbnis nach Österreich, sondern blieb in Roppongi, denn ein Jahr zuvor hatte mich der Alte beschworen, seinem Begräbnis fernzubleiben, weil ich es nicht müde geworden war, den seligen Frieden meines katholischen Kärntner Heimatdorfes mit meiner Schreibhand zu durchkreuzen. Die Erinnerungsgeschichte Roppongi – Requiem für einen Vater führt den Leser an Schauplätze in Japan, Kärnten und Indien.
Mutter und der Bleistift, das Requiem für eine Mutter, ist in Indien, Kiew und Südfrankreich entstanden. Als ich in der Église in Lagrasse eine Frau beobachtete, die in der Muschel des trockenen Weihwasserbeckens die Kalkreste berührte und ein Kreuzzeichen machte, erinnerte ich mich an eine Zeit, als das Weihwassertrinken noch geholfen hat, und an meine schweigsame Mutter an der Singer-Nähmaschine, die zu mir, dem Erzministranten, sagte: »Bring mir wieder eine Flasche Weihwasser aus der Kirche!« Gleichzeitig forderte sie mich, ihren am Küchentisch kritzelnden Sohn und Linkshänder auf, den Bleistift in die rechte Hand zu nehmen. Monatelang rief sie: »Wirst du wohl den Bleistift in die schöne Hand nehmen?!« Zur Beerdigung legt ein Gehilfe des Bestatters im Auftrag des Sohnes, aus dem ein Schriftsteller geworden ist, der verstorbenen Mutter als letzte Gabe eine Glasflasche voll Weihwasser in den Sarg.
Josef Winkler, geboren 1953 in Kamering (Kärnten), lebt in Klagenfurt. Zuletzt erschienen: Winnetou, Abel und ich (2014); Wortschatz der Nacht (2013); Die Realität so sagen, als ob sie trotzdem nicht wäroder Die Wutausbrüche derEngel (2011). 2008 wurde er für sein literarisches Werk mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet.
Josef Winkler
Abschied vonVater und Mutter
Abschied von Vater und Mutter vereinigt die beiden TexteRoppongi. Requiem für einen Vater (2007)und Mutter und der Bleistift (2013).
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4592
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2007; Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer, Waldbüttelbrunn
Umschlagabbildung: Utagawa Hiroshige, Minowa, Kanasugi, Mikawashima, Nr. 102 der Farbholzschnittreihe 100 berühmte Ansichten von Edo, 1857, Brooklyn Museum.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-74139-9
www.suhrkamp.de
ROPPONGI. Requiem für einen Vater
Dhrupad und das Aussterben der Geier
Reisevorbereitungen auf dem Lande
Zeit der Gladiolen
Der am Flußufer eingeeiste Sarg
Roppongi
Tausend und eine Nacht
Die Ankunft in Varanasi
Mahashmashana – Die große Verbrennungsstätte
Der Ritus des Schädels
Die roten indischen Notizbücher
Die Glocken von Santa Fé
MUTTER UND DER BLEISTIFT
Da flog das Wort auf
ROPPONGI
Komm, Väterchen, und sieh:Die kahlen Bäume mehren sich.Komm nur heraus und nimm dein Brett.Jetzt wird es Zeit zu gehen.Narayama-Lied
DHRUPADUND DAS AUSSTERBEN DER GEIER
»Auf dem Narayama wohnte ein Gott. Alle, die zum Narayama gegangen waren, hatten ihn gesehen. Darum gab es niemand, der daran zweifelte. Da jeder wußte, daß es den Gott wirklich gab, feierte man ein Fest, das man mit besonderer Sorgfalt vorbereitete, wie sie auf keine andere Feierlichkeit verwandt wurde. Schließlich war es, als hätte es immer nur ein einziges Fest, nämlich das Narayamafest gegeben. Und da es außerdem unmittelbar vor dem Totenfest stattfand, waren das Toten-Lied und das Narayama-Lied schließlich miteinander verschmolzen.«
IM FEBER DES JAHRES 2002 schrieb ich an den Schriftsteller Bodo Kirchhoff eine Ansichtskarte aus dem indischen Varanasi nach Frankfurt mit den Worten: »Stell dir vor, Bodo, du wirst es nicht glauben, in Indien sind die Geier fast ausgestorben. Sie hockten einen Monat lang bewegungslos auf den Bäumen und plumpsten dann – wie Steine – tot zu Boden. Millionen müssen es in ganz Indien gewesen sein. Nur im Bundesstaat Rajasthan soll es noch welche geben. Ich sage immer: Vor den Dichtern sterben die Geier. Daran wird die Welt untergehen, dabei, Bodo, haben wir keine schlechte Zeit gehabt in den letzten zwanzig Jahren, seit 1979, als unsere ersten Bücher erschienen sind mit viel Eifer und viel Zorn. Schöne Grüße aus Indien: Josef (Winkler).« Jetzt, während ich zu schreiben beginne und sage, daß die Geier in Indien fast ausgestorben sind, höre ich Dhrupad. Dhrupad ist die Urform der klassischen indischen Musik, der älteste Stil nordindischer Kunstmusik, die im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts zu ihrer endgültigen Ausprägung gelangte, die noch heute existiert und deren Ursprünge auf die Veden zurückgehen. Die Struktur von Dhrupad soll bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen. Einer Legende zufolge gaben die indischen Götter den Menschen die Musik zum Spiel, um das Böse auf Erden zu zerstreuen. Dhrupad wurde zur Grundlage der gesamten nordindischen Kunstmusik. Die Aufführung eines Ragas soll das Publikum nicht unterhalten. Das Raga stellt vielmehr ein Gebet dar, einen Ausdruck religiöser Gefühle, und versucht, im Zuhörer das Bewusstsein Gottes zu erwecken. Jahrhunderte mündlicher Überlieferungen von Lehrer zu Schüler sicherten diesen Stil bis in die heutigen Tage. Sein Können ermöglicht es dem Sänger, eine weite Palette von Klangfarben und subtilen mikrotonalen Schattierungen zu erzeugen. Der Sänger, so heißt es, spielt mit seinem Atem das von Gott erschaffene Instrument.
Der große Dhrupadsänger Fahimuddin Daggar sagte zu den Grundmerkmalen der klassischen indischen Musik: »Laut der indischen Mythologie zeigt Musik den Weg zu Moksha, zur Befreiung also. Unsere Vorfahren widmeten ihre Musik dem allmächtigen Gott, um dadurch Moksha zu erlangen. Unsere Hindureligion ist anscheinend die einzige in der ganzen Welt, die den Glauben an die Seelenwanderung beinhaltet. Über Jahrtausende war der Mensch nicht imstande, sich aus dem Zyklus von Leben und Tod zu lösen. Der göttliche Zweck der Menschheit besteht darin, Moksha zu erlangen, und ohne Moksha kann sich die Seele nie endgültig von ihrer sterblichen Hülle befreien. Musik ist nur einer von verschiedenen Wegen, die zu diesem Ziel führen.« Aber nein, ich schalte das Radio wieder aus, ich kann nicht gleichzeitig schreiben und Dhrupad hören, ich muß mir die Musik bei einer anderen Gelegenheit anhören. Vor allem dann, wenn ich pausenlos in meinem Zimmer auf und ab gehe und dabei immer wieder auf das Radio hinstarre, oder auch nachts vor dem Einschlafen und zum Einschlafen, wenn ich längst wegträume, singt für mich Fahimuddin Daggar Dhrupad und verwischt, bevor ich ganz schlafe, während die Musik immer noch weiterläuft, die Hinterglasmalerei eines Bildes aus meiner Kindheit, als ich mich vor dem Einschlafen auf das Kopfkissen kniete, die Hände faltete, aufs große Heiligenbild schaute, das Schutzengelmein betete und, unter die Wolldecke schlüpfend, mit meinen nackten Zehen an den heißen, mit einem Tuch umwickelten Ziegel stieß in der eiskalten Winternacht, den ich in der Küche auf den noch heißen Sparherd gelegt und, wenn er heiß genug war, ins Schlafzimmer getragen und am Fußende ins Bett hineingesteckt hatte. Ich kann jetzt also nicht Dhrupad hören, nicht jetzt und heute beim Schreiben. Ich stelle das Radio aus und kehre wieder zu den Geiern zurück.
Innerhalb von zehn Jahren sind in Indien, Pakistan und Nepal Millionen von Indischen Geiern, Bengalengeiern und Schmalschnabelgeiern gestorben. Je nach Art haben lediglich ein bis drei Prozent der Aasvögel überlebt. Die betroffenen Tiere zeigten gichtähnliche Symptome und starben schließlich an Nierenversagen. Einen Monat lang hockten sie unbeweglich auf den Bäumen, ließen ihre Köpfe tief, fast zwischen ihre Beinen hinunterhängen und plumpsten von den Ästen. Während zunächst eine noch unbekannte Virusart vermutet wurde, fanden Forscher inzwischen heraus, daß das Medikament »Diclofenac« Hauptverursacher des Massensterbens der Geier ist. Dieses aus der Humanmedizin stammende, entzündungshemmende Schmerzmittel wird seit den Neunzigerjahren in Indien, Pakistan und Nepal auch in der Tiermedizin eingesetzt, vor allem bei Rindern. Die Geier nahmen den Wirkstoff über Haustierkadaver auf.
Noch immer bringen die Menschen die Kadaver der heiligen Kühe, die nicht geschlachtet und verspeist werden dürfen, auf Müllhalden an die Stadtränder, wo sie gehäutet werden, aber statt der Aasgeier tummeln sich nunmehr Meuten von Straßenhunden auf den Kadaverdeponien, eine gefährliche Seuchenquelle für Mensch und Tier. Innerhalb von zwanzig Minuten wurde ein Kuhkadaver von den Geiern skelettiert. Die Vermehrung der Hunde erhöht die Tollwutgefahr für die Menschen. Geier haben eine so starke Magensäure, daß ihnen Cholera und Milzbrand nichts anhaben können, und sie sind durch ihr Immunsystem vor den Erregern im verwesenden Fleisch geschützt, aber jetzt tragen wilde Hunde und Krähen die lebensgefährlichen Erreger zu Mensch und Tier in die Dörfer und Städte.
Außerdem haben Geier in Indien eine besondere Bedeutung für die 120 000 Parsen. Nach ihrem Glauben darf ein menschlicher Leichnam nicht die Elemente Erde, Wasser und Feuer beschmutzen. Traditionell bieten die hauptsächlich in der Region um Bombay lebenden Parsen ihre Toten den Geiern in Steintürmen, den »Türmen des Schweigens«, zum Fraß dar. Diese Bestattungsmethode wurde nun untersagt, da es nicht genügend Geier gibt, die die menschlichen Überreste verschlingen können. Aus der Geschichte weiß man, daß Geier, die in der Bibel als »Greuel« beschrieben werden, seit Jahrhunderten den Armeen nachgeflogen sind, etwa im amerikanischen Bürgerkrieg. Bei der Schlacht von Gettysburg gab es so viele Gefallene, daß gesagt wurde, die Geier hätten sich an den Leichen so vollgefressen, daß sie nicht mehr fliegen konnten, tagelang hockten sie zwischen den menschlichen Leichen, vor Übergewicht konnten sie nicht mehr auf den eigenen Beinen stehen und taumelten zwischen den toten Soldaten herum. In der Serengeti konsumieren Geier mehr Fleisch als Löwen, Hyänen und Leoparden zusammen. Man hat errechnet, daß die berühmte Savannenlandschaft der Serengeti über einen Meter tief unter Tierleichen begraben wäre, gäbe es nicht die Geier. In Spanien, wo es dank Schutzmaßnahmen wieder etwa 70 000 Gänsegeier gibt, benützen die Bauern die Geier als Bestatter. Anstatt zur teuren Tierkörperverwertung zu fahren, werfen sie ihre toten Haustiere den Geiern zum Fraß vor, in eigens eingerichteten sogenannten »Geierrestaurants«.
REISEVORBEREITUNGENAUF DEM LANDE
»Vor der Wallfahrt zum Narayama mußte sie sich auf jeden Fall – ganz gleich wie – eine Lücke in die Zähne schlagen, dachte sie. Wenn sie die Wallfahrt zum Narayama beginnen und sich auf das Brett setzen würde, das sich Tappei auf den Rücken geschnallt hätte, wollte sie wie eine schöne alte Frau mit lückenhaften Zähnen aussehen. Darum versuchte sie heimlich, sich die Zähne schartig zu schlagen, in dem sie mit dem Feuerstein dagegenhämmerte.«
KRISTINA WAR ALS KIND vom vierten bis zum achten Lebensjahr mit ihren Eltern und ihren beiden Schwestern in Indien, in Rourkela, in einer eisenerzreichen Gegend des indischen Bundesstaates Orissa, wo in den Sechzigerjahren ihr Vater als Ingenieur am Bau eines der modernsten Stahlwerke der damaligen Zeit mitarbeitete, das unter der Oberaufsicht der »Hindustan Steel Limited« von 35 großen deutschen und indischen Firmen errichtet wurde. Rourkela liegt am südöstlichen Rande eines Gebirges, am Brahmanifluß. Die Behörden enteigneten 32 Dörfer, von denen sie 16 völlig zerstörten. 13 000 Adivasi wurden umgesiedelt, 6 000 Ureinwohner blieben. Entwurzelt und ohne Aussicht auf Beschäftigung, lebten unzählige Adivasi als rechtlose Landarbeiter, als Schuldknechte oder als Kulis in den Slums der Städte. Wo die Adivasi mehrere tausend Jahre lang vom Ackerbau lebten, ziehen heute schwarze Rauchschwaden über riesige Slumsiedlungen, Chemikalien und Schmiermittel verschmutzen den Brahmanifluß. Rourkela war früher ein Dorf mit 2 000 Einwohnern, heute ist es eine Industriestadt mit 300 000 Menschen. Das Gelände für das Hüttenwerk und die geplante Wohnstadt, Steel City genannt, umfaßte über achttausend Hektar. In dieser Steel City waren 1800 Deutsche untergebracht, die man die Rourkela-Deutschen nannte, 40 000 Menschen arbeiteten am Projekt. Der eine Rourkela-Deutsche hatte am Eingang seines Bungalows ein großes Wappen seiner deutschen Heimatstadt aufgepinselt, der andere hatte über dem Eingang ein riesengroßes Glas schäumenden Biers mit der Aufschrift »Krombacher Pils« aufgemalt. Im »German Club«, im deutschen Krankenhaus und im Schwimmbad war den Indern der Zutritt verboten. Bei den nächtlichen Partys im German Club sangen die Rourkela-Deutschen gerne: »Es zittern die morschen Knochen …« und »O, du schöner Westerwald …«. Einmal nachts schossen betrunkene Rourkela-Deutsche auf die Haustür einer indischen Familie, in der Hoffnung, daß diese aus Angst vor weiteren Anschlägen ihre schöne, jugendliche Tochter den Wilderern übergeben würde. Im Laufe eines knappen Jahrzehnts wurde in Rourkela im Brahmanifluß ein einziges Krokodil von den indischen Dorfbewohnern entdeckt, das schließlich von einem im deutschen Krankenhaus arbeitenden Arzt erschossen wurde. Der Affe Jimmy, der nachts zwischen den Hühnern im Hühnerstall untergebracht wurde, der Bananen gestohlen hatte und den Leuten Bananenschalen entgegenwarf, wurde erschossen, weil er die sechs Meter langen, zum Trocknen aufgehängten Saris mit Lianen verwechselte, daran herumturnte und den Orissastoff beschädigte. Da es kein Bestattungsunternehmen gab, mußten in der Anfangszeit die deutschen Monteure für ihre bei der Arbeit tödlich verunglückten Kollegen eigenhändig ein Grab ausheben und bei der Beerdigung behilflich sein. Es war auch davon die Rede, daß indische Firmen, die bei Todesfällen unter ihren Arbeitern den Witwen nur dann eine Abfindung zahlten, wenn eine Leichenbeschau abgehalten wurde, dem Toten bei der Entrichtung der Abfindung das linke Ohr abgeschnitten und als Quittung einbehalten wurde, da es vorgekommen war, daß man einen Verstorbenen mehr als einmal vorgezeigt hatte. Indische Mädchen im Alter von fünfzehn bis zwanzig Jahren, von denen die meisten Christinnen waren und aus den umliegenden Adivasidörfern stammten, wurden als Haushaltskräfte in die Monteursunterkünfte gelockt, verführt und sexuell mißbraucht. Es soll häufig vorgekommen sein, daß die Monteure am abendlichen Biertisch im German Club die Mädchen einander weitervermittelten. Um den Mädchen den Zugang zum Hotelkomplex, in dem sechshundert deutsche Monteure, vor allem Junggesellen, untergebracht waren, zu verwehren, wurde von der »Hindustan Steel Limited«, die um ihren Ruf fürchtete, das Hotelgelände eingezäunt. Die Monteure empfanden den Stacheldrahtzaun und die Polizeiposten vor ihren Unterkünften als Freiheitsberaubung, als Beschneidung persönlicher Freiheit und als Rassendiskriminierung und legten den Zaun, der aus Betonpfeilern und Maschendraht bestand und fast eine halbe Meile lang war, kurz nachdem er vollendet worden war, in einer einzigen Nacht um. Mindestens zwei deutsche Firmen sollen regelmäßig Fotos von nackten, am Brahmanifluß fotografierten indischen Mädchen nach Deutschland geschickt haben, um deutsche Arbeiter zu überreden, Verträge für Indien abzuschließen. Abgesehen von einem deutschen Mundharmonika-Trio, das im German Club deutsche Volkslieder und Schlager spielte, wurden von den Monteuren auch Rourkela-Lieder gedichtet und gesungen: Rourkela war im Flug in meinen Träumen, mit Mädchen und mit Affen auf den Bäumen. Ich träumte hunderttausend schöne Sachen, von Bier, von Schnaps, vom dicken Portemonnaie. Und als ich plötzlich war im heißen Klima, da war das alles gar nicht mehr so prima. Man sagt, ich würde sehnlichst schon erwartet, und man brachte mich zum Hotel gleich hin. Rourkela, Rourkela, Rourkela …
In den vier Jahren ihres Indien-Aufenthaltes mit Eltern und Geschwistern ging Kristina in den indischen Kindergarten, später in die deutsche Schule. Einmal, so erzählte sie, als während eines heftigen Monsunregens die ganze Familie auf der überdachten Terrasse des Bungalows saß, näherte sich ihnen eine lange schwarze Kobra, die sich aber, als ihr Vater einen Korbsessel aufhob und mit den Stuhlbeinen voran auf die Schlange zuging, sofort verzog, in Sekunden verschwunden war und nie mehr wiedergesehen wurde. Eine Brillenschlange soll sich an einem warmen Nachmittag zwischen zwei im Bett schlafende Zwillinge gelegt haben. Als sich die beiden Kleinkinder beim Aufwachen bewegten, biß die Schlange zu und tötete sie. Die Familie reiste mit den toten Kindern nach Deutschland und kehrte nicht mehr nach Indien zurück. Immer wieder erzählte Kristina von Indien, starrte in Rom, Paris oder Berlin oder wo auch immer wir sonst gemeinsam waren, die Straße entlanggehende Inder an und begann wieder, von Indien zu erzählen. So entschieden wir uns für eine Reise nach Indien, denn auch ich wollte einmal das Land sehen, in dem sie vier Jahre ihrer Kindheit verbracht hatte.
Unsere erste gemeinsame Reise nach Indien fand im Frühling des Jahres 1993 statt. Wir wohnten damals noch im Bauernhaus meiner Eltern in Kamering, im Kärntner Drautal. Mein damals fünfundachtzigjähriger Vater, der zu dieser Zeit seinen Bauernhof noch nicht übergeben hatte, noch selber arbeitete, den Pflug an den Traktor spannte, mit der Sense auf die Felder und mit der Axt im tiefen Winter in die Wälder ging, schüttelte nur den Kopf, wenn ich von unserer geplanten Reise nach Indien sprach. Die Mutter seufzte wie immer und sagte – wie immer – kein Wort. Ich vor allem, weniger die indienerfahrene Kristina, hatte Angst vor gesundheitlichen Schäden, denn häufig wenn in Zeitungen und im Fernsehen von Indien berichtet wurde, war von Malaria, Cholera und Typhus, auch von der Pest die Rede. Ich hatte aber immer die Hoffnung, daß ich mich von meinen katholischen, dörflichen Themen eine Zeitlang würde lösen und neues Material zum Schreiben, vielleicht sogar für einen ganzen Roman, auf einem anderen Kontinent, in einer anderen, mir vollkommen fremden Welt würde finden können, denn der Stoff war mir vorläufig ausgegangen, ich wußte nicht mehr, worüber ich schreiben sollte, denn in der Zwischenzeit hatte ich auch, nach Jahren der Abwesenheit zum Vater zurückgekehrt, ihm Schritt auf Tritt folgend, eine Rückkehr des verlorenen Sohnes geschrieben, hatte ihm morgens und abends bei seiner Stallarbeit geholfen, war mit ihm auf die Felder und in die Wälder gegangen, um ihn zu beobachten, auszuhorchen, mir von seiner Kindheit und Jugend und auch neuerlich seine Kriegsgeschichten erzählen zu lassen und um wieder, aus anderer Perspektive, mit meinem Filmkamerakopf die hintersten und verborgensten Winkel meiner Kindheit ausleuchten zu können. Ich machte ihn im Fernsehen auf jede Kriegsdokumentation aufmerksam, saß mit Füllfeder und Notizbuch, wenn Hitler wieder auf der Mattscheibe auftauchte, neben dem Vater und schrieb seine Kommentare auf, aber dieser Sohn, der, um ein neues Buch schreiben zu können, den Alten mehrere Jahre lang nicht aus den Augen gelassen hatte, mußte wieder aufbrechen und fortgehen aus dem Haus, in dem er geboren wurde und in dem die kinderlose Gote, oder »gute Haut«, wie sie genannt wurde, die immer wieder, vor allem solange die Großeltern lebten, in ihrem Geburtshaus im bäuerlichen Haushalt mithalf, die bei allen möglichen Festanlässen ihre Verwandtschaft mit Torten und Kuchen versorgte und mir bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr in der Karwoche den Osterhasen gebracht hatte – neue Sonntagskleider oder Lederschuhe und den mit Staubzucker bestreuten Guglhupf, in dem immer ein Zehnschillingtaler steckte –, mit der blutigen Waschschüssel in der Hand Geburtshilfe leistete unter dem großen, breit und schwarz eingerahmten Heiligenbild der Muttergottes, die das Jesukind auf dem Schoß und eine weiße Lilie in der Hand hält, und das blutige Wasser in einem Schwall auf den Misthaufen schüttete, über die gackernd ausweichenden, zur Seite laufenden und davonflatternden Hühner und Hähne, die vom Blut meiner Mutter bespritzt wurden und, wieder zurückkehrend, mit ihren dünnen gelben Krallen einsanken in den Misthaufen, und mit dem Wasser wohl auch die Nabelschnurreste, die einerseits mir, dem Neugeborenen, andererseits wohl auch meiner Mutter gehörten, die mich soeben auf die Welt gebracht hatte. Halb fünf am Nachmittag soll es gewesen sein, mehr als zwei Stunden vor dem abendlichen Betläuten. Geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Kinder, die von Anfang an verdienet Straf und Ruten. Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß, du kannst und sollst sie machen los durch Sterben und durch Bluten. Ja, denke ich, das Federvieh muß meine Nabelschnur aufgefressen haben, denn wohin sollte man die Nachgeburt und die anderen Reste wohl sonst geworfen haben als auf den Misthaufen, auf den vom Nachbarhof, von den überhängenden Ästen eines Pflaumenbaumes, die dicken violettblauen Pflaumen fielen, die wir abholen, aus dem Kuhmist bergen durften, aber wehe wir stiegen auf unseren Misthaufen, näherten uns den überhängenden, schwer mit Früchten beladenen Ästen des Baumes und pflückten die eine oder andere Pflaume unter dem Geschrei des Nachbarbauern ab, der uns in den Misthaufen hineinverwünschte. Mit ein paar Pflaumen in der Hosentasche hopsten wir vom Misthaufen hinunter, liefen vors Haus zum Bach, steckten die Füße ins aufgestaute Bachwasser und aßen die Pflaumen, die wir auf unserem Misthaufen geerntet oder vom Baum gestohlen hatten. Man hat also unmittelbar nach meiner Geburt, kurz bevor dem soeben Zurweltgekommenen zum erstenmal die Dorfglocken zu Ohren kamen, eine Mistgabel genommen, ein kleines Loch ausgegraben, die Nachgeburt hineinrutschen lassen aus der weißen Emailwaschschüssel und wieder Stallmist darübergeworfen, während die aufgeplusterten Hähne an den Nabelschnurresten zerrten. Man hörte das Kettengerassel der Rinder, das Brüllen der Stiere und das Zwitschern der Schwalben und Mauersegler, die mit Mücken in ihren Schnäbeln ihre Nester aufsuchten und im Stall aus- und einflogen.
Ein halbes Jahr vor unserer ersten Reise nach Indien rief ich im Tropeninstitut in Berlin an und bat um eine Empfehlung für notwendige Schutzimpfungen. Die Frau im Tropeninstitut, die mir unwirsch und widerwillig Auskunft gab, fragte mich, bevor sie die Impfstoffe aufzählte: »Reisen Sie rustikal?« Ich verstand zuerst ihre Worte nicht, noch nie in meinem Leben hat mich jemand gefragt, ob ich rustikal reise, ich schwieg ein paar Sekunden und antwortete hilflos: »Wie meinen Sie das?« Und dann begann sie auch schon am Telefon zu schreien: »Ja, werden Sie denn in Indien auf der Straße essen, oder wie wollen Sie dort leben? Rustikal oder bürgerlich?« »Wir haben schon Geld«, antwortete ich eingeschüchtert, »wir werden uns ein Hotel suchen und ins Restaurant essen gehen!« Und wie aus der Pistole aus dem Telefon geschossen, von Berlin ins Kärntner Bauerndorf Kamering, ratterte sie los: »Diphterie, Tetanus, Kinderlähmung, Cholera, Typhus, Hepatitis A, Hepatitis B und Meningokokken als Schutzimpfungen, und gegen Malaria nehmen Sie ›Lariam‹ in Tablettenform.« »Wie heißen die Tabletten?« fragte ich nach. »Lariam!« buchstabierte sie, rief noch »Aufwiedersehn!« ins Telefon hinein und legte auf, ohne meinen Gruß und Dank abzuwarten. Lange starrte ich den Telefonhörer an, als suchte ich in den kleinen Löchern der Hörmuschel das Gesicht der dazugehörigen Stimme, und legte ihn schließlich zaghaft und leise auf die Gabel. Mir war heiß geworden am ganzen Körper, meine Wangen glühten, ich hatte Herzklopfen und blieb ein paar Minuten lang im engen Flur meines elterlichen Bauernhauses vor dem beigefarbenen Telefon stehen, das ich in diesem Augenblick, in einer sekundenlangen Sinnesverwirrung, nicht mehr als Sprechapparat, mit dem man telefonieren konnte, sondern als surreales Objekt empfand, hob meinen Kopf und schaute lange auf die über dem Telefon an der Wand hängenden eingerahmten Fotos aus den Dreißigerjahren, auf denen mein damals noch jugendlicher Vater stolz am Kirchenfeld auf einer neuen Mähmaschine sitzt, der ersten im Dorf, die von zwei braunen Pferden über den Acker gezogen wird.
Ihn, der das elterliche Anwesen nur für die Kriegsjahre verlassen und in der englischen Gefangenschaft, wie er erzählte, oft so einen Hunger gehabt hatte, daß er am liebsten dem Teufel die Ohren abgefressen hätte, hörte ich immer wieder sagen: »Am liebsten hätte ich dem Teufel die Ohren abgefressen!« Oder auch: »Wenn der Krieg nicht gewesen wäre, wäre ich nirgendwo hingekommen, nach England nicht, nach Holland nicht und auch nicht nach Frankreich, ich wäre immer am Hof geblieben.« Und jetzt sollte sein Sohn freiwillig und ohne Einberufungsbefehl monatelang nach Indien verreisen, ins Land des Elends, des Hungers und der heiligen Kühe. Wenn er im Stall vor der pumpenden Melkmaschine zwischen den Kühen saß, seinen Kopf an den Bauch einer Kuh drückte und ich mich in einer Arbeitspause vor ihn hinstellte, mich auf den Stiel der Mistgabel stützte, von den Impfungen und Medikamenten für die vorgesehene Reise nach Indien sprach – der kotige Kuhschwanz pendelte vor seinem Gesicht hin und her –, schüttelte er seinen Kopf und sagte: »Bei uns ist es so schön, geh in die Berge, geh ins Maltatal zur Kölnbreinsperre oder schau dir das Liesertal an, quartier dich in einer Almhütte ein, dort kannst du auch schreiben, wenn du willst, und Medikamente brauchst du auch keine, höchstens einmal ein Aspirin! Was willst du denn in Indien? Was willst du in einem Land, wo sie die Kühe wie Heilige behandeln, wo aber die Menschen hungern und auf der Straße krepieren, kein Fleisch essen und wo die Kühe auf der Straße herumtaumeln und eingehen lassen? Und? Trinken sie überhaupt Milch, die kommt ja auch von den Kühen? Und die Hitze! Denk an die furchtbare Hitze, vierzig, fünfzig Grad!« Bereits als Fünfzehnjähriger habe er sechzig Kilometer weit zweihundert Schafe von seinem Heimatdorf Kamering im Drautal ins Liesertal auf die Alm getrieben, und wenn sich die eigenen Schafe mit den Schafen der anderen Bauern vermischten, habe er die Schafe seines elterlichen Hofes an ihren Gesichtern wiedererkannt, erzählte er, stirnrunzelnd zwischen den Kühen auf dem Melkerschemel sitzend, den Schweiß mit dem rechten Unterarm von der Stirn wischend. »Das Gesicht jedes einzelnen Schafes habe ich mir gemerkt! Alle habe ich sie wiedererkannt!« Manchmal boxte er wütend mit seiner Faust oder stieß mit seinem Ellbogen einer Kuh in den Bauch, auch wenn sie hochträchtig war, wenn sie ihm, der zwischen zwei Kühen auf dem Melkerschemel saß, einmal tatsächlich den Schwanz mit den eingetrockneten Kotzöpfen ins Gesicht, um Nase und Mund schlug, so daß er mehrere Male ausspucken und seinen Mund an seinen gebräunten, haarigen Unterarmen abwischen mußte.
Mehrmals, in bestimmten Abständen, fuhren wir, Kristina und ich, mit dem Omnibus von Kamering nach Villach, um uns impfen zu lassen: Diphterie, Tetanus, Kinderlähmung, Cholera, Typhus, Hepatitis A, Hepatitis B, Meningokokken. Kiloweise verstaute ich Medizin in einem großen, kantigen silbernen Aluminiumkoffer, mit dem auch schon Kristinas Eltern nach Indien gereist waren und den sie mir immer wieder abnehmen wollten, was ich aber nie zugelassen habe, immer wieder bin ich mit dem Koffer entwischt, denn inzwischen bin ich bereits siebenmal nach Indien gereist und immer mit dem großen, mehr als ein halbes Jahrhundert alten Aluminiumkoffer. Der Vormittag der ersten Abreise nach Indien kam, die schweren Koffer waren im Flur bereitgestellt. Ich ging in die Knechtstube, in der einst mein damals zwanzigjähriger Vater als Speckdieb erwischt worden war und in der meine Großmutter aufgebahrt lag, nachdem man den Leichnam in einer Wolldecke über die Stiege getragen hatte, und überlegte mir, welche Schuhe ich anziehen sollte. Ich entschied mich für die italienischen Lederschuhe, die ich einmal unweit von Rom bei einem Schuster in einem kleinen Dorf gekauft hatte, deren dicke Sohlen in der ungeheizten, eiskalten und feuchten Knechtstube angeschimmelt waren. Mich schämend, weil mir Tränen über die Wangen rannen, verließ ich das elterliche Bauernhaus, nachdem ich mich kurz und ohne ihnen in die Augen zu sehen von den Bewohnern verabschiedet hatte, und ging mit dem nahezu dreißig Kilogramm schwer beladenen Aluminiumkoffer in der Hand, es war Anfang März, in meinen verschimmelten Schuhen über den leichtbeschneiten Dorfhügel hinauf zur Omnibushaltestelle. Die Schwester Apollonia half beim Koffer- und Taschentragen, sie verließ aber – ebenfalls mit Tränen in den Augen – die Haltestelle, noch bevor der Omnibus in der Ferne, am sumpfigen Manig mit den unzähligen aufgeblühten Schneeglöckchen vorbeifahrend, auftauchte, immer größer wurde und schließlich vor uns stand und wir mitfahren sollten. Aus dem Fenster des anfahrenden Omnibusses schauend, warf ich einen letzten Blick auf mein Elternhaus. Der Vater stand im Hof, zwischen Haus und Heustadel, und schaute auf den vorbeifahrenden Omnibus, suchte uns hinter den spiegelnden Fensterscheiben, den speckigen Hut in der Hand. Die Mutter und die Schwester Apollonia hatten sich in der Küche verkrochen. In Spittal an der Drau stiegen wir in einen Zug, der uns nach München brachte. Von München flogen wir nach London und mit British Airways nach Delhi. Am Flughafen in Delhi, nachdem wir den Stempel für die Einreise in den Reisepaß bekommen hatten, nahmen wir eine Motorrikscha und fuhren, eingepfercht zwischen den Koffern und die Taschen auf dem Schoß, in der Finsternis wohl eine Stunde lang in die Stadtmitte hinein, um ein Hotel zu suchen. Links und rechts von unserer offenen Motorrikscha im weißblauen Qualm der Abgase kamen Lastwagen und Omnibusse oft zentimeterdicht an uns heran und rauschten an uns vorbei. Da und dort standen Prostituierte an den Straßenrändern oder auf den Verkehrsinseln und winkten uns zu. In der Enge von Old Delhi fanden wir nach längerer Suche und nachdem ich mich entsetzt von einigen Spelunken abgewandt hatte, die uns mitlaufende Inder aufdrängen wollten, die schweren Koffer an den Händen, in einem Hotel ein Zimmer mit einer Klimaanlage, in dem sich aber kein Fenster befand. Bereits in diesem Käfig kochten wir aus Angst vor Magen- und Darmkrankheiten desinfizierenden Ingwertee. Die ganze Nacht über lief laut die Klimaanlage. Immer wieder wachte ich auf und schaute, ob der silberne Aluminiumkoffer noch unter dem Bett stand mit der vielen Medizin. Da für diese Reise nach Indien die österreichische Botschaft für mich einige Lesungen an den Universitäten in Delhi, Jaipur, Bombay und Varanasi organisiert hatte, bezogen wir, nachdem ich den Botschaftssekretär vom Schrecken der vergangenen Nacht berichtet hatte, für zwei weitere Tage ein Gästezimmer in der Botschaft. In den frühen Morgenstunden des dritten Tages fuhren wir mit dem Zug in einer fünfzehnstündigen Fahrt nach Varanasi, wo wir schließlich in den Abendstunden in der Main Station ankamen und wo uns sofort und ohne zu fragen die aus Rajasthan stammenden Kofferträger mit den weinroten Jacken das Gepäck aus der Hand nahmen. Zwischen dem Gedränge der Leute versuchten wir die Gepäckträger nicht aus den Augen zu verlieren. Für Varanasi entschieden hatte ich mich endgültig, nachdem mir, neben Kristina, die als Kind, während ihres Rourkela-Aufenthaltes im indischen Bundesstaat Orissa, mit ihren Eltern zwar nur ein paar Tage in Varanasi verbrachte, der Wiener Literaturprofessor Wendelin Schmidt-Dengler während einer gemeinsamen Zugfahrt von Udine nach Klagenfurt ebenfalls die Empfehlung gegeben hatte, in die heilige Stadt der Hindus, nach Varanasi ans Ufer des Ganges zu fahren, da ihm aus mehreren Romanen die Beschreibungen meiner dörflichen, katholischen Riten und Rituale geläufig waren und er wohl ahnte, daß ich in dieser Stadt, die auch »Mahashmashana« genannt wird, was soviel heißt wie »Der große Einäscherungsplatz«, in Indien am besten aufgehoben sein würde.
ZEIT DER GLADIOLEN
»Erwachsene und Kinder, alle, die auf dem Festplatz versammelt waren, stießen beim Anblick von O Rins Mund einen lauten Schrei aus und flohen. Als O Rin die Gesichter der Leute sah, hütete sie sich, ihren Mund zu schließen. Sie begnügte sich nicht damit, ihre oberen Zähne zu zeigen und mit ihnen ihre Unterlippe zusammenzudrücken, sie schob auch noch das Kinn vor, als wollte sie sagen: ›Seht her!‹ Und da sie überdies von Blut überströmt war, bot sie einen entsetzlichen Anblick.«
AUF DEM FOTO MIT DEM BRAUNSTICH