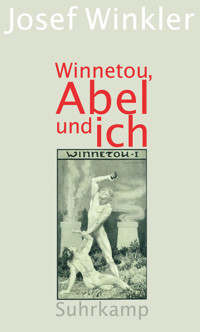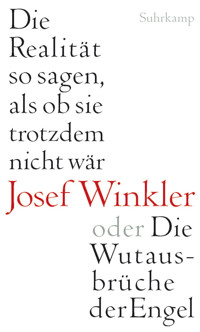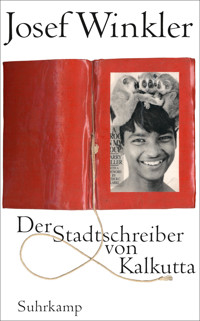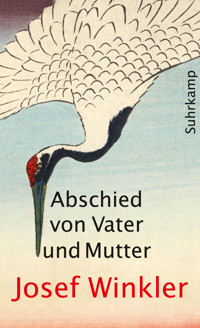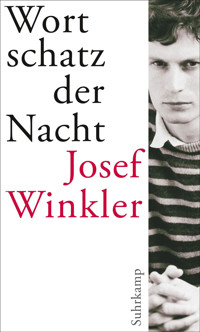11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Josef Winkler, der in einem von katholischen Engeln und Teufeln besetzten Kärntner Dorf, in dem es keine Bücher gab, aufgewachsen ist, schildert in Die Wutausbrüche der Engel die Frühzeit seines Kampfs um Sprache und Bilder. Nachdem seine Mutter einmal gesagt hatte: »Für Bücher haben wir kein Geld!«, begann er Geld zu stehlen. Zuerst der Mutter, für Karl-May-Bücher und -Filme, wovon im ersten Teil »Winnetou, Abel und ich« berichtet wird. Später dem Vater, für Bücher von Camus, Hemingway, Sartre, Peter Weiss und Jean Genet. Er reiste mit einem befreundeten Maler nach Paris, um sich die expressiven Bilder des russisch-jüdischen Malers Chaim Soutine anzusehen, und im zweiten Teil »Die Realität so sagen, als ob sie trotzdem nicht wär« erzählt er von Soutines Leben, von Kindheit und Jugend des Dichters und Diebs Jean Genet – vor allem aber von der umstürzenden Wirkung großer Literatur auf das eigene Leben.
Die Wutausbrüche der Engel vereinigt die beiden Bücher Winnetou, Abel und ich (2014) und Die Realität so sagen, als ob sie trotzdem nicht wär (2011).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
In Die Wutausbrüche der Engel beschreibt Josef Winkler, der bereits, wie es heißt, als einjähriges Kind ständig einen Bleistift bei sich trug und in einem von katholischen Engeln und Teufeln besetzten Kärntner Dorf, in dem es keine Bücher gab, als Ministrant aufwuchs, seinen Kampf mit den sich verweigernden Erwachsenen um Sprache und Bilder, wonach er früh eine Sehnsucht in sich entdeckt hatte. Nachdem seine Mutter einmal gesagt hatte: »Für Bücher haben wir kein Geld«, begann er seiner Mutter Geld zu stehlen, zuerst für Karl-May-Bücher und -Filme, wovon im ersten Teil dieses Buchs (»Winnetou, Abel und ich«) berichtet wird, und einige Jahre später seinem Vater: für Bücher von Camus, Hemingway, Sartre, Peter Weiss und Jean Genet. Er reiste mit einem befreundeten Maler nach Paris, um sich die expressiven Bilder des russisch-jüdische Malers Chaim Soutine anzusehen, und erzählt im zweiten Teil (»Die Realität so sagen, als ob sie trotzdem nicht wär«) von Soutines Leben sowie von Kindheit und Jugend des Dichters und Diebs Jean Genet – vor allem aber vom eigenen Werdegang mit der Hilfe selbsteroberter Bücher und von der umstürzenden Wirkung großer Literatur auf sein Leben.
Josef Winkler, geboren 1953 in Kamering (Kärnten), lebt in Klagenfurt. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, 2008 den Georg-Büchner-Preis. Zuletzt erschienen: Wortschatz derNacht (2013) und Abschied von Vater und Mutter (suhrkamp taschenbuch 4592, 2015).
Josef Winkler
Die Wutausbrücheder Engel
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4745
© Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Suhrkamp Taschenbuch Verlag
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagabbildung: Umschlagabbildung: Daniel Richter, Flash, 2002, Sammlung Essl, Klosterneuburg / Wien
Foto: Jochen Littkemann, Berlin, © VG Bild-Kunst, Bonn 2016
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-76910-2
www.suhrkamp.de
Inhalt
WINNETOU, ABEL UND ICH(Mit Bildern von Sascha Schneider)
Winnetou, Abel und ich
Selki lata und Schöner Tag
Swallow, Parranoh und Pimo
Weihnacht oder Die gute Haut
Winnetous Mord und Winnetous Tod
DIE REALITÄT SO SAGEN, ALS OB SIE TROTZDEM NICHT WÄR ODER DIE WUTAUSBRÜCHE DER ENGEL
Das erste Kapitel
Das zweite Kapitel
Das dritte Kapitel
Das vierte Kapitel
Winnetou, Abel und ich
Zitat
Ende des 19. Jahrhunderts besuchte der berühmte Fotograf Burton Holmes mit seinem Freund Oscar Depue das nördliche Arizona, wo sie den Schlangentanz der Hopi-Indianer filmten. Als er den fertigen Film vor 500 Angehörigen des Navaho-Stammes vorführte, befühlten und streichelten die völlig verblüfften Indianer, die sich in den beweglichen Bildern wiederfanden und erkannten, die Leinwand und rieben ihre Wangen daran.
WINNETOU, ABEL UND ICH
Mitte der sechziger Jahre kamen die Karl-May-Filme in der österreichischen Provinz in die Kinos. Als »Winnetou I« in Ferndorf auf der Leinwand flimmerte und meine Schulfreunde, die Söhne des Lehrers Emanuel Wenger, mir stolz auf der Dorfstraße berichteten, daß sie mit ihrem Vater im weißen Volkswagen von unserem Heimatdorf Kamering ans andere Ufer der Drau, nach Ferndorf, führen, um sich den Winnetoufilm anzuschauen, fragte ich den Lehrer, ob ich mitfahren dürfe. Bis dahin hatte ich noch nie einen Kinosaal betreten, nie eine Leinwand gesehen. Ich ging an einem frühen Nachmittag zu meinem Vater, der in der Getreidemühle neben dem Plumpsklo in stundenlanger Arbeit wieder einmal das ohrenbetäubende Mahlwerk reparierte mit den immer wiederkehrenden Fluchworten »Teufel! Teufel! Doppelteufel!«, und fragte ihn, ob ich mit unserem Oberlehrer, wie wir ihn respektvoll und im geheimen auch ironisch nannten, und mit seinen beiden Söhnen ins Kino gehen dürfe. »Winnetou eins spielt!« rief ich im Lärm der Mühle dem Vater zu. Er reparierte weiter verbissen und mit gerunzelter Stirn das Mahlwerk, gab mir aber keine Antwort. Nachdem ich ihn mehrere Male gefragt hatte, verließ ich die mit vielen vom Mehlstaub beschwerten, tief herunterhängenden Spinnweben ausgekleidete Mühle, in der auf jedem Gegenstand ein zentimeterdicker Mehlfilm lag, ging an der schlampig abgedeckten Jauchegrube vorbei, setzte mich eine Zeitlang auf den hölzernen Rand des Plumpsklos mit dem breit ausbetonierten Schlund, in dem dann und wann ungeliebte, neugeborene Katzen verschwanden, um dann in der Jauchegrube aufzutauchen, blätterte in der »Kärntner Kirchenzeitung« und kehrte in die Mühle zurück. Wieder bekam ich vom Vater keine Antwort, ging noch einmal aufs Plumpsklo und raschelte nervös in den herumliegenden Zeitungen. Die Mühle ratterte inzwischen mit regelmäßigem Ton, sie war repariert, der Vater war von oben bis unten mit Mehl bestäubt, selbst an seinen Augenbrauen hing der Staub des frisch gemahlenen, warmen Getreides, weiß waren auch seine schmalen, trockenen Lippen, selbst an den Bartspitzen hing da und dort als winziger weißer Punkt ein Mehlstaubpartikel. Laut rief ich in das klappernde Geräusch hinein: »Tate! Darf ich mit dem Lehrer ins Kino gehen? Winnetou eins spielt, fünf Schilling kostet es. Der Eman und der Erich kommen auch mit!« Ich kam wohl fünfmal bei ihm vorbei, es dauerte über eine Stunde, bis der am ganzen Körper mit Mehl bestäubte Vater zustimmend nickte, aber nach wie vor sagte er kein Wort. Zum Schluß flehte ich nur mehr jammernd: »Tate! Tate! Tate! Kann ich …«
Am Abend ging ich in den Stall und bat ihn um das Kinogeld. Ich hatte Angst, daß er sein wortloses Versprechen schon wieder vergessen oder es sich überhaupt anders überlegt haben könnte. Er schob seinen speckigen dunkelgrauen Arbeitshut, der wohl ein Jahrzehnt nicht gewaschen wurde, nachdenklich auf seinen Hinterkopf, runzelte die Stirn, stand wortlos vom Melkschemel auf, ging über den Hof, ins Haus und in die Küche und nahm aus dem obersten linken Fach der Küchenanrichte, die einst mit dem ganzen Geschirr zu Boden gedonnert war, seine schwarze Brieftasche heraus, gab mir wortlos das Geld und verschwand in den Stall, hockte sich, gedankenverloren mit beiden Händen den Kopf aufstützend, zur pumpenden elektrischen Melkmaschine zwischen zwei Kühe. Neben der abgegriffenen Brieftasche befanden sich in dem Fach auch sein elektrischer Philips-Rasierapparat und die mechanische »Wehrmacht-Alcoso-Haarschneidemaschine-Solingen«, die man heute noch erwerben kann, mit der er mich und meinen jüngeren Bruder alle paar Monate malträtierte. Auf der zerfledderten roten Schachtel, auf der die Haarschneidemaschine abgebildet war mit den mich immer bedrohenden, kleinen, Daumen und Zeigenfinger stützenden Hörnern an den Haltegriffen, stand in großen Lettern: »Máquina para cortar el pelo«. Diese manuelle Haarschneidemaschine mit den zangenartigen Handhebeln war aus zwei kammartigen Messern zusammengesetzt, von denen das untere mit den, um Verletzungen an der Kopfhaut zu vermeiden, abgerundeten Zinkenspitzen fest fixiert war und sich das darüberliegende, bewegliche Messer durch das rhythmische Zusammendrücken der beiden Handhebel hin und her bewegte und die Haare abschnitt. Die beiden älteren, auf dem Hof mitarbeitenden Brüder durften bereits zum Frisör Riepl ins Nachbardorf Paternion fahren und sich dort die Haare schneiden lassen. Wenn der Vater dann einmal zu uns jüngeren sagte: »Ihr schauts schon wieder aus wie die Beatles!« wußte ich, was uns in den nächsten Tagen blühen würde. Den Tag und die Stunde, wann sich das Haarschneideritual abspielen sollte, bestimmte ausschließlich er. Jedesmal, wenn er mir mit dieser oft in die Kopfhaut beißenden Wehrmachtsmaschine meine Haare scherte, vom Kragen hinauf bis zur Fontanelle, und auf unseren Kinderköpfen eine Hitlerjungenfrisur zurechtschneiderte, hatte ich das Gefühl, vom eigenen Vater – von wem sonst? – geköpft zu werden, weit über ein Jahrzehnt hinaus hat er mich auf diese Art mehrmals im Jahr fürchterlich zugerichtet. Die abgeschnitten vom Haupt rutschenden Haare klebten auf meinen tränennassen Wangen. Hätte ich nicht in die Schule gehen müssen, hätte ich mich aus Scham und Eitelkeit tagelang im Schlafzimmer verkrochen und mich unter meinem Bett in die Staubflocken eingenistet. Nur einmal entstand eine heitere Stimmung, in der ich die Hoffnung faßte, daß dieses mörderische Haarschneideritual zu Ende gehen werde und auch wir, mein jüngerer Bruder und ich, endlich zum Frisör Riepl nach Paternion würden fahren können, als nämlich die Haarschneidemaschine nicht mehr funktionierte, der Vater das Gerät auseinanderschraubte, mit Nähmaschinenöl beträufelte, zusammenschraubte und neuerlich versuchte, mir die Haare zu scheren. Als die Maschine noch immer nicht funktionierte, warf er sie, »Teufel! Teufel! Doppelteufel!« fluchend, in die Küchenecke, gegen die vor dem Herd stehende Holzkiste. Mit hochrotem Kopf, besorgt, vielleicht das Gerät zerstört zu haben, hob er sie auf, versuchte es noch einmal, und zu meinem Schrecken und zu seinem Grinsen funktionierte die Haarschneidemaschine wieder und ratterte über meinen Hinterkopf. Ich hoffte, daß er sich eine neue, eine modernere kaufen und es tage-, vielleicht wochenlang dauern würde, bis er dafür in die Stadt käme. Ich war tieftraurig, als ich auf dem Küchenboden, auf meinem Schuhwerk und an den braungebrannten Unterarmen meines Vaters büschelweise meine abgeschnittenen brünetten Haare sah.
Als ich nach meinen geduldigen Bettelgängen in die enge weißbestäubte Getreidemühle das Geld für die Kinoeintrittskarte erhalten und auch den Lehrer über mein Glückslos im frischen Mehlgeruch informiert hatte, zog ich meine schönsten Kleider an, die ich von meiner Tante und Taufpatin, der »Gote«, wie wir sie nannten, der kinderlosen Ragatschnig Tresl, neben einem silbernen Schokoladeosterlamm mit der Auferstehungsfahne aus farbigem Marzipan und einem großen Schokoladeosterhasen sowie einem selbstgemachten, mit Vanillestaubzucker bestreuten Marmorgugelhupf, in dem ein Zehnschillingtaler steckte, wie immer zu Ostern bekommen hatte, am Karsamstag, zum Auferstehungstag. In der Mitte des Gugelhupfs, in einem kreisrunden Loch, steckte ein gekochtes und gefärbtes Osterei mit dem mehrfarbigen Abziehbild eines die Auferstehungsfahne haltenden Jesus, der sein weißes Leichentuch um Hüften und Brust geschlungen hat. Beim Eierpecken, wie wir es nannten, wenn mein jüngerer Bruder und ich die gefärbten Ostereier in einer Ecke aufstellten und Geldstücke danach warfen, in der Hoffnung, daß sie im hart gekochten Ei steckenbleiben würden und wir im brüderlichen Wettstreit einen Sieger ausrufen könnten, versuchte ich den die Auferstehungsfahne haltenden Jesus mit dem Zehnschillingtaler mitten ins Herz zu treffen. Hatte ich ihn schwer verletzt oder überhaupt getroffen, so daß an der Eierschale Kopf und Gesicht von Jesus von Nazareth zersplitterten, ging ich aufs Plumpsklo, zog meine Hose hinunter, spielte aus Angst mit meinem Geschlecht und sprach das Vaterunser und das mich wieder für ein paar Stunden oder Tage aus der Hölle erlösende Schutzengelmeingebet, denn ich war wieder ins Höllenbild des katholischen Religionsbüchleins eingetaucht, das ich aus meinem hellbraunen, schweinsledernen Schülerranzen zog, den mir einmal, ebenfalls zu Ostern, die Ragatschnig Tresel geschenkt hatte, ins Höllenbild, das mich fast ein Jahrzehnt lang beängstigte und zu dem im samstägigen Religionsunterricht der Pfarrer Franz Reinthaler die Geschichte vom reichen Mann erzählte, der sich in Purpur und feine Leinwand, wie er wörtlich und höhnisch sagte, kleidete und alle paar Tage ein pompöses Mahl gab, während der arme Lazarus mit den Geschwüren an den Beinen, an der Türschwelle kniend, sich gerne von den abfallenden Brotbröckchen ernährt hätte. Hunde machten sich an ihn heran und leckten an seinen Geschwüren. Als der arme Lazarus starb, wurde er, so der Pfarrer und Religionslehrer vor den gebannt zuhörenden Schulkindern, von den Engeln in den Himmel hinaufgetragen, in den Schoß Abrahams. Der Reiche, der in die Hölle kam, rief in den Himmel hinauf: »Vater Abraham! Erbarme dich meiner und sende den Lazarus zu mir! Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesen Flammen!« Dabei benäßte der Pfarrer seine Fingerspitze und hielt vor den mit weit aufgerissenen Augen in der Schulbank sitzenden Kindern seine Hand in die Höhe und bewegte den feuchten Zeigefinger. Ein gehörnter, haarloser roter Teufel mit spitzem Kinn, spitzen Ohren, langgezogenen, buschigen Augenbrauen, gespreizten, knochendünnen Fingern der linken Hand und hochstehenden großen, durchscheinenden Fledermausflügeln auf seinem Rücken schüttete mit seiner ausgestreckten rechten Hand dem mit hocherhoben flehenden Händen zwischen den hochzüngelnden Flammen in der Hölle liegenden reichen Prasser, der mit einem weißen Tuch um die Hüften bekleidet war und um dessen Oberkörper sich eine lange grüne Schlange gewunden hatte, auch noch aus einem Becher Galle in den Mund. Etwas erhaben auf dem Höllenbild, links oben, kniete der erlöste, dankbare Lazarus vor dem gütigen Abraham und legte die Arme in dessen Schoß.
Besonders in der Zeit, als ich meinem Vater aus dem Weg gehen mußte, wir uns nicht riechen konnten, ich ihn einmal, vom Friedhof kommend, in hundert Meter Entfernung über die Dorfstraße Richtung Friedhof gehen sah und schließlich wortlos, an ihm auf der anderen Seite der Dorfstraße vorbeigehend, beinahe in Ohnmacht gefallen wäre, ich spürte jedenfalls starke Kreislaufstörungen, konnte nicht mehr geradeaus gehen, bekam auch Sehstörungen, erblickte ich im Gesicht dieses Teufels aus dem Höllenbild im Religionsbuch immer wieder die dämonische Seele und die Larve meines Vaters. Aber dennoch, abends, wenn er bei seinem Nachtmahl – er tauchte einen Krapfen in eine Katzenschüssel mit Malzkaffee, an der das weiße Email abgesplittert war – hinter dem Tisch unter dem kleinen Radio saß, gleichzeitig in der Bauernzeitung oder in der Volkszeitung blätterte, setzte ich mich neben ihn, las in einem Karl-May-Buch und schaute immer wieder auf sein rechtes Ohr, das mich maßlos anzog, zählte die Haare und die kleinen dunklen Punkte an der Ohrmuschel und dachte traurig daran, daß auch er eines Tages sterben wird, ich ihn nicht mehr riechen werde können nach der Stallarbeit, am Abend, beim Nachtmahl, denn oft wusch er sich nach der ganzen Tagesarbeit auf dem Feld, im Wald oder im Stall nicht einmal seine Hände. Aber dennoch … In einem Raufhandel mit meinem jüngeren Bruder hatte ich einmal die Volkszeitung zerrissen. Sie war Vaters allabendliches Heiligtum, in dem er nach der Arbeit, vor dem Schlafengehen blätterte und vor allem die politischen Berichte las. Bis zum Sport oder zur Kultur, auf den hinteren Seiten, drang er in der Zeitung niemals vor. Ich ging mit der vor allem auf der Titelseite beschädigten Zeitung in den Stall und beobachtete ihn eine Zeitlang beim Füttern der Stiere, versteckte die Zeitung hinter meinem Rücken. Als er sich wieder zwischen zwei Kühe auf den Melkerschemel setzte, trat ich ängstlich vor ihn hin. »Tate! Ich habe die Zeitung zerrissen!« sagte ich reumütig mit gebrochener Stimme und zeigte sie ihm. Er nickte mit dem Kopf, sagte aber kein strafendes Wort, er zeigte sich zufrieden mit meiner Beichte. Ich lief mit der Zeitung über den beschneiten Hof, klebte die auseinandergerissenen Teile, so gut es ging, mit einem durchsichtigen Klebestreifen, den ich aus dem zerknitterten, hellbraunen, schweinsledernen Schulranzen nahm, zusammen und legte sie sorgsam auf den Küchentisch, an seinen Sitzplatz. An diesem Abend hoffte ich sehr, daß er so bald wie möglich von der Stallarbeit kommen, sich zum Nachtmahl – »Nochblig!«, wie wir es nannten – an den Tisch setzen und die zusammengeflickte Zeitung in die Hand nehmen würde.
Ich putzte meine braunen Lederschuhe, kleidete mich in meinen einzigen Sonntagsanzug, den ich zu Ostern von der Tresl bekommen hatte, lief mit meiner dunkelblauen, weiß gesprenkelten Krawatte in den Stall und bat den Vater, mir einen Knoten zu binden. Nachdem er mit seinen nach Stallkot und frischer Milch riechenden Händen den Krawattenknoten zwischen den Zipfeln des Hemdkragens an meinen Adamsapfel gedrückt hatte, nun mein Unterkiefer und der Hemdskragen nach der Haut einer Milchkuh rochen, musterte er mich von oben bis unten und setzte sich wortlos zwischen zwei Kühe auf den dreibeinigen Melkschemel. Rechtzeitig tauchte ich, in Schale geworfen, vor dem Schulgebäude auf, in dem die Lehrerfamilie, gegenüber dem großen Dorfkruzifix, im ersten Stock wohnte. – Im Parterre des Schulgebäudes befand sich der große Klassenraum, in dem vier Schulstufen gleichzeitig unterrichtet wurden. An der Außenwand des Schulgebäudes, an einer Verzierung über den Fenstern, glaubte ich in meiner kindlichen Vorstellung als Erstklassler, wie wir genannt wurden, als uns noch der reisefreudige Lehrer Franz Berghuber unterrichtete, der sich später erschoß, nachdem er von seiner Krebserkrankung erfahren und seinen nahen Bekannten brieflich mitgeteilt hatte, daß er nun seine letzte Reise antreten werde, manchmal ein Zeichen zu sehen, daß wir an diesem Tag im Unterricht, wie mehrmals im Jahr, einen Film sehen würden, denn ich konnte es nicht fassen, sich bewegende Bilder auf einer kleinen weißen Leinwand, der umgedrehten Landkarte von Kärnten, zu sehen, ich war vollkommen fasziniert davon und süchtig danach. – Mit dem weißen Volkswagen fuhren wir mit dem Lehrer Emanuel Wenger von Kamering nach Mauthbrücken, am Elektrizitätswerk und an der Stelle vorbei, wo ich erst vor wenigen Monaten ein bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglücktes Kind, das mit Packpapier abgedeckt war, im Feld hatte liegen sehen – neben dem Packpapier lag die abgerissene Gummihosenleiter des toten Kindes im Gras –, über die Draubrücke in das meinem schattseitigen Heimatdorf gegenüberliegende Ferndorf, auf die sogenannte Sonnseite. Nachdem ich eigenhändig am Kinoschalter meine erste Eintrittskarte kaufen hatte dürfen, gingen wir über eine breite Stiege hinauf in den großen Festsaal des Heraklithwerkes hinein, in dem nach einer Wartezeit von mehr als einer Viertelstunde – wir waren die ersten Zuschauer gewesen – zu meinem Erstaunen langsam und elektrisch der Vorhang aufging und der Zauber begann. Ich hatte erwartet, daß der Filmvorführer oder die Kartenabreißerin, wie wir sie nannten, eigenhändig den Vorhang wegziehen würde, um die Wand zu entblößen, auf der sich der Film abspielen sollte, das Wort »Kinoleinwand« kannte ich noch nicht. Im Vorspann, bevor vom Constantinverleih der Hauptfilm angekündigt wurde, spielte sich auf der Leinwand in der schmalspurigen sogenannten »Wochenschau«, die mit dem Drehen einer Erdkugel im Kreis begann, eine Filmszene mit ganz langsamen Bewegungen ab. Der neben mir sitzende Lehrer drückte seine Schulter an meine und flüsterte mir ins Ohr: »Das ist Zeitlupe!« – »Das kenn ich schon!« flüsterte ich ihm stolz ins Ohr. Ich kannte es vom Fernsehen, aus dem Zimmer meines Großvaters mütterlicherseits – als John F. Kennedy ermordet wurde und man auf dem Bildschirm immer wieder in Zeitlupe den sich langsam vor und zurück beugenden und im Todeskampf sich schüttelnden Oberkörper des Präsidenten sah, den ganzen Abend lang, immer wieder, und ich in der Finsternis in einer Weltuntergangsstimmung durchs Dorf hinauf in mein bäuerliches Elternhaus ging und mich sogleich unter der Bettdecke verkroch.
Einige Jahre später, als ich im Alter von fünfzehn Jahren in Villach in die Handelsschule ging und einmal nicht, wie üblich, spätestens um halb drei Uhr nachmittags aus dem Omnibus stieg, sondern erst um halb fünf nach Hause kam – denn ich hatte um die Mittagszeit im Bahnhofkino, in dem die Kinosessel schlotterten, wenn am ersten Bahnsteig ein über hundert Meter langer, Abertausende Tonnen schwerer Güterzug mit hoher Geschwindigkeit vorbeidonnerte, den Agentenfilm »Mister Dynamit! Morgen küßt euch der Tod« angeschaut, in dem der verehrte Old-Shatterhand-Darsteller, Lex Barker, die Hauptrolle spielte, wobei ich mich nur an die Szene erinnern kann, in der einem auf einem Hügel stehenden Mann, bevor man ihn erschoß, mit Lack ein großes weißes Kreuz auf den Rücken gesprüht wurde – und nach der verspäteten Ankunft in meinem Elternhaus bei Tisch saß und mir die Mutter schnippisch die aufgewärmte Suppe servierte, ging hinter meinen Rücken die Tür auf. Der Vater erschien mit seinen nägelbeschlagenen Goisererschuhen, seinen speckigen grauen Hut auf dem Kopf, in seiner um seine Beine schlotternden, zusammengeflickten blauen Arbeitsuniform – er war der einzige Bauer im Dorf, der eine blaue Arbeitsuniform trug –, einen Zweitagebart in seinem von Wind, Wetter und Sonne gebräunten, spitzen Teufelsgesicht mit den zentimeterlangen Augenbrauen, hielt mir einen kotbeschmierten Hanfstrick, mit dem Kälber auf die Welt gezogen wurden und mit dem sich die Dorfjugend im Stall erhängte, unter die Nase, so daß ich tatsächlich den Strick, eine Mischung aus Kot und Hanf, riechen konnte, und sagte donnernd und zähneknirschend, aber mit ebenso gebrochener wie verzweifelter Stimme: »Wenn du noch einmal so spät heimkommst! Schau ihn dir an! Schau ihn dir genau an!« Hinter seinem Rücken schaute ihm höhnisch und mit giftigem Blick der ebenfalls nach Stall riechende Hoferbe und zukünftige Ackermann über die Schultern. Danach drehte sich der Vater um und verschwand zur Tür hinaus. Mit hochrotem Kopf und schlotternden Beinen löffelte ich meine Suppe aus. Die Mutter empfand ich als Verräterin, dieses einzige Mal in meinem Leben, sie hätte auf die Frage nach meinem Verbleib auch eine Ausrede erfinden, aber die vollkommen sprachlose Frau hatte nur sagen können, was geschehen war, es ist schon halb fünf, und er ist noch nicht aus der Schule zurück. Von da an wußte ich, daß ich alleine auf der Welt war, daß ich mich auf niemanden mehr verlassen konnte, auf Vater und Mutter nicht, auf die Geschwister schon gar nicht, und für ewig und immer verloren war. Es war auch die Zeit, in der mich der Vater ständig wegen meiner Beatlesfrisur als Gammler, Zottl und Hippie beschimpfte, mich aber nicht mehr zum Frisör zwingen konnte, mich auch einen Bettelstudenten nannte, da er für meinen Besuch in der Handelsschule jeden Monat 500 Schilling Schulgeld zahlen mußte und die täglichen Omnibusfahrten, eine Omnibuswochenkarte, die 50 Schilling kostete, die ich mir jeden Sonntag von ihm erbetteln mußte, um weiterhin in die Schule fahren zu können, während meine anderen Brüder mit den anständig gepflegten Haarschnitten und Frisuren, über die sich niemand im Dorf mokieren konnte, eine Lehre als Handwerker absolvierten und bereits seit dem vierzehnten Lebensjahr ihr eigenes Geld verdienten. Meinem Vater mißfiel meine Beatlesfrisur auch deswegen, weil er immer wieder von den Leuten im Dorf darauf angesprochen wurde.
Später wollte ich mich an meinem Vater rächen und mit dem nach Stall stinkenden IHN, den ich mir beim Suppelöffeln genau anschauen mußte, einen Veitstanz in seinem Stall aufführen, bis ich daran hängenbleiben würde über den gebogenen Hörnern seiner gottverfluchten Kühe, zwischen denen er morgens und abends saß und, solange niemand in seiner Nähe war, vollkommen unverständliche Selbstgespräche führte, denn ich hatte ihn öfter belauscht, es sind die Gespräche eines Irrenhäuslers, dachte ich damals, aber kaum tauchte jemand auf, wandelte er sein Wort in eine verständliche Sprache um. Seit mir der Vater dieses mit Stallkot beschmierte Geburts- und Todeswerkzeug beim nachmittäglichen Suppelöffeln unter die Nase gehalten hat, weine ich, auch heute noch, fast bei jedem Kinofilm, selbst bei Kinderfilmen breche ich vor der Kinoleinwand zusammen und erinnere mich dabei manchmal an ein Vorarlberger Kino, das »Invalidenkino« genannt wurde, in dem sich ein neunzehnjähriger Kärntner hinter der Kinoleinwand erhängte. Erst als man im Kino nach mehreren Tagen den Verwesungsgeruch wahrnahm, wurde der Selbstmord entdeckt. »Tod in Cinemascope!« schrieb damals die Kärntner Tageszeitung in großen Lettern auf der Titelseite. Ich malte mir Szenen aus den Karl-May-Filmen auf der Leinwand aus. Während Winnetou das Messer aus seinem Gürtel zog, sich auf Old Shatterhand stürzte und zum Stoß gegen seine Brust ausholte, das Messer in die linke Brusttasche von Old Shatterhand fuhr, eine Sardinenbüchse traf, vom Blech abglitt und ihm oberhalb des Halses durch die Kinnlade in den Mund drang und die Zunge durchstach, begann hinter der Cinemascope-Leinwand langsam der Leichnam des jugendlichen Selbstmörders mit der heraushängenden, zwischen den Zähnen eingeklemmten Zunge zu verwesen, seine Augäpfel und seine Hoden fielen zu Boden, sein linker Arm und rechter Fuß hingen nur mehr an einer Sehne und rutschten schließlich zu Boden.
Wiederum fünfzehn Jahre später, im Alter von neunundzwanzig Jahren, als ich nach der Niederschrift mehrerer Romane die Sprache verloren, nachdem ich über tausend Seiten mit dem Vater und der katholischen Kirche gerungen hatte, empfand ich mich als sprachloses Elendshäufchen, das zurückgefallen war in die Sprachlosigkeit seiner Dorfkindheit und nach mehreren elend-luxuriösen, mit Literaturpreisen ausgestatteten Schriftstelleraufenthalten in Berlin, Paris, Wien, Rom und Venedig vor Einsamkeit und Verlorenheit zu verkümmern drohte. In Paris stand ich Tag für Tag am Ufer der Seine und dachte an Paul Celan, der dort in die Fluten gegangen war – an welcher Stelle wohl, fragte ich mich immer wieder, das Seineufer entlanggehend –, und später, nachdem ich mich nicht hatte entschließen können, Paul Celan in den Ertrinkungstod zu folgen, an einem eisigen Wintertag fand ich mich in der Finsternis am Lido von Venedig bereits mit einem Totenkranz um den Hals auf dem Holzskelett einer Meeresbrücke, wo ich mich hinein- und hinabziehen lassen wollte zu den Selbstmördern in meinem Heimatdorf, die sich alle mit einem Strick das Leben genommen hatten, worauf ich reumütig zu meinem Vater in mein Geburtsdorf Kamering zurückkehrte, in der Hoffnung, daß ich in dem Dorf, das ich, wie die Leute sagten, »kaputtgeschrieben« hatte, meine Sprache wiederfinden und eine Heimkehr des verlorenen Sohnes schreiben würde können. Auf Schritt und Tritt folgte ich ihm im Stall, auf dem Feld oder im Wald mit einem Zettel und einem Bleistift in meiner Hosentasche.
Einmal wollte ich ihn in dieser Zeit verführen, mit mir ins Kino zu gehen, mit dem Omnibus nach Villach zu fahren, denn er hatte zeit seines Lebens keinen Autoführerschein, um ihm den Film »Auf Wiedersehen, Kinder« von Louis Malle im Stadtkino zu zeigen, in dem die Geschichte von mehreren jüdischen Heimkindern erzählt wird, die im besetzten Frankreich nach Verrat und Denunziation von einem SS-ler aus einer Schulklasse geholt und ins KZ gebracht werden – auch in der Hoffnung, daß er mir dann wieder vom Krieg erzählen und ich wieder alles aufschreiben würde können –, aber er speiste mich mit einer deutlichen Handbewegung seiner krallenartigen Finger und mit den Worten ab: »Das ist nur Augenschmaus! Ich war schon 70 Jahre nicht mehr im Kino. Ich geh nicht mehr ins Kino!«
Die Plakate für die Karl-May-Filme wurden von zwei Arbeitern, die ihren Lieferwagen mit Kleisterkübeln und zusammengerollten Plakaten vor das Heustadeltor stellten, auf die verwitterten und maroden Bretter der Holzwand geklebt, unweit eines üppig Früchte tragenden Marillenbaums, dessen Äste sich um die Ecke zur plakatierten Heustadelwand hinbogen und den mir mein Onkel und Göte, der Ragatschnig Motl, geschenkt und auch eingepflanzt hatte, auf den ich, besonders während der Ernte, unendlich stolz war, weil ich der geliebten Mutter körbeweise Marillen in die Küche bringen konnte, die Marillenknödel zubereitete, Kompott und Marmelade daraus machte, und den eines Tages, wie ich sah, als ich von der Handelsschule nach Hause kam und an der mit Filmplakaten beklebten Heustadelwand vorbeiging, der Vater und der älteste Bruder, der künftige Hoferbe und Ackermann, einfach weggeholzt hatten, obwohl wir nur einen kleinen Garten mit wenigen Obstbäumen hatten, ich die vom Nachbarsbaum auf unseren Misthaufen gefallenen Zwetschgen aufsammelte, manchmal vom bösartigen Nachbarbauern dabei erwischt und beschimpft wurde, nur weil ich es erst gar nicht gewagt hatte, die saftigvioletten, schmackhaften Früchte in der Dämmerung oder um Mitternacht von den auf unseren Misthaufen überhängenden Ästen des Baumes zu pflücken. »Ich reiß dir gleich den Arsch aus!« rief der Bauer Thonhauser mit seiner rauhen Reibeisenstimme, der einmal meinem Vater erzählte, daß er die vielen unerwünschten neugeborenen Katzen nicht, wie es üblich war im Dorf, in einen Jutesack steckt, den er mit einem Stein beschwert und in der Drau verschwinden läßt, sondern die noch blinden Katzen beim Schwanz packt und so lange mit dem Schädel an die Stallmauer schlägt, bis das Blut aus ihrem Maul tropft, über die mit Stallkot besprenkelte, gekalkte Wand rinnt und er die Katzenleichen im meterhohen Misthaufen begraben kann.
Das Abholzen des Marillenbaumes durch den Vater und seinen Komplizen, meinen ältesten Bruder, den künftigen Hoferben, hatte ich als ein Komplott, als einen Mordanschlag zweier verwandter Bauersleute gegen mich empfunden, denn mir gehörte auf dem Hof außer diesem Aprikosenbaum nichts, gar nichts, keine Gladiole und keine rosarote Fleischblume, kein Strauß Petersilie, kein Maggikraut, keine Katze, kein Hund, außer vielleicht die nicht zu fassenden, zwischen meinen gespreizten Fingern und zwischen Haus und Stall durch die Luft schwirrenden, segelnden und zuckenden Schwalben und die vielen Spatzen, die sich vor dem Stall frech an das Hühnerfutter heranmachten und die wir mit selbstgebastelten Steinschleudern, einem eingefädelten Lederfleck in einer Haselnußastgabel, bedrohten, so daß sie aufgescheucht zwischen den Hühnern, ausgestreuten Weizenkörnern und heranschießenden Steinchen hin und her hüpften, die wir aber nie trafen, nur verwirrten, von der einen in die andere Futterecke jagten in der Zeit, als uns der Pfarrer Franz Reinthaler in der Volksschule die Geschichte vom Schafhirten Abel und vom Ackermann Kain erzählte, die wir auch in unserem bebilderten »Katholischen Religionsbüchlein« aus dem Jahre 1931 nachlesen konnten, das wir im Religionsunterricht verwendeten und vor dessen Bildern ich oft stundenlang saß und mich hineinphantasierte in die Geschichten und naiven, mich damals tief berührenden farbigen Zeichnungen von Philipp Schumacher. Nach langer Zeit, so erzählte der Pfarrer Franz Reinthaler mit angespannter Stimme, geschah es, daß Kain dem Herrn Früchte von seinem Feld brachte, Abel ihm aber sein bestes Schaf opferte. Als dann der Herr mit Wohlgefallen auf Abel, nicht aber auf Kain vom Himmel herabschaute, wurde Kain fürchterlich eifersüchtig auf seinen Bruder Abel. Da sprach der Herr zu Kain: »Warum bist du so zornig? Wenn du Gutes tust, dann wirst du deinen Lohn erhalten; wenn du aber Böses tust, wird sogleich die Strafe folgen. Unterdrücke die Lust zur Sünde!« Eines Tages, als Abel und Kain wieder auf dem Feld arbeiteten, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und erschlug ihn mit einem Stein. Aber der Herr sprach zu Kain: »Wo ist dein Bruder Abel?« Kain antwortete: »Ich weiß nicht. Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders?« Gott sprach: »Was hast du getan, Kain! Das Blut deines Bruders schreit zu mir! Nun sollst du verflucht sein!« »Und wenn du Lust fühlst«, rief der Pfarrer Franz Reinthaler im Religionsunterricht, vor der Tafel stehend, über der ein Kruzifix angebracht war, »wenn du Lust fühlst, etwas gegen den Willen deiner Eltern zu tun, jemanden zu schlagen, zu naschen, zu lügen, dann unterdrücke die böse Lust sogleich! Sprich im Herzen: ›Das tue ich nicht! Das ist eine Sünde. Gott straft die Sünde.‹«
Immer wieder schaute ich im Religionsbuch auf das farbige Bild mit Abel und Kain. Im Vordergrund kniet Abel, der seinen nackten Ober- und Unterkörper mit einem weißen Schaffell umhüllt hat, neben einem im Gras liegenden Hirtenstab ehrfürchtig mit erhobenen Händen vor seiner aus Steinen aufgebauten Feuerstelle, neben der Holz und ein totes Lamm liegen und von dem die hochlodernden rotgelben Flammen und grauweißer Rauch senkrecht in den Himmel aufsteigen, während im Hintergrund auf der ebenfalls mit großen Steinblöcken aufgebauten Feuerstelle, neben der Holz und eine Getreidegarbe liegen, mit erhobener Faust und bösem Blick sein Bruder Kain, der ein grünes Tuch um seine Hüften geschlungen hat, kniet, und sein Feuer entwickelt sich nicht, die Flammen steigen nicht in die Höhe, der schwarze Rauch ist zum Boden niedergedrückt. Neben seiner Feuerstelle liegen ein Bündel Getreideähren und ein großer orangefarbener Kürbis. Hinter Kain und Abel, im weiten Feld, biegt sich ein Fluß. Beim Betrachten dieses Bildes hatte ich immer die Vorstellung, daß der böse und eifersüchtig schauende Ackermann Kain aufspringt und seinem Bruder Abel einen im Vordergrund, neben einem Früchte tragenden Marillenbaum liegenden großen Stein mehrmals auf den Schädel schlägt, bis Abel vor seinen hochlodernden Flammen und dem toten Lamm blutüberströmt zu Boden fällt und das Blut in sein weißes Lammfell hineinsickert, das er um Brust und Hüften trägt.
Der älteste Bruder und künftige Hoferbe war eifersüchtig und beschwerte sich beim Vater, daß auch er, der bereits die Hauptschule abgeschlossen hatte und als zukünftiger Ackermann in die Land- und Forstwirtschaftsschule ging, beim Vater auf dem Hof arbeiten müsse, damit mein monatliches Schulgeld für die Handelsschule, die Unterrichtsmaterialien, die wir ebenfalls selber zahlen mußten, und die täglichen Omnibusfahrten von Kamering nach Villach bezahlt werden könnten, aber dennoch kam der Vater, als er einmal gemeinsam mit meinem ältesten Bruder in der Stadt gewesen war, grinsend mit einer Brother de luxe, einer hellblauen Schreibmaschine mit weißen Kunststofftasten in einem Transportkoffer, den man rundum mit einem Reißverschluß öffnen konnte, zurück, einer Schreibmaschine, für die er mehrere tausend Schilling gezahlt hatte, und stellte sie, unter den Augen des mürrischen Bruders, wortlos und stolz auf den Küchentisch, mindestens ein Kalb hatte sie ihn gekostet. »Dankschön, Tate!« sagte ich. Ich wußte, die Schreibmaschine war nur für mich allein, kein anderer durfte in die Tasten greifen. In mehreren Jahren kam es nicht ein einziges Mal vor, daß es eines meiner Geschwister wagte, den Reißverschluß des Schreibmaschinenkoffers zu öffnen und die Maschine herauszuheben. In der Handelsschule hatte uns die Maschinschreiblehrerin die Empfehlung gegeben, daß wir, um das Zehnfingersystem so schnell wie möglich zu erlernen, auch zu Hause üben müßten, meinen Eltern hatte ich mitgeteilt, daß ich, um überhaupt die Handelsschule besuchen zu können, eine eigene Schreibmaschine benötige. Da es in meinem aus Stein gebauten bäuerlichen Elternhaus im Winter als einzigen beheizten Raum nur die große Bauernküche gab, schrieb ich mit den Typengabeln neben meinen Eltern und Geschwistern, neben Magd und Knecht gegen den Lärm an und klopfte mit den auf dem Papier auftauchenden Buchstaben in Rot und in Schwarz das Familienzusammenleben aus meinem Kopf und das Familienauseinanderleben in meinen Kopf hinein, Tag für Tag, ich lernte besessen Maschinschreiben, schlug »Winnetou III« mit dem Titelblatt von Sascha Schneider auf, auf dem der nackte Winnetou abgebildet ist, dem bei der Himmelfahrt die Häuptlingsfeder abhanden kommt, und begann damit, die Sterbepassage abzutippen, das Zehnfingersystem am Tod Winnetous zu erproben und zu lernen, bis ich in der Handelsschule in Villach zu denen gehörte, die am schnellsten tippen konnten, und man mich zu einem österreichweiten Maschinschreibwettbewerb nach Graz schickte, wo ich als einziger Mann zwischen zwanzig jungen Frauen mit meinen langen, dünnen Fingern auf der Schreibmaschine um die Wette klopfte und im Bewerb zumindest im Mittelfeld landete.
Keines meiner Familienmitglieder wagte es, sich über meinen Lärm mit der Schreibmaschine aufzuregen. Anschlag für Anschlag, schritt- und buchstabenweise nahm ich Abschied von den Eltern und Abschied von der Schule. Wohl fuhr ich morgens mit dem Omnibus nach Villach, ging aber nicht mehr in die Handelsschule, sondern in die Konditorei Kleinsasser auf dem Villacher Kirchplatz, unweit der drei Kinos, dem Apollokino, dem Stadtkino und dem Elitekino, las von Camus den Roman »Der Fall«, von Sartre »Das Spiel ist aus«, von Antoine de Saint-Exupéry »Dem Leben einen Sinn geben«, von William Faulkner »Licht im August« und ging oft schon um zehn Uhr vormittags ins Apollokino am Ufer der Drau und schaute mir mit den anderen Beatles, Hippies und Schulschwänzern aus den Villacher Gymnasien, der Handelsschule und Handelsakademie die neuesten Italo-Western an. Am Nachmittag setzte ich meinen Leinwandtrip im Bahnhofkino oder im Elitekino fort und kam Tag für Tag erst am Abend mit dem letzten Omnibus um zwanzig Uhr nach Hause. Keiner wagte es mehr, ein Wort zu sagen, mich zu fragen, ob denn der Schulunterricht so lange gedauert hatte, der Vater nicht, der, schon von der Stallarbeit in die Küche gekommen, seinen Malzkaffee mit Polenta auslöffelte und, hinter dem Küchentisch sitzend, über den Rand der vererbten Augengläser seines Vaters schaute, wenn ich mit meiner Schultasche, in der keine Schulbücher, sondern Romane und Erzählungen steckten, die Küche betrat. Auch die Mutter, die ihr ganzes Leben lang in diesem Haus nichts sagte und auch nichts zu sagen hatte, stellte mir nicht die Frage, wovon ich mich eigentlich ernähren wolle, denn ein paar Monate davor hatte ich einen Sommer lang im Büro der Spittaler Molkerei gearbeitet, wo der Vater seine Milch ablieferte und wo einst mein Großvater mütterlicherseits als Vorstand zu einem Geburtstag einen Pfau, später einen Fernseher, den zweiten im Dorf, geschenkt bekommen hatte, und hatte, auch zum Stolz meines Vaters, der sich in der Molkerei nach mir, nach meiner Büroarbeit erkundigte, mein eigenes Geld verdient und war von der einen auf die andere Woche kein »Nichtsnutz« und kein »Faulpelz« mehr, und keiner sagte mehr zu mir, daß ich wohl Straßenkehrer werden könne, wie ich es öfter von der Mutter gehört hatte, dabei hatten sie keine Ahnung, wie lange ich mit diesem über den ganzen Sommer verdienten Geld auskommen würde. Tatsächlich habe ich mich als Kind nach der mehrfachen Ankündigung, daß ich wohl keinen, wie es hieß, ordentlich Beruf, erlernen werde können, mit dem Straßenkehrer angefreundet und bin ihm kilometerweit gefolgt, wenn er mit einem Besen den Rand der Straße kehrte.
In Wirklichkeit hatte ich ab dem zweiten Jahr in der Handelsschule mehrere Jahre lang Geld von meinem Vater gestohlen, um mir Bücher kaufen und ins Kino gehen zu können, und ab meinem dritten Jahr in der Handelsschule aß ich auch nicht mehr zu Hause, ich warf das erbärmliche Jausenbrot, das mir die Mutter morgens in die Schule mitgegeben hatte, unterwegs in einen Papierkorb – dann und wann verschimmelte das eine oder andere in meinem Schulranzen, bis es bockig und grün und schwarz war und ich es im Plumpsklo entsorgen mußte, nicht einmal mehr den Schweinen in den Trog werfen konnte –, stieg am Morgen mit den anderen Schülern aus dem Omnibus, ging am Villacher Busbahnhof in eine kleine Gastwirtschaft, frühstückte Frankfurter mit Semmel, schlenderte dann zur Buchhandlung Pfanzelt, ging über den Kirchplatz in die Konditorei Kleinsasser, trank Kaffee, einen »Verlängerten«, wie es hieß, schaute die neugekauften Bücher an, ging oft schon um zehn Uhr am Vormittag ins Apollokino, während der Vater und der älteste Bruder und zukünftige Ackermann meines bäuerlichen Elternhauses nach der morgendlichen Stallarbeit und nach dem Frühstück mit Malzkaffee und Krapfen zum Holzfällen in den Wald gingen.