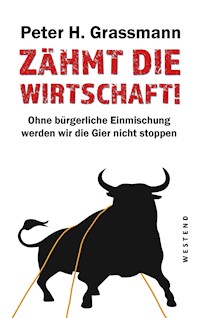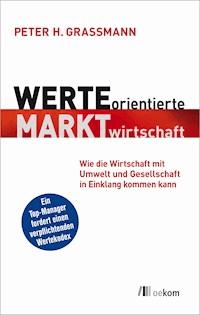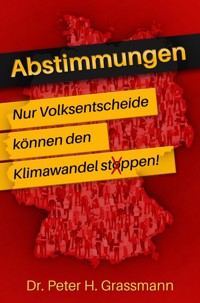
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist aus Wut entstanden. Schon vor 15 Jahren hat Peter Grassmann in seinem Buch Plateau3 gewarnt, dass der Klimawandel durch die rein repräsentative Demokratie nicht zu beherrschen sein wird. Nun ist der Klimawandel tägliche Erfahrung, ein Abbremsen der CO2-Emissionen ist vorrangig. Aber noch immer lässt man den Bürger bei der Gestaltung der notwendigen technologischen Umstellungen nicht mitreden. Es fehlt laut Grassmann die Mitbestimmungskomponente, deren Kraft er als ehemaliger Manager großer Konzerne kennt. Sein Vorschlag sind Volksentscheide auch auf Bundesebene. Denn die Staatsgewalt wird laut Grundgesetz vom Volke durch Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Genutzt ist dies noch nicht. Dieses Buch zeigt, wie Volksentscheide auch auf Bundesebene funktionieren können, wie dazu Wissen in der Wählerschaft aufgebaut und wie Falschinformation unterdrückt wird. Wählen wieder zum Erlebnis machen - durch ergänzende Abstimmungen mit Problembezug.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Table of Contents
Titel
Impressum
Das größte Wirtschaftsverbrechen der Geschichte – in einer schwachen Demokratie
Repräsentative Demokratie, aber mit Bürgerbeteiligung
Ein nächstes Plateau der Demokratie: mit Fachkompetenz
Sonderkapitel
Zähmt die Wirtschaft – Ohne bürgerliche Einmischung werden wir die Gier nicht stoppen
1. Verrat an der Zukunft
4. Mehr Macht dem Volk
Plateau 3 – Werteregulierte Marktwirtschaft und Bürgerdemokratie – erschienen 2006 bei Murmann
1. Die Zeit ist reif für neue Lösungen
4. Bürgerbeteiligung – der Schlüssel zum Marktwandel
Schlusswort
Dr. Peter H. Grassmann
Alle Staatsgewalt … wird vom Volke in Wahlen und
Abstimmungen
ausgeübt …
Nur Volksentscheide können den Klimawandel stoppen!
Impressum
Ausgabe September 2023 © Peter Grassmann
Kontakt:
Dr. Ing. Peter H. Grassmann
Klenzestr. 59
80469 München
Website: www.grassmann.de
E-Mail: [email protected]
Coverdesign und E-Book-Formatierung: Daniela Rohr / www.skriptur-design.de
Das größte Wirtschaftsverbrechen der Geschichte – in einer schwachen Demokratie
Der Klimawandel wäre vermeidbar gewesen
Es liest sich wie ein Märchen. Der Klimawandel wäre vermeidbar gewesen, wenn es in den westlichen Demokratien mehr Mut der Politiker gegen die kriminelle Lobbyarbeit der Erdölindustrie gegeben hätte. Denn anfänglich war der politische Wille durchaus vorhanden. In einem der seltenen Rückblicke berichtete die Wochenzeitung Die Zeit vor einigen Jahren unter der Überschrift »Morgen vielleicht« über die Anfänge der Klimadebatte in der Politik:
»1988 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Resolution 43/53, sie hieß ›Der Schutz des globalen Klimas für die heutige und die künftige Menschheit‹. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher warnte damals, die Welt sei dabei, sich in einer ›Hitze-Falle‹ zu verfangen. Der spätere US-Präsident George H. W. Bush versprach im Wahlkampf, er werde dem Treibhauseffekt einen ›White House Effect‹ entgegensetzen. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl kündigte einen ›wirksameren globalen Schutz der Umwelt‹ an.«
In seinem Wahlprogramm 1998 schrieb er:
»Wir wollen die natürlichen Lebensgrundlagen für nachfolgende Generationen bewahren. Das ist Kernanliegen unserer Politik in christlicher Verantwortung. […] ›Global denken, vor Ort handeln‹ – das bedeutet, dass Erfolge im Kampf um das ökologische Gleichgewicht auf dieser Erde nur erzielt werden können, wenn jedes Land den ihm zustehenden Beitrag mit den Mitteln nationaler Umweltpolitik erbringt. Wir halten an unserem Ziel fest, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2005 um 25 % zu reduzieren. Wir wollen den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung – Solarenergie, Wasser- und Windkraft – bis zum Jahr 2010 verdoppeln. Und wir wollen die rasche Einführung des 5- und des 3-Liter-Autos. […] Wir setzen uns ein für eine europaweit abgestimmte, harmonisierte, aufkommens- und wettbewerbsneutrale Energiebesteuerung.«
Brutalo pur – Lobby siegt über Risikowarnungen
Kaum zu glauben ist der danach einsetzende Widerstand der Ölkonzerne, allen voran der Öl- und Gaskonzerne Shell und Exxon gegen diese Absichten der Politik, die in ihrer Konsequenz deren ertragreiches Geschäftsmodell mit fossilen Energien beenden und sie durch neue Energieformen ersetzen würde. Die ohne diesen Wandel rasch wachsende Gefahr eines fatalen Klimawandels war den Konzernen genau bekannt. Shell hatte bereits 1984 Wissenschaftler beauftragt, die Risiken eines Klimawandels zu klären. Mit großer Deutlichkeit wiesen sie auf die Gefahren hin, aber das Management des Ölkonzerns reagierte mit Geheimhaltung. 1986 sagten dann auch Wissenschaftler von Exxon in einem 84-seitigen Bericht den durch steigenden Brennstoffverbrauch ausgelösten Klimawandel erstaunlich korrekt vorher und empfahlen auch ihrerseits Alternativen. Aber es blieb bei Geheimhaltung. Die Empfehlung, sich mit neuen Energietechnologien zu befassen, blieb unbeachtet.
Stattdessen schufen Exxon und Shell gemeinsam mit BP und Peabody, der Ölfirma des Brüderpaares Koch, die Lobbygruppe Global Climate Coalition und stellten ihr erhebliche Finanzmittel bereit. Die Aufgabe war, die Unsicherheit der Prognosen zu nutzen und weltweit Zweifel an diesen immer eindeutiger werdenden wissenschaftlichen Ergebnissen zu schüren. In die Medienberichte brachte man verunsichernde Gegenmeinungen ein und nutzte Kommentare und Talkshows als Plattform zur Verunsicherung und als Gegenpol zu Diskussionen mit seriöser Wissenschaft.
Die amerikanische Demokratie versagt
In USA wurde der für den Kilmaschutz eintretende Präsidentschaftskandidat Al Gore gezielt in Misskredit gebracht und alle seine energiepolitischen Absichten in Misskredit gebracht. Das Wahlergebnis im Jahr 2000 war dann knapp. Gore hatte insgesamt mehr Stimmen, aber das amerikanische Wahlsystem geht nach Erfolgen in den Bundesstaaten. Florida wurde entscheidend. Zwar hatte Bush einige hundert Stimmen mehr, aber die dort verwendete Stanzung in Lochkarten war nicht geeignet für ältere und unsichere Wähler. Nicht voll ausgestanzte Löcher wurden von den Zählmaschinen nicht erkannt. Bush lag zunächst einige hundert Stimmen vorne, aber es kam zu einer manuellen Nachzahlung. Als klar wurde, dass sich nun eine Stimmenmehrheit für Al Gore ergeben würde, ließ Bush diese Nachzählung durch den Supreme Court abbrechen und wurde so Präsident. Das war ein schwerer Verstoß gegen die bei jeder demokratischen Wahl notwendige Fairness. Erstmals hatten Geld und kriminelle Methoden den Ausgang der Präsidentenwahl bestimmt, was sich später unter Donald Trump noch erschreckender fortsetzte und den Respekt vor der amerikanischen Demokratie beendet hat.
George W. Bush, der im Ölstaat Texas zuvor Governor war und von seinen Freunden dort finanziell enorm unterstützt wurde, beendete dann alle politischen Vorhaben zum Klimaschutz. Nicht nur der Klimaschutz wurde so zum Verlierer, es war auch die Demokratie. Eine Führungsnation der Demokratie zu sein, können die USA nun nicht mehr beanspruchen.
Nach der Ernennung von George W. Bush löste sich diese Global Climate Coalition auf. Die Ölindustrie konnte nun darauf vertrauen, dass Bush junior ihre Ziele weiterverfolgen würde. Die Lobby hatte gewonnen, ein Verbrechen, das bis heute ungesühnt und nicht einmal als solches voll verstanden ist. Das liegt auch an dem Schweigen der Medien, denn die waren mit beteiligt in ihrer Freude, Skepsis zu unterstützen und wohl auch wegen ihrer Abhängigkeit von den hohen Werbeeinnahmen der Öl- und Automobil-Industrie.
Erfolgreiche Lobbyarbeit gegen Klimaschutz-Programme
Statt eines Widerspruchs gegen diese unglaubliche Lobby gegen den Klimawandel schwenkte die Politik weltweit um, wurde zögernd und abwartend, trotz eines steigenden Drucks aus Teilen der Bevölkerung, aber unterstützt von Klimaskeptikern und Klimaleugnern. Eine breite Anti-Klima-Bewegung bildete sich, teils auch durch die Medien gefördert, blieb aber dennoch eine Minderheit. Die Wikipedia-Seite Klimawandelleugnung liest sich wie ein Horrorszenario. In diesem globalen Umfeld waren auch die Politiker Europas nicht bereit, sich für ernsthaften Klimaschutz einzusetzen – trotz laufender Warnungen der Wissenschaft. Al Gore, der Wahlverlierer, zog sich aus der Politik zurück, wurde zu einem der großen Mahner, wendete insgesamt 300 Millionen Dollar für seine Kampagnen auf, aber ändern konnte er nichts. Die Regierungen blieben (fast) untätig.
Sein Film »Eine unbequeme Wahrheit«, in dem er eine Zeitenwende forderte, war für mich Anlass für mein erstes Buch Plateau 3. Für mich war aufgrund meiner Erfahrungen mit der Mitbestimmung bei der Sanierung großer Unternehmen klar, dass auch unser demokratisches Modell zusätzliche Elemente der Mitbestimmung benötigte und die übliche »repräsentative Demokratie« es ohne eine entsprechende Weiterentwicklung nicht schaffen wird. Heute gilt leider diese damalige Mahnung immer noch, ebenso wie die damals vorgeschlagenen Lösungsansätze. Denn an den Defiziten unseres Demokratiemodells hat sich nichts geändert. Sie wurden nur deutlicher. Weil diese nach fünfzehn Jahren noch immer unveränderte Gültigkeit dieser Warnung im Grunde erschütternd ist, ist sie im Sonderteil nochmals abgedruckt. Der damalige Titel: Die Zeit ist reif für neue Lösungen.
Das nicht aufgearbeitete Verbrechen – gezieltes Zersetzen politischer Handlungsfähigkeit
Das Fazit ist eindeutig: der Klimawandel ist nun unbestrittenes Faktum. Gegenmaßnahmen unterblieben auf Druck interessierter Teile der Wirtschaft und einer starken Gruppe von Skeptikern und Leugnern, unterstützt von den Medien, die nur zu gern Unsicherheit und Zweifel erzeugen. Diese Verunsicherung hat den Handlungswillen der Politik zielgerichtet zersetzt. Das Ganze, nicht nur die Lobbyarbeit der Energiekonzerne, sondern auch deren Unterstützung durch die Medien ist ein riesiger Skandal, ein Verbrechen an der Menschheit. Eine Aufarbeitung ist überfällig. Aber da es um die Medien selbst geht, bleiben sie zu diesen Vergehen stumm und die öffentliche Meinung ist auf diesem Auge (noch) blind. Die Aufarbeitung durch eine unabhängige Ethik-Kommission bleibt dennoch die logische Konsequenz, eine Forderung, die sich mit zunehmenden Klimaproblemen zügig verstärken dürfte. Durchgesetzt werden könnte sie wohl nur mit einem Volksentscheid, denn das Interesse von Politik und Medien als den Betroffenen ist naturgemäß gering.
Deutsches Verbots-Tripel
In dieser politischen Gesamtsituation setzte sich also der frühzeitige Weg einer allmählichen Transformation durch Anreize und staatliche Steuerung nicht durch, weder in den USA noch bei uns. Jahrzehnte vergingen mit vielen Versprechungen, aber ohne Erfolge, gut messbar am unveränderten CO2-Ausstoß.
Nun aber – unter neuer »Ampel« – wurde unter dem Druck der rasch zunehmenden und nun für jeden merkbaren Klimaveränderungen bei uns eine Verbotsphilosophie gewählt, in einem Hauruck-Verfahren, das man auch als ideologiegetrieben bezeichnen kann. Es kam innerhalb nur weniger Jahre zu einem »Verbotstripel«, dreier sich ergänzender Endszenarien für Teile des aktuellen Energiesystems:
> dem Aus für russisches Gas, beginnend mit dem Verbot von Nord Stream 2,
> dem Aus für Atomstrom und
> dem Aus für die Kohle.
Kleingeredet wurde, dass dieses Tripel, so notwendig die Trennung von Öl und Gas auch sein mag, in seiner Kombination zwangsläufig zu einer erheblichen Schwächung der Wirtschaftskraft und schließlich einer Rezession führen musste. Die ist aber auch unter dem Aspekt des Klimaschutzes kontraproduktiv, da Transformationen eine starke Wirtschaft und große Investitionen erfordern und eine Abschwächung den Wandel erschwert, wenn nicht sogar unmöglich macht.
Das Verbot von Nord Stream 2 wurde nach Beginn des Ukrainekriegs ausgeweitet auf ein komplettes Verbot des Imports von russischem Gas. Selbst Außenministerin Baerbock gibt heute zu, dass dieses Embargo wirkungslos war, da das Gas in andere Teile der Welt verkauft wurde und die beabsichtigte wirtschaftliche Schwächung von Russland ausblieb. Geschwächt wurden nur wir.
Bekanntlich schwebt das gleiche Fragezeichen der Wirksamkeit auch über der Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke, da nun Atomstrom aus den Atomkraftwerken Frankreichs bezogen werden muss – und sichere Atomkraft emissionsfrei und im Quervergleich mit den Gefahren des Klimaschutzes ihre Abschaltung von wesentlich geringerer Priorität ist. Zudem macht diese Parallelität den unter Klimaaspekten wichtigsten Ausstieg, nämlich das Aus für die Kohle, besonders wirkungsarm, denn es zwingt zum Stromimport auch aus den Kohlekraftwerken des Nachbarlands Polen.
Im Fazit ist also nicht nur die Klimapolitik der »repräsentativen Demokratie« gescheitert – deren Maßnahmen blieben wirkungslos -, sondern die Maßnahmen führten zudem zu einer massiven wirtschaftlichen Abschwächung mit entsprechend verringerter Kraft für technologische Umstellungen und mit subventionsbedingt enormer Schuldenbildung.
Dreißig Jahre erfolglos – die repräsentative Demokratie ist zu schwach
Bei diesem Szenario ist es höchste Zeit, die Handlungsfähigkeit der rein repräsentativen Demokratie zu hinterfragen. Denn sie ist offensichtlich nicht in der Lage, das Klimaproblem zu lösen und die Transformation zu einer emissionsfreien Wirtschaft durchzusetzen. Die über dreißig Jahre lang erfolglose Politik bestätigt die Schwäche des Modells.
Das oben genannte Tripel von Verboten hat nun die Bereitschaft der Bevölkerung, die Konsequenzen widerspruchsfrei mitzutragen, überfordert. Es ist das Dilemma der sogenannten Ampelkoalition, der ersten Regierungskonstellation auf Bundesebene, die den Klimaschutz als Gefahr akzeptiert und sich auf Gegenmaßnahmen festgelegt hat. Aber die Kritik ist enorm, das Vertrauen in diese Politik schwindet.
Die Bedeutung von Vertrauen
Nicht beachtet wurden die Gesetze der Sozialpsychologie, die bei schwindendem Vertrauen eine sichtbare Einbeziehung der Betroffenen empfiehlt. Während meiner Studentenzeit in USA am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, hatte ich begeistert Managementkurse besucht, denn die waren dort völlig anders als die klassischen betriebswirtschaftlichen Vorlesungen in München. Unvergesslich sind mir die Botschaften, die mir ein Kurs mit dem Titel »Management of Innovation« an der dortigen Sloan School of Management auf den Weg gab. Denn der Kurs befasste sich fast ausschließlich mit Motivation, Teamgeist und Teilhabe und nicht mit Ingenieurskunst, wie man es am MIT als berühmtester Technischer Universität der USA erwartet hätte. Die von mir damals Zeile für Zeile gelesene begleitende Literatur hieß Social Psychology of Organisations von Daniel Katz und Robert Louis Kahn – auch Jahrzehnte später ein noch lesenswertes Standardwerk der Sozialpsychologie von Organisationen.
Damit ist die Psychologie des menschlichen Zusammenspiels in Unternehmen oder auch in Nationen gemeint, also da, wo viele Menschen zusammentreffen und gemeinsam Aufgaben meistern müssen, möglichst konfliktfrei und motiviert. Es ging um die vielen Facetten der Gruppendynamik, die zu kennen für Unternehmer und deren Marketingfachleute, aber auch für Politiker hilfreich sind. Und es ging um Empathie, dieses Gefühl für Mitmenschen und Andersdenkende.
Einer der wichtigsten Punkte dieser Sozialpsychologie von Organisationen ist »teilhaben lassen«, eine Grundregel, die in Unternehmen heute zum Standard guter Führung gehört, von der Politik allerdings allzu oft außer Acht gelassen wird. Es ist für Mitarbeiter – und auch die Bürger eines Landes – ein großer Unterschied, ob sie und ihresgleichen zu einer Entscheidung beitragen können, auch wenn dann die Entscheidung nicht ihrer eigenen Meinung entspricht. Die Autoren schrieben in der Zusammenfassung in der Originalausgabe:
»Das vielleicht größte organisatorische Dilemma unserer Organisationsstrukturen ist der Konflikt zwischen den Erwartungen demokratisch erzogener Menschen und ihrer tatsächlichen Teilhabe an Entscheidungsfindungen. Obwohl die Mehrzahl der Entscheidungen von der Führung gefällt werden muss, können die Gruppenmitglieder psychologisch in den Prozess einbezogen werden, wenn sie die Informationen, die der Entscheidung zugrunde liegen, teilen können. Informiert können dann auch Einzelne die öffentliche Meinung mobilisieren, und selbst wenn eine Gruppe Gewünschtes nicht erreicht hat, empfinden sie es doch als genugtuend, an der Meinungsbildung beteilig gewesen zu sein.«
Solche »Mitbestimmung« der Belegschaft ist für die Motivation in einem Unternehmen mitentscheidend für den Erfolg. Eine gute Führung akzeptiert Mitbestimmung. Es ist einer der Eckpunkte des deutschen Erfolgsmodells der Mitbestimmung, also der Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretungen, wichtig gerade in Krisenzeiten.
Auch als Unternehmer ist man immer wieder vor die Situation mangelnden Vertrauens gestellt und muss mit ihr zurechtkommen. Mit Sonntagsreden an die Belegschaft lässt sich das nicht gewinnen. Reden vor großem Auditorium haben von vornherein den Nachteil, dass die Rückkopplung sehr eingeschränkt ist. Mal wird geklatscht, mal wird gepfiffen, mal gibt es Zwischenrufe. Aber eine wirkliche Rückkopplung, die mit einfließt in Entscheidungen, gibt eine Betriebsversammlung nicht. Der Betriebsrat wird zum wichtigen Mittler, denn ihm wird gerade in Krisenzeiten oft mehr vertraut als der Unternehmensleitung.
Diese Erfahrungen machen die Idee des Bürgerrats als Begleiter von Volksentscheiden interessant als eine Vertretung, die stärkeres Vertrauen genießt als die Führung. Die in meinen früheren Büchern vorgeschlagene Zusammensetzung mit Verbänden, Parteien und Zivilgesellschaft bleibt aber unter dem Verdacht einer zu starken Regierungsabhängigkeit und die für die Begleitung von Volksentscheiden so wichtige Neutralität wurde deshalb von vielen angezweifelt.
Repräsentative Demokratie, aber mit Bürgerbeteiligung
Das große Experiment – KI-basierter Bürgerrat Mehr-Demokratie e.V.
Aufbauend auf ältere Erfahrungen, setzte Irland 2019 als erste Nation in der Europäischen Union einen aus allen Schichten der Bevölkerung zusammengesetzten Bürgerrat für eine Frage der nationalen Gesetzgebung ein, und zwar für die kontroverse Frage der Geschlechter-Gerechtigkeit. Trotz des exotischen Themas war es ein voller Erfolg. Der Bürgerrat tagte ausführlich und empfahl einen Volksentscheid, der für Ende 2023 angesetzt wurde. Das ermunterte Mehr Demokratie e.V. als schon lange für Volksentscheide kämpfende NGO, auch in Deutschland ein solches Experiment zu wagen, und zwar zur Zukunft der Demokratie. Es wurden dazu in Zusammenarbeit mit den Meldeämtern Bundesbürger in einem gruppengeordneten statistischen Verfahren ausgelost, einen »Bürgerrat« zu bilden.