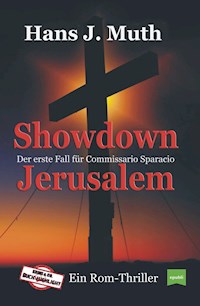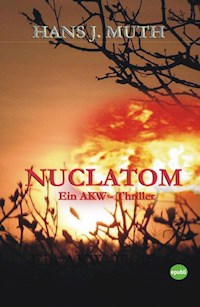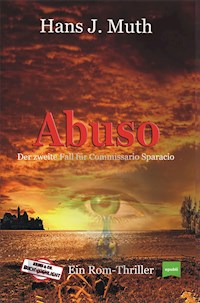
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Fälle des Commissario Sparacio
- Sprache: Deutsch
Abuso ist der italienische Ausdruck für Missbrauch. Nach einem verheerenden Hochwasser in Rom zieht sich der Tiber wieder zurück in sein Bett, einen grausam zugerichteten Toten in einer Baumkrone hinterlassend. Commissario Marcello Sparacio steht vor einem großen Rätsel. Weitere Tote tauchen auf und Sparacio begreift, dass dieser Fall größere Dimensionen zu haben scheint als bisher angenommen. Als schließlich noch ein kleiner Junge vermisst wird und Commissario Sparacio beginnt, die mysteriösen Zeichen zu deuten, führen alle Spuren in den Vatikan - Vom Autor des Thrillers Nahtlos !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans J Muth
Abuso
Der zweite Fall für Sparacio
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
ABUSO
Impressum
Prolog
Prolog
1.Kapitel
2.Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16.Kapitel
17.Kapitel
18. Kapitel
19.Kapitel
20. Kapitel
21.Kapitel
22. Kapitel
23.Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
Impressum neobooks
ABUSO
Hans J. Muth
Rom-Thriller
Der zweite Fall für Commissario Sparacio
Impressum
Texte: © Copyright by Hans MuthUmschlagfoto I-Stock
Umschlag © Copyright by Hans Muth
Verlag: Hans Muth
Kapellenstr. 6 54316 Lampaden [email protected]
Druck:
epubli, ein Service der
neopubli GmbH, Berlin
Printed in Germany
Nach dem Roman „Tränen der Rache“, mit freundlicher Genehmigung des Verlags Stephan Moll, Burg Ramstein 2014
Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um einen Roman. Personen, die darin vorkommen, existieren in der Wirklichkeit nicht. Dennoch ist es nicht immer möglich, jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen zu vermeiden.
Keiner sieht meine Qualen,
niemand kennt meinen Schmerz.
Gott im Himmel repariert mein gequältes Herz
Merrlyn
Wenn der Geist bereit ist zur Rache, wird er nicht eher ruhen, bis sein Körper als Handlanger der Sinne das vollendet hat, das seinem Leben wieder einen Sinn gibt oder er selbst Zuflucht im Tode gefunden hat. (hjm)
Prolog
Teil 1
Irgendwo in San Lorenzo, Rom
Der schwere Schmiede-Hammer federte mit einem durchdringend hellen Klang zurück, als er die spiegelglatte Fläche des Ambosses traf, um gleich darauf wieder nach unten auf das glühende, zum Kreis gebogene Metallteil zu prallen, wobei die Frequenz des Schlages um einiges an Tiefe gewann. Funken stoben und nach ein paar Schlägen hielt die Faust des Mannes inne, nicht ohne den Hammer erneut einige Male auf der blanken Amboss-Fläche nachfedern zu lassen.
Der schlanke, sehnige Arm hob das bearbeitete kreisrunde Werkstück in die Höhe, dicht vor sein Gesicht, wo er es mit engen Augen eine Zeitlang nachdenklich betrachtete. Dabei wiegte er den Kopf von einer Seite zur anderen und ein höhnisches Lächeln zeichnete sich auf seinem Gesicht ab. Er nickte zufrieden, ehe er mit einer entschlossenen Bewegung das Metall in einen Eimer mit kaltem Wasser stieß, gleich einem Schwert in die Brust eines wehrlos Daliegenden. Gleichzeitig mit dem Zischen des abgeschreckten Werkstücks stieg eine weiße Dunstwolke empor und eisenhaltiger Wasserdampf verteilte sich nebulös im Raum.
Der Mann streifte sich bedächtig die ledernen Arbeitshandschuhe ab und wischte mit einer flüchtigen Bewegung beider Hände über seine blaue Arbeitshose. Er durchquerte gebeugt den fensterlosen Raum, der mit seinen Mauern aus Quadersteinen einem kahlen Kerker glich und in dem außer einer kleinen Esse und dem Amboss lediglich noch eine Arbeitsbank und ein Azetylen-Schweißgerät standen. Er legte die hitzebeständigen Handschuhe auf die metallene Werkbank vor sich und stützte sich mit gestreckten Armen und gesenkten Kopf, einige Male tief durchatmend, darauf ab. Sein Blick starrte auf die Innenseiten seiner Hände und der Ausdruck seines Gesichts hatte etwas Befremdliches, Undurchdringliches.
Langsam erhob er seinen Blick, dorthin, wo in jeder anderen Werkstatt Werkzeuge oder ein Arbeitsschrank ihren Platz gehabt hätten. Doch an dieser Wand gab es keine Werkzeuge. Es gab weder Hammer, Zange noch eine Säge, es gab nicht einmal einen Schrank. An dieser Wand gab es nur Fotos. Zahlreiche Fotos in allen Größen, in Farbe und in Schwarz-Weiß. Sie zeigten nur einen Menschen, einen Jungen, vielleicht zehn oder zwölf Jahre alt. Der Junge lachte. Auf fast allen Bildern lachte er. Ein Junge mit großen tiefbraunen Augen und lockigem schwarzen Haar. Die Fotos zeigten nur das Gesicht, keine Umgebung, keinen Raum. Nur das Gesicht war jeweils aus dem Gesamtmotiv herausgeschnitten worden, bei jedem der unzähligen Bilder.
Die Backenknochen des Mannes mahlten in seinem schmalen Gesicht, während er mit feucht schimmernden Augen auf die Fotos starrte und leise den Namen Matteo vor sich hin sprach. Dann sah er wieder auf seine Handflächen und anschließend auf die Fotos.
Ich muss es tun. Wir müssen beide unsere Ruhe finden.
Dann drehte der Mann sich jäh herum, griff in den Eimer mit dem Löschwasser und zog das erkaltete geschmiedete Eisen mit einem energischen Ruck heraus, ein kreisrundes Etwas, kaum größer als seine Handfläche und warf einen entschlossenen Blick darauf.
Er ging zurück zur Werkbank und legte das Teil darauf ab. Dann öffnete er die Ventile der Azetylen- und der Sauerstoffflasche und hielt ein brennendes Streichholz vor die zischende Öffnung des Schweißbrenners. Mit einem hellen Knall entzündete sich eine weiß-blaue Flamme, die der Mann über die beiden Regler an der Armatur hochfuhr, bis ihm das beißende Geräusch sagte, dass die Arbeitstemperatur erreicht war.
Er näherte sich dem Werkstück mit der Flamme und als das Metall zu glühen begann, griff er nach einem bereitliegenden Draht, schweißte den Anfang an dem kreisrunden Teil fest und formte jene Applikationen, die dem Kunstwerk den Erkennungswert gab, den zu schaffen er beabsichtigte.
Was ich tue, das tue ich für dich.
Die Augen des Mannes verengten sich und schienen die Bilder an der Wand mit ihren Blicken aufzusaugen. Für dich und all die anderen, denen ein Leid zugefügt wurde. Sie werden ihr Leben mit diesem Zeichen teilen müssen. Mit dem Zeichen der Schmach, das unauslöschlich bis ans Ende ihrer Tage mit ihnen verbunden sein wird.
Wie zur Bestätigung seiner Worte erklang das diffuse Geläut von Kirchenglocken, irgendwo außerhalb der fensterlosen Gemäuer.
Prolog
Teil 2
An einem anderen Ort in San Lorenzo, Rom
Die großgewachsene dürre Gestalt eilte gebeugt und mit staksigen Schritten über die Piazza di San Lorenzo in Lucina, einem südlichen Stadtteil Roms, den langen Schatten ihres Körpers mit der wehenden Kutte und der seinen Kopf verdeckenden Kapuze in der untergehenden Abendsonne vor sich herschiebend. Ihre Schritte waren nahezu lautlos, als sie an der Längsseite der Basilika entlangeilte und schließlich an einer stählernen, mannshohen Tür verharrte.
Die vermummte Gestalt schaute sich nach allen Seiten um und griff nach dem metallenen Türknopf. Das Portal gab dem Druck ihrer Hand nach und schwenkte mit einem leisen Quietschen nach innen. Dann sah sie sich noch einmal nach allen Seiten um und verschwand schließlich hinter der Tür, die sie mit einer bedächtigen Bewegung hinter sich schloss.
Die Gestalt eilte über drei bis vier steinerne Stufen abwärts, um sich anschließend in der Sakristei des Gotteshauses wiederzufinden. Dort öffnete sie die Tür zum Kirchenschiff, sah sich nach allen Seiten um und nickte zufrieden. Die Bänke waren leer, weder Gläubige, noch Touristen hielten sich dort auf. Sie lauschte noch einen kurzen Moment in die Leere der heiligen Halle und schloss die Tür. Dann begab sie sich zur der Stirnwand der Sakristei, an der ein offensichtlich ausgesonderter Hochaltar stand, der den Priestern dazu diente, die zur Messe gebräuchlichen Utensilien darin aufzubewahren, wobei auf das Aufstellen eines eher weltlich wirkenden Schrankes verzichtet werden konnte.
Die Gestalt beugte sich an der linken Seite des Altars zum Boden und tastete mit der linken Hand an der Rückseite des Altars entlang. Dann schien sie gefunden zu haben, was sie suchte, denn wiederum nickte sie zufrieden und sofort ertönte ein leises „Klack“, als ihre Hand einen Mechanismus betätigte. Sie erhob sich aus ihrer gebeugten Haltung und gleichzeitig schwenkte der Altar an der linken Seite etwa einen halben Meter nach vorne, gerade weit genug, dass sich die Gestalt hindurchzwängen konnte. Ein weiterer Griff und eine schmale unscheinbare Tür öffnete sich. Ehe sie sich durch sie hindurchzwängte, betätigte sie noch einmal den Schließmechanismus. Der Altar schwenkte hinter ihr langsam in seine ursprüngliche Stellung zurück.
*
Die Gruppe der fünf in dunkle Kutten gehüllten Männer verharrte schweigend mit gesenkten Köpfen in dem kleinen Raum, tief unter dem Kirchenschiff der Basilika San Lorenzo in Lucina. Außer einem runden Tisch aus schwerem alten Eichenholz und den darum angeordneten Stühlen sowie einigen Pechfackeln in ihren Halterungen an den Wänden befand sich keinerlei Mobiliar in dem Raum, dessen kalte und erdrückende Atmosphäre an die Folterkammern und Kerker einer vergangenen Epoche erinnerte.
Die Männer hatten diesen Raum nacheinander unerkannt durch die Sakristei und den beweglichen Altar erreicht. Nun verharrten sie wortlos, mit gesenkten Köpfen unter ihren Kapuzen, die Arme an den Körper gezogen, in dem Versuch, die Kühle des Raumes von sich fernzuhalten. Keiner schaute den anderen an, niemand eröffnete ein Gespräch, es schien, als lauschten sie in das Innere ihrer Körper, ihrer Seelen, in einer Erwartung, die sich sogleich zu bestätigten schien.
Denn, plötzlich, wie auf Kommando, erhoben sich die Köpfe der Männer. Sie lauschten den leisen Schritten, die ihnen über die Treppe entgegenkamen, über die steinernen Stufen, über die auch sie nach unten in den geheimen Raum gelangt waren.
Die einzige Tür des Raumes wurde von außen geöffnet und gab den Blick frei auf die schmalen Steinstufen der nach oben führenden Wendeltreppe, die in diesem Moment teilweise durch einen in der Türöffnung stehenden schlanken Mitbruder mit Kutte und Kapuze verdeckt wurde.
Die Gruppe am Tisch erhob sich ehrfurchtsvoll von ihren Plätzen und grüßte den Neuankömmling mit einem leichten demütigen Kopfnicken. Der jedoch blieb noch einige Augenblicke auf der untersten Stufe stehen und besah sich die Männer am Tisch. Ein zufriedenes Gefühl beschlich ihn, als er die ausnahmslos demütige und devote Haltung der anderen zur Kenntnis nahm.
„Nehmt wieder Platz und lasst uns für einen Moment die Förmlichkeiten vergessen“, forderte er schließlich die Männer auf, schloss die Tür hinter sich und nahm auf dem letzten freien Stuhl Platz.
„Ist Euch auch niemand gefolgt?“ Er sah in die Runde der Anwesenden, sah auf ihre Kapuzen, denn sie hielten die Köpfe immer noch gesenkt. „Seid Ihr euch dessen sicher?“, fragte er weiter. „Ist euer Geheimnis auch weiterhin gehütet?“
Die Männer nickten stumm zur Bestätigung und langsam erhoben sie ihre Häupter und sahen den Neuankömmling erwartungsvoll an.
„Wir werden uns sputen müssen“, drängte dieser. „Die Luftzufuhr unter der Krypta, wie ihr wisst. Wenn die Fackeln zu flackern beginnen, werden wir unser Treffen beenden. Deshalb komme ich gleich zur Sache.“
Er verharrte kurz und blickte die Dreinschauenden erneut der Reihe nach an. Doch dieses Mal senkten sie nicht ihre Köpfe. Erwartung stand in ihren Mienen geschrieben.
„Unser Treffen heute und hier, es musste sein. Man trachtet euch nach dem Leben“, sagte der Mann, der ihr aller Herr zu sein schien, schließlich so leise, dass sich die Köpfe der Anwesenden wie auf ein Kommando in Richtung des Wortführers bewegten. „Einer eurer Brüder … man hat ihn gefunden, brutal ermordet. Aber keine Sorge, die Schändung an seinem Körper wurde ausgelöscht, euer Geheimnis wird also gewahrt bleiben …“
„Wer hat die Zeichen entfernt, Herr?“, kam die zögerlich fragende Stimme aus der Reihe der Anwesenden, ohne dass der Fragende den Kopf erhob. „Wer hat ihn ermordet? War es des Zeichens wegen, oder ...?“
Der Neuankömmling erhob sich von seinem Stuhl und stützte seine Arme auf dem Tisch ab. Sein Atem ging schwer, als er in die Runde schaute und sah, wie einer nach dem anderen unterwürfig den Kopf senkte.
„Jemand ist hinter sein Geheimnis gekommen“, zischte er und sah erneut in die Runde. „Entweder, wir haben einen Verräter unter uns oder jemand führt einen Rachefeldzug gegen euch.“
„Aber …“ versuchte einer der in Kutten gehüllten Gestalten einen Einwand, doch die schroffe Handbewegung des Wortführers schnitt seinen begonnenen Satz im Ansatz ab.
„Wir werden von heute an mehr als vorsichtig sein. Nein, mehr noch. Wir müssen demjenigen, der uns das antut, zuvorkommen. Wir müssen ihn ausfindig machen.“ Die Stimme des Wortführers wurde lauter und fordernder. „Und wir werden dafür sorgen, dass es keine weiteren Opfer gibt. Ich habe Vorkehrungen getroffen. Euch wird ein Leibwächter zugewiesen, jedem Einzelnen. Ihr werdet ihn nicht sehen, nicht hören. Doch er wird in eurer Nähe sein. Es ist für alles gesorgt. Von euch erwarte ich Schweigen und absolute Loyalität. Niemand wird von eurem Geheimnis erfahren. Niemand!“ Und leise, fast flüsternd, fügte er hinzu: „Wir werden uns in nächster Zeit immer an diesem Werktag und zur selben Uhrzeit hier unten treffen. Legt nun das Schweigegelübde ab. Wer es bricht, wird den Zorn Gottes erfahren.“
1.Kapitel
Bei einer Wasserleiche handelt es sich um die sterblichen Überreste eines Menschen, die logischerweise in einem Gewässer gefunden wurden. Durch den Aufenthalt im Wasser, beispielsweise in Seen, Flüssen oder im Meer ist der Prozess der Verwesung je nach Liegezeit, Temperatur und diverser anderer Umstände, wie auch durch das Vorkommen von Bakterien, die sich im Wasser befinden, meist in hohem Maße fortgeschritten.
Gefunden werden Wasserleichen üblicherweise in Flusskehren oder an Stränden im Gewässer treibend, mit dem Gesicht und den Extremitäten nach unten zeigend, den Rudern von Booten gleich.
In den seltensten Fällen aber werden Wasserleichen an Land vorgefunden und nahezu unwahrscheinlich ist ihr Vorkommen in den Ästen von Bäumen, auch wenn sich diese an Uferböschungen befinden. Dennoch gibt es diese äußerst seltenen Fälle, wie der frühe Montagmorgen des 11. Juli an einem Pfad entlang des Tibers im römischen Stadtteil von San Lorenzo bewies.
Ein heißer und wolkenloser Sommertag begann sich über Rom zu legen, so wie es seit einer Woche täglich der Fall war. Die Freude darüber war den Bürgern der Stadt anzumerken, denn die anhaltende Regenperiode hatte insbesondere den Anwohnern im Stadtteil San Lorenzo in der Nähe des Tiber-Verlaufs gezeigt, dass auch die Ewige Stadt von Naturkatastrophen nicht verschont blieb. Der schier endlos herabfallende Regen hatte das Wasser des Flusses bis über die Begrenzungen seines Bettes angehoben, hatte die Uferwege im Wasser verschwinden lassen und sogar die Bäume an den Uferhängen nahezu bis an die Kronen in der schmutzigen Brühe ertränkt.
Seit 40 Jahren war der Tiber nicht mehr so hoch angestiegen wie in diesem Jahr. Über 12 Meter zeigten die Skalen der Wasserstands-Anzeiger; die Schäden, die das Hochwasser angerichtet hatte, waren hoch. 150 Millionen Euro schätzten die Behörden die Wasserschäden alleine in der Heiligen Stadt.
Dann hatte sich das Wasser langsam wieder zurückgezogen, die Wolken waren aufgebrochen und seit über einer Woche prallte die Sonne auf das ehemals überschwemmte Gebiet und trocknete auch den letzten Tropfen des Tiberwassers dort, wo es nicht hingehörte. Die Uferwege boten den Radfahrern, Wanderern und Joggern wieder ihre Dienste an und dort, wo der Fluss den von ihm verteilten Unrat liegengelassen hatte, waren die Kräfte der Polizia Stradale bemüht, mit Besen und Schaufeln den Urzustand wiederherzustellen.
Um acht Uhr in der Früh an diesem Sommertag, einem Montag-, folgten zwei junge Männer ihrer Gewohnheit, sportliche Aktivitäten auf dem Pfad entlang des Tiber-Ufers auszuleben, wie sie es seit Jahren taten. Heute war es das erste Mal seit dem Regen und der Überschwemmung, dass sie die Stadt für ihr Fitnesstraining mieden und die Nähe des Flusses bevorzugten.
Luigi Ferraro und Georgio Fellini verrichteten gemeinsam ihren Dienst bei der städtischen Feuerwehr und hatten ihre Nachtschicht ohne größere Einsätze hinter sich gebracht. Stumm liefen sie nebeneinander her und ihre einzige Abwechslung bestand darin, ab und zu den noch nicht gänzlich ausgetrockneten Pfützen auf dem unbefestigten Uferweg auszuweichen.
Sie hatten die verschiedensten Straßen des Stadtteils San Lorenzo durchlaufen und folgten der Via Luigi Petroselli, um schließlich in die Via della misericordia abzubiegen. Damit verließen sie die verkehrsträchtigen Straßen und eilten zur Ponte Palatino, wo sie einem Fußweg auf die Uferpromenade folgten. Nebeneinander joggten sie nun auf dem Pfad entlang des Tibers unterhalb der Häuser von San Lorenzo.
Beide waren bekleidet mit hellblauen T-Shirts und kurzen dunklen Sporthosen und ihre muskulösen Beine glichen inzwischen landkartenähnlichen Gebilden, geschaffen vom schlammigen Schmutz des Weges.
Luigi verlangsamte seinen Lauf und riss die kräftigen Arme in die Höhe, um sogleich in die Beuge zu gehen und mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren. Es war eine von den zahlreichen Lockerungsübungen, für die sie ab und zu ihren Lauf unterbrachen. Seine schulterlangen schwarzen Haare, die er zu einem Zopf zusammengebunden hatte, fielen ihm dabei nach vorne über die Schulter. Laut ausatmend wiederholte er die Dehnung und Georgio tat es ihm gleich.
„So liebe ich die Stadt“, keuchte Luigi zwischen den Übungen und drehte mit angewinkelten Ellbogen den Oberkörper von einer Seite zur anderen. „Regen passt nicht hierher. Nur das sonnige Rom ist das echte Rom.“
„Dann hoffen wir einmal, dass es so bleiben wird“, keuchte Georgio und schwang kraftvoll den Oberkörper mit den gestreckten Armen nach hinten, mal nach rechts, mal nach links, jede federnde Bewegung mit einem zischenden Atemgeräusch begleitend.
„Benedetto, il Tedesco, wird's schon richten!“, rief Luigi lachend mit einem Blick in Richtung des Vatikans, von dem man gerade einmal das obere Ende der Kuppel des Petersdoms erkennen konnte. „Sieh, die rote Sonne dort drüben. Man könnte meinen, Nero würde Flammen über die Stadt werfen. Sieh dir dieses Rot an! Sieh doch nur! Sieh … was ist das?“
Luigis Tirade erstickte mitten im Satz und sein Blick erstarrte in der Richtung des blutroten Sonnenaufgangs.
„Was ist was?“ Georgio war dabei, die Sehnen seiner Oberschenkel zu dehnen. Er hatte das rechte Bein gestreckt nach hinten abgesetzt und presste den Oberkörper auf das angewinkelte linke Bein. Dann hielt er inne und sah zu Luigi hinüber.
„Dort … im Geäst der Bäume, gleich dort. Siehst du es nicht?“ Luigis rechter Arm zeigte in die Richtung der am Uferhang befindlichen Bäume, -bei den meisten handelte es sich um wilden Ahorn-, wobei Georgio das Zittern seiner Hand kaum übersehen konnte.
Georgios Blick folgte dem ausgestreckten Arm und als er in die blutrote Sonne sehen musste, zog es ihm für einen Moment die Pupillen zusammen.
„Siehst du auch, was ich sehe?“ stotterte Luigi und kniff die Augen zusammen, um das, was er zu sehen glaubte, im Gegenlicht erkennen zu können. „Verdammt, was ist das?“, flüsterte er, als sich seine Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten. Auch sein Blick schien sich nicht von dem lösen zu können, was auch Georgios Blick wie hypnotisiert anzog.
„Das … das sieht ja aus, wie …“
„Wie ein Mensch“, beendete Luigi stotternd und mit weitaufgerissenen Augen den begonnenen Satz. „Oder das, was von einem Menschen übriggeblieben ist.“
2.Kapitel
Commissario Marecello Sparacio faltete murrend die Tageszeitung zusammen und legte sie neben sich auf dem Kaffeetisch ab. Er war heute sehr früh aufgestanden und verhielt sich bewusst leise, damit Sophia, seine Frau, nichts davon mitbekam und friedlich weiterschlummern konnte. Er hatte für sich Kaffee und für Sophia Cappuccino, den sie so liebte, vorbereitet und war schnell zwei Straßen weiter zur Bäckerei gelaufen, um Cornettos und Olivenbrot einzukaufen. Dann hatte er so leise wie möglich den Tisch gedeckt. Er hätte lieber auf Sophia gewartet, doch heute wollte er zeitig auf seiner Dienststelle erscheinen, auf seiner neuen Dienststelle, deren Leiter er war.
Während er eine Scheibe des noch lauwarmen Brotes mit Marmelade bestrich, hatte er gleichzeitig die Tageszeitung im Blick. La Repubblica berichtete wieder einmal, wie es jeden Tag in den vergangenen beiden Wochen der Fall gewesen war, über das Hochwasser des Tibers und seine Auswirkungen, obwohl der Wasserpegel inzwischen wieder seinen normalen Pegelstand erreicht hatte und das Leben an seinem Ufer schon fast zur Normalität zurückgefunden hatte. Es gab auch heute für Rom kaum Neues und Interessantes zu berichten und schon gar nicht für den Stadtteil San Lorenzo, in den es ihn vor einer Woche ohne eine Vorwarnung verschlagen hatte.
Im Polizia-Commissariato in der Via Portuense war die Position des Commissario-Capo seit mehr als zwei Monaten vakant gewesen. Leonardo Balestra, der bis zu diesem Zeitpunkt die Dienststelle geleitet und sich selbst als brutaler Verbrecher entpuppt hatte, hatte in den unterirdischen Irrungen des Tempelberges in Jerusalem, geprägt von Habgier und Mordlust, den Tod gefunden. Ausgerechnet Sparacio hatte die mörderische Spur eines erst unbekannten Verbrechers verfolgt und schließlich seinen Vorgesetzten Balestra als Verbrecher entlarvt und im Heiligen Land zu Fall gebracht.
Während dieser vergangenen beiden Monate hatte Sparacio die Dienststelle in der Via Portuense kommissarisch geleitet und insgeheim gehofft, irgendwann in nächster Zeit die Leitung als Commissario Capo offiziell übernehmen zu können. Doch es war anders gekommen, anders, als er es sich vorgestellt hatte.
Sparacio ließ die Kaffeetasse sinken und stöhnte auf, gerade in dem Moment, als Sophia, ein Lied summend, früher als erwartet, fröhlich die Küche betrat. Sein aufkommender Ärger verebbte und er stand auf, um sie mit einem Kuss auf die Wange zu begrüßen. Sophia roch gut und genau in dem Moment, als er ihr Parfum einatmete, wusste er bereits, dass sie heute nicht gemeinsam das Frühstück einnehmen würden.
„Ich muss los, Carino, ich werde im Büro eine Tasse Kaffee zu mir nehmen“, flüsterte sie ihm ins Ohr und Sparacio trat einen Schritt zurück. Dabei hielt er ihre Oberarme mit gestreckten Händen, als wolle er sie einerseits aufgrund des gerade Gehörten von sich stoßen, sie aber andererseits mit seinem starken Griff zum Bleiben veranlassen.
Er sah in ihr schönes, leicht gebräuntes Gesicht, an dessen beiden Seiten die leicht gelockten schwarzen Haare bis auf die Schultern fielen, er sah auf ihre dezent geschminkten vollen Lippen und stellte wieder einmal fest, dass sie für ihr Alter, -immerhin hatte sie vor einem Monat ihren 45-jährigen Geburtstag gefeiert- noch sehr jugendlich aussah. Ihre großen dunklen Augen über den leicht hervorstehenden Backenknochen mit dem zart aufgelegten Rouge wurden bei dem um Verständnis bittenden Lächeln noch um einen Glanz heller.
„In einer Viertelstunde erwartet mich ein Kunde, um sich ein Projekt anzusehen. Du musst mir die Daumen drücken, Carino. Es wird ein gutes Geschäft, wenn ich ihn überzeugen kann.“
„Du wirst ihn überzeugen, Liebes“, antwortete Sparacio leise, darauf bedacht, ihr seine Enttäuschung über den allzu schnellen Abschied nicht zu zeigen. „Wenn das Projekt hier in San Lorenzo liegt, wünsche ich ihm viel Glück“, bemerkte er vielsagend lächelnd.
„Mir gefällt es in diesem Stadtteil“, rief Sophia im Hinausgehen und winkte Sparacio noch einmal zu, ehe sie aus der Wohnung verschwand. Er hörte noch das Klappern ihrer Pumps, dann fiel die Tür ins Schloss.
Sparacio seufzte. Dass Sophia einmal mit Immobilien makeln würde, daran hätte er noch vor einigen Wochen nicht im Traum gedacht. Claudio Lulli, ein Freund der Familie, hatte Sophia gefragt, ob sie nicht Interesse an einer Tätigkeit in seiner Firma hätte. Nicht, dass er in dem Glauben handelte, für Sophia oder gar für sie und Marcello wäre ein Zubrot finanziell vonnöten. Beileibe nicht. Claudio wollte Sophia damit lediglich einen Gefallen tun, ihr die Möglichkeit bieten, tagsüber, wenn ihr Mann im Dienst war, in einem Arbeitsverhältnis Kontakt zu anderen Menschen zu haben.
Sparacio sah es einerseits mit einem Hauch von Eifersucht, andererseits gönnte er Sophia ihre Eigenständigkeit oder das, was sie darunter verstand. Und sie hatte Freude an dem, was sie tat. „Ich bin wieder unter Menschen, Carino“, hatte sie zu ihm gesagt und in ihren Augen las er das Verlangen nach Verständnis, bevor sie ging.
Sparacio versuchte es zu verstehen. Er sah auf die Uhr. Es war kurz vor halb acht Uhr. Zeit genug, seinen Kaffee gemütlich auszutrinken. Außerdem war er der Chef. Er war der Commissario Capo, der Leiter der Dienstelle, seiner neuen Dienststelle. Allerdings nicht mehr im Polizia-Commissariato in der Via Portuense. Sparacio seufzte erneut. Er schenkte sich frischen Kaffee ein und schob den Frühstücksteller von sich. Der Hunger war ihm vergangen.
Sparacio wohnte mit Sophia in der Via della Pilotta mit Blick auf einen kleinen grünen Park, der nur durch die verkehrsreiche Fahrbahn geteilt wurde. Immer, wenn er aus dem Fenster sah, war er erfreut darüber, in der dritten Etage und nicht im Erdgeschoss zu wohnen. Die Aussicht hier war, trotzt aller städtischen Begebenheiten, nicht derart eingeengt, wie es in den dichten Straßen Roms der Fall war. Es bedeutete ihm ein Stück Freiheit, wenn er über die Bäume und Sträucher dies- und jenseits der Via Maggio sah, und er empfand es als große Erleichterung, dass die Geräuschkulisse des Straßenverkehrs bis zu seiner Wohnung hin fast verebbte.
Seit einer Woche war Sparacio nun Commissario Capo des Polizei-Kommissariats in San Lorenzo. Questore Giovanni Recchia hatte ihn zu sich in die Questura geladen und nicht nur ihn. Erstaunlicherweise sah sich Sparacio einem weiteren, ihm bislang unbekannten Kollegen, gegenüber.
„Sie werden sich nicht kennen“, begann der Questore. „Commissario Sparacio - Commissario Bretone“, stellte er die beiden vor und Bretone neigte leicht den Kopf in Sparacios Richtung, ohne eine Miene zu verziehen.
„Signore Bretone hat sich auf die vakante Dienststelle in der Via Portuense als Leiter beworben“, hörte Sparacio seinen Vorgesetzten wie aus weiter Ferne. „Wir haben dem entsprochen. Nein, lassen Sie mich ausreden.“ Der Questore hob beschwichtigend die Hand, als er sah, dass Sparacio tief einatmete. „Ihnen, lieber Commissario, haben wir eine andere Aufgabe zugedacht und Sie werden sich dabei nicht verschlechtern. Sie werden die neue Dienststelle in der Via Urbana im Stadtteil San Lorenzo übernehmen.“
Er winkte erneut mit der Hand ab, als er das Vorhaben Sparacios, einen Kommentar zu geben, bemerkte. „Sie beide, meine Herren, werden zum Commissario Capo befördert, wie es Ihrer Position zusteht. Ich weiß, Sie werden Ihre Sache hervorragend machen. Meine Herren.“
Der Questore erhob sich und geleitete die beiden Kollegen zur Tür und gab ihnen damit nicht die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder gar eine Diskussion zu beginnen. Es war ein einseitiges Gespräch gewesen und als Sparacio wenige Minuten später auf dem Gehweg vor dem Präsidium stand, überlegte er, ob man ihm die Entscheidung nicht hätte schriftlich mitteilen können, denn eine Gelegenheit, seine Meinung einzubringen, hatte man ihm so oder so nicht eingeräumt.
Es brauchte seine Zeit, bis Sparacio sich mit der Entscheidung des Questore abgefunden hatte, doch dann sah er es an der Zeit, die Gestaltung seiner neuen Dienststelle selbst in die Hand zu nehmen. Und so trug er seine Wünsche dem Questore telefonisch an und war erstaunt, dass er seinen Anträgen stattgab. Kurz darauf informierte er Enzo Sciutto, einen Beamten der Carabinieri, der immer zur Stelle war, wenn Sparacio einen zuverlässigen Mitarbeiter benötigte, per Telefon.
„Sie kommen mit nach San Lorenzo, zu unserer neuen Dienststelle“, hatte er ihm gesagt und Sciutto war schier aus dem Häuschen. „Da wird sich Maria aber freuen“, war das Erste, was er sagte. „Und ich habe nur noch den halben Weg zur Arbeit. Wann soll es denn losgehen, Commissario?“
„Sofort, Sergente, sofort. Drei Ihrer Kollegen haben schon vor einer Woche ihren Dienst dort begonnen.“ Er dachte kurz nach. Dann war die Dienststelle ja vollständig eingerichtet, eine Belastung weniger für ihn. „Sie, Sciutto“, endete Sparacio, „Sie werden bis auf Weiteres zu meiner persönlichen Verfügung stehen.“
Sparacio schmunzelte, als er Sciutto förmlich am anderen Ende der Leitung über das ganze Gesicht grinsen sah.
„Danke, Commissario, danke. Wenn ich das Maria erzähle.“
Sparacio beendete sein Frühstück, kaum, dass er einen Bissen zu sich genommen hatte. Er räumte die verderblichen Dinge in den Kühlschrank und stellte das benutzte Geschirr auf der Spüle der Anrichte ab. Dann überlegte er, ob er sich noch um den Abwasch kümmern sollte, doch ehe er die Entscheidung herbeiführen konnte, läutete das Telefon.
„Commissario, es tut mir leid, dass ich Sie störe.“ Es war Sciutto, der Sergente, den er zu seiner rechten Hand auf der neuen Dienststelle im Stadtteil San Lorenzo gemacht hatte. „Vermutlich sitzen Sie mit Ihrer Frau gemütlich beim Frühstück, draußen auf der Terrasse. Die Sonne … es wird ein so schöner Tag in Rom…“
„Sciutto, was ist los? Sie rufen mich doch nicht an, um mir einen guten Appetit zu wünschen. Haben Sie Probleme auf der Dienststelle?“
„Na, ja“, kam es gedehnt aus der Leitung. „Probleme kann man das schon nennen. Wir … wir haben einen Toten, unten an der Biegung des Tibers, etwa 200 Meter unterhalb der Ponte Palatino. Können Sie gleich kommen?“ Es klang irgendwie zaghaft.
„Eine Wasserleiche?“, fragte Sparacio zurück, während er mit dem Hörer am Ohr ins Wohnzimmer eilte und nach seinem Sakko Ausschau hielt.
„Ja und nein, Commissario“, kam es nun gequält aus der Hörmuschel. „Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen erklären soll …“
„Dann lassen Sie es“, sagte Sparacio unwirsch. „Ich bin gleich bei Ihnen.“ Er ließ den Hörer auf die Ladestation fallen und warf sich das Sakko über. „Ja und nein“, äffte er Sciutto im Hinauseilen nach. „Er wird doch wohl noch eine Wasserleiche von einer üblichen Leiche unterscheiden können.“
3. Kapitel
An diesem Montag, dem 11. Juli, war der Verkehr dichter als sonst und Sparacio sah keinen Sinn darin, einen anderen Weg als den direkten zum Tiber zu nehmen. Als er die Häuser seiner Wohnsiedlung verlassen hatte, folgte er der Via del Teatro Marcello, die er bis zum Tiber-Ufer nicht mehr verlassen musste.
Schon von weitem sah er die rotierenden blauen Rundumleuchten zweier Polizeiwagen, die auf dem Parkplatz an der Via di Santa Maria auf sein Erscheinen warteten. Sparacio ließ seinen Blick über die dunkle Brühe des Flusses gleiten, über den Fluss, den die Römer blonder Tiber nannten, über das Ufer, soweit es an den Bäumen vorbei einsehbar war und schließlich zu den wartenden Kollegen in Uniform, die angeregt mit zwei Männern diskutierten, ihrer Kleidung nach Jogger, die sich in der frischen Morgenluft austoben wollten.
„Was gibt es?“, fragte er kurz, als Sciutto auf ihn zu lief. „Eine Wasserleiche wird es doch wohl hier oben nicht angeschwemmt haben“, stellte er sarkastisch fest.
„Wir müssen dort hinunter.“ Sciutto zeigte auf den Abhang und zum etwa fünf Meter darunterliegenden unbefestigten Uferweg. „Mit dem Auto ist es ein großer Umweg. Stromaufwärts gibt es irgendwo eine Zufahrt. Für den Leichenwagen … später.“
„Also. Was ist denn nun?“
Sciutto bemerkte, dass Sparacios Nerven am heutigen Morgen nicht die besten waren und beeilte sich, einen Rapport zu geben. „Eine Leiche, dort unten. Sie hängt im Geäst eines dieser Bäume am Ufer-Pfad. Ich glaube, sie hängt dort schon länger.“
„Ein Selbstmord? Tod durch Erhängen? Mensch, Sciutto, es ist doch nicht das erste Mal, dass sich ein Mensch in einem Baum erhängt, auch nicht in der Nähe eines Uferweges. Warum sind Sie so aufgeregt? Ist doch nicht ihr erster Toter.“
Sparacio schüttelte den Kopf und sah zu den anderen drei Carabinieri hinüber, die auf irgendwelche Befehle zu warten schienen. „Es ist nicht so, wie Sie sich das vorstellen, Commissario. Er hängt nicht am … Hals … Sie verstehen schon. Er liegt.“
„Was denn nun, Sciutto? Ein Mann also?“ Sparacio schien irritiert und verärgert. „Liegt er oder hängt er?“ Dann winkte er verärgert mit einer barschen Handbewegung ab und machte Anstalten, den Hang hinabzuklettern. „Kommen Sie, wir werden uns das mal ansehen.“
„Ich werde vorangehen. Folgen Sie mir. Aber vorsichtig, der Hang ist noch rutschig“, warnte Sciutto vor den schlammigen Resten des Hochwassers, die im Schatten der Bäume noch nicht zur Gänze weggetrocknet waren.
Den befestigten Parkplatz trennte von dem Uferweg ein mit Bäumen bewachsener Hang und Sparacio folgte Sciutto, der, sich an den Ästen der Sträucher festhaltend, mehr rutschend als gehend hangabwärts dem Uferweg näherte.
„Und?“ Als sie auf dem Uferweg angekommen waren, glitten Sparacios Blicke über den Uferweg und wanderten zu den Bäumen und Sträuchern am Tiberufer.
„Nicht in diesen Bäumen, Commissario“, bemerkte Sciutto geduldig und zeigte mit ausgestrecktem Arm in die entgegengesetzte Richtung. „Sehen Sie, dort, die Bäume oberhalb des Weges, zur Via di Santa Maria hin.“
Sparacio runzelte die Stirn und schüttelte wortlos den Kopf. Er drehte sich kopfschüttelnd in die angegebene Richtung und folgte dem Blick Sciuttos. Dann verharrte er wie versteinert und langsam öffnete sich sein Mund. Nicht in der Absicht, etwas zu sagen, es war vielmehr das ungläubige Erstaunen, das seine Gesichtsmuskeln entgleisen ließ.
„Sie wird vom Hochwasser dorthin gespült worden sein“, versuchte Sciutto eine Erklärung. „Und dann die Sonne. Wer weiß, wie lange sie schon dort hängt … äh liegt.“
Sparacios Sprachlosigkeit legte sich mit einem Schlag und er begann die Situation zu analysieren. Einige Meter über ihm, an einem der eher kleinen Ahornbäume, die wild am Uferweg wucherten, hing mitten im buschigen Geäst eine unbekleidete Leiche. Eigentlich hing sie nicht. Es war so, wie der Sergente es sagte: Sie lag. Sie lag in einer Art und Weise, als habe man sie dort mitten im Astwerk aufgebahrt. Die Rückseite zeigte gegen den Boden, die Arme hingen schlaff seitlich am Körper herab, die Beine waren in den Kniekehlen über einem Ast nach unten abgewinkelt. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte Sparacio nicht feststellen. Was er aber sah, war die auffallend rote Farbe der Haut im oberen Bereich des Körpers, soweit man das von unten her erkennen konnte. Die der Erde zugewandte Körperseite wies eine dunkle Farbe auf, ein Gemisch von Grün, Dunkelblau und Schwarz. Seilartige Gebilde hingen an der Leiche herab und verliefen sich unterhalb des strauchartigen Baumes.
„Wer hat die … Leiche gefunden?“
„Zwei Jogger, Sie haben sie vielleicht oben bei den Kollegen bemerkt“, beeilte sich Sciutto zu antworten. „Zwei Feuerwehrmänner, hatten Nachtschicht und wollten sich vor ihrer Bettruhe nochmal auspowern.“
„Dann scheinen sie einen leichten Dienst gehabt zu haben, letzte Nacht. Sind die beiden befragt?“
„Ja, ich habe ihre Aussagen notiert und die Personalien aufgenommen. Sie laufen uns nicht davon, wenn wir sie noch brauchen sollten.“
Sparacio schien in Gedanken versunken und hatte seinen Blick auf die Leiche im Baum gerichtet.
„Was halten Sie davon?“, hörte er Sciutto neben sich fragen. „Eine seltsame Art, sich aus dem Leben zu verabschieden.“
„Sciutto, was soll das? Was glauben Sie, wie die Leiche dorthin kommt? Na? Haben Sie es eben nicht selbst vermutet?“
Sciutto schien kurz zu überlegen. „Jetzt weiß ich, worauf Sie hinauswollen, Commissario: Das Hochwasser. Genau, so ist es“ brach es triumphierend aus ihm heraus. „Das Hochwasser des Tibers in den letzten Wochen hat die Leiche angeschwemmt und als die Flut zurückging, spuckte sie die Leiche aus, dort auf den Baum.“
„Nun werden Sie mal nicht theatralisch.“ Sciutto bemerkte aus den Augenwinkeln, dass Sparacio lächelte. „Was ist mit der Spurensicherung? Rufen Sie die Polizia Scientifica. Di Silvio soll sich auf den Weg machen. Wir müssen verhindern, dass sich hier ein Menschenauflauf bildet. Wir können von Glück sagen, dass die Mauer dort oben entlang der Via della Greca die Sicht hier herunter auf den Fundort verhindert. Aber die Bergung muss schnell geschehen, sorgen Sie dafür.“
„Di Silvio habe ich bereits verständigt“, sagte Sciutto beflissen und schob schnell die Frage hinterher: „Soll ich einen Arzt verständigen?“
„Einen Arzt, Sciutto? Wozu?“ Sparacio schüttelte verständnislos den Kopf. „Es reicht, wenn der Tod in der Gerichtsmedizin festgestellt wird. Ordern Sie den Leichenbestatter und sagen Sie ihm, welche Aufgabe hier auf ihn wartet, damit er sich danach richten kann. Haben Sie einen Fotoapparat dabei?“
„Si, Commissario.“ Sciutto nickte beflissen. „Sie wollen, dass ich ein paar Aufnahmen schieße? Ich werde ein paar Aufnahmen schießen. Aus allen Perspektiven. Noch bevor die Polizia Scientifica eintrifft. Sie werden zufrieden sein.
Sie trafen fast gleichzeitig ein, Andrea di Silvio von der Spurensicherung und Pietro Foresta vom Erkennungsdienst. Sie hatten mit ihrem Fahrzeug den Weg über den Uferweg gewählt. In angemessener Entfernung ließen die Kollegen das Fahrzeug stehen und kamen, jeder einen Spurensicherungskoffer in der Hand, die letzten Meter zu Fuß auf Sparacio und Sciutto zu.
Beide sahen sich um und schienen etwas zu suchen. Dann folgten ihre Blicke der kurzen Kopfbewegung Sparacios und ebenso wie er standen die beiden schließlich mit offenen Mündern da.
„Was ist das?“ stotterte Foresta, ohne seinen Blick von dem Toten im Geäst abzuwenden.
„Wonach sieht es aus?“, stellte Sparacio die Gegenfrage und merkte sogleich selbst, wie ungehalten er klang. „Ein Opfer des Hochwassers, offensichtlich“, fügte er schnell hinzu. „So wie es aussieht, werden wir das nicht auf Anhieb feststellen können.“
„Also das ganze Programm?“ Es war mehr eine Feststellung als eine Frage.
Sparacio nickte. „Das ganze Programm“, antwortete er und fügte noch schnell ein Danke hinzu.
Di Silvio und Foresta machten sie sich an ihre Arbeit und eine halbe Stunde später fuhr der Leichenwagen auf dem Uferweg vor. Ihm entstiegen zwei Männer in dunkler Arbeitskleidung. Einer von ihnen öffnete die Hecktür des Kombis und förderte eine Leiter zutage.
„Können wir anfangen?“, fragte der ältere, etwas korpulente Mitarbeiter, der wie sein Kollege mit schwarzer Hose und weißem kurzärmeligen Hemd bekleidet war. Schon bei der Frage verzog sich sein Gesicht, als habe er Essig getrunken. Dass diese Tätigkeit eine Arbeit darstellt, die laut mancher Leichenbestatter angeblich auch gleichzeitig aus einer Berufung heraus resultieren soll, ist nur schwer vorstellbar. Aber da ist auf der einen Seite der gute Verdienst, der raketenartig in die Höhe schnellt, wenn es Leichen wie diese zu bergen gilt. Dann die Transportkosten. Je weiter die Leiche transportiert werden muss, umso besser. Auch das erhöht die Einnahmen von Kilometer zu Kilometer.
Allerdings ist von der oftmals so propagierten Berufung nicht mehr allzu viel festzustellen, wenn Leichen wie die in dem Baum am Verlauf des Tibers zu bergen sind. Abscheu und Ekel werden dann einzig und allein in der Vorstellung von barer Münze etwas reduziert. Doch auch das gelingt nicht in allen Fällen.
Sparacio sah, dass die Kollegen von der Polizia Scientifica ihre Sachen zusammenpackten und nickte den beiden Bestattern zu. Die Männer machten sich an ihre Arbeit, erklommen den Hang, legten die Leiter an und blieben schließlich ratlos neben dem Baum stehen.
„Sie tropft zu stark“, rief der Ältere, der wie sein Mitarbeiter in sicherem Abstand von dem Baum auf eine Antwort wartete. „Und hier ist alles voller Maden!“ Er hob die Arme wie zur Abwehr und trat einige Schritte zurück.
„Sie ist eben nicht mehr die Frischeste“, rief Sparacio gut gelaunt zurück. „Ihr kennt doch euer Geschäft. Wird kaum unterbezahlt. Also runter mit der Leiche und ab in die Gerichtsmedizin.“
„Aber das da …“ rief derselbe Sprecher nun und zeigte auf die wie Seile aussehenden dünnen Stränge, die von der Leiche bis zum Boden reichten. Das sind …“
„Das sind nur Därme“, rief Sparacio zurück. „Packt sie wieder dahin, wo sie hingehören. Also: Wir sehen uns später.“
„Was haben Sie da eben gesagt? Därme? Das sollen Därme sein? Menschliches Gedärm?“ Sciutto schüttelte sich.
„Das ist die Natur, Sergente. Vielleicht haben auch Schiffspropeller dabei eine Rolle gespielt. Oder Aale, aasfressende Fische oder alles zusammen. Wer weiß? Wir werden es vielleicht nie erfahren. Warten wir den Nachmittag ab. Dann werden wir zur Gerichtsmedizin fahren. „Haben Sie die Fotos gemacht?“, fragte er Sciutto, als sie den Hang hochgekraxelt waren und auf dem Parkplatz bei den Fahrzeugen standen.
„Alles im Kasten. Aber die Polizia Scientifica hat den Tatort doch sowieso fotografiert. Was meinen Sie, Commissario? Mord, Selbstmord, Unglücksfall?“
Sparacio überhörte die Frage des Sergente. „Ja, die Kollegen werden ihre Arbeit schon richtigmachen. Ich werde mich später mit ihnen in Verbindung setzen.“ Dann blieb er kurz stehen und drehte sich noch einmal um, obwohl der Tatort mit der Leiche im Baum schon außer Sichtweite war.
„Die Maden, sie interessieren mich“, murmelte er nachdenklich
„Die Maden, Commissario? Warum die Maden? Es schüttelt mich, wenn ich daran denke.“
„Aber, Sciutto“, begann Sparacio, und es klang, als spräche ein Lehrer zu seinem Schüler. „Maden kann man essen. Wussten Sie das nicht?“
„Essen? Maden? Commissario, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Allein an den Gedanken wird mir schlecht.“
„Die Sarden stellen Käse her, Casu Marzu ist seine Bezeichnung. Das ist ein überreifer Schafskäse, der so lange reift, bis er Maden enthält.“
„Casu marzu? Nie gehört. Ich bin geneigt zu betonen, dass ich darüber froh bin.“
„Casu marzu bedeutet in einem sardischen Dialekt so viel wie verdorbener Käse“, belehrte Sparacio seinen Kollegen. „Der Herstellungsprozess hat einiges gemeinsam mit dem da unten.“ Er machte eine entsprechende Kopfbewegung in die Richtung des Tibers. „Käsefliegen legen bei der Herstellung ihre Eier in dem Käse ab, so wie die Fliegen auf der Leiche. In beiden Fällen entstehen dann Maden. Ist ein natürlicher Vorgang.“
„Wozu soll denn eine solche Schweinerei gut sein?“ Sciutto schüttelte sich bei dem Gedanken an seinen geliebten Parmigiano Reggiano und sah förmlich die Maden an der Oberfläche wimmeln.
„Das müssen Sie diejenigen fragen, für die solch ein Käse eine Spezialität darstellt“, antwortete Sparacio. „Die Maden dringen in den Käse ein und wandeln ihn durch Verdauung um, so dass er eine cremige Konsistenz und ein kräftiges Aroma bekommt und eine Flüssigkeit absondert, die lagrima genannt wird. Beim Verzehr befinden sich lebende Maden in dem Käse. Aber ich kann Sie beruhigen, Sergente. Nicht jeder Sarde isst die Maden auch mit. Das ist dem harten Kern vorbehalten.“
„Sie haben mir den Appetit gründlich verdorben, Commissario. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Die Vorstellung allein …“ Sciutto schüttelte sich. „Sie wollten mir erzählen, warum Sie sich für die Maden in unserer Leiche interessieren.“
„In unserer Leiche, wie das klingt.“ Sparacio musste lachen. „Aber ich will es Ihnen sagen, Sergente. Passen Sie gut auf. Maden können uns etwas darüber erzählen, wie lange der Tote schon dort oben in dem Baum hängt.“
Sciutto zog die Augenbrauen zusammen. „Commissario, Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Ich …“
„Nein, nein. Die Maden, und nicht nur die, sondern alle Lebewesen, die sich auf einer Leiche einnisten, sind sozusagen Zeugen, die wir eingehend befragen müssen. Sehen Sie, es ist ein Unterschied, ob wir junge Maden dort vorfinden oder ältere, ob wir verpuppte Maden vorfinden oder nur noch deren Hüllen. Oder aber, ob es vielleicht von Fliegen dort wimmelt, von ehemaligen Maden also.“
„Sie können junge von alten Maden unterscheiden?“ Sciutto verstand momentan kaum etwas von alledem, was ihm sein Commissario da erzählte. „Wie ...?“
„Es ist wie bei allen Lebewesen, Sergente. Der Alterungsprozess. Es ist der farbliche Unterschied. Junge Maden sind hell und alte sind dunkel. So einfach ist das.“
„Sie meinen, wenn sich herausstellt, dass nur junge Maden auf einer Leiche gefunden werden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sie erst seit kurzer Zeit am Tatort liegt?“
„Oder am Fundort. Genau. Sind die Maden älter, liegt die Leiche schon länger dort. Es gibt eine Reihe biologischer Einflüsse, die uns bei einer Zeitbestimmung unterstützen können.“
„Dann werden sie auf dieser Leiche dort nur alte Maden finden“, frohlockte Sciutto über sein frisch erhaltenes Wissen. „Das Hochwasser ist über eine Woche zurückgegangen, also hängt die Leiche rund eine Woche dort oben.“
„In diesem Punkt werden Sie wohl Recht haben, Sergente. Dennoch: Wir werden dort oben“, er zeigte in Richtung der Leiche im Geäst, „außer den alten Maden auch junge finden. Es ist eben wie bei uns Menschen. Manchmal wohnen auch mehrere Generationen in einem Haus.“
„Was glauben Sie, Commissario? Mord oder Selbstmord?“
„Es geschehen auch viele Unfälle bei Hochwasser, wer weiß, Sergente. Ich möchte mir schon vorher Gedanken machen können, ehe viel Zeit vergeht, bis wir Einsicht in die Fotos und die restlichen Unterlagen haben“, brummte Sparacio. „Dazu benötige ich dringend Ihre Aufnahmen. Wie auch immer. Der Fall wird sich vielleicht als Selbstmord herausstellen und schon morgen wird die Staatsanwaltschaft die Leiche zur Beerdigung freigeben.“
4. Kapitel
Im Kommissariat in der Via Urbana herrschte friedliche Ruhe, als Sparacio und Sciutto gegen zehn Uhr dort eintrafen. Die Kollegen der Carabinieri befanden sich noch zur Unterstützung der Tatortsicherung am Tiber-Ufer und so waren sie vermeintlich die einzigen Anwesenden im Büro des Sergente. Sparacio nutzte die Zeit, die von Sciutto geschossenen Fotos im Computer zu betrachten, während sein Kollege ihm über die Schulter sah.
Plötzlich hörten sie ein Poltern aus dem Nachbarzimmer, dem Büro Sparacios, das sich anhörte, als sei ein Stuhl umgefallen oder ein Mensch gegen ein Möbelstück gestoßen.
„Wir sind doch die Einzigen hier, oder?“ Sparacio starrte Sciutto an und richtete sich langsam auf. Sciutto blieb wie versteinert auf seinem Stuhl sitzen. Dann hörten sie es erneut. Dieses Mal klang es, als zöge jemand einen Stuhl über den Fußboden. Dann verstummte auch dieses Geräusch.
Sparacio legte den Zeigefinger seiner linken Hand auf seine Lippen und zückte mit der rechten seine Pistole. Dann schlich er zur Tür, die in den Nebenraum führte und Sciutto folgte seinem Chef auf Zehenspitzen.
„Commissario, ich glaube …“
„Psst!“ Sparacio winkte energisch ab und Sciutto zuckte ergeben mit den Schultern. Er sah, wie sein Chef langsam den Türgriff umklammerte und hörte, wie er tief einatmete. Sparacio drückte mit einer plötzlichen Bewegung den Türgriff nach unten, stieß die Tür mit einem kräftigen Ruck auf und machte Anstalten, nach vorne zu stürmen. Doch angesichts dessen, was er vor sich sah, brach er seine Bemühungen jäh ab.
Vor ihm präsentierte sich das Hinterteil einer, ja, nennen wir es einmal kräftigen Frau, mit den dazu passenden rundlichen Beinen. Das Gesäß wurde umspannt von einem, bedingt durch die Körperhaltung, enganliegenden dunklen Rock, die prallen Beine mit den undurchsichtigen und braunen Strümpfen steckten in einem Paar beiger Halbschuhe.
„Commissario, ich …“ versuchte sich Sciutto erneut Gehör zu verschaffen, doch wiederum winkte Sparacio hektisch ab.
Inzwischen war auch das Oberteil der Frau zum Vorschein gekommen. Sie richtete sich langsam in ihrer vollen Größe auf und drehte sich erst mit dem Oberkörper zu den beiden Polizisten um, dann folgte der Rest ihres Körpers. Nun, da sie in voller Größe vor ihnen stand und sich die Proportionen ihres Körpers dorthin verteilt hatten, wo sie hingehörten, offenbarte sie schon eine stattliche Erscheinung. Kräftig, mit Fettpolstern versehen und Rundungen, die, man kann sagen, überproportional ausfielen.
„Wer … wer sind Sie?“, stotterte Sparacio und betrachtete die sich ihm bietende Fülle von Kopf bis Fuß, wobei sein Blick über die schulterlangen pechschwarzen Haare, über das rundliche Gesicht und die dunklen Augen glitt und auf dem riesigen Vorbau unter der locker getragenen beigefarbenen Bluse der etwa fünfzigjährigen Frau haften blieb.
„Wonach sieht es denn aus?“, kam die spitze Gegenfrage und Sparacio glaubte ein rauchiges Kratzen in der Stimme festzustellen. „Sind Sie hier der Chef? Ja, Sie sind der Chef, sieht man sofort“, gab sie sich die Antwort selbst. „Ich bin Carla. Carla Formosa. Ihre neue Sekretärin. Hat Ihnen der Sergente nicht erzählt, dass ich heute hier anfange?“
Mit einem ungläubigen Ausdruck im Gesicht drehte sich Sparacio wie in Zeitlupe zu Sciutto herum. Der hatte die Schultern eingezogen und die angewinkelten Unterarme mit den Handflächen nach oben zu einer Unschuldsgeste geformt. Den Kopf hatte er mit einem demütigen Lächeln leicht zur Seite geneigt.
„Ich wollte es Ihnen sagen, Commissario, aber Sie …“
Sparacio winkte ärgerlich ab und ging auf die Frau zu. „Signora Formosa, entschuldigen Sie, Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass man uns heute schon jemanden zuteilt. Ich freue mich natürlich sehr darüber.“
„Heute ist Montag“, sagte Carla Formosa streng mit leicht zusammengekniffenen Augen, was ihrem insgesamt hübschen Gesicht eine interessante Note verlieh und sah dabei nur Sparacio an. „Neue Mitarbeiter beginnen ihren Dienst meist Anfang der Woche. Übrigens: Da war ein Anruf für Sie.“
Carla drehte ihren gewichtigen Körper in Richtung des Schreibtischs, nahm einen Zettel, den sie offensichtlich dort abgelegt hatte und reichte ihn Sparacio. „Der Vice Questore. Er meint, es wäre an der Zeit, dass er Sie kennenlernt. Sie sollen ihn zurückrufen. Und so, wie es klang, würde ich ihn nicht allzu lange warten lassen.“
„Der Vice Questore also.“ Sparacio dachte an die Begegnung mit dem Questore und eigentlich reichte die ihm vollkommen. Auf der anderen Seite: Der Vice Questore war sein unmittelbarer Vorgesetzter, wogegen die Position des Questores mehr die politischen Belange der Polizei abdeckte. Er würde also nicht darum herumkommen, ihm seinen Antrittsbesuch zu machen. Alles zu seiner Zeit, dachte er und laut sagte er: „Das fehlte mir gerade noch. Ich habe weiß Gott wichtigere Dinge zu tun, als mich zu einem Kaffeekränzchen mit …“ Sparacio stockte und Carla vollendete den Satz.
„Mit Ihrem Vorgesetzten …“
„Wenn schon. Das hat Zeit. Wir haben einen Todesfall zu bearbeiten. Falls er wieder anruft, sagen Sie ihm, wenn es meine Zeit zulässt, werde ich mich bei ihm melden.“
Carla atmete tief durch und ordnete geschäftig einen Stapel Schriftstücke auf dem Schreibtisch. „Genauso soll ich es ihm sagen?“
„Genauso. Was ist nicht richtig daran?“
„Wenn Sie meinen, Chef.“
„Was soll der Unterton, Carla? Der Vice Questore hat seinen Dienst auch erst vor einigen Tagen hier in Rom angetreten …“
„Aber Signore Domenico ist eben der Vice Questore, Commissario Capo Sparacio. Er hat das Recht …“
„Domenico also.“
„Adolfo Domenico“, flötete Carla belustigt. Dieses Spiel schien ihr zu gefallen. „Vice Questore Adolfo Domenico. Was soll ich ihm sagen, wenn er wieder anruft?“
Sparacios Falten auf der Stirn waren nicht zu übersehen. „Ich werde ihn anrufen, später. Das hier geht vor. Er schüttelte den Kopf, als wolle er böse Geister verscheuchen. „Sergente!“ Es klang aggressiver, als er es vorhatte und Sciutto zog instinktiv den Kopf ein.
„Hören Sie, Enzo“, -er sagte Enzo, um den Eindruck, den er soeben erweckt hatte, vergessen zu machen, was Sciutto mit einer wohltuenden Verwunderung zur Kenntnis nahm-, „nehmen Sie sich die Vermissten-Listen der letzten … sagen wir sechs Monate, vor und legen Sie mir die Ausdrucke vor. Tun Sie es bitte gleich. Vielleicht kann ich mir in der Zwischenzeit einmal in Ruhe Ihre Fotos ansehen.“
„Des letzten halben Jahres, Commissario?“ Der ungläubige Blick Sciuttos traf Sparacio und zauberte diesem ein Grinsen ins Gesicht. „Wenn sechs Monate ein halbes Jahr sind, Sergente, das ist das wohl so.“
„Puh“, war das Einzige, das der Sergente imstande war von sich zu geben. Achselzuckend verließ er das Büro und Sparacio zog den Kopf ein, in der Ahnung, dass die Tür härter als üblich ins Schloss fallen würde. Doch seine Verspannung löste sich, als dieser Fall nicht eintraf.
Sparacio zog seinen Bürostuhl zu sich heran und vernahm hinter sich ein leises Pah, bevor sich die Tür erneut, und dieses Mal hinter Carla, schloss.
Mit einem fast unmerklichen Kopfschütteln breitete er die Ausdrucke der Fotos vor sich aus. Dass die Aufnahmen ausschließlich die Rückenansicht des Toten zeigten, nahm er zur Kenntnis. Vor ihm zeigte sich die Leiche -Sparacio tippte wegen des Körperbaus auf einen Mann-, dessen Rücken, Ober- und Unterschenkel und Fersen eine tiefblaue Färbung aufwiesen. Die Haut war infolge der Sonneneinwirkung an der ihm zugewandten seitlichen Körperhälfte an zahlreichen Stellen aufgeplatzt und zeigte angefaultes Muskelgewebe und Stellen, an denen Feuchtigkeit austrat, was die Leichenbestatter am Fundort mit Entsetzen zur Kenntnis genommen hatten. Auch Maden waren zu erkennen. Die Fotos zeigten einige der Exemplare, die sich zu weit über die Körperoberseite gewagt hatten und andere, die im Begriff waren, nach unten abzurutschen und auch einige, die das Foto im freien Fall abbildete.
Die Tür schlug erneut und Sparacio wusste, dass Sciutto seinen Ermittlungen nachging. Er schaute auf die Uhr und schüttelte missmutig den Kopf. Der Weg in die Via Portuense, -dort hatte der Vice Questore sein Büro-, würde ihm nicht erspart bleiben. Der Vice Questore würde keine Ruhe geben. Er musste es hinter sich bringen. Doch er nahm sich vor, erst der Gerichtsmedizin einen Besuch abzustatten. Er musste den Toten sehen und vielleicht konnte man ihm schon etwas über dessen Identität sagen.
Er griff zum Telefon und wählte die Nummer der Polizia Scientifica und ließ sich mit Pietro Foresta vom Erkennungsdienst verbinden.
„Ah, Marcello, ich dachte schon, du rufst nicht mehr an“, scherzte dieser, denn üblicherweise nervte ihn Sparacio schon dann, wenn es noch zu früh für irgendwelche Einschätzungen war.
„Und? Wie sieht‘s aus?“, fragte Sparacio ohne Umschweife. „Gibt es Anzeichen für ein Fremdverschulden?“
„Machst du Witze?“, gluckste es aus der Leitung. „Ach, ja, du hast die Leiche ja nur von unten, ich meine, ihre Rückseite, gesehen. Fremdverschulden? Überlassen wir das dem Gerichtsmediziner. Nein, was ich dir sagen kann: Es handelt sich um einen Mann. Das steht fest. Das Alter? Schwer zu bestimmen“, gab er sich selbst gleich die Antwort. „Die Fische … oder vielleicht Schiffsschrauben haben der Leiche arg zugesetzt. Und dann noch die Maden. In seinem Körper befanden sich Unmengen dieser Viecher. Aber alles hat ja zwei Seiten, wie du weißt. Sie werden uns dabei helfen, die Lagezeit der Leiche zu bestimmen.“
„Lagezeit klingt gut“, witzelte Sparacio. „Aber er lag ja, wenn auch in einem Baum.“
Foresta überhörte die Bemerkung. „Wir werden versuchen, die Identität des Mannes festzustellen, Fingerabdrucks-Vergleiche und so. Tut mir leid, dass ich dir nicht vorerst mehr sagen kann.“
Sparacio wollte gerade auflegen, da fiel ihm noch eines ein. „Wir vergleichen derzeit unsere Vermisstenfälle. Hat der Tote irgendwelche besonderen Kennzeichen? OP-Narben oder so? Du weißt schon.“
„Die haben die Maden weggefressen“, lachte Foresta und Sparacio stellte ihn sich am Ende der Leitung vor, wie der ewig fröhlich wirkende Kollege die Fotos vor sich mit Blicken abtastete. Sparacios Vermutung bestätigte sich sogleich. „Aber warte mal. Ich habe da jede Menge Fotoaufnahmen von der Leiche gemacht“, sagte Foresta. „Dank digitaler Technik habe ich sie schon vor mir auf dem Bildschirm.“
Was sonst? dachte Sparacio. „Na und?“, fragte er ungeduldig.
„Im Bereich der rechten Brusthälfte, in Höhe des Rippenbogens, da ist etwas. Ich kann es nur vermuten … aber du wirst es in der Gerichtsmedizin aus der Nähe betrachten können.“
„Bitte, komm‘ zur Sache. Ich habe noch Termine heute Nachmittag.“
„Kann mir schon denken. Der neue Vice Questore. Will Informationen aus erster Hand. Ich finde ja, er sollte selbst erst einmal Fuß fassen auf seiner neuen Dienststelle, anstatt …“
„Pietro!“
„Ja, ja. Ich verstehe. Also: Sieht aus wie der Teil einer Narbe. Eine Verbrennung vielleicht. Kann man nicht mehr erkennen. Ist einfach zu klein. Die Haut mit dem restlichen Teil der Narbe … die Maden, die Aale, oder was auch immer … du verstehst? Kann vielleicht wichtig zur Identifizierung sein.“
Sparacio beendete das Gespräch und schnappte sich sein Jackett. Dann eilte er die Stufen ins Erdgeschoss hinab und stand schließlich auf dem Gehweg, geblendet von der heißen Mittagssonne. Dann fasste er einen Entschluss. Questore oder Gerichtsmedizin? fragte er sich. Dann sah er den vorbeifahrenden Autos zu und fasste eine Entscheidung. Hell für den Vice-Questore, dunkel für die Gerichtsmedizin.
Es dauerte nur wenige Sekunden, dann tauchte ein Mercedes älteren Baujahrs mit einem deutschen Kennzeichen auf. Urlauber. Fünf Personen, eine komplette Familie. Der Fahrer, ein dicklicher älterer Mann mit Hut, hatte das Lenkrad krampfhaft umfasst und schaute konzentriert geradeaus.
Der Mercedes war schwarz. Sparacio lächelte. Der Vice-Questore musste warten.
5. Kapitel
Diejenigen, die mit Landolfo Franco Geschäfte machten, nannten ihn nur Accolito, den Handlanger. Seine Art der Geschäfte verlangte nicht nach einem vollständigen bürgerlichen Namen; sie bedurfte keiner Wohnadresse. Accolito erreichte man oder man erreichte ihn nicht. Er wechselte seine Wohnung häufig, ohne dabei die rechtlichen Bestimmungen für sich in Anspruch zu nehmen. Er war wie ein Phantom. Anmeldungen, die eine behördliche Verfolgung möglich gemacht hätten, kannte er nicht.
Denjenigen, bei denen er logierte, war es egal. Solange er gut bezahlte, waren sie auf seiner Seite. Die Bleibe, die man ihm bot und die er für seine Zwecke in Anspruch nahm, entsprach der niederen Gesellschaftsschicht. Die Zeit seiner Einmietung legte er nach Gefühl fest, manchmal waren es mehrere Wochen, manchmal nur wenige Tage. Nie verließ er ein Quartier, ohne sich bereits nach einem nächsten umgesehen zu haben. Er entlohnte seine Wohnungsgeber stets über die üblichen Unkosten hinaus, aber mit seiner erdrückenden Präsenz und der Tatsache, wie er mangelnde Loyalität bestrafte, verschaffte er sich nicht nur bei seinen Wohnungsgebern Ergebenheit und Verschwiegenheit.