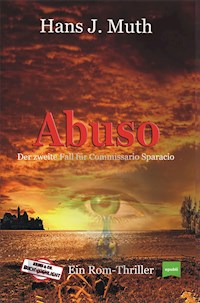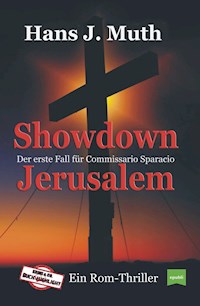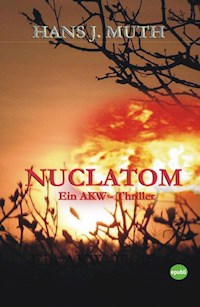Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Fälle des Julian Thalbach
- Sprache: Deutsch
Achmed schauderte. Nur der Mund Merlots lächelte. Seine Augen waren eiskalt. Das letzte Mal, dass er diesen Ausdruck in seinem Gesicht gesehen hatte, hatte ein Mensch dran glauben müssen. Wer war jener geheime Apostel Christi, der den Tribun, Besitzer des unter dem Kreuz verlosten Rockes, erschlug, um sich des Gewandes Christi zu bemächtigen? Eine todbringende Jagd beginnt nach den aramäischen Schriften aus dem Jahr 33 nach Chr., in die ein französischer ehemaliger Legionär, eine Archäologen-Gruppe, ein Abgesandter des Vatikans sowie ein Beauftragter des Bistums Trier verwickelt sind. Commissario Sparacios erster Fall führt ihn während seiner Ermittlungen in Rom auch in die ägyptische Wüste bis hin nach Jerusalem. Krimi & Co.urteilt: Und schon wieder eine Perle! Das Buch ist ein Thriller, der alles beinhaltet was ein spannendes Lesevergnügen ausmacht: Klasse Plot, Abenteuer, geschliffener Schreibstil und interessante Protagonisten. D Wer auf Geschichten á la Dan Brown steht, wird "Showdown Jerusalem" lieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans J. Muth
Lautlos
Der erste Fall für Julian Thalbach
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
LAUTLOS
Impressum
Zum Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Impressum neobooks
LAUTLOS
Hans J. Muth
Psycho-Thriller
Der erste Fall für Julian Thalbach
Impressum
Texte: © Copyright by Hans MuthUmschlagsfoto: I-Stock
Umschlag: © Copyright by Hans Muth
Verlag: Hans Muth
Kapellenstr. 6 54316 LampadenDruck: epubli, ein Service der
neopubli GmbH, Berlin
Printed in Germany
Nach dem Roman „Der Stimmentöter“, mit freundlicher Genehmigung des Verlags Stephan Moll, Burg Ramstein 2017
„Wenn seine Kindheit auch ganz verstummt wäre -
einmal wird sie wieder aufwachen und zu ihm sprechen.“
Peter Sirius, deutscher Dichter und Aphoristiker
Zum Inhalt
An einer Staustufe wird eine weibliche Leiche gefunden. Hauptkommissar Julian Thalbach kann schnell herausfinden, dass die Tote nicht ertrunken ist, sondern durch Fremdeinwirkung ums Leben gekommen ist. Offensichtlich wurde sie mittels einer Plastiktüte erstickt. Er macht noch am Fundort eine grauenvolle Entdeckung. Der Mund der Toten ist zugenäht. Bei der anschließenden Obduktion wird eine weitere unmenschliche Handlung zutage gefördert. Die Stimmbänder der Frau sind durchtrennt. Als ein weiterer gleich gelagerter Todesfall bekannt wird, sieht sich Thalbach einer brutalen Mordserie gegenüber, deren Motive er im psychologischen Bereich des Täters zu erkennen glaubt.
Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um einen Roman. Personen, die darin vorkommen, existieren in der Wirklichkeit nicht. Dennoch ist es nicht immer möglich, jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen zu vermeiden.
Kapitel 1
Er stand da wie ein Fels in der Brandung. So wirkte er nach außen hin.
Doch in seinem Inneren schoss das Wasser seines Lebens den Fels entlang nach unten und bildete einen See aus Tränen.
Er sah seine Mutter mit aufgerissenen Augen an. Seine Lippen bewegten sich und wäre es still im Raum gewesen, hätte man die zitternd gehauchten Worte aus seinem jungen Mund verstehen können:
„Mama! Bitte nicht mehr schimpfen!“
So stand er da, mit seinen sieben Lebensjahren, in denen er kaum auf schöne Momente, die ihm wie jedem anderen Kind so wichtig gewesen wären, zurückblicken konnte und sah zu ihr empor. Er sah ihren wütenden, stehenden Blick und die immerwährenden Bewegungen ihres großen und breiten Mundes. Der aggressive Hall ihrer Stimme übertönte seine Gedanken und irgendwann hatte er sie in seinem Kopf ausgeschaltet. Er hatte sich diese Fähigkeit nach und nach angeeignet und versetzte sich dadurch in eine Art Trance, die ihm überlebenswichtig schien. Das gelang ihm nur für eine kurze Zeit, doch es war immerhin diese Zeit, in der er glaubte, auf einer dunklen Wolke zu schweben, nichts und niemanden um ihn herum wahrzunehmen.
Er sah nur den sich auf und zu bewegenden Mund seiner Mutter, die ungepflegten Zähne, welche hinter ihren Lippen in unregelmäßigem Rhythmus aufblitzten und die irr erscheinenden Augen, die auf ihn herunter starrten. Manchmal, wenn sie sich zu ihm nach unten beugte, wobei ihr die blonden fettigen Haare vor das Gesicht fielen, roch er den Alkohol aus ihrem Mund. Dann schlich sich ein Gefühl der Schuld in sein kleines Herz, denn er war stets der Überbringer dieser Droge, von der sie inzwischen nicht mehr lassen konnte. Was sollte er tun? Ihm blieb doch keine Wahl.
Er sah ihren großen Mund und ihr verzerrtes Gesicht, doch er blieb tapfer stehen und sah sie nur an.
„Mama, bitte!“
Er sagte es so leise, dass er selbst seine Worte nicht hören konnte. Er hatte diese Situation schon oft durchmachen müssen in seinem jungen Leben. Einen Grund, ihn anzuschreien, ihn zu schlagen, hatte seine Mutter immer gefunden.
Er schloss die Augen und schaltete wieder einmal seine Wahrnehmungen einfach aus. Es war für ihn, als höre er eine Stimme aus einem gedämpften Raum, eine Stimme, deren Silben und Wörter er nicht verstehen und ihren Sinn nicht ergründen konnte.
Dann, als habe man eine schalldichte Tür mit einem Ruck geöffnet, drang ihre Stimme wieder in seine Gehirnwindungen und ihre Lautstärke dröhnte in seinen Ohren.
„Wie oft habe ich dir gesagt, dass du nach dem Einkauf sofort nach Hause kommen sollst! Mich lässt man nicht warten! Du bist genau wie dein Vater! Ein Glück, dass er auf und davon ist.“
Ihre schrille Stimme versagte für einen Moment und Speichel tropfte aus einem ihrer Mundwinkel vor ihm auf die Erde.
Er kannte seinen Vater kaum, denn kurz nachdem die kindlichen Erinnerungen Teil seines Lebens geworden waren, wurden diejenigen an seinen Erzeuger wieder ausgelöscht. In seinen Gedanken tauchte sein Vater nur schemenhaft auf und er sah dies in seinen jungen Jahren bereits als einen psychologischen Vorteil, der ihm allzu persönliche Gefühle ersparte. In seinem Herzen aber war sein Vater präsent, der ihm in schweren Zeiten Kraft gab, mit dem er redete, auch wenn er keine Antwort erhielt. Sein imaginärer Vater, von dem er nur eine vage bildhafte Vorstellung hatte, bei dem er dennoch Schutz suchte, wenn er nicht mehr weiterwusste.
Er spürte plötzlich einen brennenden Schmerz auf seiner linken Wange und hätte das Gleichgewicht verloren, wenn in seiner unmittelbaren Nähe nicht der Küchentisch gestanden hätte, an dem er sich im letzten Moment festhalten konnte. Instinktiv griff er sich an die schmerzende Stelle und in seine Augen schossen Tränen.
Seine Mutter lallte irgendetwas Unverständliches, rieb sich ihre Hand und wandte sich von ihm ab. Sie griff nach der rot-gelben Plastiktüte, die ihr Sohn nach dem Nachhausekommen auf einem Stuhl abgelegt hatte, und entnahm ihr eine Flasche mit wässriger Flüssigkeit. Wodka. Das große Wort füllte das Etikett der Flasche fast aus und schien ihr entgegenzurufen: Trink! Trink sofort!
Sie drehte den Schraubverschluss auf und leckte sich über die trockenen Lippen. Als sie die Flasche aufsetzen wollte, sah sie kurz zu ihm hinüber.
„Verschwinde!“ rief sie mit schwankender Stimme. „Mach, dass du fortkommst!“
Der Junge drehte sich langsam um, wobei seine Augen so lange an seine Mutter geheftet blieben, bis die Sperre in seinen Halsmuskeln dies nicht mehr zuließ. Mit gesenktem Kopf verließ er den Raum und schloss die Tür hinter sich.
Während der Alkohol brennend die Kehle seiner Mutter durchfloss, versuchte der Junge hinter der verschlossenen Tür zu weinen. Der Drang nach dieser Erlösung war groß, doch es verließ keine Träne seine blanken Augen. Er hob den Kopf und in seinem Gesicht zeigte sich harte Entschlossenheit, die in keinem Verhältnis zu seinem kindlichen Wesen stand. Er formulierte einen Satz, dessen ersten Teil er in hörbare Worte fasste. Der unverständliche Rest ging in leisem Flüstern unter:
„Wenn ich einmal groß bin ...!“
Kapitel 2
Als Vera das Bewusstsein wiedererlangte, war ihre erste Wahrnehmung eisige Kälte, die ihren Rücken durchflutete und die sich über Ober- und Unterschenkel bis hin zu ihren Fersen ausbreitete. Ihre Augenlider waren schwer und es fehlte ihren zarten Muskeln die Kraft, sie auch nur einen Spalt zu öffnen. Müdigkeit beherrschte ihren Körper und am liebsten hätte sie sich in den angenehmen Schlaf, aus dem sie gerade erwacht war, zurückfallen lassen.
Doch irgendetwas ließ sie dagegen ankämpfen. Es war nicht allein die Kälte, die ihren Körper vibrieren ließ. Es war die Stille, die sie umgab. Als es ihr mit großer Anstrengung gelang, die Augenlider einen Spalt zu öffnen, war es die gleiche Dunkelheit wie vorher, als ihre Augen noch geschlossen gewesen waren. Sie tastete mit den Händen an ihrem Körper entlang, suchte die Ursache der Kälte, die ihren Körper durchströmte.
Ihre Handflächen fühlten blankes, kaltes Metall.
Sie erstarrte.
Ich liege auf einer metallenen Unterlage. Was ist das? Wo bin ich?, schoss es ihr durch den Kopf und Panik breitete sich wie ein elektrischer Stromstoß in ihrem Körper aus. Sie öffnete erneut ihre Augenlider, die sich gegen ihren Willen wieder geschlossen hatten, es änderte nichts. Die Dunkelheit blieb.
Sie drehte den Kopf nach links und war verwundert darüber, dass ihr alleine diese kleine Bewegung große Mühen bereiteten. Dann versuchte sie, auf der rechten Seite etwas zu erkennen, doch wohin sie auch sah, es umgab sie schwarze Dunkelheit.
Ist etwas mit meinen Augen, dachte sie panisch. Kann ich etwa nicht mehr sehen? Ist es Tag oder Nacht? Mein Gott …
Vera tastete mit der Hand nach dem, was sie an Kleidung an ihrem schlanken Körper trug und erschrak abermals. Ihre Hände tasteten von ihrem Hals abwärts über ihre Brust und ihren Bauch bis zu den Oberschenkeln, soweit ihre Arme reichten.
Ein Nachthemd, stellte sie, inzwischen vor Kälte zitternd, fest. Ich trage ein Nachthemd und weiter nichts. Was um Himmels Willen geschieht mit mir?
Veras Mund war trocken und sie hatte einen Geschmack im Mund, den sie nicht zum ersten Mal in ihrem Leben verspürte. Sie erinnerte sich. Als man ihr vor einigen Jahren den Blinddarm im städtischen Krankenhaus entfernt hatte und sie aus der Narkose erwacht war, hatte sie den gleichen Geschmack im Mund. Damals rührte er von einer Narkose her. Es war ein süßsaurer Geschmack gewesen, der ihre Geschmacksnerven einige Tage lang begleitet hatte und einherging mit Übelkeit, so dass sie sich mehrfach erbrechen musste.
Heute war ihr nicht schlecht, aber der Geschmack! Es war der gleiche wie damals. Wie nach der OP vor einigen Jahren.
Eine Narkose? Wo befinde ich mich hier? In einem Krankenhaus?
Sie versuchte sich zu erinnern. Ihre Gedanken rasten und machten ihr einen Rückblick auf die vergangenen Stunden unmöglich.
Nein, ich bin nicht krank. Ich hatte auch keinen Unfall. Oder doch?
Es kommt vor, dass man sich nach einem Unfall hinterher nicht mehr an das Geschehene erinnern kann, überlegte sie. Aber sie hatte keine Schmerzen am Körper.
Nein, ich hatte keinen Unfall! Selbst wenn, das hier ist kein Krankenhaus, wiederholte sie ihre Gedanken. In einem Krankenhaus liegt man auf einer warmen Matratze. In einem Krankenhaus ist es hell, man kümmert sich um den Patienten.
Die Unterlage, die ihrem Körper die Wärme entzog, war aus Metall. Aus blankem, kaltem Metall. Dazu die Dunkelheit, die auch dann nicht endete, wenn sie mühsam die Lider einen Spalt öffnete.
„Hilfe!“
Der Schmerz in ihrem Hals erstickte den Schrei im Ansatz. Die Kehle brannte ihr wie Feuer und plötzlich hatte sie den Geschmack von Blut auf der Zunge. Sie schluckte die Flüssigkeit, die sich im Inneren ihres Mundes bildete, und schrie erneut vor Schmerzen auf. Doch es war ein lautloser Schrei, keine Silbe hatte dabei ihren Mund verlassen, der Hauch ihres Atems und ein leises Flüstern waren die einzigen Geräusche, die zu ihren Ohren drangen.
Sie verspürte einen schmerzhaften Reiz im Hals und als sie husten wollte, war es, als stoße ihr jemand ein brennendes Eisen in die Kehle. Und je mehr sie versuchte, sich zu artikulieren, umso schmerzhafter brannte es in ihrem Hals.
Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass alles, was soeben passierte, ohne einen Laut geschah. Selbst als sie hustete, nahm sie kaum das ihr vertraute Geräusch wahr. Vera formte mit den Lippen einen Satz, trotzdem entsprang kein Wort ihrem Mund, alleine der Schmerz tobte in ihrer Kehle wie glühende Kohle. Sie versuchte sich zu räuspern, doch es verließ nur ein leises Zischen ihre Atemwege, begleitet von dem brennenden Schmerz, der ihre Gegenwart bestimmte.
Ihr Herz schlug so stark und so schnell, dass sie glaubte, es müsse jeden Moment zerspringen. Noch immer konnte sie nicht einordnen, wo sie sich befand, was mit ihr geschehen war. Sie nahm alle Kraft zusammen und versuchte sich aufzurichten. Sie benutzte dabei ihre Ellbogen und schließlich gelang es ihr, sich auf den Unterarmen aufzustützen. Mit letzter Anstrengung wollte sie ihre Beine anziehen, um mit einer Drehung in eine sitzende Position zu gelangen. Doch ihre Beine bewegten sich nur wenige Zentimeter, bevor die Bewegung, begleitet von einem metallischen Geräusch, jäh gebremst wurde. Vera wehrte sich gegen den Widerstand, der ihre Beine beherrschte, doch das Zerren gegen die unbekannte Gewalt, begleitet durch metallisches Gerassel, blieb ohne Erfolg.
Ich bin gefesselt! Man hat meine Füße an das, worauf ich liege, gefesselt. Was geschieht hier?
„Hilfe!“
Es blieb ein lautloser Schrei voller Schmerzen in der Kehle, und die Tränen, die ihr in die Augen schossen, rannen als kalte Tropfen nach hinten in ihr blondes Haar.
Dann hörte sie Schritte, irgendwo, außerhalb des Raumes, die sich langsam näherten.
Tack … tack … tack!
Ein schmaler Lichtstreifen drängte sich durch den Türspalt über dem Fußboden, der Vera trotz ihrer nahezu geschlossenen Augenlider wie gleißendes Flutlicht vorkam.
Ich kann sehen! Ich bin nicht blind!
Irgendetwas wie Freude mischte sich in ihre panische Angst. Ein Quäntchen nur, aber es war ein kleiner seelischer Balsam auf dem gequälten Herzen, dessen Wirkung jedoch abrupt verflog.
Die Schritte endeten vor der Tür, nur das Scharren von Schuhsohlen war kurz zu vernehmen. Der Lichtschein unter der Türe wurde mehrmals unterbrochen und schließlich zu einem Teil abgedeckt. Dann war es still. Vera lauschte mit geschlossenen Augen, als könne sie die Dunkelheit und die Tür durchdringen und mit ihren Gedanken all das wahrnehmen, was hinter dieser Tür vor sich ging. Irgendjemand stand dahinter und würde zu ihr hereinkommen. Insgeheim wünschte sie einerseits, dass die Person draußen bliebe, andererseits hoffte sie, dass sie möglicherweise Hilfe für sie bedeutete.
„Hilfe!“
Es war ein Ruf voller Hoffnung, doch es blieb ein ungehörter Ruf. Der Schmerz in ihrer Kehle war wieder da.
Endlich hörte sie ein metallenes Geräusch.
Ein Schlüssel wurde ins Schloss gesteckt.
Kapitel 3
„So eine verdammte Sauerei!“
Ich hatte gehofft, es vom Dienstwagen aus in die Vorhalle der Dienststelle zu schaffen, bevor der Himmel seine Schleusen öffnete. Doch dieser machte mir einen Strich durch die Rechnung und leerte eine gefühlte Wolke voll kaltem Regenwasser direkt über mir aus, als schien er mir klarmachen zu wollen, dass sich der Sommer nun endgültig verabschiedete.
Der Oktober hatte seine letzten Tage erreicht und der Winter würde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Gefühlt stand er bereits vor der Tür und wartete nur darauf, hereingelassen zu werden.
Mit einigen schnellen Schritten rettete ich mich unter das Vordach des Eingangsportals, wo ich meinen klitschnassen Hut mehrfach auf den Trenchcoat über meinem rechten Bein schlug. Das Regenwasser spritzte gegen die Eingangstür des Trierer Polizeipräsidiums, die sich beim meinem Nähern automatisch langsam öffnete. Wie lange dieser Bau uns noch für die dienstlichen Belange zur Verfügung stehen würde, stand in den Sternen. Man hatte Schadstoffe in den Wänden oder wo auch immer vorgefunden und als die ersten Kollegen Anzeichen von Unverträglichkeiten feststellten, hatte man mit entsprechenden Untersuchungen begonnen. Nun warteten wir gemeinsam auf die Ergebnisse und hinter verschlossenen Türen munkelte man schon über einen neuen Dienststellen-Standort.
Ich setzte den Hut wieder auf, öffnete meinen Mantel, zog ihn aus und legte ihn über meinen linken Unterarm.
„Morgen, Julian!“, tönte es mir entgegen. Hinter der kugelsicheren Glasscheibe des Eingangsbereichs winkte mir Walter Ebers kurz zu, in der rechten Hand einen Telefonhörer, offensichtlich mitten in einem Gespräch.
Evers war ein ehemaliger Kriminalbeamter, jenseits der fünfundsechzig, mit gedrungener Figur, glatzköpfig, jederzeit für einen Scherz zu haben. Zahlreiche Operationen an diversen Gelenken seines Körpers hatten einen weiteren Verbleib in der Ermittlungsbehörde unmöglich gemacht. Man schickte ihn in Pension, doch irgendwie konnte er sich nicht trennen. Er bewarb sich auf den Dienst an der Pforte und seit einem halben Jahr verbrachte er nun dort sitzend, auf 400-Euro-Basis, einen Teil seiner Pensionärs-Zeit.
Ich winkte zurück und mein Ärger über das Regenwetter verflüchtigte sich langsam. Ich vernahm das Summen des Öffners der Zwischentür, die gemeinsam mit dem Haupteingang eine Schleuse bildete und nickte Ebers, der sich wieder seinem Telefonat widmete, kurz zu. Dann ging ich zum Aufzug, drückte auf die Vier und fuhr schließlich in die Etage der Mordkommission.
Mein Name ist Julian Thalbach, Kriminalhauptkommissar. Ich bin 56 Jahre alt und leite diese Dienststelle nun schon seit über zwanzig Jahren. Im Großen und Ganzen ist die Stadt in kriminalistischer Hinsicht eher ein ruhiges Fleckchen Erde, vergleicht man sie mit Großstädten wie Hamburg, München oder Frankfurt. Dennoch kann es vorkommen, dass wie aus heiterem Himmel das große Verbrechen seinen Weg auch zu uns findet. Dann ist zumindest für den Zeitraum von der Tat bis zum Ermittlungsergebnis kein wesentlicher Unterschied zu den eben genannten Städten erkennbar.
Die Arbeit und ihre Konzepte sind überall gleich, aber vielleicht haben wir hier den Vorteil, dass wir uns mit einem bereitgestellten Team auf diese Straftat konzentrieren können, während die Großstädte ihre Beamten dann weiterhin in vielfacher Hinsicht beanspruchen müssen.
Was mein Privatleben angeht … was soll ich sagen? Martha, meine erste Frau, starb vor fünfundzwanzig Jahren. Knochenkrebs. Es gab keine Hilfe für sie. Die Metastasen waren überall. Ich brauchte lange, um diesen Schmerz zu verkraften.
Seit fünf Jahren bin ich wieder mit einer Frau liiert. Getrennte Wohnungen, versteht sich. Ich möchte es so. Meine Martha ist immer noch gegenwärtig und ich möchte sie zumindest in meinen vier Wänden mit niemandem teilen.
Antoinette Mouton hat einen französischen Vater und eine deutsche Mutter. Ich nenne sie Nette. Der doppelte Sinn der Abkürzung ihres Namens hat es mir angetan. Nette ist in Deutschland aufgewachsen und spricht beide Sprachen. Akzentfrei. Sie ist ein gutes Stück jünger als ich und ich fühlte mich geschmeichelt, als sie mir sagte, dass sie einen Teil ihres Lebens mit mir verbringen möchte. Sie ist eine starke Frau, die auch mich in meinen schwächsten Lebensmomenten stark macht.
Ich wusste nicht, warum ich gerade jetzt an sie dachte, aber ehrlich gesagt ertappte ich mich tagsüber des Öfteren bei Gedanken an sie. Vielleicht, weil ich sie brauchte, vielleicht, weil sich im Innersten meines Herzens die Angst eingenistet hatte, dass sie mich eines Tages verlassen könnte.
Ich verdrängte all diese Gedanken und merkte, wie es kühl an meinem linken Unterarm wurde. Der kurze Regenguss hatte meinen Mantel durchweicht und ich spürte die Feuchtigkeit, die sich durch den Ärmel meines Sakkos auf meinem linken Unterarm breit machte. Ich fasste den Mantel mit meiner rechten Hand, wie man einen Hund am Genick packt, und hielt ihn vom Körper weg. Sollte er doch zerknittern. Es war mir völlig egal. Der nächste Regenguss würde ihn wieder in seine nasse, schlappe Form bringen.
Ich schaute auf meine Armbanduhr. Montag, 12:15 Uhr. Na klar, es war Mittagszeit. Die meisten meiner Kollegen und Schreibkräfte saßen oben in der Kantine oder machten einen kleinen Stadtbummel. Immerhin gab es ja den Dauerdienst, der sich während dieser Zeit verstärkt um die dienstlichen Belange kümmerte.
Mich beschäftigten wichtigere Dinge. Ein Raubüberfall vor drei Tagen bei einem Juwelier in der Innenstadt konnte bislang nicht aufgeklärt werden, obwohl eine gute Personenbeschreibung durch den Ladeninhaber vorlag. Auch meine Ermittlungen innerhalb der vergangenen Stunden hatten nicht dazu beigetragen, auch nur einen Schritt voranzukommen.
Ich schritt den Gang entlang und öffnete die Tür zum Großraumbüro, von dem aus ich mit meinem Team agierte. Büro 432. Verwundert blieb ich in der Tür stehen und schaute auf meinen Mitarbeiter, der sich mit der Tastatur seines Computers beschäftigte.
„Was ist?“ Ich war verwundert über seine Anwesenheit im Büro. „Keine Mittagspause, Laufenberg?“
Ich warf meinen Trenchcoat über die Lehne eines Stuhles in der Besucherecke und näherte mich meinem Mitarbeiter. Oberkommissar Alexander Laufenberg war schlank und hochaufgewachsen, dennoch war seine Figur kraftvoll und dynamisch. Er war etwa halb so alt wie ich, gerade einmal 27 Jahre alt, vor wenigen Wochen erst zum Kriminal-Oberkommissar befördert worden und bildete mit mir und einer weiteren Kollegin ein verhältnismäßig gutes Team. Mit Laufenberg zusammenzuarbeiten war eine gute Sache. Ich konnte mich in jeder Situation auf ihn verlassen und hatte auch das Gefühl, dass er nicht unbedingt in ein anderes Kommissariat wechseln wollte.
„Moin, Chef“, grinste Laufenberg, stieß sich mit den Füßen vom Schreibtisch ab und rollte mit dem Bürostuhl ein Stück zurück. Er fuhr sich mit der Hand durch die gelockten dunkelbraunen Haare und ordnete sie, als seien sie während der Arbeit am PC in Unordnung geraten.
„Ich habe schon was gegessen“, bemerkte er und kam gleich zur Sache. „Die Beschreibungen des Täters durch den Juwelier könnten doch besser kaum sein. Ich versuche schon den ganzen Morgen, die Person zu identifizieren. Negativ. Alles negativ. Auch die Recherchen beim Bundeskriminalamt und beim LKA.“
„Ein Ersttäter also“, brummte ich. „Wir sollten mit unseren Ermittlungen vielleicht nicht in die Ferne schweifen …“
„… wenn der Täter möglicherweise hier in Trier oder Umgebung zu suchen ist“, ergänzte Laufenberg grinsend.
„Genau. Ist die Pressemeldung eigentlich schon in der Tageszeitung erschienen?“
Laufenberg schüttelte den Kopf. „Das Wochenende, Chef. Wird vermutlich morgen erscheinen.“
„Warum erst morgen?“ Ich spürte, wie sich meine Stirn in Falten legte. „Heute ist der erste Tag der Woche, an dem dieses Blatt erscheint. Machen Sie den Leuten mal Druck. Morgen will ich den Artikel in der Zeitung sehen. Wo ist eigentlich Frau Esslinger?“
Kommissarin Simone Esslinger war die Dritte im Team. Mit ihren 23 Jahren war sie eigentlich zu jung, um in einer Mordkommission eingesetzt zu werden. Indes hatte sie mit ihren Bewerbungen nie locker gelassen und sich mit Intelligenz und flotten Sprüchen irgendwie dann trotzdem ihren Weg hierher geebnet.
„Simone ist zu Tisch, in der Kantine. Heute ist Geflügel-Tag. Sie wissen doch, unsere Kommissarin ist auf dem Weg zur Vegetarierin. Schweine- und Rindfleisch sind bereits passé.“
„Das kann ja heiter werden.“
Ich fühlte mich müde, ließ mich auf meinen Bürosessel fallen und stützte die Arme auf dem Schreibtisch ab.
„Irgendwann wird sie sich nur noch von Grünem ernähren und wir müssen dann ihre Launen ausbaden. Aber Sie werden sehen, Laufenberg“, ich hob vielsagend den Zeigefinger in die Höhe, „das geht vorüber. Die meisten, die mit diesem Vorsatz schwanger gingen, haben zu alten Gewohnheiten zurückgefunden. Frau Esslinger wird es ebenso ergehen.“
„Was wird mir wie ergehen?“
Ich schreckte auf, als ich Simones Stimme hörte und blickte in ihre Richtung. Sie lehnte mit leicht übereinandergeschlagenen Beinen schräg im Türrahmen und stützte sich dabei mit der gesamten Länge ihres rechten Unterarms ab. Mit ihrer linken Hand rieb sie vielsagend ihr Kinn und ihre grau-grünen Augen funkelten im Kontrast zu ihren blonden Haaren.
„Ich habe im Zusammenhang mit meiner Person das Wort ‚schwanger‘ verstanden. Darf man erfahren, was damit gemeint ist?“ Bei dieser Frage wiegte ihr Kopf drohend hin und her.
Meine Blicke huschten über die schlanke Gestalt meiner Kollegin, die sich heute in eine hellblaue Jeans gepresst hatte, über welche locker eine um die Taille verknotete, weiße Bluse hing. „Schwanger? Nein, das betraf Sie nicht.“
„Aha.“
Na ja, ich meinte nur …“
„Das Läuten des Telefons rettete mich aus meiner Erklärungsnot. Ich hob den Hörer auf und sah aus den Augenwinkeln das breite Grinsen im Gesicht Laufenbergs, während dieser seinen Blick in Richtung der weiblichen Erscheinung richtete. Doch sein Gesichtsausdruck änderte sich sofort, als er zu mir herüber sah.
„Wir kommen“, war meine knappe Antwort in den Hörer, bevor ich auflegte. „Wir müssen los“, sagte ich, erhob mich dabei und griff nach Mantel und Hut. „Die WaPo hat eine Wasserleiche aus der Mosel geborgen, an der Staustufe am Ende der Stadt. Offensichtlich eine Frau. Haben wir irgendwelche Vermisstenfälle?“
Ich wartete die Antwort nicht ab. „Frau Esslinger, Sie bleiben hier und klären das. Seien Sie für uns erreichbar, für alle Fälle.“
Kapitel 4
Ich starrte auf den leblosen Körper vor mir auf der vom Regen durchnässten Erde. Eine Frau. Sie war nicht groß, vielleicht ein Meter fünfundsechzig, und hatte eine kräftige Figur. Nicht dass ich sie als dick bezeichnet hätte, vollschlank wäre die zutreffende Bezeichnung, wie ich für mich feststellte. Sie hatte mittellange, dunkelblonde Haare. Die Tote lag auf dem Bauch, ihre durchnässte Kleidung lag eng an ihrem Körper an und betonte die Konturen ihrer Figur.
Lange konnte sie noch nicht im Wasser gelegen haben, dafür sah die Leiche zu gut erhalten aus. Ihr Körper war noch nicht aufgetrieben, wie es bei länger im Wasser treibenden Leichen der Fall war. Auch wenn es bis vor wenigen Minuten stark geregnet hatte, war die Außentemperatur bisher nicht unter 20 Grad gefallen.
Ich suchte mit den Augen nach Verletzungen, dort, wo der Körper nicht von der Kleidung bedeckt war. Mein Blick blieb an ihrem Hals haften, der durch den hochgerutschten Kragen ihrer leichten Sommerjacke nur schemenhaft zu erkennen war. Ich ging in die Hocke, begleitet von einem schmerzhaften Knirschen im Bereich meiner Lendenwirbelsäule, fasste mit den Spitzen von Daumen und Zeigefinger den Kragen und legte den Hals der Toten ein Stück frei. Die Todesursache erschien mir eindeutig. Schmale Strangulationsmerkmale von rötlich-bläulicher Farbe, die hinter dem Genick überkreuzt verliefen, ließen keinen Zweifel aufkommen.
„Sie wurde erdrosselt und dann einfach weggeworfen.“
Alexander Laufenberg, der sich von den Kollegen der Wasserschutzpolizei über die Bergungsumstände hatte informieren lassen, stand plötzlich neben mir.
„Was wollte der Täter damit bezwecken?“, fragte er. „Wenn man eine Leiche verschwinden lassen will, geht man anders vor. Wer sie irgendwo ins Wasser wirft, muss schließlich davon ausgehen, dass sie irgendwo wieder an Land gespült wird. Ist doch irgendwie seltsam.“
Ich überging seine Frage und sah Laufenberg erwartungsvoll an. „Ist ein Arzt verständigt?“
„Ja, habe mich darum gekümmert. Muss gleich hier sein. Auch der Leichenbestatter. Soll ich?“ Er sah fragend zu mir auf, während er in die Knie ging und sich der Leiche näherte.
Ich nicke. „Untersuchen Sie die Leiche. Ich werde noch einige Worte mit den Kollegen wechseln.“
Während ich mich zum Boot der Wasserschutzpolizisten begab, um bei den Kollegen die obligatorische Befragung durchzuführen, tat Laufenberg das, was die Vorschriften von uns verlangten. Die polizeiliche Leichenschau musste am Tatort oder eben, wie heute, am Fundort, geschehen. Und sie hatte ein bestimmtes Ritual. Ohne mich umzudrehen konnte ich im Geist jede Handlung meines Kollegen nachvollziehen.
Laufenberg streifte sich ein Paar Einweghandschuhe über. Dann nahm er den Kopf der Toten in beide Hände, hob ihn an und bewegte ihn nach allen Seiten. Obwohl die Todesursache für ihn keine Zweifel aufkommen ließ, tastete er den Kopf nach Verletzungen ab und versuchte, eventuelle Knirschgeräusche im Bereich der Halswirbel zu erkennen oder aber auszuschließen. Offensichtlich gab es dort keine Verletzungen.
Er packte die Arme der Toten, legte sie an deren Körper an und drehte die Frau auf den Rücken. Kurz wurde sein Blick abgelenkt auf ihren rechten Arm, der nach der Drehung gestreckt auf den Boden aufgeklatscht war. Als er seinen Blick auf das Gesicht der Toten richtete, erschrak er so sehr, dass sein Körper zurückzuckte und ein Fluch seine Lippen verließ.
„Was ist los?“ Offensichtlich hat mich Laufenberg nicht kommen hören, denn er zuckte bei meiner Frage kurz zusammen.
„Chef, sehen Sie sich das mal an“, sagte er, während er sich aus seiner hockenden Position aufrichtete und mit gestrecktem Arm auf das Gesicht der Frau zeigte, die ich auf maximal 30 Jahre schätzte.
Ich tastete mit meinen Augen den Kopf der Frau ab und hörte Laufenberg neben mir sagen: „Der Mund, sehen Sie das?“
„Mein Gott!“, entfuhr es mir. Ich hatte schon manches im Verlauf meiner Dienstjahre gesehen, doch das hier … Es war das erste Mal, dass mir so etwas unterkam.
„Was hat man dieser Frau angetan?“ Ohne Rücksicht darauf, dass die unteren Enden meines ohnehin schon gebeutelten Mantels den nassen Boden berührten, beugte ich mich vor und ging langsam in die Hocke, um mir das, was uns beiden Kriminalisten so zusetzte, genauer anzusehen.
„Man hat ihr die Lippen zugenäht“, stellte ich fest und die Worte schienen meinen Mund fast tonlos zu verlassen. Ich sah zu Laufenberg hinauf. „Was für ein jämmerlicher Tod. Sie hatte nicht einmal Gelegenheit, sich ihren Schmerz von der Seele zu schreien.“
Ich erhob mich langsam und strich meinen Mantel glatt.
„Sehen Sie nach, ob uns weitere Überraschungen bevorstehen“, sagte ich leise zu Laufenberg, der sich daraufhin zu der Toten beugte und sich anschickte, ihre Kleidung zu öffnen, es sich dann aber anders zu überlegen schien. Er sah mich an. Ich nickte. Das hatte Zeit. Soll der Doc doch seinen Dienst erst einmal tun. Unseren verbleibenden Part würden wir später in der Leichenhalle der Gerichtsmedizin erfüllen. Nur das Nötigste, jetzt, hier.
„Sehen Sie am Hals nach. Sieht nach Strangulationsmerkmalen aus.“
Laufenberg öffnete Jacke und Bluse der Toten im oberen Bereich und schob die Kragenenden beiseite, so dass sich das Ausmaß der Würgemale deutlich erkennen ließ.
„Seltsam, Chef“, sagte er, während er den Kopf der Toten zur Seite legte. „Ich glaube nicht, dass die Frau erwürgt wurde. Ich habe außerdem meine Zweifel, dass es sich um Strangulationsmerkmale handelt.“
„Was reden Sie da, Laufenberg?“ Ich mühte mich erneut in die Hocke, um mir den Hals der Toten aus der Nähe anzusehen. Dann sah ich es auch.
„Sie könnten recht haben, Laufenberg. Die Frau wurde nicht stranguliert. Das hier sieht aus, als habe man ein … ja, ein Seil oder etwas Ähnliches um ihren Hals gebunden. Allerdings reichte das nicht, um sie zu erwürgen. Haben Sie die Augen überprüft?“
Laufenberg verzichtete auf eine Antwort und hob ein Augenlid der Frau an. Dann nickte er. „Punktuelle Einblutungen, Chef. Der Tod ist auf jeden Fall durch Ersticken eingetreten.“
„Das Seil“, überlegte ich, „es könnte sein, dass man es nur zur Befestigung benutzt hat. Vielleicht hat man der Frau eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und diese mit einem Seil zugebunden.“
„Es hat dem Täter nicht gereicht, ihren Mund zuzunähen. Ein jämmerlicher Tod“, bemerkte Laufenberg und erhob sich. „Aber offensichtlich hat der Täter die Tüte nach der Tat wieder entfernt und ebenso das Seil.“
Ich überging Laufenbergs Information. „Hat sie Papiere dabei?“
Laufenberg tastete die Taschen der Jacke und der Hose ab und drehte die Leiche auf die Seite, um an die Gesäßtaschen zu gelangen.
“Nichts, keine Mappe, kein Geldbeutel, kein Schlüsselbund. Nicht mal ein Taschentuch oder einen Lippenstift. Nichts. Absolut nichts.“
Vielleicht hat meine Kollegin auf der Dienststelle ja inzwischen etwas herausgefunden in Bezug auf vermisste Personen, dachte ich und wandte mich an Laufenberg.
„Hat sich Frau Esslinger eigentlich schon gemeldet?“ Doch ich hätte mir die Frage schenken können. Wäre es so gewesen, hätte ich es mitbekommen. Wie erwartet schüttelte er den Kopf.
„Gut, wenn der Arzt die Leiche untersucht hat, soll der Leichenbestatter die Frau in die Gerichtsmedizin bringen. Dort können Sie dann auch Ihre Arbeit zu Ende bringen“, gab ich Anweisung. „Ist schon in Ordnung so. Diese Arbeit läuft uns nicht mehr davon. Ah, Doktor, da sind Sie ja!“
Ich hob die Hand zum Gruß. Leopold Wackershausen war Amtsarzt in der Moselmetropole und uns daher von zahlreichen unvermeidlichen Treffen bekannt. Der schlaksige, hochaufgeschossene Mann war schon jenseits der sechzig und immer wieder war er es, der erschien, wenn Not am Mann war. Allgemeinmediziner mit eigener Praxis konnte man mit solchen Aufträgen nicht mehr hinter dem Ofen hervorlocken, und im Krankenhaus einen Doc anzufordern, darauf konnte man getrost verzichten. Die Ärzte dort waren unabkömmlich und niemand zweifelte an der Richtigkeit der Begründung, wenn eine Absage erfolgte.
„Zu jung, um schon zu sterben“, bemerkte Wackershausen, nachdem er uns begrüßt hatte und auf die Leiche sah. „Ihr habt sie aus dem Wasser gezogen? Ah, ich sehe schon.“
Er beugte sich zu der Leiche, nestelte Handschuhe aus seinem Köfferchen und streifte sie über.
„Was ist das?“, stellte er erschrocken fest. „Wer tut denn so etwas? Das ist mir in meiner langjährigen Praxis noch nicht vorgekommen. Man hat ihr den Mund zugenäht. Und soll ich Ihnen etwas sagen? Das scheint fachgerecht und nach ärztlicher Kunst geschehen zu sein. Ein Kollege als Verbrecher?“
Er schüttelte den Kopf, als wollte er diesen Gedanken von sich weisen, ihn nicht zulassen.
Wackershausen bewegt den Kopf der Toten zur Seite und betrachtete die Verletzungen am Hals näher. „Sie wurde nicht erwürgt. Diese Merkmale lassen den Schluss auf Erdrosseln nicht zu.“
„Ist auch unsere Meinung“, bestätigte ich ihm unsere Einschätzung. „Die punktuellen Rötungen in den Augen sprechen aber für Ersticken, da werden Sie mir wohl recht geben.“
„Sie denken, man hat sie erstickt?“
„Genau. Vielleicht mit einer Plastiktüte, die man …“
„Die man am Hals zusammengebunden hat, darum die Merkmale am Hals, die jedoch nicht tief genug sind, um den Tod durch Erdrosseln herbeizuführen.“
„Wie lange ist die Frau schon tot?“, drängte ich.
„Na ja, oberflächlich betrachtet acht bis zwölf Stunden, schätzungsweise. Auf keinen Fall länger.“
„Dann hat man sie vergangene Nacht in den Fluss geworfen. Sie hatte sich im Rechen der Staustufe verfangen“, sinnierte ich vor mich hin. „Wenn sie, nehmen wir mal an, seit zwölf Stunden tot ist, kann sie theoretisch ein gutes Stück die Mosel herunter getrieben worden sein …“
„Verstehe, Sie wollen wissen, wo man die Frau ins Wasser geworfen hat. Ist schwer zu sagen. Sie kann unterwegs aufgehalten worden sein“, konstatierte der Arzt. „Sie müssen berücksichtigen, dass Brückenpfeiler oder im Wasser schwimmende Gegenstände diese Berechnungen durchaus verfälschen können. Sie werden es herausfinden. Was die Todesbescheinigung betrifft, werde ich sie Ihnen ausstellen. Obwohl für uns hier und jetzt die Todesursache eindeutig zu sein scheint, wird der Eintrag auf ungeklärt lauten, das verstehen Sie doch. Theoretisch kann ja auch …“
„Natürlich, ich weiß“, brummte ich. „Warten wir die Obduktion ab. In der Zwischenzeit werden wir versuchen, die Identität der Frau herauszufinden. Laufenberg, Sie veranlassen, dass die Leiche von der SpuSi entsprechend fotografiert wird. Falls keine Vermisstenmeldung vorliegt, geben Sie eine Pressemeldung mit der Personenbeschreibung heraus. Vielleicht gibt es Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Und machen Sie der Presse dieses Mal Dampf. Wir brauchen die Meldung in der nächsten Ausgabe. Und dann die Fotos an LKA und BKA, das ganze Programm, Sie wissen schon.“
Hinter uns bremste der Leichenwagen mit einem knirschenden Geräusch auf dem Schotter.
„In die Gerichtsmedizin!“, rief ich den beiden schwarz gekleideten Gestalten zu, die sich schwerfällig aus dem Fahrzeug wanden. „Und nichts an der Toten verändern. Nicht entkleiden, nicht einsargen. Lassen Sie die Leiche so, wie sie ist. Wir sind in einer Stunde dort.“
Kapitel 5
Heute war einer der besseren Tage in seinem Leben, das nun schon neun Jahre andauerte.
Es war ein Sonntag und er hatte ausschlafen können, ohne dass seine Mutter ihn aus dem Schlaf gerissen und zum Einkaufen geschickt hätte. An diesem Morgen wurde er wach, als die Sonne durch das Fenster seines kärglichen Zimmers schien und mit warmen Strahlen seine Augen blendete.
Er schloss die Augen wieder und schmiegte sich an seinen Teddy, der in seinem Bett fast den gleichen Raum einnahm wie er selbst. Er war allein, aber er fühlte sich nicht einsam. Einsam fühlte er sich, wenn er sich außerhalb seines Kinderzimmers befand. Hier dagegen fühlte er sich geborgen, hier, allein und mit seinem riesengroßen Teddy, dem er Dinge anvertraute, die er keinem Menschen mitteilte, mit dem er kuschelte, mit dem er einschlief und am nächsten Morgen wach wurde.
Er erinnerte sich noch genau an den Tag, als sein Großvater vor etwa einem Jahr, kurz vor seinem Tod, von einer Reise zurückkam und ihm dieses für ihn bisher unerreichbare Geschenk machte. Sein Opa, wenn er doch nur noch da wäre. Dann hätte er jemanden, zu dem er in seiner Not laufen könnte, der ihn beschützen würde vor …
Er zwang sich, nicht weiterzudenken, denn trotz allem wollte er sich nicht gegen den Menschen stellen, der seine Mutter war. Aber wenn Großvater noch leben würde, dann …
So war es nur sein Teddy, hinter dem er sich verstecken konnte, der jedoch nicht die Macht hatte, sein Beschützer im realen Leben zu sein. Er hörte Geräusche an der Tür und sah auf. Seine Mutter blickte durch einen Spalt und ihm fiel auf, dass sie ihre Haare geordnet und offensichtlich noch nichts getrunken hatte.
„Steh auf und komm nach unten“, sagte sie und tatsächlich konnte er ein Lächeln in ihrem Gesicht erkennen. „Wir haben Besuch.“
Dann schloss sich die Tür wieder und er stand auf, nahm seine Kleidungsstücke, die er am Abend zuvor über einem Stuhl abgelegt hatte und kleidete sich an. Dann legte er seinen Teddy an seine Stelle im Bett und deckte ihn so zu, dass nur noch der Kopf zu sehen war. Mit einem letzten Blick auf ihn verließ er den Raum und ging nach unten.
„Komm her“, hörte er seine Mutter sagen, während er zu Boden sah. „Das ist mein Sohn“, sagte sie und zeigte auf den Jungen. Der hob seine Augen und blickte in die Gesichter zweier Männer, die sich aus ihren Sesseln erhoben und ihn von oben herab mit einem, wie ihm schien, gekünstelten Lächeln ansahen. Einer der Männer, hochgewachsen und hager, mit dunklem, kurzen Haar, in einen dunklen Straßenanzug gekleidet, beugte sich zu ihm herunter.
„Ich glaube, du wirst ungefähr so alt sein wie mein Sohn“, sagte er und legte dem Jungen die Hand auf den Kopf. „Ich hätte dir ein Geschenk mitbringen sollen, aber wir kamen nur schnell vorbei, um deiner Mutter Guten Tag zu sagen. Beim nächsten Mal, versprochen.“
Der Mann richtete sich wieder auf und setzte sich nochmals in seinen Sessel. Der andere Mann, ein etwas jüngerer mit einem blonden Schnauzer und Haaren bis zur Schulter, tat es ihm gleich.
„Mein Kleiner hat heute Geburtstag“, sagte der Mann, der ihm von seinem Sohn erzählt hatte. Er wandte sich wieder an den Jungen. „Stell dir vor, ich habe kein Geschenk für ihn. Wir beide“, er zeigte auf den anderen Mann, „waren den ganzen Tag unterwegs und inzwischen sind die Geschäfte zu. Aber kein Sohn wird das verstehen. Du bist acht, sagt deine Mutter. Fast genauso alt wie mein kleiner Felix.“
Der Junge überlegte, was die beiden Männer überhaupt hier wollten. Er hatte sie vorher nie gesehen. Freilich war es für ihn schon in Ordnung, wenn sie ja Bekannte von seiner Mutter waren.
Der Mann sprach weiter. „Ich werde versuchen, es meinem Sohn zu erklären. Er wird enttäuscht sein, aber es ist nun mal nicht zu ändern.“
„Einen Moment noch“, hörte der Junge seine Mutter sagen, als sich die beiden Männer erheben wollten. „Wir können doch helfen, oder? Was meinst du?“ Seine Mutter sah ihn kurz an, dann sah sie an ihm vorbei und verließ den Raum. Der Junge hörte, wie sie die Holztreppe nach oben stieg. Für einen Moment war es ruhig, ehe sich ihre Schritte wieder nach unten näherten. Als sich die Tür öffnete und seine Mutter eintrat, traf es ihn wie ein Schlag. Mit einem Lächeln im Gesicht stand sie dort in der Tür, sah an ihm vorbei und sagte zu dem Vater von Felix: „Darüber wird er sich ganz bestimmt freuen.“
Die Augen des Jungen wurden immer größer, der Mund öffnete sich, doch er brachte keinen Ton heraus. Tränen schossen ihm in die Augen, wie er es lange nicht mehr erlebt hatte, gleich, was er hatte durchmachen müssen. Seine Mutter hielt seinen Teddy in beiden Händen vor dem Körper, den Teddy, der ihn täglich an seinen Großvater erinnerte, der sein einziger Freund war, der ihm in guten und schlechten Zeiten beigestanden hatte. Dieser Freund sollte nun einem anderen gehören.
„Nein!“ Er erschrak über seinen eigenen Schrei und sah, wie sich der Ausdruck im Gesicht seiner Mutter verfinsterte.
„Ich kaufe dir ein neues Spielzeug“, sagte sie mit zugekniffenen Augen. Wir wollen doch Felix den Geburtstag nicht vermiesen.“
Sie ging an ihm vorbei und drückte dem Mann den Teddy in die Hände. Dann wandte sie sich dem Jungen zu. „Geh nun bitte auf dein Zimmer. Heute ist Sonntag, da hast du ja viel Zeit zum Spielen.“
Wie in Trance drehte sich der Junge um und verließ den Raum. Langsam stieg er die Stufen in die obere Etage des Hauses und schlich zu seinem Zimmer. Als er sein Bett erreichte, ließ er sich darauf fallen und brach in Schluchzen aus. So, wie er sich immer an seinen Teddy gekuschelt hatte, presste er seinen Kopf in das zerknüllte Kopfkissen und ließ seinen Tränen freien Lauf.
Dann wurde er plötzlich still. Er setzte sich auf die Bettkante und wischte sich mit beiden Händen über seine Augen. Während er durch das Fenster in den Abendhimmel sah, verengten sich seine Augen zu einem Spalt und von Hass und Enttäuschung geprägt formten seine Lippen die Worte: „Wenn ich mal groß bin ...“
Kapitel 6
Das Klappern des Schlüssels im Schloss der Tür drang in der Stille des Raumes wie das Rasseln schwerer Ketten zu Vera herüber. Der Lichtschein unter der Tür wurde ständig durch schlurfende Bewegungen der dahinter befindlichen Person unterbrochen.
Die Angst kroch in Vera von den Zehenspitzen bis zur Stirn empor und ihre Augenlider begannen vor Erregung zu flattern. Wer immer auch dort draußen stand, er führte nichts Gutes im Schilde. Das hier war kein Krankenhaus und weder ein Arzt noch Bedienstete einer Klinik verschafften sich dort auf solche Art und Weise Zugang zu irgendwelchen Räumlichkeiten.
Die Gedanken begannen erneut durch ihren Kopf zu schießen. Wie komme ich hierher? Was ist meine letzte Erinnerung? Vera presste die Augen zusammen und versuchte in ihren Gehirnwindungen die Gedanken in ein geordnetes System zu bringen.
Langsam hellte sich ihr gedanklicher Horizont etwas auf. Das Theater! Dort war sie gewesen, das fiel ihr jetzt wieder ein. Aber wann war das? Gestern? Vorgestern? Oder heute? Wie lange lag sie schon so hier, auf dieser eiskalten Ablage? Sie erinnerte sich an eine Gesangsprobe. Ja, sie sang in einem Chor des Stadttheaters Trier. Sie war Mitglied des Projektchors.
Gott sei Dank, die Erinnerungen kamen wieder. Sie hatte am Abend ihre Wohnung verlassen, um sich zur Gesangsprobe ins Stadttheater zu begeben.
Das Gesicht ihres Ehemannes tauchte vor ihr auf. Frederik!
Frederik Brunner war Arzt, Chirurg in der städtischen Klinik. Sie hieß Vera Brunner. Warum sie sich ihren Namen in Gedanken bestätigte, das wusste sie selbst nicht. Es gehörte zur Findung der Situation dazu wie die Frage nach den Ereignissen der letzten Tage.
Aber was war geschehen? Sie versuchte, die Strecke, die sie zur Probe genommen hatte, wieder aufleben zu lassen. Von ihrer Wohnung bis zum Stadttheater waren es nur einige hundert Meter. Sie nahm diesen Weg stets zu Fuß und verband dies mit einer Bewegungseinheit, wie sie es nannte. Doch genauere Erinnerungen blieben ihr in den nachforschenden Gedanken fremd. Irgendetwas war geschehen auf dem Weg dorthin, jedoch fiel ihr jetzt absolut nichts mehr dazu ein.
Sie leckte sich mit der Zunge über die Lippen. Sie verspürte Durst. Im gleichen Moment begann ihr Magen zu knurren. Wann hatte sie zuletzt gegessen und getrunken? Sie wusste es nicht.
An der Tür wurden die Schlüsselgeräusche lauter.
Dann, plötzlich, ein schnappendes Geräusch. Die Verriegelung hatte nachgegeben. Langsam öffnete sich die Tür und gleißendes Licht blendete ihre Augen, die sich, wie durch einen geheimen Mechanismus, schlossen.
Krampfhaft öffnete Vera die Augen wieder. Das gleißende Licht war schwächer geworden. Die Ursache dafür stand in Form einer menschlichen Gestalt als Silhouette mitten im Türrahmen. Veras Augen weiteten sich, denn die Gestalt setzte sich langsam in Bewegung und kam auf sie zu. Die Aura des Lichts hinter der Person nahm an Helligkeit und Größe ab. Vera riss den Mund auf und setzte zu einem Schrei an. Jäh wurde sie daran erinnert, dass irgendetwas mit ihrer Kehle geschehen war. Der Schmerz jagte wieder einmal vom Hals ausgehend durch ihren Körper.
Die Gestalt hatte sich ihr nun so weit genähert, dass sie mehr als nur die Konturen erkennen konnte. Sie trug einen Kittel. Einen dunklen Kittel, keinen weißen, das konnte Vera erkennen.
Das ist kein Arzt, dachte sie. Als sie ihren Kopf anhob, um in das Gesicht der Gestalt zu sehen, blickte sie in ein dunkles Loch in der Öffnung einer Kapuze. Das Licht im Hintergrund und die Dunkelheit des Raumes verhinderten auch nur annähernd die Identifizierung dessen, was hinter der dunklen Öffnung lag.
Die Gestalt blieb am Fußende stehen und beugte sich leicht nach vorne. Vera wollte sich nach hinten wegbewegen, doch die Fesseln an den Füßen machten jede Bewegung in diese Richtung unmöglich.
„Ich sehe dich sprachlos“, flüsterte die Gestalt und beugte sich ein kleines Stück weiter nach vorne. Ein leises Lachen begleitete die zynische Bemerkung und Vera konnte immer noch nicht erkennen, ob es sich bei der Gestalt um einen Mann oder eine Frau handelte. „Glaub mir, es tut dir selbst gut, wenn deine Stimme nun zur Ruhe kommt.“
Der Atem der Person begann schneller zu werden. „Hast du mit dieser Stimme deine Kinder eingeschüchtert, deinen Mann angeschrien? Wer alles würde es mit Genugtuung sehen, dass deine Anstrengungen, auch nur ein Wort herauszubekommen, kläglich scheitern? Du wirst niemanden mehr anschreien, niemanden mehr beschimpfen.“
Die Stimme wurde lauter, erhob sich zu einem heiseren Krächzen.
„Ich besitze deine Stimme, mir gehört dein Schrei, dieser Ausdruck deiner Wut.“
Die Gestalt richtete sich langsam auf und bewegte sich rückwärts auf die Tür zu. Der helle Hintergrund vergrößerte sich erneut Stück für Stück.
Die Stimme war wieder zu einem Flüstern hinab gesunken. Vera sah das Gesicht der Gestalt im Gegenlicht immer noch nicht. Dennoch hatte sie das Gefühl, dass die unsichtbaren Augen die ihren wie eine Feuerlanze durchbohrten. Sie riss an den Fußfesseln, versuchte erneut zu schreien. Und wieder durchflutete ihre Kehle ein brennender Schmerz. Doch sie hörte unter der Kapuze nur ein mitleidiges Lachen.
„Bemühe dich nicht“, raunte die Stimme. „Deine Worte sind für immer von dir gegangen.“
Kapitel 7
Es war bereits die dritte Nachtschicht hintereinander, die Dr. Frederik Brunner in dieser Woche zu absolvieren hatte. Er konnte nichts dagegen tun. Hier in der Stadtklinik zu kündigen, um sich an einem anderen Krankenhaus zu bewerben, würde den Spruch ‚Vom Regen in die Traufe‘ bestätigen. Für ihn war die Situation bedrückend, so wie bei den meisten jungen Ärzten in den deutschen Krankenhäusern. Leistungsverdichtung, Reduzierung von Planstellen und Kostendruck führten zu unerträglicher Arbeitsbelastung. Zudem hatte er einen befristeten Arbeitsvertrag, der einherging mit zahlreichen unbezahlten Überstunden.
Vera, seine Ehefrau, sah er nur noch sporadisch und wenn er es tatsächlich schaffte, einige Stunden zu Hause zu verbringen, dann war er der Sklave seines Telefons, das stets griffbereit in seiner Nähe lag.
„Wenn du willst, übernehme ich für eine Stunde deinen Dienst“, hörte er in seine Gedanken hinein die Stimme seines Kollegen Frank Lauterbach. Frank hatte das kleine Büro, das ihnen auch als Aufenthaltsraum diente, fast lautlos betreten, was an seinen weißen Sportschuhen mit den weichen Sohlen lag.
Frederik Brunner drehte sich zu Frank herum und sah ihn an. Frank war etwa in seinem Alter, um die dreißig, ein hochaufgeschossener, schlaksiger Mann, einen Kopf größer als er selbst. Sein Arztkittel, der um seine Hüften schlackerte, schien eine Nummer zu groß.
Frank sah ihn freundlich an und es erschien Frederik, dass bei ihm von Müdigkeit keine Spur vorhanden war.
„Du bist doch genauso lange wie ich auf den Beinen, Frank. Ich verstehe das nicht. Wie schaffst du es nur, das alles hier so wegzustecken?“
Frank zog sich einen Stuhl bei und setzte sich. Frederik tat es ihm gleich und obwohl er auf eine Antwort wartete, wusste er, dass er eine solche nicht erhalten würde. Frank hatte die gleichen Probleme wie er selbst, nur dass man sie ihm optisch nicht so ansah. Vielleicht kam er auch mit weniger Schlaf aus. Viel Schlaf hatte er, Frederik, immer schon gebraucht. Manchmal ertappte er sich sogar bei dem Gedanken, das hier alles hinzuwerfen und irgendwo in die Forschung zu gehen, dorthin, wo ihm ein geregelter Dienst winkte. Freilich verflogen diese Gedanken immer wieder schnell. Er war Arzt und er war dies gerne. Es waren die Umstände, die ihn zweifeln ließen, mal mehr, mal weniger.
„Leg dich etwas hin“, sagte Frank erneut und zeigte auf eine der beiden zusammenklappbaren Liegen, die sie in dem Büro für solche Fälle aufgestellt hatten. „Wir haben eine Verantwortung unseren Patienten gegenüber, das brauche ich gerade dir nicht zu sagen. In einer Stunde wecke ich dich. Bis dahin werde ich das schon alleine schaffen.“
Frederik nickte und stand auf. Dankbar legte er seine Hand auf die Schulter seines Kollegen und schlurfte zur Liege. Doch bevor er sie erreichte, läutete das Telefon.
„Lass nur“, sagte Frank und gab ihm ein Zeichen, sich niederzulegen. Er hob den Hörer auf und lauschte kurz. Dann zuckte er entschuldigend mit den Schultern.
„Ist für dich. Du solltest rangehen.“ Er hielt ihm den Hörer hin.
Frederik atmete tief durch. „Brunner?“
„Hallo Frederik, es tut mir leid, aber ich würde dich nicht anrufen, wenn es nicht wichtig wäre. Es geht um Vera.“
„Vera?“
Brunner erstarrte und sah zu Frank hinüber. „Was ist mit Vera, Claudia?“
Claudia Petry war eine Freundin von ihm und seiner Ehefrau und genau wie sie seit Jahren Mitglied im Projektchor des Trierer Stadttheaters. Sie war oft bei ihnen zuhause, zum Abendessen oder zu anderen Anlässen. Sogar gemeinsame Urlaube hatte Vera mit Claudia verbracht und Frederik war froh über jede Gelegenheit, die sich bot, seiner Frau eine Abwechslung zu verschaffen, während er im Krankenhaus seinen grenzenlosen Pflichten nachkam.
„Vera ist heute nicht zur Probe erschienen, Frederik. Ist sie krank? Ich möchte dich nicht beunruhigen, doch es ist einfach noch nie vorgekommen, dass sie unentschuldigt gefehlt hat. Sie hat immer …“
„Hast du schon bei uns zuhause angerufen, Claudia? Sie muss dort sein. Vielleicht ist es ihr nicht gut und sie hat sich hingelegt. Ich weiß, wie tief sie schlafen kann“, unterbrach sie Brunner.
Es entstand eine kleine Pause, bevor Claudia sich wieder meldete. „Ich habe angerufen, eben gerade, als die Probe beendet war. Es meldet sich niemand. Kannst du es nicht einmal versuchen?“
„Ja, natürlich“, antwortete Frederik fahrig. „Danke für den Anruf, Claudia.“
Dann legte er auf und sah Frank nachdenklich an. „Vera ist heute Abend nicht zur Gesangsprobe erschienen und Claudia sagt, zu Hause geht niemand ans Telefon.“
Während er das sagte, griff er zum Hörer und wählte die Nummer des Anschlusses in seiner Wohnung.
Das Telefon läutete durch, mehrmals. Frederik wartete, bis das Besetztzeichen ertönte. Anschließend wählte er die Nummer von Veras Handy. Die Mailbox war aktiviert. Der Teilnehmer sei nicht erreichbar, tönte es ihm entgegen.
Langsam legte er den Hörer zurück in die Einbuchtung des Telefons und sah Frank erneut an. „Was soll ich tun? Ich kann jetzt eh nicht schlafen. Ich muss versuchen, Vera zu erreichen.“
„Kann sie nicht bei Bekannten sein, bei Freunden? Oder ist da ein Termin, den sie übersehen hatte? Denk doch mal nach.“
Frederik schüttelte gedankenverloren den Kopf. „Vera hätte sich vor der Probe abgemeldet. Was mich betrifft, weiß sie, dass es nicht immer einfach ist, mich zu erreichen.“ Er nahm sein Handy erneut und sah unter möglichen Anrufen nach. „Nichts. Sie hat nicht versucht, mich zu erreichen.“
„Und nun hast du keine Ruhe mehr, was ich verstehen kann“, sagte Frank. „Willst du denn schnell nach Hause fahren? Ich meine, du musst dafür natürlich auf deine Stunde Schlaf verzichten.“
„Danke, Frank.“ Frederik Brunner zog seinen weißen Kittel aus, hängte ihn an den Kleiderhaken hinter der Tür und legte dann sein Stethoskop auf den Tisch. „Du weißt, wie du mich erreichen kannst. Ich melde mich, sobald ich etwas Genaueres weiß.“
Als er kurz darauf auf dem beleuchteten Parkplatz des Krankenhauses stand und die frische Luft in seine Lungen sog, verflog ein Teil seiner Müdigkeit. Doch er musste einen Moment überlegen, wo er seinen Wagen abgestellt hatte. Er betätigte den Mechanismus seines Türschlüssels und schritt in die Richtung, in der die Blinkleuchten den Standort des Autos verrieten.
Kapitel 8
„Na, Frau Esslinger, was haben Sie herausgefunden? Sie haben doch die Vermisstenfälle der vergangenen Wochen recherchiert?“
Ich warf die Bürotür hinter mir ins Schloss, schlüpfte aus meinem Mantel und warf ihn über die Lehne eines freien Bürostuhls. Ich wartete nicht die Antwort meiner Kollegin ab, die mich mit großen Augen ansah und offensichtlich krampfhaft nach einer Antwort suchte.
„Weiblich, vielleicht 30 Jahre, korpulent, dunkelblond, maximal 1,70 Meter groß. Haben Sie da was gefunden?“, schob ich hinterher,
Die Tür öffnete sich erneut und Laufenberg betrat das Zimmer, den Kopf missmutig schüttelnd. Dass ich ihm die Tür einfach in Gedanken und ohne ihn brüskieren zu wollen vor der Nase zugeschlagen hatte, konnte er nicht ahnen. Er ging an mir vorbei und setzte sich hinter seinen Schreibtisch.
Simone blätterte indessen ohne hochzusehen in dem Stapel Unterlagen vor sich auf dem Schreibtisch. „Besondere Merkmale?“, fragte sie beiläufig und hob ihren Blick in meine Richtung.