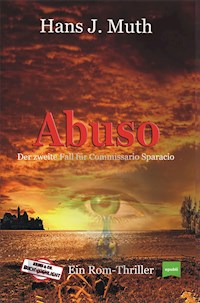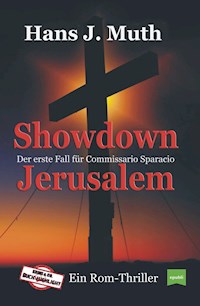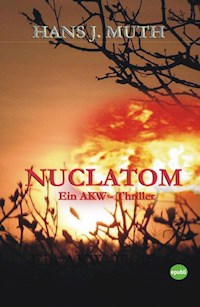
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Explosion in einem Uranbergwerk in Niger/ Westafrika und erpresserische Forderungen erschüttern den französischen Staat. Wird das Atomkraftwerk Nuclatom Ziel eines Super-GAUs? Äußere Gefahren wie Terrorangriffe sind nie ganz auszuschließen. Man kann nur hoffen, dass die Reaktoren in einem solchen Fall standhalten. Dass aber auch im Inneren eines AKWs Gefahren lauern, die weit über technisches oder menschliches Versagen hinausgehen, zeigt Hans J. Muth am Beispiel eines fiktiven GAUs im Kraftwerk Nuclatom im deutsch-französisch-luxemburgischen Ländereck.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans J Muth
Nuclatom
Ein AKW-Thriller
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
NUCLATOM
Impressum
Der Autor
ES MUSSTE IRGENDWANN SO KOMMEN!
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10 Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23.Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Letztes Kapitel
Nachwort
So sieht es aus!
Notfallplan unzureichend!
Impressum neobooks
NUCLATOM
Hans J. Muth
AKW-Thriller
Impressum
Texte: © Copyright by Hans MuthUmschlagsfoto: © Ute Schlumpberger
Umschlagsgestaltung: © Copyright by Hans Muth
Verlag: Hans Muth
Kapellenstr. 6 54316 [email protected]
www.hansmuth.de
Druck: epubli, ein Service der
neopubli GmbH, Berlin
Printed in Germany
Nach dem Roman Fallout-Mit dem Westwind kommt der Tod“, mit frdl. Genehmigung des Verlags Stephan Moll, Burg Ramstein, 2015
Man kann noch so viele Demos organisieren und Appelle an die Regierung richten. Es wird nichts nützen, wenn nicht ein Augenmerk auf die Gefahr von Inneren eines AKW hergerichtet ist. Der sogenannte Schläfer hat seine Bezeichnung seines Namens wegen. Niemand wird Verdacht schöpfen, wenn er in verantwortungsvoller Position in einem AKW auf finale Befehle von außen wartet.
Der Autor
Für meinen Bruder Manfred, der mir bei meinen nicht immer leichten Recherchen stets fachkundig zur Seite stand.
Der Autor
Hans J. Muth al. Hannes Wildecker wurde 1944 im Kreis St. Goarshausen geboren, war einige Jahre Beamter der Schutzpolizei und anschließend 30 Jahre lang Kriminalbeamter beim Polizeipräsidium Trier. Mit dem Schreiben von Lyrik und regionalgeschichtlichen Abhandlungen begann er in den 70er Jahren. Die Liebe zur kriminalistischen Belletristik entdeckte er erst im Alter von 60 Jahren. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und lebt in der Nähe von Trier.
Die Rom-Thriller-Reihe um Commissario Sparacio“ ist einer der literarischen Wege. Bereits erschienen sind „Nahtlos“ und „Tränen der Rache“.
Unter dem Pseudonym Hannes Wildecker schreibt er die Krimi-Reihe „Tatort Hunsrück“. Seine regionalen Kriminalromane handeln im Hunsrück und beschreiben neben dem eigentlichen Fall die Eigenarten der Natur und den natürlichen bodenständigen Charme der Bewohner von Hunsrück und Hochwald einfühlsam. Erschienen sind bisher acht Romane aus dieser Reihe. Mit „Nuclatom“ will Muth den Leser auf die vielfachen Irrwege der Atomkraft-Politik und auf mögliche Angriffe auf Atomkraftwerke hinweisen.
ES MUSSTE IRGENDWANN SO KOMMEN!
Eine Explosion im Uranbergwerk in Niger/Afrika und erpresserische Forderungen erschüttern den französischen Staat. 50 Milliarden Euro als unverhandelbare Summe? Wird das Atom-Kraftwerk Nuclatom an der deutschfranzösischen Grenze, im Dreiländer-Dreieck Frankreich-Luxemburg-Deutschland, Ziel eines Super-Gaus?
Technisches oder menschliches Versagen kann durchaus Ursache für einen Super-Gau in einem Atomkraftwerk sein. Dass Gefahren aber durchaus terroristischer Art sein können, begründet Hans J. Muth am Beispiel eines Super-Gaus im fiktiven Kraftwerk Nuclatom an der deutschfranzösischen Grenze.
Wie kann es dazu kommen, dass von außerhalb geplante Sabotage im Inneren des AKW seine Vollendung findet?
„Ein Super-GAU würde die Evakuierung von 1,5 Millionen Menschen bedeuten.“
(Das sagte bereits der ehemalige saarländische Umweltminister Jo Leinen im Jahr 1986)
Handlung und Personen in diesem Roman sind frei erfunden. Sollte irgendjemand eine Ähnlichkeit mit gleichgelagerten Vorfällen auf der Welt zu sehen glauben, so wird nichts dagegensprechen, ihm das abzunehmen. Diesen Fall hat es allerdings niemals gegeben, jedenfalls nicht während der Zeit, in der dieser Roman entstand. Ich hoffe inständig, dass auch im Nachhinein nichts Derartiges geschieht.
Der Autor
Prolog
Niger (Afrika), AKWAB Uran-Minen, 16:00 Uhr
Die Detonation kam überraschend und vernichtend.
Die Druckwelle hatte ihren Ursprung in einer Halle gleich neben dem Förderturm, bahnte sich brutal den Weg durch die Bauten der Anlage, und ließ Holz und Metallpfosten knicken wie Streichhölzer. Orkanartig fegte die Welle über den grauen, uranhaltigen Schutt, der sich im Freien des riesigen Betriebsgeländes wie großflächige Dünen ausmachte, hinweg, wirbelte ihn in die Höhe, um ihn dann gleichmäßig über den Baracken der Arbeiter und dem Gelände abregnen zu lassen. Menschen schrien, Tote lagen von der Druckwelle in den Uranstaub gepresst, andere liefen, das eigene Leben zu retten.
Es war nicht das erste Mal, dass es auf dem Gelände des französischen Urankonzerns zu einer Explosion gekommen war. Sabotage und Selbstmordattentate gehörten hier schon fast zur Regelmäßigkeit, doch sich dagegen zu wehren oder Vorkehrungen zu treffen, war offensichtlich nicht möglich. Nicht immer war klar, wer hinter diesen Anschlägen stand. Es gab Vermutungen über Zusammenhänge mit dem Kriegseinsatz der Franzosen im Nachbarstaat Mali, denn kurz nach dem Kriegseintritt der Franzosen in der Sahel-Region kam es auch in Algerien zu einer Terroraktion an einer Gasförderungsanlage, wobei es zahlreiche Tote zu beklagen gab.
Die Betriebsleitung war spontan von einem Anschlag mutmaßlicher Angehöriger der malischen islamistischen Miliz Mujao ausgegangen, denen in der Vergangenheit solche Anschläge angelastet werden konnten. Doch in diesem Fall hatte man schnell Erkenntnisse, dass die Ursache anderer Natur war. Als ein Bekennerschreiben bei der Betriebsverwaltung einging, wusste man, dass dies erst der Beginn einer Terrorwelle werden könnte, deren Ausmaße unvorstellbar sein würden.
„Euer Land wird ein Inferno erleben, wie es noch nicht dagewesen ist."
Mit diesen Worten begann der halbseitig in französischer Schrift verfasste Brief, den der Leiter des Förderbetriebes, Marcel Laurent noch am selben Tag in der Hand hielt. Er zitierte sofort Pascale Federence, Sicherheitsingenieur und gleichzeitig seinen Stellvertreter, zu sich, denn er alleine wollte nicht die Last dessen tragen, was geschehen war und offensichtlich noch geschehen sollte.
Laurent war 42 Jahre alt, korpulent, aber dennoch muskulös. Seine dunklen Haare hatte er auf Streichholzlänge gestutzt und so fiel sein kräftiger Oberlippenbart, der in französischer Manier die Oberlippe vollends bedeckte, umso mehr auf. Laurent war seit drei Jahren Chef des Förderbetriebes und lediglich sein monatliches Gehalt ließ ihn weiter an seinem Arbeitsplatz haften. Nur das Geld entschädigte ihn für eine menschenunwürdige Umgebung, ein Leben in Kontamination und der Angst vor täglichen Anschlägen. Dieser heute war einer davon und er dankte Gott dafür, dass es ihn nicht getroffen hatte.
„Eine gottverfluchte Schweinerei!"
Mit diesen Worten erschien Federence in der Tür und bevor sich Laurent über dessen Zustand auslassen konnte, kam ihm jener zuvor.
„Es bleibt einem hier nichts erspart."
Er sah an seiner schlanken hochgeschossenen Figur hinab, auf dessen blauem Overall sich ein grauer Staubfilm angelegt hatte. Sein schmales bartloses Gesicht war ebenfalls mit einem grauen Schleier belegt. Da er einen Helm trug, war es Laurent klar, dass er irgendwo im Werk unterwegs gewesen sein musste. Federence machte mehrmals täglich seine Runde, fuhr auch schon mal hinab in den Schacht, um nach dem Rechten zu sehen und sich um Kranke zu kümmern oder auch schon mal einen Toten ans Tageslicht bergen zu lassen.
„Sie lassen nicht locker, diese islamistischen Mujao, bis wir entweder die Förderung einstellen oder ..."
„Das waren nicht die Mujao", unterbrach ihn Laurent mit gepresster Stimme. Lesen Sie selbst."
Federence besah seine Hände und holte aus, um sich den Staub von der Kleidung zu schlagen, was Laurent mit einem stechenden Blick verhinderte. Federence nickte ergeben und streckte die rechte Hand nach dem Schreiben aus, das Laurent ihm entgegenhielt.
„Das ist ja ungeheuerlich!", entfuhr es Federence, als er den Brief überflogen hatte. Kommentarlos begann er erneut, jedes Wort erneut zu lesen, um das glauben zu können, was dort geschrieben stand: „Euer Land wird ein Inferno erleben, wie es noch nicht dagewesen ist. Was heute geschah, ist nur ein Vorgeschmack dessen, was geschieht, wenn ihr nicht auf unsere Forderungen eingeht."
„Wer steckt dahinter?", fragte Federence leise und es war eine rhetorische Frage, nicht an Laurent gerichtet. Er sprach sie automatisch vor sich hin.
„Lesen Sie!", forderte Laurent ihn erneut auf, der die Frage auf sich gemünzt sah. Stockend begann Federence zu lesen.
„Wir fordern:
1. den Abzug Ihrer Spezialeinheiten, die für militärischen Schutz Ihrer Uranminen sorgen;
2. die Einstellung des Uranabbaus in unserem gesamten Lande mit gleichzeitigem Rückbau der Minenanlagen
3. In der Wüstenregion verbraucht der Abbau des Urans unsere Wasservorräte, die aus sehr großen Tiefen gefördert werden. Dieses Wasser brauchen wir zum Leben. Doch es ist durch Ihre Schuld verseucht und unsere Leute sterben oder siechen dahin. Deshalb fordern wir von der französischen Regierung für den anschließenden Wiederaufbau und die Regeneration unserer Lebensbereiche den Betrag von 50 Milliarden Euro. Fünf Bankverbindungen finden Sie am Ende des Schreibens. An jede dieser Verbindungen transferieren Sie 10 Milliarden Euro. Und denken Sie jederzeit daran: Wir lassen nicht mit uns spaßen. Die Explosion heute und hier war nur ein Warnschuss. Das werden Sie bald verkraftet haben. Ob Sie aber verkraften können, dass wir drei Ihrer besten Männer in unsere Gewalt gebracht haben, das wird die Zukunft zeigen.
Sie werden schnell feststellen, um wen es sich handelt. Wir geben Ihnen vier Tage. Sollten die Forderungen nicht erfüllt werden oder eine Hinhaltetaktik Ihre Strategie sein wird, werden wir jeden Tag einen Ihrer Männer hinrichten. Wir geben Ihnen noch etwas Zeit, wir sind ja keine Unmenschen. Der erste Ihrer Männer stirbt in drei Tagen, am kommenden Dienstag, um 16:00 Uhr Ihrer Zeit. Sollten Sie aber bereit sein, diese Menschen zu opfern, wird es zu der ultimativen Maßnahme kommen, die wir Ihnen eigentlich ersparen wollten.
Unser strategisches Ziel wird eines Ihrer zahlreichen Atomkraftwerke sein, als deren Sklaven Sie uns ansehen: Nuclatom. Es wird der vierte Tag sein, von dem noch spätere Generationen mit Grauen berichten werden. Der vierte Tag, Punkt 16:00 Uhr. Leiten Sie also unsere Forderungen so schnell wie möglich weiter, wenn Sie das Leben Ihrer Leute retten wollen. Sie kontaktieren uns über die Telefonnummer am Ende des Schreibens."
Unterzeichnet war das Papier mit Unabhängiges Niger 1960.
Es folgte noch ein kleiner Zusatz, der daraufhin wies, dass ein Schreiben gleichen Inhalts auch auf dem Weg in das Elysee-Gebäude sei.
Wie in Zeitlupe hob Federence den Kopf und sah zu Laurent hinüber. „Die beabsichtigen doch nicht ...?"
Laurent ließ sich in seinen Sessel fallen. „Man wird diese Forderungen nie erfüllen. Sie wissen, was das bedeutet?"
Federence nickte und starrte erneut wie gebannt auf den Brief.
„Die Regierung wird verhandeln müssen, das ist der einzige Weg. Je eher Sie sich mit ihr in Verbindung setzen, desto intensiver können sie sich auf das Schlimmste gefasst machen. Wer ist das: ‘Unabhängiges Niger 1960'?“, fragte er ungläubig. „Ich habe noch nie etwas von einer solchen Organisation gehört?"
Laurent sprang aus seinem Sessel hoch und begann, in seinem großräumigen Büro, dem einzigen Luxus, der ihm in dieser Einöde zur Verfügung stand, umherzugehen. Federence schaute ihm aus den Augenwinkeln zu, doch er vermied es, die Gedankengänge seines Kollegen zu unterbrechen. Dann blieb er abrupt stehen und sah Federence direkt an.
„Niger wurde 1958 zu einer autonomen Republik der Französischen Gemeinschaft und erlangte am 3. August 1960 die Unabhängigkeit. Es ist der Unabhängigkeitstag, den sich die Gruppe offensichtlich namentlich zu eigen macht", sagte er und nickte zu seiner eigenen Bestätigung. „Offensichtlich eine fundamentale Organisation, die mit der derzeitigen Regierung nichts zu schaffen hat. Ist nur eine Vermutung, aber ..."
„Aber eine logische", führte Federence die Begründung weiter. „Korruption und langjährige politische Kontroversen, was auch die Mehrheitsbeschaffungen im Parlament betraf, könnte Grund für die Abspaltung sein. Das würde auch der Forderung dieser enorm hohen Summe ein Gesicht geben."
„Ich kann Ihnen auch sagen, wie dieses Gesicht aussehen wird", nickte Laurent. Vermutlich wollen sie die derzeitige Regierung stürzen und beabsichtigen, die erpressten Mittel in einen Neuanfang zu investieren. Die Sklaven, wie sie unsere Arbeiter in den Werken bezeichnen, werden davon nicht viel mitbekommen."
„Aber, warum verlangen sie dann, dass die Werke stillgelegt werden sollen. Das passt doch nicht zu den restlichen Forderungen."
„Ich glaube, dahinter verbirgt sich eine raffinierte Ablenkungstaktik", begann Laurent zu kombinieren. „Das Abziehen der Truppen passt zu meiner PutschTheorie. Mit den anderen Forderungen wollen sie ihre wahren Absichten verschleiern. Sie werden keine der Gruben vernichten und sie werden keinen einzigen der Arbeiter aus den Minen herausholen. Sie beabsichtigen, die Uranminen weiter für sich und ihr neues Regierungsgebilde zu beanspruchen. Das ist es. Das erklärt diese enorm hohe Summe."
Laurent sah auf seine Armbanduhr. „Der Premier, ich muss mich mit dem Ministre Premier in Verbindung setzen. Gott schütze
Frankreich!"
„Und die angrenzenden Länder", murmelte Federence. Doch Laurent hörte diese Bemerkung nicht mehr. Er hatte bereit den Telefonhörer in der Hand.
1. Kapitel
Die Zeit danach/Stadtklinik
Ich werde sterben.
Das ist eine Tatsache, die unausweichlich ist, an der kein Sterblicher etwas ändern kann. Sie werden wahrscheinlich angesichts dieser für Sie dilettantischen Aussage geneigt sein, das gerade begonnene Buch mit einer Geste des Unverständnisses enttäuscht beiseite zu legen. Denn sterben, das tun wir schließlich alle, irgendwann.
Doch tun Sie es nicht, denn es ist nicht der lapidare Versuch, das Interesse in Ihnen wecken zu wollen, Sie weiter an die folgenden Zeilen zu fesseln.
Ich werde sterben, schon bald.
Bevor Sie meine Aussage nun tatsächlich zum Anlass nehmen, endgültig zu einem anderen Buch zu greifen, werde ich Ihnen den Grund offenbaren:
Ich bin verstrahlt.
Ja, Sie lesen richtig. Verstrahlt. Atomar verstrahlt. Mein baldiges Dahinscheiden beruht auf dem Versagen von Menschen, denen Macht und Geld vor der Sicherheit ihrer Spezies steht. Ich bin verseucht durch nukleare Energie. Obwohl, wenn ich es mir so überlege, Energie, bezogen auf meine Person, ist in diesem Zusammenhang der falsche Ausdruck. Was mich betrifft, ist Energie ein Zustand, der schon lange meinen Körper verlassen hat. Wobei auch der Begriff Zeit, bezogen auf meinen Zustand und meine Hilflosigkeit, als relativ eingestuft werden muss.
Die Ärzte sagen, dass ich vor zwei Monaten eingeliefert wurde. Ich selbst kann mich kaum daran erinnern. Irgendwann vor ewiger Zeit, die man in medizinischen Kreisen wohl Koma nennt, verließen meine Gedanken das Dunkel und mithilfe der Ärzte und des Pflegepersonals schleicht sich die Erinnerung wieder mühsam und zaghaft in meine Gehirnwindungen.
Ich weiß nicht, wie lange ich heute geschlafen habe, drei, vier Stunden oder mehr. Ist auch egal. Ich öffne meine Augen, deren Lider den Befehlen meines Gehirns zunehmend weniger zu gehorchen scheinen und warte, bis sich der Schleier vor meinen Augen langsam verflüchtigt.
Die Zimmerdecke und zwei unter Reflektoren versteckte Neonröhren sind das Erste, was sich jeweils beim Öffnen meiner Augen in ihren Blickwinkel drängt. Ich rolle meinen Kopf langsam mühevoll zur rechten Seite und blicke zur Tür, erkenne einen Schrank daneben, einen Nachttisch dicht neben meinem Bett, auf dem eine Flasche Wasser und ein Glas stehen und verspüre angesichts der Flüssigkeit den Drang, meine Kehle zu befeuchten. Das kühle Nass lindert meine Schmerzen im Hals, zumindest für kurze Zeit und auch nur dann, wenn sich einer der Pflegekräfte bemüht, mir das Glas an den Mund zu setzen.
Meine Arme liegen an meinem Körper entlang. Ich bewege die Finger. Sie gehorchen problemlos. Mein Schlafanzug, oder das, was ich dafür halte, bedeckt meine Arme und lässt nur eine Sicht auf meine Hände zu. Ich sehe kurz hin und schließe die Augen sofort wieder. Auf meinen Handrücken sehe ich, seit meine Erinnerung zurückkehrte, meine Zukunft. Ich wage mir nicht vorzustellen, was sich auf der Oberfläche meiner restlichen Haut abspielt.
Seit meiner Einlieferung habe ich keine Gelegenheit, in einen Spiegel zu sehen. Aber, um ehrlich zu sein, hatte ich bisher nicht das geringste Bedürfnis, nach einem solchen zu verlangen.
Mein Blick saugt sich an meinen Händen fest. Die roten Flecken, mit denen die Haut übersät ist, beginnen aufzubrechen. Glänzende Reste von irgendwelchen Cremes verstärken den Eindruck, der selbst auf mich abstoßend wirkt. Sie bekommen den Fortschritt der Krankheit nicht in den Griff.
Krankheit? Was rede ich? Es ist doch keine Krankheit. Es ist ein Siechtum, das muss ich akzeptieren, muss mit ihm leben, mich mit ihm anfreunden in den letzten Tagen, die mir noch bleiben.
In etwa zwei Wochen werde ich tot sein. Das versuchen die Ärzte mir so schonend wie möglich beizubringen, abwechselnd und scheu wie Kinder, die sich eines schlechten Gewissens bewusst sind. Das Einzige, das sie für mich tun können, ist das Verabreichen der Jod-Tabletten in regelmäßigen Abständen und das Wechseln der Verbände, dort, wo die Haut die Körperflüssigkeit nicht mehr zurückhalten kann. Die Pillen verlängern mein nicht lebenswertes Dasein unwesentlich, denn gegen radioaktive Strahlung schützt grundsätzlich kein Medikament.
In wenigen Minuten ist Visite. Ich sehe bereits jetzt schon die mitleidvollen Mienen der hereinschwebenden Weißkittel, von denen sich einige zurückhalten, obwohl sie wissen, dass meine so genannte Krankheit nicht ansteckend ist. Ich glaube, sie sind überfordert. Überfordert wie auch die meisten derjenigen, die mit der Sicherung und der Handhabung einer solchen Gefahrenstelle, die für meinen Zustand verantwortlich ist, betraut sind.
Überfordert wie die Behörden, die nicht einmal über konkrete Alarmpläne verfügen. Niemand, absolut niemand scheint je damit gerechnet zu haben, dass es in der Region jemals zu einem Super-Gau, das ist die genaue Bezeichnung für einen Vorfall in einem Atomkraftwerk, um das theoretische Szenario des vollständigen Abrisses einer Hauptkühlmittelleitung am Reaktordruckbehälter kommen könnte.
Wenn ich ehrlich bin, auch ich hatte nie einen Gedanken an einen solchen Vorfall verschwendet. Neben dem durch die Explosion ausgelösten Schock war es auch ein Teil Überraschung, der von mir Besitz ergriffen hatte, bevor hochradioaktiver Schutt auf das Kraftwerksgelände und damit auf mich und meine Kollegen geschleudert wurde.
Die Ärzte sagen, bei der Höhe meiner Verstrahlung spreche man von einer des dritten Grades, der höchsten Kontamination überhaupt. Flüssigkeitsabsonderungen und Absterben der Haut seien die Folge, sagen sie, während sie meine sich lösende Haut mit getränkten Verbänden belegen. Meine Schweißdrüsen und die Haarbälge seien irreparabel geschädigt, so wie mein gesamter Organismus, mit dem es schon bald zu Ende gehen werde. Nur mein Wille zu leben könne die Prozedur um wenige Tage verlängern.
Ich habe lange darüber nachgedacht. Darüber, ob ich mich aufgeben soll, weil ich mein Siechtum dadurch verkürze oder ob ich kämpfen soll wie Don Quichotte gegen die unbesiegbaren imaginären Gegner. Mein Gegner ist ebenfalls unbesiegbar. Aber er ist nicht imaginär. Er ist Wirklichkeit, er ist in mir drin, ich beherberge ihn, teile mein Leben mit ihm bis in den Tod.
Ich denke auch darüber nach, warum das alles passieren konnte und komme schnell zu dem Ergebnis: Weil es da ist. Nein, weil es da war. Und weil es noch viele Male passieren kann, weil sie da sind, zahlreich da sind, die Kernkraftwerke in unserem Lande und dem angrenzenden Ausland. Sie sind angeblich sicher, wahrscheinlich sind sie das auch. Ich glaube das beurteilen zu können, denn ich bin vom Fach.
Da fällt mir ein: Ich war vom Fach. Ich arbeitete bis zu dem Störfall der höchsten Kategorie in einem Kraftwerk. Nicht in Deutschland, obwohl ich hier lebe und seit einiger Zeit in meinem Heimatland dahinvegetiere. Ich bin Ingenieur, genauer gesagt, ich war Nuklearingenieur im französischen AKW Nuclatom, als Mitglied einer deutschen Firma mit einem Zeitvertrag betraut. Ich war hauptverantwortlich für das Ressort Nuklearwissenschaft im Zusammenhang mit der Erzeugung, der Kontrolle und dem Nutzen von Kernenergie sowie dem Entsorgen radioaktiver Abfälle. Abfälle gibt es nun wahrlich in großen Mengen zu entsorgen, doch ich werde dabei nicht mehr behilflich sein können.
Einen der vier Reaktoren des AKW Nuclatom gibt es nicht mehr!
Ich denke an die armen und hilflosen Menschen in der kleinen Stadt, unmittelbar neben den strahlenden Reaktoren. Ihnen wird es nicht viel anders als mir ergangen sein. Vermutlich sind die Krankenhäuser voll von ihnen. Vorübergehend. In wenigen Wochen werden nach und nach die Betten frei werden.
Doch Frankreich hat aufgerüstet. Weitere 54 Nuklearanlagen stehen im Land verteilt. Ich wage nicht zu beurteilen, ob sich der Fall Nuclatom wiederholen könnte. Ich weiß nur eines: Die Zeit die mir noch bleibt, werde ich nutzen, soweit es mir möglich ist, um aufzuklären, zu warnen. Wie, das weiß ich noch nicht. Eines aber weiß ich: Nie wieder darf sich das wiederholen, was unzählige Menschen ins Unglück gestürzt hat.
Meine Gedanken werden unterbrochen. Das weiße Geschwader schwebt in mein Krankenzimmer, die Jüngeren der insgesamt vier Weißkittel bleiben an der Tür stehen, während der Oberarzt und eine Krankenschwester sich meinem Bett nähern. Die Schwester trägt Latex-Handschuhe und einen Mundschutz. Ihre Augen flackern. Dr. Maximilian Bollinger, so steht auf dem Namensschild geschrieben, zieht sich einen Stuhl heran und setzt sich vor mich.
„Wie fühlen Sie sich?"
Er sieht mich mit großen graublauen Augen väterlich an. Sein Alter schätze ich auf fünfzig, eher etwas weniger und mit meinen achtunddreißig Jahren hat sein väterlicher Ausdruck für mich etwas Kurioses.
„Was soll ich sagen?", antworte ich und frage mich, welche Antwort er auf seine Frage erwartet.
Er fasst meine Hand und hebt sie an. Dr. Bollinger trägt keinen Mundschutz und er hat auch keine Handschuhe übergestreift. Das macht ihn mir sympathisch.
„Sie denken viel nach, habe ich Recht?"
Bollinger sieht mich erwartungsvoll an und bevor ich antworten kann, fährt er fort: „Sie sollten Ihre … Zeit nicht damit verschwenden."
„Was?"
Ich verstehe seine Bemerkung nicht.
„Welche Zeit? Sie sagten mir, in zwei Wochen oder …"
„An dieser Meinung hat sich auch nichts geändert, Herr Westermann“, antwortet Bollinger, ohne sein väterliches Lächeln zu verlieren.
Zum ersten Mal höre ich seit langem wieder einmal meinen Namen. Westermann. Jakob Westermann. Meine Freunde und Bekannten nennen mich Jerry, der amerikanischen Übersetzung von Jakob wegen.
Ich bin seit einiger Zeit wieder Junggeselle und heute danke ich Gott dafür. Nicht, dass ich froh darüber wäre. Dass Christine mich verlassen hat, was ich einerseits bedaure, war für sie eine Gottesfügung. Und meine neue Liebe? Ich versuche krampfhaft, mir ihr Gesicht vorzustellen. Offensichtlich habe ich Gedächtnislücken. Wie auch immer. Sie würde von dem Unfall erfahren und keinen Gedanken mehr an mich verschwenden. Es ist gut so, wie es ist. So kämpfe ich alleine gegen die Krankheit und mich selbst, meinen inneren Schweinehund, wie sich der Volksmund auszudrücken pflegt.
„Dennoch sollten Sie die Zeit sinnvoll nutzen", höre ich Dr. Bollinger sagen.
Ich sehe ihn an. Sein Gesichtsausdruck hat sich nicht verändert. Er scheint zu meinen, was er sagt. Ich habe nicht den Eindruck, dass er mich hochnehmen will.
„Sagen Sie mir bitte, was ich in meiner Situation Sinnvolles tun kann?", krächze ich und ein Hustenkrampf schüttelt mich. Ich zeige auf die Flasche auf dem Nachttisch. Die Schwester eilt herbei und wird durch eine Handbewegung Bollingers gestoppt. Er nimmt die Flasche, gießt ein halbes Glas voll mit der Flüssigkeit und hält es mir hin. Ich sehe ihn fragend an.
„Versuchen Sie es. Mobilisieren Sie Ihren Willen, Jerry! Ich darf Sie doch so nennen?"
Ich nicke und hebe langsam meine rechte Hand. An ihr scheint ein schweres Gewicht festgebunden zu sein. Der Arzt schaut mir in die Augen, immer noch lächelnd. Ich merke, wie ich zu schwitzen beginne. Mein Unterarm hebt sich, dann fällt er zurück auf das Bett, neben meinen dahinsiechenden Körper.
„Das ist gut. Sie haben es versucht", sagt Dr. Bollinger und führt mir das Glas an die Lippen. Ich trinke gierig. „Mehr habe ich nicht erwartet", lächelt er. „Sie haben noch Energie. Nutzen Sie sie."
„Ich verstehe Sie immer noch nicht", flüstere ich und merke, wie Müdigkeit über mir hereinbricht. Sollen Sie doch gehen und mich allein lassen.
„Sie sollten alles aufschreiben“, höre ich den Doc sagen und kämpfe dagegen an, dass mir die Augenlider zufallen. „Das, was Sie erlebt haben, was geschehen ist. Schreiben Sie es auf. Schreiben Sie es für die Menschen auf, damit sie niemals vergessen, warum sie für ihre Ziele kämpfen. Es reicht nicht, dass Schilder mit dem Slogan „Atomkraft nein danke" hochgehalten oder auf Autohecks geklebt werden. Jetzt, da es passiert ist, muss es sich in das Gewissen all derer einbrennen, die Verantwortung tragen und in die Herzen jener, die von dieser Verantwortung abhängig sind. Wenn Sie es jetzt niederschreiben, ist es wie eine Aufforderung zum Kampf, eine Aufforderung zum Widerstand. Tun Sie es! Der Zukunft zuliebe."
Bollinger lächelt nicht mehr. Sein Gesicht ist ernst, seine Miene fordernd.
„Schreiben Sie!", wiederholt er sich und noch einmal: „Schreiben Sie alles auf!"
„Wie soll das gehen?“, frage ich kraftlos und denke darüber nach, dass mir bereits Ähnliches in den Sinn gekommen war.
Bollinger erhebt sich. Als er in seiner ganzen Größe vor mir steht, nickt er, als habe er eingesehen, dass es keinen Sinn hat. Doch ich habe mich getäuscht.
„Ich werde Ihnen alles besorgen: Ein Diktiergerät, ein Headset mit Mikrofon und eine Fernbedienung. Sie werden sehen, Sie werden Freude an Ihrer zukünftigen Arbeit haben."
Während ich langsam in den Schlaf hinüber dämmere, interessiert mich nur noch eines. Ich nehme alle meine Kraft zusammen und hauche ihm entgegen: „Warum wollen Sie unbedingt, dass ich das tue?"
„Wie aus weiter Ferne höre ich die stockende Antwort, die gemeinsam mit mir ins Reich der Träume dahinschwebt:
„Meine Frau … sie ist heute Morgen an den Folgen der Kontaminierung gestorben."
2. Kapitel
Die Zeit davor/Felix
Der Himmel erstrahlte in einem Blau, wie ich es in diesem Sommer selten so erlebt habe. Die weißen, mit Grau durchzogenen Wolkenpartikel gaben dem Gesamtbild über mir etwas von einer Polarisierung, wie es Fototechnik kaum besser würde ausdrücken können.
Ich schaute hinauf in diese Pracht der Unendlichkeit. Es fiel mir nicht schwer, regungslos, über einen längeren Zeitraum, den Blick nach oben gerichtet zu halten. Ich lag auf meiner Sonnenliege, auf dem Balkon der vierten Etage in der Stadt, unter mir das Brummen und Hupen der Fahrzeuge, über mir die Ruhe des unendlichen Weltalls. Ein Kontrast, wie er unterschiedlicher nicht sein konnte. Die Wohnung in der Innenstadt konnte ich mir leisten, mein Beruf machte es möglich und außerdem hatte ich nach niemandem zu fragen.
Noch eine knappe Woche, dann würde mein Urlaub vorbei sein, so vorbei, wie meine Beziehung zu Christine, die mich vor wenigen Tagen verlassen hatte. Die Trennung kam nicht plötzlich, nicht spontan aus einem unmittelbaren Grund heraus. Sie hatte sich lange angebahnt und es war nur eine Frage der Zeit gewesen, wann Christine für sich feststellte, dass mir meine Arbeit mehr bedeutete, als ein Zusammenleben mit ihr, so, wie sie es sich sicherlich erhofft hatte.
Auch für mich war diese Beziehung in meinem Inneren schon längere Zeit beendet. Es war nur eine Frage der Zeit, wann es zu einer Trennung kommen sollte. Außerdem war da eine andere Frau. Christine wusste nichts von ihr und ich selbst war von dieser neuen Beziehung mehr als überrascht. Es hatte sich ergeben, einfach so, im Werk, im Anschluss an irgendeine dienstliche Zusammenarbeit.
Ich starrte weiter auf den blauen Himmel und begann, die Geschwindigkeit zu schätzen, mit der sich die Wolken bewegten. Der Wind, heute ging eine leichte lauwarme Brise, kam von Westen und trieb die Wolken kaum sichtbar für meine Augen vor sich her.
Der Wind kommt immer von Westen, dachte ich für mich. Auch der Regen. Das schlechte Wetter. Immer kommt es aus dem Westen. Wir Grenzbewohner sagen deshalb scherzhaft: Die Franzosen schieben das Wetter, das ihnen nicht gefällt, über die Grenze zu uns herüber. Heute war das nicht so. Über den leichten Wind, der von Westen herüberweht, konnte ich mich durchaus erfreuen.
In der Ferne, am Ende des westlichen Horizonts hatte sich eine Wolke gebildet, die anders war, als die, die über mir schwebten und einen Kontrast zu dem blauen Himmel bildeten. Die Wolken dort waren künstlicher Natur. Ich wusste das und konnte das auch begründen. Schließlich war ich in den meisten Fällen an ihrer Kreation beteiligt. Nur nicht heute. Heute hatte ich Urlaub. Aber wenn ich zur Arbeit ging, wenn ich im Kernkraftwerk Nuclatom hinter der Grenze meinem verantwortungsvollen Job nachging, dann war ich daran beteiligt.
Die Grundbezeichnung meines Jobs war Ingenieur, speziell für meinen Einsatzbereich war meine Berufsbezeichnung Nuklear Ingenieur. Ein verantwortungsvoller Job, wie ich schon sagte. Ich war verantwortlich im Bereich Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Nukleartechnik und hauptverantwortlich für das Ressort Nuklearwissenschaft im Zusammenhang mit der Erzeugung, der Kontrolle und dem Nutzen von Kernenergie sowie dem Entsorgen radioaktiver Abfälle. Und ich war Mitproduzent dieser Wolken, die man Kilometer weit sehen konnte, ohne das darunter befindliche Atomkraftwerk in Augenschein zu bekommen.
Die Bevölkerung sah stets mit gemischten Gefühlen zu dem künstlichen Wassergebilde hin, obwohl man von Seiten der Kraftwerks-Direktion und auch der Politik nicht müde wurde zu erklären, dass dieser Wasserdampf ungefährlich für Mensch und Tier sei. Ich musste stets lächeln bei diesen Bekenntnissen und manche Diskussion, die ich entfachte, machte mich, zumindest für eine Zeitlang, zu einem Außenseiter, dem man zu verstehen gab, dass es Folgen haben würde, beschmutzte man das eigene Nest.
Wenn alles seinen geregelten Gang ging, war es auch tatsächlich so, dass keine Gefahr von der Wolke, die im Hintergrund inzwischen an Volumen leicht zugenommen hatte, ausging. Kühltürme sind normalerweise Bestandteile der Anlagen, die für die Bereitstellung des so genannten Kühlwassers für die Prozesskühlung erforderlich sind. In der Regel befinden sich Kühlwasser und Kühlturm in einem eigenen geschlossenen thermodynamischen Kreisprozess.