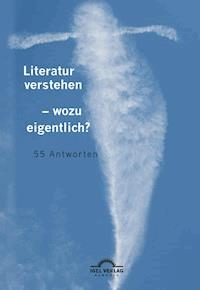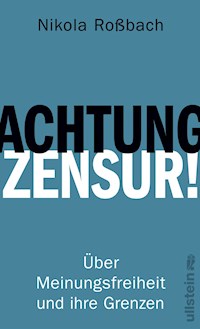
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zensur ist der Schlachtruf der Stunde: Ein Gedicht wird von einer Fassade entfernt? Zensur! Ein Bild aus einem Museum entfernt? Zensur! Ein Redner von einer Universität ausgeladen? Zensur! Doch ist es das wirklich? Viele haben heute das Gefühl, ihre Meinung nicht mehr offen sagen zu können. Sie fragen sich, ob Facebook und Google ihre Kontrollaufgaben nicht rigider wahrnehmen als mancher Staat, ob Kunst politisch korrekt sein muss, wieviel Freiheit man den Feinden der Freiheit geben kann. Eine heiße Debatte ist entbrannt, bei der vieles durcheinander geht. Klassische Zensur vermischt sich mit neuen Formen, polemisches Geschrei von rechts mit Sprechverboten von links. Die Literaturwissenschaftlerin Nikola Roßbach analysiert die kontroverse Diskussion um das Sagbare und legt die unterschwelligen Mechanismen unserer Gesellschaft offen. Zugleich fordert sie eine Zensurdebatte, die über Polemiken und effektheischende Extrempositionen hinausgeht. Eine Auseinandersetzung, die zeigt, was Meinungsfreiheit bedeutet und wie viel sie uns tatsächlich wert ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Die klassische Zensur, wie sie der Staat in Diktaturen und Autokratien auch heute noch durchsetzt, ist im modernen Rechtsstaat überwunden. Dennoch ist in Deutschland eine hochemotionale Debatte um die Meinungsfreiheit entbrannt. Die Literaturwissenschaftlerin Nikola Roßbach analysiert die kontroverse Diskussion um das Sagbare und legt ihre unterschwelligen Mechanismen offen. Sie fordert eine Zensurdebatte, die über Polemiken und effektheischende Extrempositionen hinausgeht. Der offene demokratische Diskurs ist hierzulande nicht mehr vom Staat bedroht. Die Gefahr kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Wer sind die neuen Feinde der Meinungsvielfalt? Und was müssen wir ihnen entgegenhalten?
Die Autorin
Nikola Roßbach ist Professorin für Neuere deutsche Literatur in Kassel und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Kontrolle und Normierung literarischen Wissens. Seit 2016 konzentriert sie sich in Forschung und Lehre verstärkt auf das Thema Zensur: Als wissenschaftliche Partnerin des monumentalen Kunstprojekts Parthenon of Books von Marta Minujín (documenta 14) nahm sie an zahlreichen öffentlichen Debatten teil.
Nikola Roßbach
ACHTUNG, ZENSUR!
Über Meinungsfreiheit und ihre Grenzen
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweise zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1794-6
© 2018 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Covergestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, München Autorenfoto: © privat
E-Book: L42 AG, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
INHALT
Worum es hier geht
I. Zensur classic: Die Macht und das Wort
1Zensur und Recht
2Der Eisberg der Zensur: Anfänge
3Schutzbehauptungen. Die Logik der Zensur
4Die Richtung des Zuges . Zensur, Veränderung und Macht
5Große Angst vor kleinen Mäusen oder: Die Macht der Literatur
6Jugendgefährdungstatbestände
7Zensur – Erfolgs- oder Misserfolgsgeschichte?
8Zensur ist sexy! Ungewollte Werbeeffekte
9Die deutschen Censoren – – – Dummköpfe: Subversion der Zensur
10Die Zensur ist überlebt, nutzlos, paradox …: Kritik der Zensur
11Unter dem Strich: Zensurbilanz
12Neue Wörter für die gleiche Sache: Decknamen der Zensur
II. Zensurpolemiken: Inflation und Missbrauch eines Begriffs
1Politische Zensurpolemik von rechts
2Ängstliche weiße Männer
3Wir müssen reden. Oder?
4Zensurskandal um ein Gedicht
5Tod des Autors oder Tod der Literatur
6Die Zensur, die Kunst und die Freiheit
7Zensurskandal um ein Bild
8Darf Kunst alles?
9Korrekte Kunst
10Exkurs: Wenn Zensur zu Kunst wird
11Zensurgedöns. Abnutzungserscheinungen
III.Zensur paradise lost: Sehnsucht nach Grenzen
1Gibt es gute Zensur?
2Skandal auf der Buchmesse
3Rauchmelder oder Feuerlöscher?
4Kulturelle Aneignung: Winnetou und wir
5Die Forderung nach literarischer Unfreiheit
6Geschlechtergerechte Sprache
7Mein pinkes Geheimnis
8Sicherheit geht vor: Die Sehnsucht nach safe spaces
9Minenfeld Universität? Trigger und microaggressions
10Die hohe Kunst des Eierlaufens
11No-platforming
12Freiheit den Elefanten – auch in Porzellanläden
IV.Zensur new age: Neue Fronten, neue Player
1Markt, Macht und Medien
2Zensur des Klimas – Klima der Zensur
3Ein Dekalog der digitalen Freiheit
4Herkules’ Hintern
5Frisch gefiltert. Digitalisierung, Desinformation und Demokratie
6Über staatliche Schutzpflichten und Freiheitsgefährder
7Gesetz gegen Gehetz
8Weltveränderung per Klick?
9Ungeschriebene Kapitel
Meinungsfreiheit: wie viel sie uns wert ist
Literatur und Quellen
WORUM ES HIER GEHT
Eine heftige gesellschaftliche Debatte über die Meinungsfreiheit ist entbrannt.
Und sie erhält laufend neuen Zündstoff: Auf Facebook hat der Kasseler Herkules jetzt eine Badehose an. Der US-Präsident schließt Journalisten von seinen Pressekonferenzen aus. Berliner Studierende wollen ein als sexistisch empfundenes Gedicht von der Fassade einer Hochschule entfernen lassen. Eine schwarze Künstlerin fordert in New York die Zerstörung eines von einer weißen Künstlerin gemalten Bildes, das schwarzes Leid zeigt. US-Universitäten sollen zu safe spaces werden, aus denen negative Themen verbannt werden. Twitter blockt Nutzeraccounts. China blockt Twitter.
Das alles und noch viel mehr befeuert die gegenwärtigen Debatten über die Meinungsfreiheit und ihre Grenzen. »Zensur!« ist der Schlachtruf. – Zensur? Wirklich? Woher kommt eigentlich das immer stärker verbreitete Gefühl, kontrolliert und gegängelt zu werden, seine Meinung nicht mehr offen sagen zu können, unfrei zu sein – obwohl doch Zensur in westlichen Demokratien längst tabu ist? Oder etwa nicht?
Aktuell vollzieht sich in der Tat ein spürbarer Wandel im Umgang mit Zensur und Meinungsfreiheit. Ein Wandel, der viel mit einem sich verändernden gesellschaftlichen Selbstverständnis zu tun hat.
Um diesen fundamentalen Veränderungsprozessen in unserer Gesellschaft auf die Spur zu kommen, gilt es zunächst die ›klassische‹ Zensur besser zu verstehen: jene formelle Beschränkung der Meinungsfreiheit, die die Mächtigen seit Jahrhunderten praktiziert haben und heute immer noch überall auf der Welt praktizieren. Denn auch wenn die historische Langzeitperspektive eine allgemeine, globale Demokratisierung zeigt, existiert weiterhin massive Zensur. Welche Logik steht hinter der klassischen Zensur, verstanden als formell ausgeübte Kontrolle bzw. Verbot von Äußerungen? Wie argumentieren Zensoren und welche Ziele haben sie? Haben sie Erfolg – oder scheitern sie nicht sowieso immer? Wie genau sieht klassisch-formelle Zensur heute aus, und hinter welchen Decknamen versteckt sie sich? Häufig ist das Wort ›Zensur‹ gerade dort tabu, wo das Phänomen besonders präsent ist.
Doch es gibt auch den umgekehrten Fall, dass Zensur zwar nicht in Sicht, aber in aller Munde ist. Sie wird zum inflationär verwendeten polemischen Kampfbegriff, in der Politik ebenso wie in Kunst und Kultur. Doch was passiert, wenn der Zensurbegriff überstrapaziert wird, wenn er sich abnutzt? Wenn wir überall Zensur wittern, wo eigentlich nur Kritik geübt wird? Ist die Waffe Zensur vielleicht schon stumpf geworden im Kampf für die Meinungsfreiheit?
Zensur wird allerdings in unserer Gesellschaft nicht nur geschmäht, sondern auch gewünscht. Die Offenheit für abweichende Meinungen scheint allgemein auf dem Rückzug zu sein; wenig komplexe Weltbilder werden immer beliebter. Wer genau wünscht sich heute engere Grenzen der Meinungs- und Redefreiheit und warum? Die einen wollen für Ungerechtigkeiten sensibilisieren und befürworten deshalb rigide Grenzen der Rede- und Meinungsfreiheit. Die anderen erinnert das an totalitäre politische Systeme; sie beklagen hypersensible Gesinnungsdiktatur und moralische Zensur. Wie kann man hinter diesen platt-polemischen Gegensatz gelangen? Wie lässt sich die komplexe Situation analysieren, ohne sofort Recht und Unrecht zu verteilen?
Schließlich folgt eine Sondierung der aktuellen Lage. Ist die Zensur wirklich zurück – mitten in unserer freien Gesellschaft, zwischen lautem Zensurgeschrei hier und kaum leiserer Zensursehnsucht dort? In der Tat ist das Thema auch in offenen, demokratischen Gesellschaften nicht erledigt. Die Zensur hat heute andere Gesichter, die schwerer zu erkennen sind. Ihre Player sind andere geworden, ihre Methoden subtiler, versteckter. Damit stellen sich auch andere Fragen zu freier Rede und Zensur: Welche Rolle spielen die Kontrollmechanismen des Marktes in einer globalisierten Welt? Wie wirken sich die Verflechtungen von Wirtschaft, Politik und Medien auf die Meinungsfreiheit aus? Inwiefern beeinflussen uns Algorithmen, Filterblasen und Löschaktionen sozialer Netzwerke?
Gewöhnen wir uns an eine neue Unfreiheit? Das sind provokative, aber berechtigte Fragen. Einfache Antworten sind nicht zu erwarten.
Kassel, im Juli 2018 Nikola Roßbach
KAPITEL I
Zensur classic: Die Macht und das Wort
Keine Zensur gibt es nicht. Seit Menschen denken, sprechen, schreiben, lesen, existiert auch die zensorische Restriktion dieser Praktiken. In Europa wurde Zensur mit dem Aufstieg des Feudalismus und der frühneuzeitlichen Medienrevolution durch den Buchdruck zu einem wichtigen Mittel geistlicher und weltlicher Herrschaftsabsicherung. Und sie ist es, aus globaler Perspektive betrachtet, bis heute geblieben.
Doch was ist Zensur eigentlich? Leider lässt sich darauf keine allgemeingültige, eindeutige Antwort geben. Es ist unbefriedigend, andererseits aber auch ziemlich normal, wenn sich Sprache nicht auf einen eindeutigen Begriff bringen lässt. Gerade Abstrakta sind meistens sprachliche Chamäleons. Es gibt unzählige Zensurdefinitionen: weite und enge, juristische und alltagssprachliche, politische und historische, sozial- und literaturwissenschaftliche. Am einen Ende der Skala wird Zensur ganz eng definiert, als eine vom Staat ausgehende Vorprüfung einer zur Veröffentlichung bestimmten Rede. Am anderen Ende der Skala bedeutet sie so ungefähr jede Form von Meinungsäußerungskontrolle in einer Gesellschaft, ob nun präventiv oder nachträglich, ob vom Staat oder der Kirche ausgehend oder von anderen Institutionen, Gruppen oder Einzelpersonen. Je nach Ziel und Zweck der begrifflichen Festlegung, je nach Situation und Kontext kann Zensur etwas ganz Unterschiedliches meinen.
1ZENSUR UND RECHT
Die Frage danach, was Zensur bedeuten kann, stellt sich zunächst vor der eigenen Haustür, in Deutschland. Wenn alles mit ›rechten‹ Dingen zuginge, würde man hier allerdings gar nicht fündig werden. Denn, so steht es zumindest im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 5, Absatz 1: »Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.«
Und was genau findet in Deutschland nicht statt? Die Juristen sind sich da einig. Sie haben überwiegend ein enges Verständnis von Zensur und praktizieren das auch so in der Rechtsprechung: Sie interpretieren den Grundgesetzartikel so, dass er sich ausschließlich auf ein vom Staat ausgehendes präventives Verbot von Meinungsäußerung bezieht. Und das darf zumindest nicht stattfinden. Tatsächlich darf man in offenen, freien Gesellschaften sehr viel sagen – was im Umkehrschluss bedeutet, dass man auch sehr viel aushalten muss. Meinungsfreiheit schließt die Meinung des anderen ein, wie dumm und beschränkt, wie überheblich oder engstirnig, wie verrückt oder gar wahnsinnig sie einem auch erscheinen mag.
Doch Artikel 5 des Grundgesetzes ist damit bekanntlich noch nicht zu Ende – die Meinungsfreiheit ist nicht grenzenlos. Es folgt die sogenannte Schrankentrias. Absatz 2 knüpft an den ersten an: »Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.« Der Satz beschreibt Fälle, in denen eine Kontrolle von Meinungsäußerung eben doch sein darf, wenn sonst andere Rechtsgüter beschädigt würden. Solche Rechtsgüter sind zu finden in den ›allgemeinen Gesetzen‹ – eine sehr vage Formulierung –, im Jugendschutz und im Persönlichkeitsschutz. Es gilt abzuwägen.
Ich nenne Beispiele: Ein Aufruf zu einer Straftat ist in Deutschland nicht vom Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt. Ebenso wenig eine Anleitung zum Suizid – der Schutz des Lebens ›schlägt‹ die Meinungsfreiheit. Auch darf man nichts äußern, was die Würde einer Person verletzt oder Gewalt verherrlicht, man darf keine Volksverhetzung und keine Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener betreiben und so weiter. Wenn nun in solchen Fällen eine Äußerung mit Rechtsmitteln kontrolliert oder gar verboten wird, bezeichnen Juristen diesen Vorgang nicht mehr als ›Zensur‹. Sie sprechen dann von der gerichtlichen Ahndung rechtswidriger Tatbestände.
Die Zensurforschung sieht das oft anders. Dieter Breuer zum Beispiel hat in seinem Standardwerk zur Geschichte der literarischen Zensur in Deutschland einen eher weiten Zensurbegriff: Er bezeichnet auch gerichtliche Prozesse gegen Literatur, wie sie beispielsweise in der Weimarer Republik zahlreich stattfanden, als »Zensurverfahren«.
Wolfram Siemann hingegen, ein anderer bedeutender Zensurforscher, nennt eine solche weite Begriffsverwendung wenig erkenntnisfördernd. Er bevorzugt einen strengen Zensurbegriff, gebunden an »öffentliche, staatliche autoritative Herrschaft«. Er will das Wort ›Zensur‹ reservieren für das »streng formelle Verfahren, amtlich Genehmigung erteilen und durch staatliche Herrschaft Einfluß nehmen zu wollen«. Das erscheint wiederum recht eng gefasst; ein solcher Begriff erfasst ja nicht einmal die geistliche Zensur, die doch in der Zensurgeschichte, vor allem in der Geschichte der katholischen Kirche, eine fundamentale Rolle gespielt hat. Hinzu kommt, dass ein enger Zensurbegriff sehr starr ist und neue, informelle Formen der Meinungsäußerungskontrolle nicht einfangen kann, selbst wenn sie ebenfalls sehr umfassend wirken, systematisch organisiert und institutionalisiert sind. Zum Beispiel Formen, wie sie gerade in digitalen Zeiten immer virulenter werden.
Sinnvoll erscheint mir allerdings Siemanns strikte Trennung von Zensur und Rechtsstaatlichkeit: In Deutschland habe im 19. Jahrhundert die Entwicklung von der Zensur zur Rechtsstaatlichkeit stattgefunden. Zwar gebe es durchaus auch Gemeinsamkeiten zwischen Zensur im Obrigkeitsstaat einerseits und Grundrecht im Verfassungsstaat andererseits: Beide setzten der Meinungsfreiheit Schranken. Darum seien sie aber noch lange nicht über einen Leisten zu schlagen. Begrenzung der Meinungsfreiheit durch Gesetze, die kollidierende Rechtsgüter (wie Persönlichkeit, Menschenwürde, Jugendschutz, Leben) schützen wollen, »generell und überall ›Zensur‹ zu nennen, auch unter den Bedingungen des Rechtsstaats, ist absurd«, erklärt Siemann.
In der Tat verliert der Zensurbegriff durch eine direkte Analogie von Rechtsstaatlichkeit und Zensur, wie sie in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung häufig vorkommt, deutlich an Schärfe. Die Frage ist: Soll man ein rechtsstaatliches Verfahren – das Rechtsgüter öffentlich gegeneinander abwägt, und zwar in einer Demokratie, in der die Gewaltenteilung von Legislative, Judikative und Exekutive herrscht –, soll man ein solches Verfahren wirklich begrifflich vermengen mit klassisch-formellen Verbotspraktiken, bei denen rechtsstaatliche Instrumente wie Anklage, Verteidigung usw. ja gerade nicht vorgesehen sind? Ich meine nicht. Der klare, historisch begründbare Unterschied zwischen diesen beiden Phänomenen sollte auch sprachlich sichtbar sein.
Hinzu kommt allerdings ein weiterer Aspekt: Dass Rechtsstaatlichkeit und Zensur nicht in einen Topf zu werfen sind, heißt natürlich nicht, dass Rechtsstaatlichkeit Zensur prinzipiell und immer verhindere. Wie schön das wäre! Es zu glauben, ist naiv bis gefährlich. Die Geschichte, zumal die deutsche, lehrt zur Genüge, dass man sich auf Gesetze auch in einem demokratischen System nicht ein für alle Mal verlassen kann. Sie sind nicht in Stein gemeißelt, weder unantastbar noch heilig. Menschen haben sie gemacht und können sie wieder ändern, zum Positiven und zum Negativen hin. »All animals are equal«, heißt es in George Orwells politischer Parabel Animal Farm (1945), in der die Tiere eines Bauernhofes eine Gemeinschaft von gleichberechtigten und freien Wesen bilden wollen. Doch irgendwann verändern die Schweine das Gebot und ergänzen: »but some animals are more equal than others«. Natürlich sind es die Schweine selbst, die gleicher sind als die anderen Tiere. Die Demokratie mutiert zur Diktatur.
Auf das Thema Zensur übertragen bedeutet das: Auch die Judikative eines demokratischen Staates muss unter kritischer Dauerbeobachtung bleiben. Bei neuen Gesetzesvorhaben ist zu prüfen, ob sie die Meinungsfreiheit womöglich in unzulässiger Weise einschränken. Im schlimmsten Fall könnte ein neues Gesetz als Feigenblatt für Zensur fungieren – die so von Diktatoren in spe heimlich, still und leise wieder eingeführt würde. Auch dafür hält die Geschichte, nicht nur die deutsche, düstere Beispiele parat.
Gesetzgebung, die missbraucht wird, um Zensur zu legitimieren: Besonders berüchtigt für eine gesetzlich legitimierte Wiedereinführung von Zensur sind in der deutschen Geschichte die 1920er- und 1930er-Jahre. Schon die Weimarer Republik schränkte die Rede- und Publikationsfreiheit immer mehr ein, etwa durch das Gesetz zum Schutz der Republik von 1922 und durch das Schmutz-und-Schund-Gesetz von 1926. Mit den ab 1931 in Kraft tretenden Pressenotverordnungen waren dann nicht einmal mehr die Gerichte für Bücherverbote zuständig, sondern die staatliche Polizei. Die Zensur zeigte nun unverhüllt und offen ihre hässliche Fratze.
Man muss jedoch gar nicht so weit in die deutsche Geschichte zurückgehen, um einen Konflikt zwischen Gesetzgebung und Meinungsfreiheit aufzuspüren. Ein ganz anderes Beispiel, das zumindest Analogien zur Zensur erkennen lässt, stammt mitten aus der Bundesrepublik der 1970er-Jahre. Damals verbreitete die RAF gerade mit terroristischen Gewalttaten Angst und Schrecken. Als Konsequenz daraus wurde das Strafrecht geändert. Man wollte dem Linksextremismus mit Anti-Terror-Gesetzen energisch den Kampf ansagen. Ab Mai 1976 standen daher in der BRD neu unter Strafe: die verfassungsfeindliche Befürwortung von Straftaten, die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, die Anleitung zu Straftaten und die Belohnung und Billigung von Straftaten.
Als problematisch erwies sich insbesondere der Paragraf 88a zur Befürwortung von Straftaten – problematisch für die im Grundgesetzartikel 5 Absatz 3 garantierte Kunstfreiheit. In der allgemeinen Terrorismushysterie machte man nämlich keinen Unterschied zwischen Sachtexten und Fiktionen. Wenn also eine erfundene Romanfigur eine ›Straftat befürwortete‹, war das genauso gravierend wie bei einem echten Terroristen. Was ein Autor oder eine Autorin denkt und sagt und was seine oder ihre Figur denkt und sagt, wurde gleichgesetzt. Ein ziemlich veraltetes Literaturverständnis – und zudem eines mit weitreichenden Konsequenzen. Die Frage liegt nahe: Müsste man dann nicht eigentlich fast jeden Kriminalroman verbieten? In Krimis wimmelt es doch nur so von zwielichtigen Gestalten mit hoher krimineller Energie, denen eine Befürwortung von Straftaten mühelos über die Lippen kommt. Und wenn ein Ritter, ein Cowboy, ein ganz normaler Bürger in einem Roman ruft: »Tötet ihn!« – auch dann wäre der Straftatbestand von Paragraf 88a ja schon erfüllt.
Zu Recht erntete der neue Strafrechtsparagraf heftigen Protest, vor allem vonseiten der Kultur- und Literaturschaffenden. Vertreter der politischen Linken formierten sich im sogenannten dritten ›Russell-Tribunal‹ und untersuchten von 1977 bis 1979 die Situation der Menschenrechte in der BRD. Das Tribunal kam zu dem Schluss, dass die terrorbedingten Strafrechtsänderungen durchaus eine Form von Zensur darstellten. Es sei notwendig, die Menschenrechtssituation hierzulande weiterhin kritisch zu beobachten. Der breite Protest der Intellektuellen hatte Erfolg: Im Jahr 1980 kassierte der Bundestag den Paragrafen 88a. Er verschwand aus dem Strafgesetzbuch. Rückblickend sah man also die durch ihn bedingte Einschränkung der Meinungsfreiheit als gegenüber dem Grundgesetz nicht gerechtfertigt an.
Es bleibt festzuhalten: Zu einer selbstkritischen, offenen Demokratie gehört es unbedingt dazu, stets von Neuem, wenn ein konkreter Anlass dazu besteht, über die Frage zu streiten: Noch Gesetzgebung oder schon Zensur? Nicht immer wird dabei ein Konsens erreicht.
Ein weiteres Beispiel für den Konflikt zwischen Gesetzgebung und Meinungsfreiheit, bei dem sich auch die Juristen selbst uneinig sind, ist die Leugnung des Holocaust. Sie steht in Deutschland unter Strafe. Das erscheint zunächst einmal einleuchtend, vor allem aus moralischen Gründen. Es ist höchst unmoralisch, der größten Tragödie des 20. Jahrhunderts nicht mit historischer Verantwortung, mit Achtung und tief empfundenem Mitleid zu begegnen. Doch – hier kommt das Gegenargument – ein unmoralisches Verhalten ist ja grundsätzlich nicht verboten. Wir dürfen uns in unserer Alltagswelt, im Beruf und im Privatleben, im Straßenverkehr und in der Politik ja auch wie Arschlöcher benehmen – warum nicht hier? Warum ist die Holocaust-Leugnung nicht eine zwar verwerfliche, aber doch legitime Meinungsäußerung? Sonst darf man doch auch lügen, alle lügen jeden Tag. Und wer fake news und ›alternative Wahrheiten‹ verbreitet, wird bekanntlich weder hier noch in den USA bestraft.
Die Ausnahme, die das Gesetz für den Holocaust macht, ist historisch begründet: Man darf die Ermordung der Juden nicht leugnen, weil es das Andenken Verstorbener verunglimpft und volksverhetzend ist. Der entsprechende Paragraf 189, »Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener«, im bundesdeutschen Strafgesetzbuch ist denkbar kurz: »Wer das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.« Während hier gar nicht erläutert wird, was ›Verunglimpfung‹ überhaupt bedeutet, fühlt sich der Gesetzgeber zu wesentlich breiteren Ausführungen veranlasst, wenn es um ›Volksverhetzung‹ geht. StGB-Paragraf 130 führt zunächst aus, inwiefern die Störung des öffentlichen Friedens strafbar ist, und kommt dann im dritten und vierten Absatz konkret zum Thema Nationalsozialismus: Bestraft wird, wer »eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in Paragraph 6 Absatz 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost«, ebenso, »wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt«.
Übrigens ist die Holocaust-Leugnung nicht nur in Deutschland verboten. In den Gesetzbüchern vieler Länder gilt sie als Rassismus, Störung der öffentlichen Ordnung oder Beleidigung. In den USA ist das anders, für Holocaust-Leugnende gilt dort die freedom of speech, auch wenn die Wirklichkeit des Holocaust im Jahr 1981 in einem Gerichtsurteil des Superior Court von Kalifornien bestätigt wurde. Immerhin kann man einen HolocaustLeugner vor dem amerikanischen Zivilgericht auf Schadensersatz verklagen.
Jetzt sind wir schon mittendrin in den kontroversen Debatten über Zensur und Recht – wo ich doch als Nichtjuristin eigentlich gerade nicht ins juristische Detail gehen wollte. Was Zensur allgemein eigentlich sei, das war die Frage. Die Antwort darauf ist sofort ins Weite und Uferlose geraten, und das, obwohl die Frage nur an einem kleinen Zipfel, nämlich dem juristischen, angefasst wurde.
Ich selbst arbeite hier mit einem Zensurbegriff, der über die verfassungsrechtliche Definition staatlichen Präventivhandelns hinausgeht und trotzdem klar von einer vagen Gesellschaftsdiagnose allumfassender Kontrolle abzugrenzen ist. Zensur ist nach meinem Verständnis eine umfassende, strukturell und institutionell verankerte Kontrolle, Beschränkung oder Verhinderung von zur Veröffentlichung bestimmter oder veröffentlichter Meinungsäußerung. Das hört sich jetzt fast genauso sperrig an wie eine juristische Definition, wird aber im Laufe dieses Buches klarer werden.
Festzuhalten bleibt an dieser Stelle: Zensur ist in Deutschland, wie in vielen anderen modernen westlichen Staaten, verfassungswidrig. Die Freiheit der Meinung ist ein hohes, rechtlich geschütztes Grundrecht. Doch auch diese Freiheit hat Grenzen, wenn etwa das Leben, die Würde oder das Persönlichkeitsrecht eines Menschen oder die Sicherheit eines Staates bedroht sind. Das leuchtet erst einmal ein – doch Achtung: Grenzen können sich unmerklich verschieben und schließlich die Meinungsfreiheit bedrohen. Diese muss eine Gesellschaft beschützen und immer wieder ein- und ausüben. Dazu gehört, dass man diskutiert: über Freiheit oder Unfreiheit des Wortes, über echte oder vermeintliche Zensur. Dabei darf man verschiedenste Ansichten vertreten, treffend oder falsch argumentieren. Man darf sogar lügen, mit allen Konsequenzen. Genau das ist Freiheit.
2DER EISBERG DER ZENSUR: ANFÄNGE
Die Sache mit der Zensur kann also nicht als erledigt betrachtet werden. Auch eine demokratische Verfassung verhindert nicht, dass das Thema Zensur eine offene Wunde bleibt. Ein Unruheherd, ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen. Das liegt vor allem an Freiheitsbeschränkungen, die der klassische, formell-staatliche Zensurbegriff nicht erfasst. Eine verfassungsrechtliche Garantie der Meinungsfreiheit verhindert längst nicht alles, was wir allgemein und alltagssprachlich unter ›Zensur‹ verstehen. Die meisten Formen von Meinungsunfreiheit bekommt die Rechtssprechung nicht in den Blick. Im Alltag und auch in der Wissenschaft wird Zensur sehr viel weiter definiert als im Gesetzbuch.
Sie meint zum Beispiel auch die Kontrolle und Unterdrückung eigener Meinungsäußerung: die Selbstzensur. Dabei handelt es sich nicht um eine formelle Zensur im klassischen Sinn – wohl aber um eine strukturell wirksame und daher nicht weniger mächtige Form der Zensur. Zur Selbstzensur gehören nicht nur ungeschriebene Bücher und Manuskripte in Schubladen, unterdrückte Blogbeiträge oder ungehaltene Reden. Dazu können auch zahme Verlagspolitiken und Medienstrategien gehören. Was nicht zur Selbstzensur gehört, sind alle möglichen Formen der sozialen Selbstkontrolle, auch wenn sie manchmal dazu gezählt werden. Wenn man dem Phänomen da auf die Spur kommen will, wo es wirklich weh tut, macht es wenig Sinn, bei der Einhaltung von Tischmanieren oder des Dresscodes Selbstzensur zu beklagen. Genauso wenig ist eine freiwillige, bewusste Entscheidung für ein sensibles gesellschaftliches Handeln, etwa die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache, sinnvoll als Selbstzensur zu bezeichnen. Umso klarer muss Selbstzensur benannt werden, wenn Menschen ihre Meinung aufgrund empfundenen oder ausgeübten Drucks von außen nicht frei äußern – um sich oder andere nicht zu gefährden, um wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen Misserfolg zu vermeiden, um keinen Shitstorm zu ernten.
Die staatlich-formelle Zensur, die demokratische Verfassungen verbieten, stellt also immer nur die Spitze eines Eisberges dar. Im Verborgenen herrschen informelle, subtile Formen der Kontrolle und Beschränkung freier Rede, die man als Zensur oder zumindest als zensurähnlich beschreiben kann. In diesem Kapitel geht es allerdings gerade nicht um das, was sich unter Wasser abspielt. Es geht um die weithin sichtbare Spitze des Eisbergs, hart und schneidend kalt: Zensur classic. Auf die Geschichte jener klassischen Zensur werden nun wenige Schlaglichter geworfen, vom 15. Jahrhundert bis heute. Natürlich im extremen Zeitraffer. Es geht um Praktiken, Motive und Argumente der Zensur, ihre Logik und die damit verbundene Frage nach der Macht von Literatur.
Am Anfang steht eine sehr kurze Erzählung: »Gottes Zorn gegen die Menschen war groß, denn sie hielten sich nicht an die Gesetze. Sie fluchten und lästerten, betrogen, soffen und schwelgten im Luxus. Da ließ der Schöpfer Teuerung, Krieg, Pest und andere mannigfaltige Plagen über sie kommen.« Die – sinngemäß wiedergegebene – Erzählung stammt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Sie stammt nicht etwa von einem engagierten Pfarrer, einem Moralprediger, der seine Schäfchen mithilfe des Alten Testaments auf den Pfad der Tugend zurückführen will. Nein, es ist der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation höchstpersönlich, der die Geschichte erzählt. Sie findet sich in der sogenannten Reichspolizeiordnung vom 30. Juni 1548. Mit Schäfchen und Tugendpfaden hat die Sache allerdings durchaus etwas zu tun.
Was war passiert? Karl V. war der Kragen geplatzt. Offenbar hörte keiner so richtig auf ihn: »Gottes gebot, auch unser vorfaren, unnd unsere Satzungen, Ordnungen und ermanungen« hätten bislang wenig oder nichts gefruchtet; sie seien vielmehr vergessen und missachtet worden. Außerdem tadelt er, dass die Obrigkeiten beim Strafen zu nachlässig seien: Nicht einmal die Regierungen der einzelnen Territorien nahmen seine Vorschriften ernst. Das alles nahm nicht nur Karl, sondern auch Gott übel. Um dessen Strafen zu entkommen, hatte sich nun der Kaiser – so erzählt er es – auf dem Reichstag von Augsburg mit Fürsten und Ständen beraten, wie »grausame Gottes lesterunge, schwür, und flüche, und andere unzimliche verbottene laster« vermieden werden könnten. Seine Lösung: weitere Vorschriften und Strafandrohungen. So begründete er die vorliegende Reichspolizeiordnung, die verschiedenste Themen behandelt: Gotteslästerung, Stände- und Kleiderordnungen, Handel und Handwerk, Betrug mit gefärbtem Ingwer, ›leichtfertige beywonung‹ und vieles mehr. Darunter eben auch Zensurregelungen, die augenscheinlich bislang kaum jemand im Alten Reich befolgte. Denn obwohl doch eigentlich keine Schmähschriften gedruckt und verkauft werden dürften, halte sich keiner daran. Im Gegenteil, es kamen immer mehr in Umlauf. Daher die schlechte Laune des Kaisers.
Zum wichtigen politischen Thema war die Zensur bereits im 15. Jahrhundert geworden, seit der großen Medienrevolution aus Mainz. Durch den Einsatz der neuen Drucktechnik mit beweglichen Lettern verbreitete sich Wissen plötzlich viel weiter und schneller. Das beunruhigte geistliche und weltliche Herrscher gleichermaßen. Zu viel Wissen kann gefährlich sein – das empfinden auch die Mächtigen von heute so. Damals war es die Kirche, die zuerst auf die neue Gefahr reagierte: Der Mainzer Erzbischof Berthold von Henneberg, zugleich Kurfürst und Erzkanzler, machte 1485/86 den Anfang mit zensurrechtlichen Bestimmungen. Nicht zufällig geschah das am Wirkungsort des Druckers Johannes Gutenberg. Zehn Jahre später zog der Kaiser in Wien nach: Maximilian I. setzte 1496 mit dem »Generalsuperintendenten des Büchereiwesens in Teutschland« einen ersten Zensor ein. Ihm folgten nach und nach die Territorialfürsten.
Das 16. Jahrhundert arbeitete weiter daran, Zensur effektiver zu machen. Der bedeutendste Auslöser war dabei natürlich der Fall Luther. Zur Erinnerung eine kleine Chronologie: Am 31. Oktober 1517 schrieb der Reformator seine 95 Thesen nieder, am 10. Dezember 1520 verbrannte er die päpstliche Bannandrohungsbulle, am 17./18. April 1521 widerrief er bei seiner Anhörung im Rahmen des Wormser Reichstags seine Schriften nicht, was zur Reichsacht durch Karl V. am 26. Mai 1521 führte. Nicht, dass das irgendetwas gebracht hätte. Die Verbreitung von Luthers Ideen und damit die Reformation wurden so keineswegs verhindert. Zeitgenossen berichteten beispielsweise aus Straßburg, wie Luthers Bücher auf dem Markt feilgeboten wurden, während daneben die kaiserlichen und päpstlichen Erlasse des Verbots angeschlagen waren; so gibt es der Literaturwissenschaftler Bodo Plachta in seinem Zensur-Band wieder.
Der Kampf um den rechten Glauben gab dem Thema Zensur dennoch eine ganz besondere Schubkraft: 1529 führte der Reichstag die Vorzensur ein, mit der jede Schrift noch vor dem Druck einem Zensor vorgelegt werden musste. Ein Jahr später folgte schon die Impressumspflicht: Ab jetzt mussten Verfasser, Drucker und Druckort namentlich auf dem Titelblatt stehen. Das funktionierte aber (noch) nicht wirklich. Erstens fehlten administrative Strukturen zur Durchsetzung der Zensurmaßnahmen – und manchmal wohl auch der Wille der Verantwortlichen vor Ort, wie der Kaiser misstrauisch vermutete. Zweitens macht Zensur eben auch kreativ: Man erfand falsche Namen, fingierte Verlagsorte und Verleger. Der berühmteste Fall ist der 1663 ›gegründete‹ Verlag Pierre Marteau bzw. Peter Hammer in Köln, der nie existiert hat und dennoch im 18. Jahrhundert immer populärer wurde. Er hielt sich bis 1848 als gerne verwendetes Fake-Impressum und führte damit die Zensur an der Nase herum.
Und doch, bei aller Holprigkeit des Starts, was die frühneuzeitlichen Zensurpraktiken betrifft: Es steht außer Zweifel, dass geistliche und weltliche Herrscher sich seit der Erfindung des Drucks immer mächtiger gegen die freie Meinungsäußerung ins Zeug legten. Betroffen waren Schriftwerke, später auch andere Künste: Unter anderem Gemälde, Abgüsse und Schnitzereien listet die erwähnte Reichspolizeiordnung von 1548 auf. Seit 1570 durfte es nur noch in Reichs-, Residenz- und Universitätsstädten Druckereien geben, seit 1577 existierte eine Nachzensur, bei der bereits gedruckte Schriften bei Buchhändlern und Käufern noch einmal geprüft und gegebenenfalls aus dem Verkehr gezogen wurden. Seit 1597 schließlich überwachten Bücherkommissionen die Messen in Frankfurt und Leipzig.
3SCHUTZBEHAUPTUNGEN. DIE LOGIK DER ZENSUR
So fing also alles an mit der Zensur in Europa. Und warum das Ganze, wozu der riesige Aufwand? Orhan Pamuk sagt, Zensur habe keine Logik. Damit meint er, dass zensorisches Handeln der Mächtigen nicht nachvollziehbar sei – und er hat recht: Nachvollziehbarkeit und Berechenbarkeit sind in der Tat keine Merkmale zensorischer Praktiken. Gerade durch Inkonsequenz und Willkür von Zensur versuchen Herrschende, eine Atmosphäre der Angst entstehen zu lassen.
Eine bestimmte Art von ›Logik‹ hat Zensur trotzdem, und zwar im Sinne ihrer Ziele, ihrer Denk-, Handlungs- und Argumentationsweise. Ziel Nummer eins derjenigen, die Zensur ausüben, ist ohne Zweifel, die eigene Position abzusichern, den Status quo zu erhalten. Das war immer so und ist es noch heute – auch wenn die offizielle Legitimation von Zensur natürlich anders klingt. Zum Beispiel so: Mit Zensurvorschriften erstrebe ich, Karl V., die »pflantzung/ unnd erhaltung Cristenlicher Lieb und eynigkeyt/ und verhüttung/ unruhe und weitherung/ so daraus volgen möchte«.
Einigkeit, Ruhe, Ordnung, Frieden, Sicherheit: Nicht nur im Jahr 1548, nicht nur in der Ära des Frühabsolutismus waren das gängige Schutzbehauptungen der Zensur. Im Jahr 1819 erschien in Paris ein interessantes Bändchen, in dem der ehemalige Generalstaatssekretär Baron Locré de Roissy Diskussionen im Staatsrat um und mit Napoleon aus den Jahren 1808 bis 1811 wiedergibt: Discussions Sur La Liberté De La Presse, La Censure, La Propriété Littéraire, L’Imprimerie Et La Librairie, also ›Gespräche über Pressefreiheit, Zensur, literarisches Eigentum, Druckerei und Buchhandel‹. Als Vorlage dienen dem französischen Sekretär seine eigenen Aufzeichnungen, die er als unparteiischer Historiker präsentieren möchte. Es sind bemerkenswert differenzierte Gespräche, die da offenbar stattgefunden haben. Nichtsdestoweniger legt Napoleon selbst, der hier als Gesprächsteilnehmer N*** geführt wird, ebenso apodiktisch wie pragmatisch fest, was Zensur ist und wozu sie dient: »Nun, was ist die Zensur? Es ist das Recht, die Äußerung von Gedanken zu verhindern, die den Frieden des Staates, seine Interessen und seine Ordnung stören. Die Zensur muss daher immer entsprechend dem Zeitalter, in dem man lebt, und gemäß den Umständen, in denen man sich befindet, angewandt werden.« Soweit Napoleon.
Zensur argumentiert vor allem restaurativ. Sie will zunächst einmal bewahren, zumindest wiederherstellen. Sie denkt Zukunft als Verlängerung der Gegenwart oder sogar der Vergangenheit. Die immer gleiche Leier der Zensur klingt ungefähr so: Ich meine es doch nur gut mit euch! Ich sorge dafür, dass alles so bleibt, wie es ist (oder wieder werden kann, wie es war, denn früher war alles besser). Ich beschütze euch und eure Kinder vor dem Bösen, vor euch selbst, vor Streit und Zwietracht, vor Revolution und Krieg. Wenn unsere Gesellschaftsordnung innen stark und einig ist, ist sie auch nach außen unbesiegbar. Daher ist es wichtig, Kritiker unter uns zum Schweigen zu bringen und zusammenzuhalten! Vertraut mir. Ich beschütze euch und mache unser Land (wieder) groß. – Hier redet natürlich schon lange kein Habsburger Kaiser mehr und auch kein französischer Diktator. Es könnte genauso gut ein autokratischer Regent des 21. Jahrhunderts sein.
»Ich meine es doch nur gut«: Zensur behauptet stets, das Gute zu wollen, Ruhe, Ordnung und Frieden zu erhalten, Bestehendes zu schützen. In den frühneuzeitlichen Anfängen der Zensur waren innere und äußere Stabilität sowie Sicherheit des Staates, Kircheneinheit und später Konfessionsfrieden derartige Standardargumente. Bis heute sind ›Schutzbehauptungen‹ hoch im Kurs, gerade bei staatlicher Zensur. Sie dient nach der Logik ihrer Verfechter stets dem Schutz von Individuen und Gesellschaft. Regierende wollen immer ihr Land schützen. Und natürlich den Weltfrieden erhalten.
Benjamin Franklin, der amerikanische Politiker und Naturwissenschaftler, erklärte 1755: Diejenigen, die die wahre Freiheit aufgeben würden für eine kleine, vorübergehende Sicherheit, verdienten weder Freiheit noch Sicherheit. Die Geschichte der Zensur zeigt allerdings, dass die Menschen sich gerne beeindrucken lassen von Pro-Zensur-Argumenten, die Sicherheit und Ordnung stark machen. Und eben nicht nur in feudalabsolutistischen Gesellschaftssystemen oder totalitären Regimen. Auch in Demokratien wollten Menschen ruhig und in Frieden leben. Und lassen sich, früher wie heute, nur zu gern verführen von der Zensurlogik der Herrschenden: Wir geben euch Sicherheit, ihr gebt uns dafür von eurer Freiheit. Erst mal nur ein bisschen, und dann schauen wir mal. Wir kontrollieren euch – zu eurem Besten.
4DIE RICHTUNG DES ZUGES. ZENSUR, VERÄNDERUNG UND MACHT
Allerdings war und ist nicht immer die Bewahrung des Status quo das Ziel der Zensur. Nicht immer sollte und soll sie das ›Weiter so‹ absichern. Manchmal kommt es in der Geschichte auch vor, dass Zensur Veränderung bewirken, Wandlungs- und Reformprozesse unterstützen soll. Werner Fuld illustriert den Zusammenhang von Zensur, Veränderung und Macht am Beispiel chinesischer Regenten vor rund 2.200 Jahren: Kaiser Qin Shihuangdi »wollte nur seine Herrschaft sichern und ließ 213 v. Chr. – als einer der ersten Bücherverbrenner – alle Schriften, in denen ›das Alte verherrlicht und das Neue herabgesetzt‹ wurde, kurzerhand vernichten. Nach seinem Tod kehrte sich die Geschichte um: Sein Palast wurde geplündert und alle ›neuen‹ Schriften ins Feuer geworfen. Das ist das Gesetz der Machtwechsel«.
Ein zeitlich und räumlich näher liegendes Beispiel stellt das Kurfürstentum Bayern zu Beginn des 19. Jahrhunderts dar. Hier hatten während des 18. Jahrhunderts noch altkirchliche Weltanschauungen dominiert. Die Zensur richtete sich vor allem gegen religionskritische Schriften der Aufklärung. 1799 kam ein neuer Kurfürst an die Macht, Maximilian IV. Joseph, und mit ihm sein Minister, der Graf von Montgelas. Unter der neuen politischen Konstellation hisste Bayern das Banner der Aufklärung. Säkularisierung hieß die Parole, unter napoleonischem Einfluss, und ihre Konsequenzen waren vernichtend. 1803 kam es zu einer verheerenden Kulturrevolution: Die religiöse bayerische Kultur, Kirchen und ganze Klosterbibliotheken wurden zerstört. Intoleranz ersetzte Intoleranz, nur noch systematischer, konsequenter, professioneller. Aufklärung wurde per Dekret durchgesetzt. Das wichtigste Herrschaftsinstrument, um kulturelle, geistige und gesellschaftliche Veränderung zu erzwingen, war die Zensur.
Modell stand hier die Französische Revolution: Um Fortschritt, Gerechtigkeit, Vernunft, Freiheit zum Sieg zu verhelfen, waren in Frankreich Kulturgüter in unvorstellbarem Ausmaß vernichtet, königliche Archive und aristokratische Bibliotheken verbrannt, Klöster aufgehoben worden. Einen Unterschied aber gab es: Bei der französischen Säkularisierung hatte es keine sachkundige Kommission gegeben, die die Bücher sortiert hatte, sondern die Bestände waren als Zeugnisse des Aberglaubens unbesehen vernichtet worden.
Und nicht nur in Frankreich, nicht nur in Süddeutschland sah man bis ins 19. Jahrhundert hinein die staatliche Kontrolle und Lenkung von mündlichen und vor allem schriftlichen Meinungsäußerungen als unabdingbar an. Ganz allgemein erschien völlige Freiheit der öffentlichen Kommunikation undenkbar. Zwar übte man gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf deutschsprachigem Gebiet verstärkt Kritik an den herrschenden Zensurpraktiken: In Zeitungen, Zeitschriften und Traktaten fand eine engagierte öffentliche Debatte über Meinungs- und Pressefreiheit statt. Doch auch die meisten kritischen Intellektuellen bezweifelten damals noch nicht die grundsätzliche Notwendigkeit und den Sinn von Zensur. Sogar aufgeklärte Geistesgrößen wie Gottfried Wilhelm Leibniz und Christian Wolff setzten sich »vehement für eine an ethischen Maßstäben orientierte Censur« ein, konstatiert der Zensurforscher Wolfgang Wüst: »Censur konnte dann zum Gradmesser des Fortschritts werden.« Und sein Kollege Klaus Bohnen resümiert lakonisch: »Die institutionelle Zensur stand im Verbund mit einem nicht unerheblichen Teil der Gelehrtenwelt, die damit selbst das Recht auf Freiheit zu schreiben untergrub.«
Gefragt war also die richtige Zensur – die die falschen Bücher verbot. Und was genau waren die falschen Bücher? Den geistlich dominierten Zensurämtern des Alten Reiches war im 18. Jahrhundert vor allem die Literatur der Aufklärer ein Dorn im Auge gewesen. Romane oder philosophische Schriften, die Religion oder Kirche kritisierten, blieben in den Netzen der Zensur hängen. Dann aber fuhr der Zug plötzlich in die andere Richtung. Dort, wo aufgeklärte Ideen bei den Mächtigen allmählich Anklang fanden, bekämpfte die Zensur ab sofort altkirchliche Weltanschauungen als ›falsch‹. Und oft verfuhren solche ›aufgeklärten‹ Kulturrevolutionen weitaus radikaler als die Zensurpraxis der alten Mächte.
Was lässt sich daraus schließen? Sind feudalabsolutistische Systeme in Zensurangelegenheiten nachsichtiger als aufgeklärt-absolutistische oder republikanische? Kann es sein, dass ein System, das Gedankenfreiheit fordert, weniger Freiheit für die Gedanken bietet? Gerade in der Aufklärung – so möchte man meinen – hätte sich doch eigentlich das Fenster zur Freiheit weit geöffnet, hätte man die Zensur ganz abschaffen können. Die Zeichen standen auf Freiheit, Gleichheit, Toleranz. Die Meinungsfreiheit war doch eines der Hauptziele der Aufklärung!
Nun ja, schon, höre ich die Aufklärer in ihre Bärte murmeln, man muss es ja nicht gleich übertreiben … Kommunikationsoffenheit, Liberalität, Pluralismus der Meinungen: All dies war auch im Jahrhundert der Aufklärung noch längst nicht Realität – und eben auch nicht erwünscht. Nicht für die meisten aufgeklärten Denker (eine große und frühe Ausnahme stellt hier Lessing dar) und erst recht nicht für die aufgeklärten Herrscher. Diese fürchteten in der totalen Pressefreiheit eine »Preßfrechheit«, so etwa der preußische König Friedrich Wilhelm II. im Jahr 1788. Zensur galt im 18. Jahrhundert immer noch als ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung einer anderen, neuen, ›richtigen‹, sprich: der je eigenen Politik.
So mutig, ganz auf Zensur zu verzichten, war damals noch nicht einmal die revolutionäre Mainzer Republik, der damals wohl fortschrittlichste der deutschen Territorialstaaten. Um sie abzusichern, diese von 1792 bis 1794 existierende Republik, erschien ihren Führern eine staatlich-formelle Zensur unabdingbar. Wieder einmal waren Staatswohl und öffentliche Sicherheit die Argumente pro Zensur – und bei den aufgeklärten Revolutionären klangen sie auch nicht viel anders als bei den absolutistischen Monarchen, die sie gestürzt hatten und deren Herrschaftsstil sie eigentlich hinter sich lassen wollten.
Auch in späteren Zeiten gab es immer wieder Versuche, politische Veränderung (und eben nicht nur Statik) durch das Mittel der Zensur zu erreichen. So wollten nach dem Zweiten Weltkrieg die amerikanischen Besatzer den Deutschen mit einer strengen Zensur das braune Gedankengut austreiben und sie zu guten Demokraten umerziehen: Re-education hieß das Gebot der Stunde. Die Nazis hatten während des sogenannten Dritten Reiches alle kritischen Autoren notorisch unterdrückt und systematisch verboten. Nach 1945 gab man die strenge Verbotspolitik also nicht etwa im Sinne der Meinungsfreiheit auf, sondern ersetzte die alte durch eine neue institutionalisierte Vorzensur. Man führte sogar wieder schwarze Listen, auf denen nun andere Titel standen – Bücher mit braunem Gedankengut. Sie wurden per Verordnung aussortiert aus Bibliotheken und Buchhandlungen, ihre Publikation und Verbreitung wurden verboten. Doch auch gut gemeinte Zensur ist Zensur. Ist es nicht paradox, jemanden mit undemokratischen Mitteln demokratisch machen zu wollen? Müsste man stattdessen nicht freien Bürgerinnen und Bürgern das Selberdenken zutrauen? In der Tat empfand man in den Westzonen schon bald diesen Widerspruch, Freiheit durch Unfreiheit anzustreben, sehr deutlich. Das Projekt der Re-education war hier nicht von langer Dauer.
Im Osten sah es anders aus. Auch im kommunistischen Teil Nachkriegsdeutschlands, der Sowjetischen Besatzungszone und nachfolgend der Deutschen Demokratischen Republik, wollte man rechte Ideen nach dem Zweiten Weltkrieg ausrotten. Aber es ging um weit mehr: die Umgestaltung der Gesellschaft nach sowjetischem Vorbild im Sinne des Sozialismus. Während sich ab Mitte 1947 der ideologische Umschulungszwang in den westlichen Besatzungszonen lockerte, verschärfte er sich im Ostteil Deutschlands umso massiver. Zensurkriterium für Kunst und Literatur war der sozialistische Realismus sowjetischer Prägung – und mit der »Gleichschaltung aller politischen Kräfte« etablierte sich eine neue Diktatur. Auch die Staatsgründung der DDR am 7. Oktober 1949 änderte nichts an der Situation, nur der Zensor veränderte sich.
Das alles ist hinlänglich bekannt, wurde schon soziologisch, psychologisch, historisch erklärt, analysiert, gedeutet und muss hier nicht noch einmal erzählt werden. Innehalten und Kopfschütteln seien dennoch erlaubt – nur ganz kurz: Es ist nicht leicht zu begreifen, wie nach einem rechten totalitären Staat so schnell auf gleichem Boden ein linker totalitärer Staat entstehen konnte, lediglich mit umgekehrten politischen Vorzeichen. Eine Entwicklung, die nicht nur von machtbesessenen Regimeangehörigen erzwungen, sondern von der Intelligenz des Landes unterstützt wurde.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.