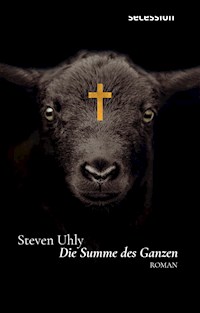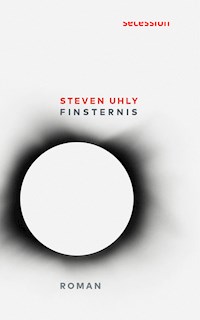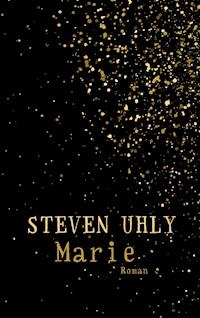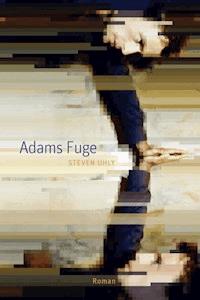
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Secession Verlag für Literatur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit seinem ironisch komponierten Spiel der Identitäten zieht Steven Uhly den Leser in den Bann eines Erzählers, dessen tragikomische Schicksalswendungen "Adams Fuge" zu einem Bildungsroman werden lassen, der die grossen Themen von Identität und Integration, Schuld, Urteil und Vorurteil neu verhandelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Steven Uhly
ADAMS FUGE
»Im Tod ist man niemand mehr«Ananda
Ich hatte einmal einen echten Namen, einen, den mein Vater mir gab und nicht ein dicker Vorgesetzter, der mich zuerst belog und anschließend verriet. Ich hieß Adem Öztürk, war ein Mensch mit einer wahren Lebensgeschichte und bewohnte ganz legal ein Kinderzimmer in der Wohnung meines Vaters im Herzen von Sincan, einem Vorort von Ankara, dessen Hässlichkeit mir stets als Beweis für die Schwere meines Schicksals diente. Nun jedoch, im Lichte all dessen, was mir widerfahren ist, sage ich: »Sincan«, und das Wort schmeckt bittersüß nach verlorenem Paradies.
Wo soll ich anfangen? Am besten da, wo alles begann, und zwar in Deutschland. Als meine Mutter es leid war, sich von unserem Vater verprügeln zu lassen, weil sie keine Türkin war und sich deshalb auch nicht so verhielt, nutzte sie einen ihrer gelegentlichen Krankenhausaufenthalte zur Flucht aus unserem Leben. Ich erinnere mich noch genau an jenen Tag. Nachdem unser Vater eine Woche lang wütend gewesen war und behauptete, unsere Mutter würde nur simulieren, besann er sich eines Besseren und fasste den Entschluss, sich mit ihr zu versöhnen. Er zog seinen einzigen Anzug an, und auch wir Kinder, Çem, Faruk, Nevin und ich, sahen aus, als wären wir auf dem Weg in die Moschee. Auf Anraten Nevins kaufte er unterwegs einen Blumenstrauß, den er nun etwas unbeholfen in seinen breiten Automechanikerhänden hielt.
Noch bevor wir ihr Zimmer betreten konnten, fing uns die Stationsschwester ab und eröffnete ihm, seine Frau habe das Krankenhaus in der Nacht zuvor auf eigene Verantwortung verlassen. Sie sagte: »Trotz des schweren Sturzes«, und warf ihm einen seltsamen Blick zu. Unser Vater verharrte einen Augenblick reglos und starrte sie an, als hätte er nicht richtig verstanden. Auch wir erstarrten, denn wir kannten diese Momente. Wie in Zeitlupe hob er den Arm, während er die Stationsschwester ansah, als wäre sie schuld an allem, und schleuderte den Blumenstrauß zu Boden. Brüllend forderte er sie auf, ihm mitzuteilen, wo unsere Mutter sich befand. Dass sie es nicht wusste, schien ihm kaum glaubhaft. Fast hätte er sie verprügelt, so wütend und verzweifelt war er.
Damals war ich acht Jahre alt. Wir lebten in Mannheim.
Ich war traurig und vermisste meine Mutter sehr. Meine Schwester Nevin war zehn, und obwohl sie selbst vielleicht am meisten litt, kümmerte sie sich um mich wie eine kleine Mama. Dafür werde ich ihr immer dankbar sein. Çem und Faruk, unsere großen Brüder, versuchten, sich nichts anmerken zu lassen, denn unser Vater verlangte von ihnen den Schulterschluss unter Männern. Er wurde nicht müde, uns zu sagen, unsere Mutter hätte uns alle im Stich gelassen und müsse bestraft werden. Wir hatten keine Vorstellung von dieser Strafe und unser Vater machte keine Ausführungen. Doch wir befürchteten das Schlimmste.
Damit die Gerechtigkeit sie möglichst schnell ereilte, unternahm unser Vater in den folgenden Monaten regelmäßige Streifzüge durch die Stadt, in der Hoffnung, seine flüchtige Frau aufzuspüren. Einige türkische Arbeitskollegen unterstützten ihn tatkräftig dabei. Nach Feierabend trafen sie sich bei uns zu Hause und besprachen ihren Einsatzplan. Manchmal hörten wir ihnen zu, wenn sie miteinander im Wohnzimmer sprachen, bevor sie sich aufmachten. Ihre Reden vermittelten uns den Eindruck, dass Deutschland ein Dschungel voller ansteckender Krankheiten war, gegen die sie mit dem Mut der Unerschrockenen zu Felde zogen. Ab und zu mussten Çem und Faruk sie begleiten. Dann zogen sie los wie Verurteilte. Wir hofften stets, dass sie unverrichteter Dinge zurückkämen.
Einen Monat nach ihrem Verschwinden sahen wir unsere Mutter wieder. Nevin und ich machten uns gerade auf den Weg von der Schule nach Hause, als sie plötzlich vor uns stand. Sie hatte mehrere Pflaster im Gesicht und man sah immer noch einige grüne und blaue Schatten um ihre Augen. Sie strahlte uns an und umarmte uns stürmisch. Wir weinten vor Freude und glaubten, alles würde nun gut werden. Sie sagte: »Bald werden wir wieder zusammen sein.« Von da an trafen wir sie regelmäßig, und auch Çem und Faruk, die immer noch mit unserem Vater auf die Jagd nach ihr gingen, besuchte sie an der Realschule. Von unserem Vater sprach sie kein einziges Wort und wir fragten nicht nach, denn wir wussten ja Bescheid.
Ein Jahr lang ging alles gut. Doch als meine Mutter mir zum Geburtstag ein Handy schenkte, damit wir telefonieren könnten, war ich so begeistert, dass ich es meinem Vater zeigte. Ich erzählte ihm, ich hätte es gefunden. Er nahm mir das Handy ab, wählte die einzige Nummer, die dort gespeichert war, und erkannte die Stimme seiner Frau. Die Worte, mit denen er sie beschimpfte, werde ich nicht wiedergeben, doch sie haben sich mir tief eingeprägt. Natürlich legte meine Mutter schnell wieder auf und das machte ihn umso wütender. Er gab mir so viele schallende Ohrfeigen in mein erschrockenes Gesicht, dass ich ihm alles über meine geheimen Treffen mit unserer Mutter erzählte. Von da an wurde es schwieriger für sie, uns zu sehen, denn unser Vater nutzte jede freie Minute, um unser Leben zu überwachen. Wir sahen sie nun unregelmäßiger und an Orten, wo nicht einmal wir mit ihr rechnen konnten.
Irgendwann verschwand unsere Mutter ganz aus unserem Leben. Ich kenne nicht einmal den genauen Zeitpunkt, an dem ihr Verschwinden begann. Wann und wo geschah es zum ersten Mal, dass sie da sein wollte und nicht da war? Und warum? Heute habe ich eine vage Vorstellung von den Ereignissen jener Zeit. Damals aber vergingen Wochen, ehe wir uns vergewisserten, dass keines von uns Kindern sie gesehen hatte.
Fortan lebten wir von der ständigen Hoffnung, sie plötzlich wiederzusehen, ja, unsere kleine Mannheimer Alltagswelt wurde zu einem Rätsel voller Zeichen, die alle auf die Anwesenheit unserer Mutter hinweisen konnten und es wirklich taten – zumindest dachten wir das. So wurden wir zu Fährtenlesern des Unsichtbaren, die Hoffnung wurde unser heimlicher Begleiter und die Möglichkeit der freudigen Überraschung ein chronischer Zustand.
In dieser Zeit erwachte in unserem Vater eine tiefe Spiritualität. Nun, in der Blüte seiner Jahre, beschloss er, noch einmal ganz neu zu beginnen und fortan auf Gottes Pfaden zu wandeln. Immer häufiger nahm er uns mit in die Mannheimer Moschee, die damals neu gebaut worden war. Dort muss ein Entschluss in ihm gereift sein, der uns unerwartet traf, als er ihn in die Tat umsetzte. Zwei Jahre nach der Flucht unserer Mutter setzte er uns in seinen alten Mercedes, den er liebevoll hegte und pflegte, und führte uns in die gelobte Türkei, wo ein Mann noch ein Mann war und eine Frau noch seine Frau. Er hörte auf, Automechaniker zu sein, besuchte eine Koranschule und machte eine Ausbildung zum staatlich geprüften Imam. Schreien konnte er immer schon gut, nun aber wurde seine Stimme geschliffen und erhielt ein erhabenes Timbre, das ihm gut stand, wenn er in der kleinen Betonmoschee, drei Blocks von unserer Wohnung entfernt, vorbetete.
Unsere Mutter sahen wir nicht mehr wieder und weil Vater uns verbot, sie zu vermissen, vermissten wir sie bald nicht mehr. Es war, als wäre sie gestorben und als gäbe es ein Grab in mir, das ich besuchen konnte. Anfangs ging ich häufig dorthin. Später aber mied ich diesen Ort. Nur unsere Schwester konnte nichts gegen ihre Trauer tun, was dazu führte, dass unser Vater nun sie verprügelte, weil er glaubte, dass es noch nicht zu spät war, aus ihr eine echte Türkin zu machen. Wir Jungen mischten uns nicht in diese Sache ein und es fiel uns kaum auf, dass wir, wann immer wir sicher sein konnten, nicht von unserem Vater gehört zu werden, Deutsch miteinander sprachen. Ja, Deutsch wurde geradezu unsere Geheimsprache.
Als Nevin dick wurde und es aufgab, unsere Mutter zu vermissen, sah unser Vater den Zeitpunkt gekommen, sie mit einem Geschäftspartner zu verheiraten. Der Mann war Gebetsteppichhändler, roch nach Magen aus dem Mund und wohnte gegenüber unserer Wohnung, auf der anderen Seite der großen Schnellstraße, hinter den sechs Bahngeleisen und gleich an der dahinter verlaufenden Durchgangsstraße. Von unserem Wohnzimmerfenster aus konnten wir sein Wohnzimmerfenster sehen, was wir natürlich erst in dem Augenblick lustig fanden, als unsere Schwester dort einzog und wir sie jeden Tag lange dort stehen sahen. Ich beobachtete sie ein paar Mal mit dem Fernglas, weil ich sie vermisste, obwohl das verboten war, und wurde deshalb zufällig Zeuge ihres Unfalls. Erst erschien sie am Fenster, dann tauchte hinter ihr ihr Mann auf und dann fiel sie aus dem Fenster und schlug mit dem Kopf drei Stockwerke tiefer auf dem Bürgersteig der Durchgangsstraße auf. Der Gebetsteppichhändler war in Trauer, mein Vater war in Trauer und wir waren es natürlich auch. Ich erzählte niemandem davon, dass ich das tragische Ereignis sozusagen live miterlebt hatte, es hätte nur den Zorn unseres Vaters auf mich gezogen, und unsere Schwester wäre dadurch auch nicht wieder lebendig geworden. Ich erinnere mich gut an ihre Beerdigung auf dem Friedhof von Sincan. Es waren viel mehr Leute gekommen, als ich erwartet hatte. Die Sippe des Gebetsteppichhändlers stand dort, zahlreich und geballt wie ein Stoßtrupp, Nachbarn und Moscheegänger hatten sich eingefunden, ob aus Neugier oder Anteilnahme kann ich nicht sagen. Meine Brüder, der Gebetsteppichhändler und unser Vater trugen den Sarg zu Grabe und als sie ihn hinabließen in das Erdloch, war mir plötzlich zum Kichern zumute. Wie kindisch!, dachte ich, als dächte ich es über jemand anderen, und dieser Trick sollte das Kichernwollen vertreiben. Aber es verschwand nicht. Es wurde stärker. Ich verkniff meinen Mund, ich spannte alle Muskeln an, um es zu unterdrücken, während der Sarg langsam und etwas ruckartig im Boden verschwand. Alle waren ernst, alle schwiegen. Meine Brüder wirkten gefasst, mein Vater etwas abwesend. Neben ihm der Gebetsteppichhändler starrte stumm ins Grab. Und ich presste mir beide Hände auf den Mund, um das Kichern darin einzusperren. Es wurde auch nicht besser, als die Männer sich daran machten, das Grab mit Erde aufzufüllen. Erst, als die Zeremonie beendet war, konnte ich aufatmen. Natürlich schämte ich mich für mein Betragen, das allerdings niemandem außer mir selbst aufgefallen war, ja, ich bin mir sicher, dass alle dachten, ich hätte versucht, nicht in Tränen auszubrechen.
Nach Nevins Begräbnis ging das Leben weiter wie gewohnt. Unser Vater widmete sich ganz seinen Aufgaben als beamteter Seelenhüter und sorgte nebenbei dafür, dass seine Schäfchen die Gebetsteppiche am liebsten bei dem Witwer seiner armen Tochter erwarben. Wir Jungen schlugen uns ausgiebig mit allen Schulkameraden, die glaubten, wir seien in Wirklichkeit gar keine Türken, sondern die Kinder einer deutschen Hure. Wenn wir gemeinsam antraten, gelang es uns meistens, unsere Widersacher von ihrem Irrtum zu überzeugen. Anders war es, wenn einer von uns allein zurechtkommen musste, was leider nur mir geschah. Meine Brüder sind zweieiige Zwillinge, der eine, Faruk, hünenhaft und blond, Çem, der Erstgeborene, kleiner und schwarzhaarig, beide aber furchtlos, athletisch und handwerklich begabt, eine Freude für unseren Vater, der in ihnen die Fortsetzung seiner Linie erkannte. Ich dagegen war ein Spätentwickler, klein und schmächtig, ohne jedes Interesse für körperliche Ertüchtigung, mit einem Hang zur Feigheit. Wenn meine Kameraden mir nach der Schule auflauerten und mich nach dem beruflichen Werdegang unserer Mutter befragten, gestand ich sofort, anstatt mich verprügeln zu lassen. Anschließend stand ich bereitwillig still, um meinen Mitschülern Zeit zu geben, mich gründlich von oben bis unten zu bespucken, bevor sie fröhlich schwatzend und lachend weiterzogen. Wenn ich anschließend nach Hause kam und mein Vater mich sah, bevor ich die Kleider wechseln konnte, holte er allerdings Schlag für Schlag nach, was meine Schulkameraden versäumt hatten. Ich wusste, er wollte nur das Beste für mich, und ich war zu jung, um über die Wahl der Mittel mit ihm zu diskutieren. Meine Brüder hielten sich heraus.
An jedem Wochenende fuhren wir aufs Land zu unseren Großeltern. Sie hatten einen Bauernhof zehn Kilometer westlich in einem kargen Kaff, an dessen Namen ich mich leider erinnere. Dort hielten sie Ziegen und Schafe. Manchmal erzählten sie aus Vaters Kindheit. »Als euer Vater klein war, da war er kaum zu bändigen«, sagte Großvater Samir eines Abends, als wir am Herdfeuer versammelt waren. »Alles musste er anfassen.« Großvater lachte gutmütig. »Seine Mutter wusste sich nicht zu helfen, nicht wahr, Defne, mein Täubchen?« Großmutter, eine kleine, rundliche Frau mit Knollnase und kaputten Hüftgelenken, lächelte lieb. »Damals«, fuhr Großvater fort, »gab es plötzlich diese großen Küchentücher aus Papier. Und als sie die erste Rolle aufgebraucht hatte, kam ihr die Idee, eurem Vater die Papprolle über die Arme zu streifen. Sie probierte es aus und sie passte ihm wie angegossen.« Er lachte laut und Vater lachte mit. »Dann kaufte sie noch eine und wartete geduldig, bis auch diese aufgebraucht war. Von da an hatten wir unsere Ruhe!« Faruk und Çem glucksten vor Vergnügen, Großvater und Großmutter lachten, Vater lachte und ich sah vor mir ein Baby, das anstelle von Armen und Händen zwei Papprollen hatte.
Die Ausflüge zu unseren Großeltern fanden mit unverrückbarer Regelmäßigkeit statt. Faruk und Çem fühlten sich dort sehr wohl, sie trieben die Ziegen und Schafe vor sich her, halfen Großvater, das kleine Feld hinter dem Haus zu bestellen, und tobten mit den Nachbarskindern herum. Ich tobte mit, verletzte mich aber so oft, dass Vater eines Tages entschied, das Toben sei nichts für mich. Fortan musste ich ihn begleiten. Er saß tagsüber in dem einzigen Café des Ortes mit den Männern und debattierte über wichtige Dinge, die ich nicht verstand. Ich saß dabei und hörte zu und hörte weg und träumte vor mich hin und malte mir aus, ich sei wie meine Brüder. Am liebsten wie Çem, denn er sah türkisch aus wie ich, aber er war bärenstark. Außerdem war er derjenige, der immer bestimmte. Wenn ich aber zu Çem würde, wäre ich nicht mehr Adem. Deshalb beschloss ich, dass ich nur dann Çem war, wenn ich gerade nicht Adem sein wollte. Als Çem könnte ich auch gemeinsam mit Faruk nach der Schule die Mädchen aus der Mädchenschule treffen und müsste nicht allein nach Hause gehen. Das war eine gute Lösung, fand ich. Damals fiel mir nicht auf, dass dann aber niemand Adem wäre.
Ein paar Jahre später wollte ich nicht mehr Çem sein, sondern Spiderman, denn der war einerseits wie ich und andererseits war er mutig und fast unschlagbar. Meine Brüder hielten es eher mit Superman (Çem) und Batman (Faruk). Unser Vater durfte nicht wissen, dass wir amerikanische Comics lasen, deshalb taten wir es nur in der Schule. Er redete immerzu von Allah, zwang uns, fünf Mal am Tag zu beten, und verbot uns, in seiner Gegenwart über alles zu sprechen, was nicht gottgefällig war. Und das war fast alles, was uns durch den Kopf ging. Deshalb sprachen wir nicht besonders viel miteinander zu Hause.
Als Çem und Faruk achtzehn wurden, fingen sie an, gerne mit Vater in die Moschee zu gehen und dort mit den anderen Männern über weltbewegende Dinge zu debattieren, von denen ich immer noch nichts verstand. Vor allem Çem liebte die endlosen Diskussionen. Er saß mit leuchtenden Augen auf seinem Hocker, gestikulierte wild und redete so laut, dass die Alten grinsen mussten über seinen Eifer. Unser Vater war so erfreut über diese Entwicklung, dass er mir ein wenig mehr Freiheit ließ. Oft saß ich dann allein zu Hause und las Bücher. Ich las sehr viel in jener Zeit und ich las wahllos. Auf halbem Weg nach Ankara, in Inönü, gab es eine Zweigstelle des Goethe-Instituts, wo Oberstufenprüfungen abgehalten wurden. Dort arbeitete ein frustrierter Deutschtürke namens Celik, der sich fragte, wie es kam, dass er nie in den wichtigen Städten dieser Erde landete. Er war in Potsdam aufgewachsen und wäre gern nach Istanbul gegangen. Ich hatte ihn kennengelernt, als ich an einem Nachmittag unerlaubterweise in die Instituts-Zentrale nach Ankara gefahren war, um mir deutsche Bücher auszuleihen. Celik sagte: »Aus Sincan kommst du? Dann komm das nächste Mal zu mir, ist viel näher. Du rufst mich montags hier an, mittwochs bin ich in Inönü, du kommst hin, ich gebe dir die Bücher, wir unterhalten uns, fertig. Und wenn du sie zurückgeben willst, machen wir es genauso. Was hältst du davon?« Ich war begeistert. Meine Lektüre war verbotenes Schmuggelgut und ich hatte Glück, dass mein Vater nie etwas davon erfuhr.
Als ich achtzehn Jahre alt wurde, schickte mein Vater mich zum Militär, weil er glaubte, höhere Schule und Universität würden meine Verweichlichung nur noch steigern. »Wenn du die Armee überlebst, darfst du studieren«, sagte er gönnerhaft zu mir und ich fügte mich.
Es war nicht ganz leicht, die Bedingung meines Vaters zu erfüllen, denn in jener Zeit mussten wir ganz im Osten des Landes ein paar aufständische Kurden in ihre Schranken weisen. Man schickte mich gemeinsam mit anderen Jugendlichen auf grünen Lastwagen über staubige Straßen dorthin und gab uns Befehle, die wir gehorsam befolgten. Jahrelang war ich dort stationiert. Die Armee wurde mein Exil und es verging kein Tag, an dem ich nicht Sehnsucht nach meiner Familie hatte. Doch wohin sollte ich gehen? Mein Vater verachtete mich und meine Brüder lebten ihr eigenes Leben. Damals verlor ich fast den Kontakt zu ihnen. Ich wusste nur, dass Çem ein Mädchen aus der Nachbarschaft geheiratet hatte und dass Faruk an der Börse in Istanbul arbeitete. Der Gedanke, meine Mutter zu suchen, kam mir nicht, sie war ein Tabu, an das ich nicht zu rühren wagte, aus Angst vor dem Schmerz, der dort lauerte. Als mein Wehrdienst beendet war, blieb ich einfach bei der Armee und wurde Berufssoldat. Selbst die Urlaube verbrachte ich in der Kaserne.
Dabei hatte ich gar kein Talent für das Soldatenleben. Weder war ich geschickt im Umgang mit der Waffe noch war ich mutig. Während der Nachtübungen schlief ich ein. Aller Drill und selbst schlimmste Strafen änderten nichts daran. Irgendwann hatten meine Vorgesetzten ein Einsehen und ließen mich in einem Büro arbeiten. Dort gab es wenig zu tun, und so konnte ich viel lesen und Filme schauen. Mein Leben wäre vermutlich noch lange, vielleicht ja für immer so ereignislos verlaufen.
Zwei Mal im Jahr aber musste auch ich an den Außeneinsätzen teilnehmen. Einer fand im Winter statt, der andere im Hochsommer.
Dort geschah es, dass ich an meinem sechsundzwanzigsten Geburtstag, fast auf die Stunde genau, zu der ich zur Welt gekommen war, dringend pinkeln musste. Wir waren den ganzen Vormittag marschiert und machten gerade auf einem Felsvorsprung Rast. Die Sonne brannte am Himmel, es war früher Nachmittag und wir schwitzten. Ich verzog mich um die Ecke, um mich zu erleichtern. Dort stand ich plötzlich einer Gruppe von Männern gegenüber, die wie Türken aussahen. Aber sie trugen andere Uniformen. Ich schwankte noch, ob ich strammstehen oder schießen sollte, als mir einer von ihnen das Gewehr aus der Hand nahm und mich an zwei seiner Kollegen weiterreichte, die mit ein paar gezielten Fausthieben in meine Magengegend dafür sorgten, dass ich mir keine Fragen mehr stellen musste. Während ich mich am Boden krümmte und meine Blase entschied, nun sei der richtige Zeitpunkt für die Entleerung gekommen, setzten sich die Männer in Bewegung. Es entstand ein großer Tumult und als ich mich endlich wieder aufgerappelt hatte und um die Ecke lugte, bot sich mir ein ganz und gar verändertes Bild. Meine Kameraden lagen tot auf dem Felsvorsprung, ihre grünen Uniformen waren an vielen Stellen dunkel angelaufen, unter ihren Körpern breiteten sich Blutlachen aus. Alle Gewehre waren fort und die Angreifer verschwunden. Nachdem ich den ersten Schreck überwunden hatte, wuchs in mir die Sorge darüber, wie ich mein eigenes Überleben rechtfertigen sollte. Da mir nichts Passendes einfiel, schmierte ich mich mit dem Blut eines der Toten ein und legte mich dazu. Es war gewiss das Beste, was ich unter den gegebenen Umständen tun konnte, ich entspannte mich jedenfalls augenblicklich und schlief ein.
Mitten in der Nacht erwachte ich. Unzählige Sterne schienen über mir, eine dünne Mondsichel stand am Horizont, ich fror. Das Blut meiner Kameraden und mein eigener Urin hatten meine Kleidung durchdrungen und waren erkaltet. Was sollte ich tun? Ich zog zweien, die nicht ganz steif und nicht ganz nass waren, die Uniformjacken aus und streifte sie mir über. Dann machte ich mich auf den Weg.
Nichts war zu hören, die karge Berglandschaft war kaum sichtbar. Immer wieder stolperte ich und fiel hin. Ich ging und ging und ging und wusste nicht einmal, in welche Richtung ich ging. Aber Hauptsache, ich ging. Endlich, als ich mich kaum noch auf den Beinen halten konnte, sah ich in der Ferne einen Lichtschein. Das gab mir neue Kraft und so schritt ich voller Hoffnung darauf zu. Als ich näher kam, bemerkte ich ein paar ausgebrannte Lastwagen. Es sah ganz nach einem großen Sieg der türkischen Armee über die Aufständischen aus. Ich wollte gerade zwischen zwei Jeeps hervor in den Lichtschein treten, als ich bemerkte, dass die Männer, die dort versammelt waren, dieselben Uniformen trugen wie jene, denen wir am Nachmittag begegnet waren. Es musste sich um ein Lager der Kurden handeln. Erschrocken blieb ich im Schatten der Fahrzeuge stehen und beobachtete sie. Doch lange hielt ich es nicht aus zwischen den Jeeps, und so beschloss ich, in einen der Wagen zu klettern. Als ich es mir auf der Rückbank bequem gemacht hatte, überkam mich mit einem Mal eine solche Müdigkeit, dass ich einschlief. Ich erwachte auch nicht, als das kurdische Lager im Morgengrauen von türkischen Einheiten angegriffen wurde. Wie das kam, kann ich mir selbst kaum erklären, denn normalerweise habe ich einen leichten Schlaf. In jener Nacht aber schlief ich so tief, als wäre ich mit meinen Kameraden gestorben. Erst als jemand in den Jeep sprang und hektisch losfuhr, prallte ich zuerst gegen die Rückenlehne und plumpste dann nach vorn auf den Boden. Der Fahrer drehte sich kurz um und wir sahen einander mit schreckgeweiteten Augen an. Er schrie: »Was machst du in meinem Jeep?« Ich schrie zurück: »Ich habe geschlafen!«
»Was?«, schrie er. Ich schrie noch lauter: »Ich habe geschlafen!« Er verdrehte die Augen und blickte mich durch den Rückspiegel an: »Ich meine, wie kommst du dazu, als türkischer Soldat in einem kurdischen Jeep zu schlafen. Spinnst du?«
»Entschuldigung, ich war müde.« Er schüttelte den Kopf und sagte: »Sei froh, dass ich keine Waffe habe.« Wir fuhren eine Weile über die holprige Straße. Ich musste mich festhalten, so schnell ging es über loses Geröll. »Wo fahren wir hin?«, fragte ich nach einer Weile. Er lachte kurz auf: »Wo möchtest du denn hin?«
»Nach Hause«, sagte ich und das war die Wahrheit, obwohl ich längst nicht mehr wusste, wo das sein sollte. Er wandte sich um und sah mir in die Augen. In seinem Blick lag etwas, das ich nicht deuten konnte. Er sagte: »Wie alt bist du, Türke?« Ich wollte ihm sagen, dass ich gar kein Türke war, dass meine Mutter Deutsche war, dass ich überhaupt nichts gegen Kurden hatte und dass ich ihn sogar nett fand, ja, dass er der erste Mensch war, der mich ganz selbstverständlich für einen Türken hielt, was ich ihm hoch anrechnete. Doch bevor ich das tun konnte, blickte ich zufällig zu Boden und sah, dass dort, halb unter dem Beifahrersitz, eine Pistole lag. Ich wollte schon wieder wegschauen, um zu sagen: »Sechsundzwanzig«, aber stattdessen sagte ich: »Sechsundzwanzig«, während ich mich nach unten beugte und die Waffe ergriff. »Hast noch keine Ahnung vom Tod, was?«, sagte mein Fahrer und lachte kehlig, wie einer, der viel Ahnung vom Tod hatte.
»Nein«, sagte ich, aber ich bin nicht sicher, ob er es noch hörte, denn es gab einen lauten Knall, als ich abdrückte.
Der Jeep hielt abrupt an, ich flog nach vorne und schlug mit dem Kopf gegen das Armaturenbrett. Wie lange wir dort wohl gemeinsam lagen, er tot und ich bewusstlos? Ich weiß es nicht, aber es war das Intimste, was ich je getan hatte. Die Sonne stand hoch am Himmel, alle Feuchtigkeit war aus der Luft gewichen, als eine Einheit der türkischen Armee den Jeep fand. Man brachte mich in ein Lazarett und ließ mich mit meiner Gehirnerschütterung allein. Aber nicht lange, denn es hatte sich herausgestellt, dass ich einen wichtigen kurdischen Anführer erschossen hatte. Drei Tage später wurde ich in einem Hubschrauber nach Ankara geflogen, in eine neue Uniform gesteckt und dem Verteidigungsminister, einem kleinen Mann mit huschenden Augen, vorgeführt. Er blinzelte mich an und heftete einen Orden an meine linke Brust, bevor er mir die Hand schüttelte und grußlos wieder verschwand. Dann ließ man mich gehen. Ich fuhr mit dem Bus, der Metro, dem Nahverkehrszug nach Hause und zeigte meinem Vater den Orden. Er gab mir eine Ohrfeige, weil ich getötet hatte, und umarmte mich anschließend, weil doch noch ein Mann aus mir geworden war. Drei Tage später wurde ich erneut ins Verteidigungsministerium bestellt. Diesmal empfing mich ein Oberst Gökdan in seinem Büro. Er war dick und freundlich. Er sagte: »Adem Öztürk, wollen Sie Ihre Mutter wiedersehen?« Ich sagte: »Ja.« Er sagte: »Sie fliegen morgen nach Deutschland. Dort besuchen Sie Ihre Mutter. Alles Weitere wird sich ergeben.« Er drückte mir einen großen Umschlag in die Hand. »Schauen Sie sich das einmal an. Ein kleiner Auftrag, nichts Besonderes für jemanden wie Sie.«
»Worum geht es denn, Herr Oberst?«
»Es gibt da ein antitürkisches Computerspiel, aber darum müssen Sie sich nicht kümmern. Suchen Sie die Hintermänner und machen Sie sie unschädlich, wie gesagt: nichts Besonderes.« Ich nahm den Umschlag, salutierte und fuhr nach Sincan. Während der Fahrt kreisten meine Gedanken um das Wort »unschädlich«. Den Umschlag würde ich erst in Deutschland öffnen, nahm ich mir vor.
So kam es, dass ich sechzehn Jahre, nachdem unser Vater uns aus Deutschland entführt hatte, wieder dorthin zurückkehrte. Man hatte mir einen Koffer mit neuen Kleidern nach Hause geschickt, außerdem einen Aktenkoffer, in dem sich ein Handy und ein Hinflugticket befanden. Ich sollte nichts Eigenes mitnehmen außer meinem Pass, also tat ich es nicht und vertraute mich ganz der Umsicht und Organisation des türkischen Verteidigungsministeriums an. Alle Gedanken an den Auftrag schob ich beiseite. Ich war glücklich und aufgeregt, dass ich endlich meine Mutter wiedersehen würde.
Ich fuhr nach Sincan zu meinem Vater und versuchte, mir nichts von meinem Auftrag anmerken zu lassen. Als er sich nach meiner bevorstehenden Reise erkundigte, erzählte ich ihm, man habe mir einen Urlaub gewährt, den ich in Izmir am Meer verbringen wollte. Er sah mich so lange an, dass mir ein leichter Schweißfilm auf die Stirn trat. Er sagte: »Komm her, mein Sohn, umarme deinen Vater, der stolz auf dich ist.« Ich tat wie geheißen. Anschließend ergriff er mich an den Schultern, schob mich ein Stück von sich fort und betrachtete mich wie ein Kenner der menschlichen Seele. Er war inzwischen fast einen Kopf kleiner als ich, aber ich hatte zu lange Angst vor ihm gehabt, um mich ihm überlegen fühlen zu können. Seine Mimik veränderte sich in jener Art und Weise, die ich gut an ihm kannte: zuerst freundlich, dann plötzlich, wie ein Wetterumschwung, finster und immer finsterer, bis ein Ausdruck der Wut erschien, auf den normalerweise der erste Schlag folgte. Diesmal aber beherrschte er sich. Mit einem dünnen Lächeln auf den Lippen sagte er leise: »Wenn du mich das nächste Mal anlügst, dann tu es so, dass ich es nicht merke, hast du verstanden?« Ich nickte erschrocken, er wandte sich ab und verschwand in seinem Zimmer. Das war spät am Abend. Als ich am nächsten Morgen aufstand, war er bereits fort. So fuhr ich also weg, ohne mich von ihm zu verabschieden und ohne zu wissen, wie viel er wirklich wusste über meine bevorstehende Aufgabe. Hatte er die Sachen durchsucht, die Oberst Gökdan mir hatte zukommen lassen? Ich zog einen der beiden Anzüge an, die ich im Koffer fand, und begab mich zum Flughafen.
Am Flughafen ging ich zu den Schaltern und stellte mich in die Schlange. Vor mir und hinter mir nur Geschäftsleute. Sie alle trugen Anzüge, die genauso aussahen wie meiner, hatten Aktentaschen wie die meine in der Hand und Koffer, die meinem ähnelten. Als ich an der Reihe war, griff die hübsche Bodenstewardess, die am Schalter saß, unter die Theke und holte einen deutschen Reisepass hervor, den sie gegen meinen eigenen austauschte. Sie lächelte und sagte: »Den alten brauchen Sie nicht mehr. Gute Reise.«
Verdutzt, wie ich war, brachte ich nur ein »Danke« hervor und schon drängte der nächste Reisende an den Schalter. Obwohl ich den Verlust meines Passes bedauerte, war ich doch beeindruckt von der Eleganz, mit der das türkische Militär diesen Austausch inszeniert hatte. Als ich den neuen Pass anschaute, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass er auf den Namen Adam Imp ausgestellt war, und zwar sechzehn Jahre zuvor in Berlin. Das war eigenartig, aber vielleicht, dachte ich, ist das üblich in der Geheimbranche. Den Nachnamen meiner Mutter nach so langer Zeit zu sehen, noch dazu in Verbindung mit der biblischen Version meines eigenen Vornamens, erzeugte ein Gefühl in mir, das ich nicht benennen konnte. Aber es gefiel mir.
Im Flugzeug saß ich am Fenster. Der Platz neben mir war frei. Auf der anderen Seite des Ganges saß ein junger Mann, der ab und zu gelangweilt herüberschaute. Er schien kein Geschäftsreisender zu sein, denn er trug Jeans und Pulli. Es war ein wolkenloser Morgen, bald schon glitzerte das Schwarze Meer unter uns. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich frei. In diesem Augenblick öffnete sich ganz vorne die Tür des Flugzeugs und ein heller Lichtstrahl durchflutete das Innere. Ich kniff die Augen zusammen. Das konnte doch gar nicht sein! Ungläubig schaute ich mich um. Niemand schien davon Notiz zu nehmen, ja, keiner der übrigen Passagiere schenkte dem Vorgang Beachtung. Hatte ich eine wichtige Entwicklung der modernen Luftfahrt verpasst? Plötzlich bewegte sich ein Schatten in dem gleißenden Licht und anschließend betrat jemand das Flugzeug. Ich sah ihn zunächst nur schemenhaft, da ich geblendet war. Dann aber, als die Tür sich wieder schloss, erblickte ich einen hochgewachsenen Mann, der durch den Gang kam. Er trug einen Hut auf dem Kopf, einen beigefarbenen Trenchcoat und in der Hand eine schwere Tasche. Als er näher kam, erkannte ich ihn. Es war der kurdische Anführer, den ich im Jeep erschossen hatte. Das konnte natürlich nicht sein, denn er war ja tot. Ich erschrak sehr über meine Entdeckung, er aber schaute mich freundlich an und sagte auf Türkisch: »Ist hier noch frei?« Dann setzte er sich, ohne meine Antwort abzuwarten, neben mich und seufzte tief. »Ah, endlich!« Er sah mich an, lächelte ironisch und sagte: »Keine Sorge, ich bin tot, du hast mir ja schließlich von hinten in den Kopf geschossen und das überlebt man nicht. Ach, du fragst dich, wie es sein kann, dass ich hier zugestiegen bin. Also«, er lehnte sich zurück, nahm den Hut ab und jetzt sah ich auch das Loch in seinem Schädel, »weißt du, wir fliegen hier auf zwölftausend Metern Höhe, das ist zwar normalerweise zu tief, aber in meinem Fall hat man eine Ausnahme gemacht. Ich durfte meine Flughöhe verlassen, um dir Gesellschaft zu leisten. Das hat mich sehr gefreut, musst du wissen, denn immerhin hatten wir so eine Art Affäre miteinander, nicht wahr?« Vor lauter Verwirrung konnte ich keinen klaren Gedanken fassen. Er muss das bemerkt haben, denn er machte ein besorgtes Gesicht und sagte: »Mach dir keine Sorgen, mein Lieber, ich bin nicht schwul. Außerdem bin ich ja tot. Und drittens könnte ich dein Vater sein, wie käme ich mir da vor?« Ich schloss die Augen, wünschte mir, ohnmächtig zu werden oder aus einem Traum aufzuwachen, öffnete sie wieder und er sagte: »Vergiss das, ich bin genauso real wie dieser junge Mann auf der anderen Seite des Ganges, vor dem du dich übrigens in Acht nehmen solltest, denn er ist hinter dir her.«
»Was?«, sagte ich, als hätte ich nicht richtig gehört. »Leise! Willst du, dass die anderen auf dich aufmerksam werden? Wenn du mit dir selbst redest, werden sie denken, du bist verrückt. Und was dann? Willst du in der Klapsmühle landen? Und ich gleich mit dir? Vergiss nicht, du wirst deine Mutter besuchen. Deine Mutter! Geliebte Mutter!« Er begann zu weinen, was mich vollends aus der Fassung brachte. »Auch ich habe eine Mutter«, schluchzte er, »aber nun hast du mich ihr genommen, die Ärmste.« Er zog ein großes Taschentuch hervor und schnäuzte laut hinein. »Keine Sorge«, sagte er schniefend, »die anderen können mich nicht hören. Das kannst nur du.« Bei diesem letzten Wort brach er erneut in Tränen aus. Allmählich erwachte ich aus meiner Schockstarre und wollte ihm gerade ein paar tröstende Worte zuflüstern, weil ich mir nicht sicher war, ob die anderen ihn nicht doch hören konnten. Aber er kam mir zuvor: »Siehst du«, sagte er heftig, »du hast überhaupt keine Courage! Immer bist du von Ängsten geplagt, das Einzige, woran du denkst, sind die anderen.« Er schüttelte resigniert den Kopf. »Wer sonst als ich sollte dir beibringen, ein Mann zu sein?«
»Du?«, fragte ich, das heißt, ich dachte es, denn inzwischen hatte ich begriffen, dass er meine Gedanken lesen konnte. »Natürlich ich!«, sagte er aufbrausend, »oder glaubst du etwa, dass du plötzlich, nur weil du mich feige von hinten ermordet hast, den Dingen gewachsen sein wirst, die vor dir liegen? Ts ts ts, vergiss es, du bist ein kindischer Idiot und ich muss auf dich aufpassen.«
»Du?«, fragte ich wieder. »Aber ich habe dich doch erschossen?« Er zuckte mit den Achseln und sagte: »Und jetzt habe ich die Verantwortung für dich, ob ich will oder nicht.«
Das Essen kam. Als die Stewardess mir das Tablett reichte, drückte mein Begleiter sich gegen die Rückenlehne, um ihr Platz zu machen. Das ist absurd, dachte ich, aber er sagte: »Natürlich ist es das, aber du willst es so, was soll ich machen, glaubst du, ich bin freiwillig hier?« Ich sagte: »Danke« zu der Stewardess und fragte ihn, was er damit meine. Er verdrehte die Augen, wie er es damals im Jeep getan hatte, und sagte: »Denkst du wirklich, dass ich neben dir sitze?«
»Nun ja, ich weiß nicht.«
»Natürlich nicht, aber ich sage dir, dass es nicht so ist. Es gibt mich gar nicht, ich bin ein Produkt deines Geistes.«
»Das heißt, ich bin verrückt geworden?«
»Was?«, rief er und starrte mir aus nächster Nähe in die Augen. »Soll das heißen, du glaubst, dass du nicht verrückt warst, als du mir eine Kugel in den Kopf jagtest?«
»Ich weiß nicht.«
»Natürlich nicht!«, rief er aufgebracht. »Du weißt gar nichts, deshalb hast du mich ja gerufen.«
»Ich habe dich nicht gerufen!«, rief ich empört. Was für ein abwegiger Gedanke, ich hatte ihn doch aus dem Weg geräumt, damit er tot wäre und nicht, damit er mitten über dem Schwarzen Meer das Flugzeug bestieg, in dem ich saß. Mehrere Passagiere drehten sich nach mir um. Unter ihnen war auch der junge Mann auf der anderen Seite des Ganges. Die Stewardess, die bereits die Reihe hinter mir bediente, kam noch einmal zurück, lächelte mich an, wie man ein verstörtes Kind anlächelt, und fragte mit beruhigendem Singsang, ob sie noch etwas für mich tun könne. »Nein danke«, sagte ich so normal wie möglich. Währenddessen saß er da mit geschlossenen Augen und schmunzelte. Ein wenig Blut rann aus dem Loch in seinem Hinterkopf. »Wie heißt du eigentlich?«, fragte ich ihn. »Nenn mich einfach ›Kurde‹, denn das bin ich.«
»In Ordnung, Kurde, ich nenne dich Kurde. Also gut, Kurde, ich befehle dir, sofort aus meinem Kopf zu verschwinden und das Flugzeug zu verlassen!« Er ignorierte meinen Befehl, öffnete die Augen, wandte sich mir zu, sagte: »Findest du nicht auch, dass der junge Mann und ich uns ähneln?« Das war mir noch nicht aufgefallen. Ich beugte mich nach vorne – durch Kurde hindurchsehen konnte ich nicht –, der junge Mann blickte zu mir, ich verglich beide und … tatsächlich, da war eine gewisse Ähnlichkeit. Kurde grinste vielsagend und sagte: »Er ist mein Sohn.«
»Was?«, rief ich und wieder blickten mich mehrere Leute an. »Das ist nicht wahr!«, dachte ich laut, wenn es so etwas gibt wie laut denken, ohne zu sprechen. Kurde sagte nichts, grinste nur, schloss die Augen und ließ mich mit meinen Befürchtungen allein.
Ich schloss ebenfalls die Augen, versuchte mich auf etwas anderes zu konzentrieren, vielleicht auf meine Mutter, wie sah sie noch gleich aus? Ich konnte mich nicht mehr an ihr Gesicht erinnern und das war eigenartig, hatte ich sie doch so viele Jahre wie ein Bild in mir getragen, um sie nicht vermissen zu müssen. Aber nun war das Bild fort, ich fand es nicht mehr. An seiner Stelle war nur noch ein Name unter Worten: Anna Imp, wohnhaft irgendwo in Mannheim, wo, wer wusste das schon, ich nicht, ich würde erst einmal suchen müssen. Was für eine Situation! Nach der eigenen Mutter suchen müssen, weil der Vater ihr die Kinder weggenommen hat. Plötzlich tat ich mir leid, ja, es war vielleicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich Mitleid mit mir selbst hatte. Es war, als sähe ich mich durch die Augen eines anderen, wie ich da saß, eingezwängt in einem Flugzeug, einsam und verfolgt von dem Geist eines Toten, der bestimmt nichts anderes war als ein Trick meines Gewissens, aber ein so guter Trick, dass ich ihm ohnmächtig ausgeliefert war. Und wenn er ein Teil meines Geistes war, dann war alles, was er sagte, irgendwie wahr. Aber wie? Wieso sollte er wissen, dass auf der anderen Seite des Ganges sein Sohn sitzt, wenn ich es nicht auch wusste? »Du weißt es«, flüsterte Kurde mir ins Ohr. »Du wusstest es in dem Augenblick, als du ihn das erste Mal gesehen hast.« Ich schüttelte den Kopf und sagte, ohne die Augen zu öffnen: »Nein. Wenn ich schon wahnsinnig war, als ich dich erschoss« – »ermordete«, verbesserte er mich – »na gut: ermordete, dann bin ich es auch jetzt und du bist nicht Teil meiner Heilung, sondern Teil meines Wahns. Und dann, lieber Kurde, kannst du mir gar nicht die Wahrheit sagen.«
»Quatsch«, sagte Kurde abfällig, »glaubst du allen Ernstes, im Wahnsinn steckt keine Wahrheit? Weit gefehlt. Dein Wahnsinn hat ja nichts mit deinem Verstand zu tun, der funktioniert doch noch, oder?« Das musste ich zugeben. »Siehst du«, fuhr er fort, »dein Wahnsinn ist eher wie ein Schneepflug, der deine Gedanken vor sich herschiebt, die sich auftürmen zu Unsinn, zu Furcht, zu Mord. Dein Wahnsinn liegt in der Seele, nicht im Kopf.«
»Aber dann habe ich ja keine Chance, das jemals zu ändern!« Er zuckte die Achseln. »Du hättest deinen Vater ermorden sollen, nicht mich.« Meinen Vater! Ich dachte an ihn, dachte an alles, was er getan hatte, und fühlte: nichts. Nein, nicht nichts, eher eine Art Blankheit in meinem Kopf, als läge ein weißer Schleier über meinem Vater, der ihn unsichtbar machte, ihn, nicht aber die Gefahr, die von ihm ausging, sie war konkret, ja, sie war das Tuch, das ihn verbarg. Oder vielleicht doch nicht?
Ich öffnete die Augen. Kurde war fort, der junge Mann auf der anderen Seite des Ganges beachtete mich nicht. Das Flugzeug ging in den Sinkflug. Vielleicht war doch alles nur ein Traum gewesen, ein Wachtraum, ein Wachalbtraum? Ich klammerte mich an diese Hoffnung wie ein Ertrinkender und während das Flugzeug durch die dichte Wolkendecke sank und unter uns allmählich jenes Land auftauchte, das ich vor so vielen Jahren hatte verlassen müssen, kehrte zum ersten Mal seit dem Beginn meiner Reise ein wenig Ruhe in mich ein.
Am Frankfurter Flughafen verlor ich den jungen Mann aus den Augen. Er schien kein Gepäck dabeizuhaben, denn er stand nicht gemeinsam mit uns übrigen Passagieren am Band. Die Ankunftshalle war voller Menschen, die erwartungsvoll in meine Richtung starrten. Plötzlich winkte mir ein Mann zu, es war Kurde. Meine gute Laune verflog sogleich wieder, aber er zeigte in eine Richtung und als ich seinem ausgestreckten Arm mit den Augen folgte, sah ich eine Frau, die mit einem Aufschrei und ausgebreiteten Armen auf mich zulief. Es war meine Mutter. »Adam! Mein Gott, Adam! Mein Sohn, mein Sohn!« Tränen liefen ihr über das Gesicht. Als sie bei mir ankam, umarmte sie mich stürmisch, und ehe ich mich aus meiner Betäubung lösen konnte, wandte sie sich um und stellte mir ihre Familie vor: »Das ist Rainer, mein Mann, und das sind Ada, Lukas und Sarah, unsere Kinder, deine Halbgeschwister!« Hinter meiner Mutter tauchten ein großer, auffallend attraktiver Mann und drei Kinder unterschiedlichen Alters auf. Zu meiner Überraschung wirkten sie alle schon sehr groß. Wie konnte das sein? Ich versuchte nachzurechnen, kam aber nicht dazu, denn sie begrüßten mich mit strahlenden Gesichtern, umarmten mich, nannten mich »Bruder«. Es war, als ob sie schon seit Langem auf mich gewartet hätten und nun wäre ich endlich angekommen. Besonders Rainer war mir auf Anhieb sympathisch, sein charmantes Lächeln, sein kantig geschnittenes Gesicht, seine breiten Schultern, seine dunkle Stimme, alles an ihm wirkte auf entspannte Weise männlich. »Woher wusstest du …?«
»Oh, die türkische Botschaft hat uns darüber informiert, dass du kommst. Mein Junge! Ist er nicht ein großer stattlicher Mann?« Rainer nickte freundlich aus seiner Höhe herab und sie fuhr fort: »Wie geht es Çem und Faruk? Und meinem Mädchen? Du musst mir unbedingt erzählen, wie es meinem Mädchen geht, und dir, mein Junge, erzähl mir, wie es dir geht!«
»Mir geht’s gut, Mama«, sagte ich und warf einen Seitenblick auf Kurde, der neben uns ging und mir ironisch zublinzelte.
Sie führten mich zu einem schwarzen Minibus, in dem für alle Platz war, sogar Kurde fand noch einen freien Sitz vorne neben Rainer. Ich saß mit meiner Mutter ganz hinten im Fond, meine Halbgeschwister unterhielten sich leise in der Mitte. Während wir auf der Autobahn Richtung Mannheim fuhren, kuschelte sich meine Mutter an mich und strahlte vor Glück. »Ach, Adam, ich dachte, ich würde euch nie wiedersehen. Jetzt erzähl mir von deinen Geschwistern, geht es ihnen gut?« Ich schluckte und sagte: »Ja, Mama, es geht ihnen gut. Faruk und Çem haben es zu etwas gebracht, wirklich, und Nevin«, ich zögerte, aber nur kurz, »Nevin ist verheiratet mit einem netten Mann.«