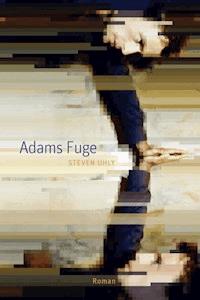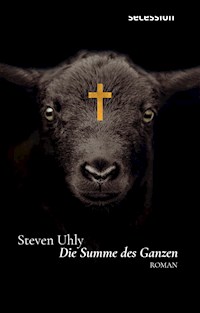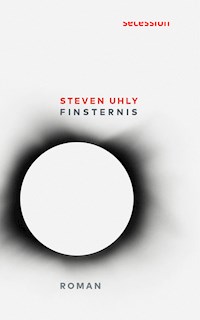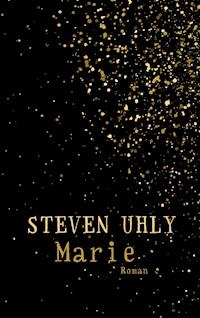
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Secession Verlag für Literatur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der zwölfjährige Frido erzählt seiner kleinen Schwester Chiara eine aufwühlende Gutenachtgeschichte. Sie handelt von einem alten Mann, der ein Baby stiehlt. Als Chiara kurz darauf ihrer Mutter davon berichtet, reagiert diese schockiert. Im Affekt schlägt sie ihre Tochter. Ein Geheimnis, ein Tabu ist greifbar. Von diesem Moment an gerät die kleine Familie aus dem Gleichgewicht. Veronika Kelber reibt sich auf zwischen ihrem Anspruch, gleichzeitig eine gute, alleinerziehende Mutter zu sein, einen neuen Partner zu finden, die Ablehnung ihres Ex-Mannes zu ertragen und jenes Wundmal zu heilen, das sie unablässig an ihr furchtbares Versagen als Mutter, Frau und Mensch erinnert. Als sie schließlich die Kontrolle über ihr Leben verliert, reißt sie ihre drei Kinder mit in einen Strudel von Ereignissen, die alles verändern werden. Steven Uhlys neuer Roman MARIE ist ein meisterhaft komponiertes Drama, das an seinen Erfolgsroman Glückskind anknüpft. Wieder lockt Uhly den Leser auf unwiderstehliche Weise in das Labyrinth menschlicher Gefühle und lässt ihn nicht mehr los. Und doch geht er überraschend neue Wege. Mit unnachahmlichem Gespür für die unsichtbaren Wunden, die uns allen nicht fremd sind, zeichnet er Figuren in Not, mit Abgründen und Träumen, die so nachvollziehbar und klar geschildert sind, dass sie den Leser tief berühren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Steven UhlyMarieRoman
STEVEN UHLY Marie
Roman
Erste Auflage
© 2016 by Secession Verlag für Literatur, ZürichAlle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christian Ruzicska
Korrektorat: Peter Natter
www.secession-verlag.com
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München Satz: Erik Spiekermann und Robert Grund, BerlinHerstellung: Renate Stefan, Berlin
Gesetzt aus der FF Meta
ISBN 978-3-905951-87-5eISBN 978-3-905951-88-2
1
HEUTE HEISST SIE MARIE. Das ist ein schöner Name. Die Mutter aber findet das nicht. Ihre Ohrfeige brennt wie ein Ausrufezeichen auf Maries Wange. Marie! Eben noch war das irgendein Name für ein harmloses Spiel. Sie stand hinter der Mutter in der Küche und sprach von der Geschichte, die Frido, ihr Bruder, ihr gestern Abend erzählt hatte. Da ging es um ein Mädchen. Sie hat der Mutter Fridos Geschichte wiedergegeben und bemerkt, wie sie am Herd plötzlich innehielt, wie sie still dastand und nur noch zuhörte. Marie ist sich ganz sicher, dass die Mutter ihr die volle Aufmerksamkeit schenkt, und das fühlt sich gut an, es geschieht selten. Damit es andauert, schmückt sie die Erzählung aus, erfindet neue Dinge, die Frido nicht gesagt hat und die nicht richtig passen, aber das ist ihr gleich, sie will, dass die Mutter ihr weiterhin zuhört. Als ihr nichts mehr einfällt, als die Stille der Mutter ihr merkwürdig vorkommt, sagt sie, Jetzt bin ich das geklaute Mädchen und du musst mich finden. Du musst mich suchen und meinen Namen rufen. Ich heiße, und dann hat sie den Namen gesagt und alles ist ganz schnell gegangen, die Mutter dreht sich um, und während sie ihr die Ohrfeige gibt, hört Marie ein leises, fast geflüstertes Nein.
Wie eine Taufe ist das, die glühende Wange, der unverwandte Blick der Mutter, nur eine Sekunde lang, aber stärker als alles, was Marie je empfunden hat. Dann wendet sich die Mutter rasch ab und kocht weiter, und Marie steht noch immer da, schaut der Mutter wieder auf den Rücken. Nicht ratlos, nicht verletzt, nicht gedemütigt. Bloß wissend, wortlos und mit Sicherheit wissend, dass sie Marie ist, und nicht wissend: Wer ist Marie?
Sie steht noch eine Weile so da, die Mutter dreht sich nicht mehr um, hantiert bloß mit den Töpfen und Kochlöffeln, rührt hier und da, es wird Gemüseeintopf geben, mit Reis, mehrere geöffnete Konservendosen stehen auf der Anrichte gleich neben der Mutter, die mehr Lärm macht als notwendig, ihre Bewegungen sind hektisch, das fällt Marie auf. Einmal fährt sie sich mit dem Handrücken über das Gesicht, die Haut glänzt dort nun nass, oder bildet Marie sich das ein? Sie denkt ihre Frage nicht, eher wird sie selbst zu einem Fragezeichen, nur ganz kurz, aber sie spürt, wie ihr Körper sich zu einer Schlangenlinie verbiegt, ihre Schultern wölben sich nach vorn, ihr Rücken wird hohl, ihre Knie geben nach. Sie, Marie, das Fragezeichen, weiß, dass sie über einem Punkt schwebt, den sie nicht sehen kann von hier oben, doch dieser Punkt gehört zu ihr, er ist sogar das Wichtigste, damit sie sein kann, was sie jetzt ist.
Marie wendet sich um und verlässt die Küche. Sie betritt den schmalen Flur. Es ist laut hier, Frido hat Freunde zu Besuch, sie spielen Computerspiele in seinem Zimmer und rufen durcheinander. Der Lärm dringt fast ungehindert durch die geschlossene Tür. Mira, ihre Schwester, sitzt gleich nebenan in ihrem gemeinsamen Zimmer und hört Musik über Kopfhörer, während sie in einer Modezeitschrift blättert und Kaugummi kaut. Marie mag jetzt nicht zu ihr gehen und sich einen der Blicke einfangen, mit denen Mira ihr klar macht, dass dieses Zimmer eigentlich ihr allein gehört und nicht auch der lästigen kleinen Schwester. Marie geht ins Wohnzimmer. Die Wange brennt kaum noch. Einen Moment lang befürchtet sie, mit dem Schmerz könne auch ihr neuer Name verblassen. Doch das geschieht nicht. Sie ist zufrieden.
»Chiara?« Sie dreht sich um. Da steht ihre Mutter, sie füllt die Tür zum Flur mit ihrer schmalen Gestalt aus. Der neue Name ist fort, ausgelöscht von diesem Ruf. Die Mutter löst ihre verschränkten Arme, wischt sie flüchtig an der weißen Schürze ab, schaut ihre Tochter an. Sie wirkt, als wolle sie etwas sagen, es vergeht Zeit, wie viel, weiß niemand, Sekunden, doch die Sekunden sind wie ein Trichter zwischen der Frau und dem Mädchen, ein Trichter, der das Vergehen der Zeit hörbar und langsamer macht. Schließlich sagt die Mutter: »Mach deine Hausaufgaben!«, und verschwindet wieder in die Küche. Chiara bleibt noch eine Weile stehen, sie schaut auf die Stelle, wo eben noch die Mutter gestanden hat. Sie hat gesehen, dass die Mutter etwas anderes hatte sagen wollen. Noch nie hat sie zu ihr gesagt, sie solle Hausaufgaben machen.
Sie betritt ihr Zimmer, ignoriert den Blick der Schwester und setzt sich auf ihr Bett. Sie denkt über das Märchen nach, das Frido ihr am Vorabend erzählt hat. Vielleicht hat die Mutter dieses Nein geflüstert, weil es im Märchen ein Mann ist, der das Mädchen findet, und keine Frau. Frido hat seinen Namen nicht genannt. Sie nimmt sich vor, ihn danach zu fragen.
Vielleicht hat die Mutter Nein gesagt, weil sie, Chiara, nicht erwarten kann, dass sie mit ihr spielt, sie ist doch so beschäftigt, hat drei Kinder, muss abends oft fort. Wie dumm von mir, denkt sie und fühlt sich plötzlich schuldig. Was für ein kindisches Spiel hat sie denn da nur spielen wollen, Ich bin doch kein Baby mehr, sagt sie sich. Sie will es wieder gutmachen, deshalb beschließt sie, die Hausaufgaben vom Vortag zu erledigen und nimmt sich vor, sie der Mutter zu zeigen, genau so, wie sie es bei Moni, ihrer besten Freundin, gesehen hat, wo Vater und Mutter abwechselnd die Hausaufgaben überprüfen. Sie holt das Mathe-Heft heraus und will anfangen zu rechnen, aber dann sieht sie anstelle der Zahlen, wie ihre Mutter sich neben sie setzt und ihr über den Kopf streichelt, während sie interessiert auf das Heft schaut und mit dem Finger auf diese und jene Zahl zeigt. Chiara schwelgt in dem Gefühl, das diese Bilder verursachen, bis Mira in ihrem Rücken unwirsch sagt: »Eingeschlafen oder was?«
Am Abend will Chiara, dass Frido ihr wieder ein Märchen erzählt. Aber ihre Mutter sagt: »Schluss jetzt! Morgen ist Schule.
Geh ins Bett!«
Chiara gehorcht. Sie beobachtet, wie ihre Mutter sich von Mira verabschiedet, sie versucht, sie zu umarmen, aber Mira wendet sich ab. Veronika streichelt zaghaft über den Rücken ihrer Tochter und belässt es dabei. Aber Chiara sieht die Berührung, und ihr läuft ein Schauer über den Rücken.
Die Mutter erhebt sich vom Bett der Schwester, wirft Chiara einen kurzen Blick zu, darauf hat sie gewartet. Die Mutter sagt:
»Schlaf jetzt!«
»Gute Nacht, Mama.«
Die Mutter löscht das Licht und schließt die Tür hinter sich.
Chiara liegt im Dunkeln. Sie hat Angst, wagt es aber nicht mehr, zu Mira ins Bett zu gehen, seit ihre Schwester sie wütend angebrüllt hat. Verschwinde! In der Dunkelheit versucht Chiara ihre Schwester zu sehen, doch alles, was sie erkennen kann, ist eine besonders dunkle Stelle genau dort, wo Mira liegt. Sie lauscht auf die Atemgeräusche der Schwester, zuerst sind sie unregelmäßig, dann werden sie gleichmäßiger und tiefer. Das ist ansteckend, es hilft Chiara beim Einschlafen.
Als ihre Kinder endlich schlafen, setzt Veronika Kelber sich in das kleine Wohnzimmer und schaltet den Fernseher ein. Normalerweise funktioniert das gut, aber heute ist sie aufgewühlt. Sie geht ins Badezimmer, ein enger, viereckiger Raum mit cremegelben Kacheln, die ihren Glanz verloren haben und deren Fugen an vielen Stellen schwarz geworden sind. Ein vergilbter Plastikvorhang, an dessen unterem Ende sich Pilz ausbreitet, trennt die Dusche ab. Der Spiegel hängt genau gegenüber der Dusche. Veronika betrachtet sich. Sie verzieht den Mund wie ein kleines Mädchen, das Grimassen schneidet. Sie sieht die Spuren, die die letzten sechseinhalb Jahre hinterlassen haben, kleine Fältchen um Augen und Mund, die Schatten sind tiefer geworden. Obwohl es Abend ist, schminkt sie sich. Das macht sie oft, aber heute hilft auch das nicht. Sie fühlt eine Wut in sich aufsteigen auf alles und jeden, auf ihren Mann, den sie, wenn sie allein ist, nur ›das Schwein‹ nennt, weil er sie sitzengelassen hat und jetzt mit seiner neuen Familie glücklich ist. Auf ihre Kinder, die schuld daran sind, dass sie keinen neuen Mann findet. Wer will sich schon drei Bälger von einem anderen anhängen lassen? Eine Zeitlang ist sie fast jeden Abend ausgegangen, um nach einem Vater für die Kinder zu suchen. So hat sie das gerechtfertigt, wenn Frido sie mit großen Augen ansah, weil er schon wieder seine Schwestern ins Bett bringen musste. Aber die Wahrheit ist viel bitterer. Sie schaut in den Spiegel, intensiv, unverwandt, als wolle sie durch ihre Augen in ihren eigenen Kopf hineinschauen. Die Wahrheit ist, dass sie sich so schrecklich allein fühlt, so schrecklich allein, dass alles sinnlos wird, alles. Sie sieht, wie die Tränen aus ihren Augen quellen bei diesen Gedanken, sie denkt, Du Heulsuse, aber sie weint trotzdem und schaut sich dabei zu.
Nach einer Weile spürt sie, wie die Energie aus ihrem Körper weicht. Sie fühlt sich kraftlos. Sie greift zu der Schachtel, die auf der schmalen Waschmaschine liegt, gleich neben dem Becken, vor dem sie steht. Sie nimmt zwei Tabletten heraus, zwei sind besser als eine. Mit Wasser spült sie sie hinunter. Das allein beruhigt sie, sie weiß, dass die Wirkung bald einsetzt. Dann wird sie sich besser fühlen, gerade so, als wäre sie nach einer stürmischen Überfahrt in einen sicheren Hafen eingelaufen. Diese verdammte Gute-Nacht-Geschichte! Am liebsten würde sie Frido verbieten, Geschichten zu erzählen. Doch mit welchem Grund? Vielleicht könnte sie ihm sagen, dass die Kleine nicht schlafen kann. Aber dann würde er sofort bemerken, dass sie lügt, denn es ist ja gerade wegen der Geschichten, dass Chiara, die kleine Klette, einschläft, wenn ihre Mutter wieder einmal ausgeht, um einen zu finden, der sie aus ihrer Einsamkeit rettet. Sie lacht kurz auf. Du dumme Kuh!, sagt sie zu ihrem Spiegelbild. Hast du wirklich geglaubt, ausgerechnet ein Mann könnte dich retten? Ausgerechnet ein Mann! Jetzt lacht sie, sie weiß, dass es nichts mit den Tabletten zu tun hat, sondern damit, dass sie die Wahrheit sagt. Doch das Gefühl währt nur so lange, bis sie wieder einmal versucht, die Entscheidung zu fällen, dass sie einfach nicht mehr suchen, sondern ihr Leben als alleinstehende Mutter akzeptieren wird, dass sie es dem Schicksal überlassen wird, ob und wann der Richtige kommt, und wenn er nie kommt, dann kommt er eben nie. Dann bleibt sie eben allein.
Sie fühlt, dass sie nicht stark genug für solche Gedanken ist. Eine Trauer flutet von unten hoch und schlägt über ihrem Kopf zusammen, sie erinnert sich, dass sie ihren Mann, das Schwein, durch Zufall kennengelernt hatte. Alles war so gewesen, wie sie sich das stets vorgestellt hatte, Liebe auf den ersten Blick, Schicksal, und er war so charmant gewesen, seiner Gefühle so sicher! Sie sieht Bilder vor ihrem inneren Auge, sein Lächeln, seine Umarmung. Fast lächelt sie jetzt in den Spiegel, so schön war es damals. Was ist nur schiefgegangen, was hat sie falsch gemacht?
Jedes Mal, wenn sie jetzt Männer trifft, um zu sehen, ob einer was taugt, weiß sie nicht, ob sie auch alles sieht, was sie sehen muss, um die richtige Entscheidung zu treffen. Deshalb spricht sie von ihren Kindern, die Kinder sind der Test. Wenn einer mich wirklich will, sagt sie sich, dann nimmt er mich auch mit den Kindern. Sie bemerkt nicht, dass sie mit der Tür ins Haus fällt und die Männer verscheucht, und wenn sie es bemerkt, nimmt sie es in Kauf. Warum eigentlich? Sie hat keine Antwort. Die Wirkung der Tabletten setzt ein, der sichere Hafen, sie spürt, wie sich die Wogen glätten. Gut so, denkt sie, und begibt sich ins Wohnzimmer, wo der Fernseher schon wartet.
Am nächsten Morgen schrillt der Wecker um halb sieben. Sie hatte ihn nicht gestellt. Das war Frido. Veronika spürt die Nachwirkung der Tabletten. Sie fühlt sich dumpf und bleiern. Sie stemmt sich gegen die Schwerkraft und kommt auf die Beine. Als sie steht, wird es langsam besser. Auch der Fernseher ist ausgeschaltet. Sie lächelt schwach. Was würde ich nur ohne meinen Frido machen?, denkt sie und öffnet seine Zimmertür. Da liegt er in seinem Bett, ihr Großer, fast zwölf Jahre alt, ein zarter, hochgewachsener Junge mit einem Gesicht … Sie genießt seinen Anblick, doch schon mischt sich Gift in den Moment. Das Gift ist ein Gedanke, immer derselbe, er lautet: Vielleicht wäre Leo bei ihr geblieben, wenn sie besser verhütet hätte. Dann hätten sie nur Frido und alles wäre gut. Das Gift erinnert sie an ihre Töchter. Sie schaltet das Licht ein und weckt ihren Sohn. Frido schlägt die Augen auf und lächelt sie an. Das tut er jeden Morgen. Wie kann ein Mensch nur so gut gelaunt sein! Sie hat keine Erklärung dafür. Sie öffnet die Tür zu den Mädchen, macht Licht und ruft »Aufstehen!«. Dann geht sie in die Küche. Die Tabletten vom Vorabend machen ihre Bewegungen langsam und auf seltsame Weise bewusster als sonst. Veronika gefällt diese Wirkung, auch wenn es anstrengend ist, sich in diesem Zustand alles zu merken.
Zuerst kocht sie sich Kaffee. Dann stellt sie drei Teller auf den Küchentisch, ein billiges Ding aus Pressspan mit vier dünnen Metallbeinen, das sie mal günstig gekauft hat. Seine Oberfläche ist grau-weiß meliert, da sieht man die Flecken nicht so schnell. Sie toastet Brot, dann holt sie Margarine, Marmelade und Schinken aus dem Kühlschrank, ein Glas Nutella steht noch vom Vortag dort.
Als der Kaffee durchgelaufen ist, setzt sie sich hin und trinkt ihn mit viel Zucker. Währenddessen hört sie, wie Frido ins Zimmer der Mädchen geht. Sie isst eines der getoasteten Brote, dann steht sie auf, zieht ihren Mantel an, hängt sich die Handtasche über die rechte Schulter und verlässt die Wohnung. Sie muss sich beeilen. Wie üblich, nimmt sie den Umweg, das kostet sie mindestens eine Viertelstunde, aber anders geht es nicht. Jeden Morgen versucht sie, das als normal zu empfinden, doch es bleibt ein Umweg.
Auch heute huschen Bilder durch ihren Kopf, die sie zur Seite schiebt. Es ist kalt, ihr Atem bildet kleine Dampfwölkchen, während sie an der vierspurigen Straße entlanghastet bis zur Überführung. Sie ist nicht warm genug angezogen, kurzer Rock, Netzstrumpfhose, Turnschuhe, eine Art College-Mantel, der zu kurz ist für diese Jahreszeit. Sie nimmt es in Kauf, sie sagt sich, Solange ich noch jung genug dafür bin.
Es herrscht Berufsverkehr, die Autos schieben sich in zähem Fluss ihren Zielen entgegen. Die Überführung ist ein großer Bogen aus Beton, weit genug geschwungen, damit auch Fahrradfahrer sie benutzen können ohne abzusteigen. Veronika beeilt sich, hinüberzugelangen, der Autolärm ist hier noch lauter, von oben sieht sie nur fahrende Dächer, keine schöne Aussicht. Auf der anderen Seite führt ein Fußweg zwischen zwei Häuserblocks hindurch und stößt auf eine stark befahrene Straße, die eine breite Schneise durch ein Wohnviertel zieht. Hier muss sie nur noch links abbiegen, dann kann sie endlich auf dem direkten Weg weitergehen.
Veronika geht jetzt an einer Bretterwand entlang, auf der man den Entwurf einer Wohnsiedlung sehen kann. Früher hat es hier einen Großmarkt für Selbständige und Unternehmer gegeben. Zusammen mit den Wohnsilos auf der anderen Straßenseite verleiht sie der Gegend etwas Trostloses, doch Veronika ignoriert ihre Umgebung. Obwohl sie schnell geht, kriecht die Kälte unaufhaltsam in ihren Körper.
Ein paar Minuten später erreicht sie ein achtstöckiges Gebäude aus Waschbeton und viel Glas. Es liegt gleich hinter der Baustelle. Im sechsten Stock befindet sich die Praxis von Dr. Prauschka. Das ist ihr Ziel. Hier wird sie den Tag verbringen und versuchen, sich auf die Patientinnen zu konzentrieren, auf deren Ängste, Sorgen und Beschwerden, sie wird versuchen, zu jeder einzelnen freundlich zu sein und alles korrekt aufzuschreiben, sie wird sich Mühe geben, im Computer kein Durcheinander anzurichten, damit auch morgen noch alles in Ordnung ist. Sie wird sich zusammenreißen wie die letzten sechseinhalb Jahre auch, damit das Jugendamt weiterhin davon überzeugt ist, dass sie, Veronika Kelber, in der Lage ist, ihre Kinder selbst großzuziehen. Aber am Abend wird sie todmüde sein und sich fragen, wofür sie das alles eigentlich auf sich nimmt, das weiß sie jetzt schon. Doch sie schiebt den Gedanken beiseite und betritt das Gebäude, nimmt den Aufzug, fährt in den sechsten Stock, sucht nach dem Schlüssel in ihrer Handtasche und schließt die Praxis auf.
2
»WIE HAT DER MANN GEHEISSEN?«
»Ich weiß es nicht, Chiara, hab ich dir doch eben schon gesagt. Putz dir endlich die Zähne, wir müssen los. Mira?«
»Ja, ja, großer Boss, ich bin soweit.«
»Siehst du, Chiara, deine Schwester und ich sind fertig, mach jetzt endlich!«
»Ich mach ja, schon. Aber wie könnte er denn geheißen haben, sag!«
»Was weiß ich! Emil vielleicht? Es ist nur eine Geschichte. Putz dir die Zähne!«
»Emil? Hm. Nein, so hat er nicht geheißen.«
Endlich ist Chiara fertig. Frido schnürt ihr die Schuhe zu, um Zeit zu gewinnen. Er hilft ihr, den Mantel anzuziehen und den Ranzen zu schultern, dann geht es los. Zu dritt verlassen sie die Wohnung, Frido wartet an der Wohnungstür, bis Mira und Chiara auf den Flur getreten sind, dann zieht er sie zu, schließt ab und steckt den Schüssel in seine Hosentasche. Sie nehmen den Fahrstuhl und fahren in die Tiefe. Niemand spricht, alle sind müde. Mira hört Musik auf ihrem Nano, Chiara hängt ihren Gedanken nach. Beide verlassen sich darauf, dass Frido sie sicher zur Schule bringt.
Es ist Routine, doch nachdem Frido die Mädchen in der Grundschule abgeliefert und noch so lange am Eingang gewartet hat, bis sie im Gebäude verschwunden sind, fühlt er sich zugleich erleichtert und sehr müde. Er muss sich nun beeilen, um nicht selbst zu spät zu kommen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter, je nachdem, wie schnell seine Schwestern morgens sind. Heute wird er es nicht schaffen.
Er läuft die Straße entlang, der sperrige Ranzen tanzt auf seinem Rücken hin und her. Als er am Lotto-Toto-Laden vorbeikommt, späht er unwillkürlich durchs Schaufenster. Und da steht er auch heute und bedient gerade jemanden, der Mann, an dessen Namen Frido sich nicht mehr erinnert, den er vielleicht aber auch nie gewusst hat. Er ist ihm schon öfter auf der Straße begegnet. Vor Schreck ist ihm jedes Mal eine Hitze ins Gesicht geschossen, und er hat versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Doch der Mann hat ihn zum Glück nicht wiedererkannt.
In der Eile hat Frido keine Zeit, länger darüber nachzudenken, nur flüchtig wird ihm bewusst, dass er sich unwohl fühlt, seit er Chiara das Märchen erzählt hat. Warum muss sie auch ständig diese Frage stellen, das nervt doch nur, denkt er, und es würde nichts ändern, wenn sie ihn wüsste.
Bevor er sich damit beschäftigen kann, dass er sich seiner Sache gar nicht so sicher ist, trifft er auf einen Klassenkameraden, der sich auch verspätet hat. Gemeinsam legen sie die letzte Strecke bis zur Realschule zurück und unterhalten sich über andere Dinge.
Zur Mittagszeit geht Veronika Kelber auf demselben Umweg nach Hause, den sie morgens zur Praxis der Frauenärztin zurückgelegt hat. Unterwegs kauft sie im Supermarkt zwei Fertigpizzas, die sie zu Hause aufbacken wird. Eine halbe Pizza wird sie selbst essen, dann muss sie wieder zurück. Warum fahren Sie nicht mit dem Fahrrad?, hat Dr. Prauschka sie mehr als einmal gefragt. Veronika hat keine Antwort darauf, Fahrradfahren hat es in ihrer Familie einfach nicht gegeben. Aber dass sie den Umweg nimmt, das versteht die Ärztin, und vielleicht ist sie überhaupt der einzige Mensch, der zumindest ein wenig Bescheid weiß. Nicht die Wahrheit natürlich, die kenne nur ich, denkt Veronika. Und er, ergänzt sie fast unwillig und sieht sein Gesicht vor ihrem inneren Auge, Er kennt sie auch.
Ihre Kinder werden nach Hause kommen und anderthalb fast kalte Pizza Margherita im Ofen vorfinden. Fridos Aufgabe ist die gerechte Verteilung der Mahlzeit, ansonsten würden die Mädchen sich streiten und Chiara hätte das Nachsehen. Meistens zieht Mira sich auf ihr Bett zurück, wo sie über Kopfhörer Geschichten oder Musik hört. Dann sitzen Chiara und Frido allein in der Küche.
So ist es auch heute. Während sie essen, beobachtet Chiara ihren Bruder. Frido wirkt komisch, findet sie. Sie kann nicht ahnen, dass er auf die Wiederholung der Frage vom Morgen wartet. Sie sagt: »Frido?«
»Hm?«
»Warum sind wir so selten beim Papa?«
Frido zuckt mit den Schultern und isst weiter. Er denkt an Irene, die Frau des Vaters, und verspürt kein Bedürfnis, dort zu sein. Er sagt: »Der Papa hat viel zu tun.«
»Die Mama auch, aber wir sind trotzdem bei ihr.«
»Sind wir?«
»Ja, schau!« Sie macht eine weite Geste, die den Raum umfasst. Frido lacht kurz auf. Er sagt: »Die Küche ist unsere Mama, willst du das sagen?«
»Nein!«, gibt Chiara ungeduldig zurück. »Wir wohnen bei unserer Mama und nicht beim Papa!«
»Ist ja gut! Würdest du denn beim Papa wohnen wollen?« Chiara schüttelt den Kopf. Sie sagt: »Irene ist blöd.«
Frido muss grinsen, obwohl er das Gefühl hat, dass er das eigentlich nicht dürfte. Er sagt: »Irene ist eben ganz anders als Mama.«
»Blöd!«, beharrt Chiara und isst unbeirrt weiter. Eigentlich will sie noch sagen, dass ihr Vater immer nur herumschreit und dass auch das blöd ist, aber sie lässt es.
Einen Moment lang schaut Frido seine Schwester zärtlich an. Als ihre Augen wieder zu ihm wandern, senkt er den Blick und steckt sich das letzte Stück Pizza in den Mund. Er sagt: »Hast du Hausaufgaben auf? Und lüg mich nicht an!«
Chiara grinst frech, sie sagt: »Nur Malen.«
»Was malen?«
»Wörter!«, platzt sie heraus und lacht ihren Bruder aus, als hätte sie einen guten Scherz gemacht. Frido seufzt. Er würde jetzt gerne seine eigenen Sachen erledigen und anschließend seine Freunde treffen. Aber das geht nicht, er muss hier bleiben und auf seine Schwestern aufpassen. Er verdrängt den Gedanken an seine Freunde und sagt: »Dann mach es gleich.«
Chiara schaut ihren Bruder an. Sie würde sich am liebsten immer weiter mit ihm unterhalten, bis die Mutter nach Hause kommt. Doch Frido will nicht mehr reden, das spürt sie. Sie nickt und steht auf, nimmt ihren Schulranzen und geht ins Wohnzimmer.
Sie setzt sich aufs Sofa und blickt aus dem Fenster. Bald kommt der Frühling, dann wird es warm, darauf freut sie sich. Dann darf sie wieder das rosa Kleid mit den kurzen Ärmeln anziehen, das Frido ihr jetzt noch verbietet. Plötzlich wünscht sie sich, dass es die Mutter wäre, die ihr etwas verbietet, und nicht immer ihr Bruder. Sie denkt an die Ohrfeige vom Vortag und hört wieder das geflüsterte Nein, das so sonderbar und deshalb so besonders ist. Wie etwas Geheimnisvolles, etwas Wunderschönes. Immer wieder spielt Chiara den Moment durch, die Ohrfeige und das geflüsterte Nein, immer wieder kostet sie das intensive Gefühl aus. Aber nach dem sechsten oder siebten Mal schwindet es allmählich und zurück bleibt nur ein kurzer Film ohne Ton und ohne Gefühl. Leise sagt sie: »Marie!«, als rufe sie verstohlen nach ihr. Dann schlägt sie das Schulheft auf, legt sich auf den Boden und schreibt den Namen hinein, macht Schnörkel darum, fährt die einzelnen Buchstaben nach, versucht, die Entfernung zwischen sich und Marie zu überwinden, um wieder Marie zu sein. Doch es gelingt ihr nicht, es fühlt sich an wie eine taube Stelle, gegen die sie stößt, und je häufiger sie es tut, desto tauber wird die Stelle und desto weiter entfernt sie sich von etwas, das sie schon gar nicht mehr sehen kann. Endlich gibt sie auf und macht ihre Hausaufgaben.
3
HEUTE IST DER WURM DRIN. Veronika versucht, sich auf Rezepte, Telefonate und Termine zu konzentrieren, doch alles, was sie zustande bekommt, ist ein Lächeln, wenn eine Patientin sie fragend anschaut, weil sie nicht zugehört hat. Ab und zu kommt Dr. Prauschka aus einem der Behandlungszimmer und schaut nach dem Rechten, als wüsste sie, dass Veronika nicht Acht gibt. Sie ist eine hochgewachsene Frau mit vollem, grauem Haar, das sie offen trägt. Ihre wasserblauen Augen sind ganz klar, und obwohl sie schon weit über sechzig ist und ihre Haut an Spannkraft verloren hat, wirkt sie jugendlich. Veronika bewundert die Ärztin dafür und gleichzeitig fürchtet sie sich vor dem Älterwerden. So, wie ich jetzt drauf bin, denkt sie, werde ich nicht wie Dr. Prauschka sein. Wie bin ich eigentlich drauf?, fragt sie sich dann, und stellt fest, dass sie diese Frage noch nie an sich selbst gerichtet hat. Wie geht es dir, Veronika? Sie erinnert sich nicht, dass ihre Eltern sich jemals danach erkundigt hätten. Nicht so gut, denkt Veronika, und meint ihren Gemütszustand. In diesem Moment fällt ihr auf, dass sie schon wieder einen Fehler gemacht hat. Sie hat wie vom Autopiloten gesteuert ein Rezept in den Computer getippt und es dem falschen Patienten zugeordnet. Inzwischen stehen schon drei Neuankömmlinge am Empfang und wollen ihren Termin wahrnehmen, während sie erst noch alles nachbessern muss. Sie wird hektisch und macht weitere Fehler, die sie zwar sofort korrigiert, aber dadurch dauert es immer länger, bis die neuen Patientinnen aufgenommen sind, einige von ihnen sind hochschwanger. Veronika muss sich sehr anstrengen, um wieder Schritt halten zu können. Als sie um fünf Uhr endlich Feierabend hat, ist sie erschöpft.
Sie verabschiedet sich von der Ärztin und ihren Kolleginnen und verlässt die Praxis. Sie nimmt den Fahrstuhl nach unten. Aber als sie aus dem Gebäude tritt, folgt sie einem plötzlichen Impuls und schlägt nicht die Richtung zur Überführung ein, sondern geht geradeaus weiter. Sie rechnet. Sechseinhalb Jahre und zwei Wochen. Vielleicht ist das genug, denkt sie. Vielleicht.
Sie sieht es schon von Weitem. Es kommt ihr so vertraut vor, als wäre sie erst gestern dort gewesen. Die breite Straße, das lange Wohngebäude, die verglasten Galerien, die zu den Wohnungen führen. Unwillkürlich wird sie langsamer, sie fühlt sich, als betrete sie ein Museum, das jemand mitten auf der Straße errichtet hat, ein Museum, das die Straße und alles, was dazu gehört, selbst ist. Sie bleibt stehen und schaut. Sie weiß genau, welche der Tonnen es war. Sie hört genau, welches Geräusch entsteht, wenn man ihren Deckel zurückschiebt. Sie spürt genau, wie das kleine Gewicht ihre Hände verlässt, sie sieht genau, wie der Deckel wieder über die Öffnung schwingt und alles, was dort zurückgeblieben ist, ins Dunkel taucht.
Veronika Kelber macht kehrt und läuft den Weg zurück, den sie gekommen ist. Obwohl sie schnell außer Atem ist, rennt sie, bis sie die Überführung hinter sich gelassen hat. Dann bleibt sie kurz stehen, ordnet ihre Kleider und geht weiter. Es dämmert bereits, die Luft ist schneidend kalt geworden. Sie geht jetzt sehr langsam, ihr ist nicht mehr kalt, aber sie fühlt sich schwach, die Handtasche an ihrer Schulter kommt ihr schwer vor, sie wechselt sie auf die andere Seite, doch es wird nicht besser.
Als das Mietshaus, in dem sie mit ihren Kindern wohnt, in Sichtweite rückt, hat das Licht weiter abgenommen. Vor dem Eingang trifft sie auf Chiara, die dort mit ihrem Roller hin und her fährt. Chiara kommt auf sie zu. Sie ruft: »Mama! Mama!« Veronika Kelber spürt, wie etwas in ihr, das eben noch pulsiert hat, fest wird und verschwindet. Sie sagt: »Was treibst du dich hier herum?«
»Entschuldige, Mama, ich habe auf dich gewartet.«
Veronika erwidert nichts. Die Liebe, die dieses kleine Mädchen für sie empfindet, erscheint ihr rätselhaft. Sie denkt, Wenn sie die Wahrheit wüsste. Das hat sie oft gedacht in den letzten sechseinhalb Jahren, aber bis gestern hat sie den Gedanken erfolgreich wegschieben können, sooft er auftauchte. Jetzt bleibt er in der Luft hängen wie Rauch.
Chiara ergreift ihre Hand, sie lässt sie gewähren, gemeinsam gehen sie zum Eingang. Veronika sperrt auf, das Flurlicht schaltet sich automatisch ein, sie steuern auf den Briefkasten zu, Veronika holt die Post heraus, dann wenden sie sich zum Aufzug, Chiara schleift den Roller, ein kleines Ding aus pinkfarbenem Plastik, mit einer Hand hinter sich her. Sie sagt: »Ich hab meine Hausaufgaben schon gemacht.«
Veronika nickt abwesend, beim flüchtigen Durchsehen der Post ist sie auf einen Brief von der Schule gestoßen. Der Aufzug kommt, Chiara zieht mühsam die Tür auf, Veronika nimmt es kaum wahr, sie hat den Brief geöffnet, Hoffentlich nichts Schlimmes, denkt sie und betritt den Aufzug, Chiara folgt ihr, die Tür fällt zu, Chiara drückt auf den Knopf, siebter Stock.
Veronika liest den Brief, es geht um Mira. Der Klassenlehrer bittet sie zur Sprechstunde, da Miras Übertritt gefährdet ist. Veronika seufzt. Sie will sich jetzt mit nichts auseinandersetzen. »Ist es was Schlimmes?«, fragt Chiara.
Veronika schaut auf. Im weißen Licht der Aufzugsbeleuchtung sieht sie, dass Chiaras Lippen rissig und blau vor Kälte sind. Sie hat nur ihr Mäntelchen an, keine Handschuhe, keinen Schal, keine Mütze. Irgendwo im Hintergrund hört Veronika ihre eigene Mutter schimpfen, wie sie es immer tat, wenn sie im Winter einfach hinausgelaufen war. Doch sie schimpfte stets so, dass Veronika das Gefühl hatte, fehlerhaft zu sein. Jetzt sieht sie ihrer Tochter in die Augen und sagt: »Ist dir kalt?«
»Nein, bestimmt nicht, Mama.«
»Doch, dir ist kalt.«
»Nur ein bisschen.«
»Wenn du dich nicht warm genug anziehst, holst du dir den …«, sie zögert, »… Tod dort draußen«. Sie schweigt. Der Aufzug kommt im siebten Stock an.
Sie essen zu Abend, Veronika, Frido, Mira und Chiara. Es ist eng auf dem vollgestellten Tisch, es gibt Butterbrot mit Schinken und Käse. Veronika kommt sich nicht wie die Mutter ihrer Kinder vor, eher wie deren ältere Schwester. Auch dieses Gefühl hat sie oft gehabt, heute nimmt sie es stärker wahr.
Sie essen schweigend. Veronika überlegt, ob sie mit Mira über den Brief sprechen soll. Doch sie fürchtet sich davor, Mira ist eine Kratzbürste. Sie denkt, Darüber denke ich später nach. Ihre Blicke suchen Frido, aber ihr Sohn sitzt ganz in sich gekehrt da, genau ihr gegenüber, doch so, als wäre er gar nicht da, während er sein Brot mit langsamen, fast gleichgültigen Bewegungen kaut.
Sie ahnt nicht, dass Frido unruhig ist, seit er Chiara diese Geschichte erzählt hat. Er fühlt sich wie jemand, der eine verbotene Grenze mit einem Fuß übertreten hat, nur ganz kurz zwar, doch nun ist da ein Abdruck, der nicht mehr verschwindet. Um ihn wegzuwischen, müsste er sich erneut dorthin begeben, er hat darüber nachgedacht. Er könnte die Geschichte anders ausschmücken, irgendwie so, dass Chiara auf andere Gedanken käme. Vielleicht ist das eine gute Idee.
Nach dem Abendbrot zieht Mira sich zurück, Veronika folgt ihr. Sie betritt das Zimmer der Mädchen, drückt die Tür mit dem Rücken ins Schloss und bleibt stehen. Mira hat sich schon auf ihrem Bett niedergelassen und will sich die Kopfhörer aufsetzen. Sie hält inne, schaut ihre Mutter fragend an. Veronika fasst sich und sagt: »Da ist ein Brief von der Schule.«
Miras Blick verschleiert sich sofort, betont gleichgültig sagt sie: »Aha.«
»Ich soll in die Sprechstunde von Herrn Maier kommen, sie sagen, dein Übertritt ist gefährdet.«
»Und?« Jetzt blitzt eine stumme Wut in Miras Augen auf. Veronika möchte am liebsten den Raum verlassen, gleichzeitig weiß sie, was eine Mutter jetzt sagen würde. Sie sagt: »Möchtest du auf die Hauptschule gehen?«
Mira zuckt mit den Schultern. »Ist doch eh egal.«
»Mit lauter Ausländern, die kaum Deutsch sprechen?«
»Hast du was gegen Ausländer?«
Veronika seufzt. Bloß keinen Streit anfangen. Sie sagt: »Dann sage ich Herrn Maier, dass du auf die Hauptschule gehen möchtest.« Sie will sich zum Gehen abwenden, aber Mira kommt ihr zuvor. Sie fährt wütend hoch und sagt: »Nichts sagst du dem! Hast du gehört? Nichts!«
Veronika fährt herum. »Wie redest du eigentlich mit mir! Ich bin deine Mutter, hörst du!«
Mira macht ein abfälliges Gesicht. Sie sagt: »Du hast doch keine Ahnung, was an der Schule läuft.«
»Ich werde übermorgen hingehen, und Herr Maier wird es mir sagen!«
»Herr Maier wird es mir sagen«, äfft Mira ihre Mutter nach. Veronika macht zwei schnelle Schritte, bevor sie nachdenken kann, ist sie bei Mira und versetzt ihr eine Ohrfeige. Mira schreit auf, dann wirft sie sich auf ihr Kissen. »Du blöde Kuh, lass mich in Ruhe! Blöde Kuh, blöde Kuh, blöde Kuh!« Sie hat es aus vollem Hals geschrien, so dass sämtliche Nachbarn es hören müssen. Veronika schaut in das wutverzerrte Gesicht ihrer Tochter und erschrickt. Sie macht kehrt und verlässt das Zimmer mit dem bitteren Gefühl, erneut gescheitert zu sein. Mira ruft ihr hinterher: »Hau ab!«
Als Veronika draußen ist, atmet sie tief durch. Dann geht sie ins Wohnzimmer, schließt die Tür hinter sich und schaltet den Fernseher ein.
In der Küche sitzen immer noch Frido und Chiara. Sie haben schweigend gelauscht. Jetzt baumelt Chiara mit den Beinen und blickt ihren Bruder an. Sie sagt: »Frido?«
»Soll ich dir eine Geschichte erzählen?«
Chiara ist überrascht. Sie ruft: »Du kannst ja Gedanken lesen!« Frido lächelt seine Schwester an. Chiara springt von ihrem Stuhl und rückt ihn ganz dicht an Frido. Dann setzt sie sich wieder und kuschelt sich an ihn. Sie sagt: »Schieß los!«, und lacht. Geschichten sind wie ein Zuhause, findet sie. Vor allem, wenn Frido sie erzählt.
Frido überlegt. Wie soll er anfangen? Er sagt: »Du erinnerst dich doch an die Geschichte mit dem Baby und dem alten Mann, die ich dir erzählt habe?«
»Na klar!«
»Nun ja, die ist nicht wahr.«
»Nicht wahr?«
»Ja, ich hab sie mir ausgedacht.«
Chiara schaut Frido verwundert an. Sie war davon ausgegangen, dass es eine erfundene Geschichte ist. Sie fragt sich, Warum muss er das jetzt sagen? Sie schaut ihn genauer an. Er sieht ganz nervös aus. Frido sagt: »Also, ich meine, klar ist sie ausgedacht. Wie alle Geschichten eben. Aber mit dieser Geschichte stimmt etwas nicht, weißt du, was ich meine?« Chiara schüttelt den Kopf. Frido fühlt sich in die Enge getrieben. Er sagt: »Also, was ich meine, ist, dass sie in Wahrheit anders war, ich hab sie anders gelesen.«
»Ist es eine aufgeschriebene Geschichte?« Chiara schaut ihn interessiert an. Wenn die Geschichte aufgeschrieben ist, kann Frido sie ihr vielleicht vorlesen.
»Nein, nicht so.« Frido windet sich, er kommt sich vor wie im Sommer, wenn er mit seinen Freunden im Stadtbach schwimmen geht. Obwohl man flussaufwärts schwimmt, wird man immer weiter abgetrieben. Er atmet tief durch. »Also«, sagt er, »das ist so: Es ist eine Geschichte, die in einer Zeitung stand.« Er hält inne. Er spürt, dass er nicht lügen kann, ihm fällt immer nur die Wahrheit ein. Was hat er sich da nur eingebrockt?