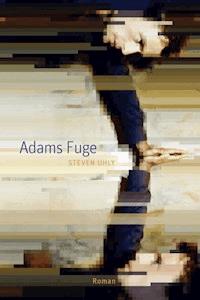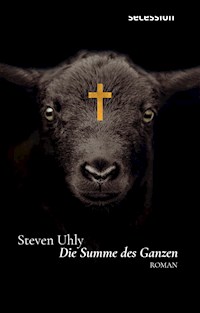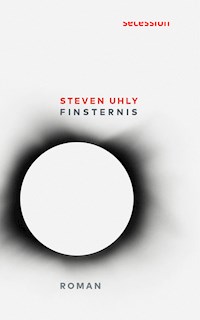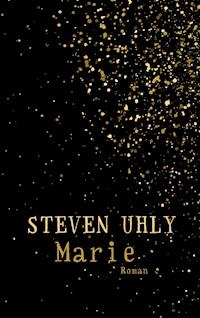Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Secession Verlag für Literatur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mitnichten nur ein Familienroman, entwirft dieses Debüt ein seelisches Panorama unserer Zeit, das Existenzielles zur Sprache bringt und zugleich ein kostbares Rezept an die Hand liefert: Freiheit? Gar Entscheidungsfreiheit? - Dass wir nicht lachen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein Leben in Aspik
Steven Uhly
ROMAN
FÜR DIE KINDER
Meine Oma hat nie einen Hehl aus ihren Gefühlen gemacht. Zumindest nicht vor mir. Dass sie ihrem Mann, meinem Opa, grollte, weiß ich, seit ich denken kann. Aber sie respektierte meine Auffassungsgabe. Erst als ich neun Jahre alt wurde, begann sie, mir von ihren Mordplänen zu erzählen. Ich hatte nichts dagegen, sie waren wie spannende Gutenachtgeschichten. Mein Lieblingsmordplan ging so:
»Eines Tages, Jungchen, wird er nicht mehr so stark sein, weißt du, denn er ist sehr stark, dein Opa.«
»Wie stark?«
»Er ist stärker als alle Omas zusammengenommen.«
»Wie viele Omas gibt es denn?«
»Oh, es gibt eine Menge, aber sie alle müssen warten, bis die Opas schwächer werden. Und das passiert immer.«
»Warum denn, Oma?«
»Das weiß Gott allein. Vielleicht hat er sie stärker und dann schwächer gemacht, damit sie zuerst über die Omas herrschen, aber nicht zu lange, denn sonst könnten die Omas sie nicht mehr ermorden und müssten immer unglücklich bleiben.«
»Warum willst du Opa denn ermorden?«
»Weil er immer ganz gemein zu mir ist, Jungchen. Und gemeine Menschen müssen von Zeit zu Zeit ermordet werden.«
»Und wie willst du es machen?«
»Also, gib gut acht, denn es ist ein teuflisch guter Plan: Zuerst werde ich ihm immer weniger zu essen geben, dadurch geht das Schwächerwerden noch etwas schneller.«
»Aber er wird doch Hunger haben!«, rief ich aus. Opa war wirklich ein großer und sehr starker Mann und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass er aufs Essen verzichten würde. Meine Oma aber lächelte nur hintergründig und sagte:
»Findest du nicht auch, dass er in letzter Zeit ein wenig dicker um die Hüften geworden ist?« Das war mir noch nicht aufgefallen.
»Siehst du«, sagte sie triumphierend. »Ich werde ihm einreden, dass er immer dicker werden wird, wenn er so weiter frisst. Und dann wirst du nicht mehr groß und stark sein, werde ich sagen, sondern nur noch groß und dick, wie eine Wurst. Und weißt du, was er sagen wird?«
»Nein, was denn, Oma?« Ich hing wie gebannt an ihren Lippen und sie genoss es und ich genoss, dass sie es genoss.
»Er wird sagen«, sagte sie und drückte ihr Kinn fest auf den Hals, bis sich die Haut in Falten vorwölbte, dann wackelte sie wie ein Orang-Utan mit abgewinkelten Armen hin und her und sagte mir ihrer dunkelsten Stimme: »Er wird sagen: Was redest du da wieder für einen Unsinn, Fötzchen, hohoho! Aber dann«, jetzt wurde sie wieder vom Opa zur Oma, »dann wird er trotzdem zum Spiegel gehen und sich ganz unsicher darin betrachten und er wird denken, dass er wirklich dabei ist, groß und dick zu werden, und zack!«, machte sie so laut, dass ich erschrak, »habe ich ihn da, wo ich ihn haben will!«
»Aber vom weniger Essen stirbt man doch nicht, Oma.«
»Natürlich nicht, Jungchen, denkst du, ich will, dass er einfach nur stirbt? Oh, nein, dass hat er nicht verdient! Dein Opa muss auf furchtbare Weise sterben, siehst du das denn nicht?«
»Nein«, sagte ich ganz naiv.
»Natürlich nicht«, sagte sie beruhigend und tätschelte mich, »du bist ja auch noch viel zu jung für solche Dinge, und deshalb muss ich es tun, wer sollte mir denn helfen? Etwa deine Mutter?« Sie lachte kurz auf. »Nein, nein, das ist allein meine Sache.«
»Aber wie geht es denn jetzt weiter, Oma?«, rief ich ungeduldig.
»Also, wie es weitergeht, das erzähle ich dir morgen Abend, und jetzt schlaf gut.« Sie küsste mich auf die Stirn und ließ mich mit meinen Gedanken allein, die um den Mordplan kreisten. Meistens schlief ich ziemlich schnell ein, weil daraus Abenteuer wurden, die geradenwegs in einen Traum führten.
Ich hatte auch gar keine Lust, meinen Opa zu ermorden, denn er spielte sehr schöne Spiele mit mir, zum Beispiel Böser Wolf und kleines Schaf. Dazu gingen wir auf den größten Spielplatz im Viertel, wo es einen Hügel und viel Gebüsch gab. Dort lief Opa mir laut knurrend hinterher und brüllte: »Ich fress’ dich, ich fress’ dich!«, und ich versuchte schreiend, zu entkommen. Am liebsten brach er durch das Unterholz wie ein echtes wildes Tier. Die anderen schauten zu und feuerten mich oder Opa an, aber die Mütter mochten unser Spiel nicht und zwangen ihre Kinder, woanders zu spielen.
Eigentlich verstand ich gar nicht, warum Oma Opa ermorden wollte. Aber dann war es ja auch nur eine Gutenachtgeschichte und Oma konnte so gut erzählen, dass ich jedes Wort glaubte.
Oma hielt ihre Versprechen immer. Deshalb erzählte sie mir am folgenden Abend den Rest ihres Mordplans. Sie wollte Opa, wenn er erst schwach geworden wäre, auf eine weite Reise mitnehmen, am besten zu den Indern, wo alle ganz dünn waren und auf Nägeln saßen. Dort sollte Opa Yoga machen und zum Vegetarier werden. Das konnte ich mir kaum vorstellen, denn Opa aß am liebsten Fleisch.
»Wart’s nur ab«, sagte Oma und lächelte listig, »ich werde ihm sagen, dass er früh sterben wird, wenn er weiter so viel Fleisch isst. Und weißt du, was er dann sagen wird?«
»Ich weiß, ich weiß!«, rief ich aufgeregt, machte die Orang-Utan-Bewegungen und sagte mit möglichst tiefer Kinderstimme: »Was redest du da wieder für einen Unsinn, Fötzchen, hohoho!«
»Genau das wird er sagen! Du bist ein kluger Junge, Jungchen. Aber gib gut acht, denn jetzt kommt es: Er wird natürlich wieder denken, dass ich doch die Wahrheit gesagt habe, weil ich ja auch sonst immer die Wahrheit sage, und zack! – isst er nur noch Gemüse.«
»Und alles bei den Indern?«
»Alles bei den Indern, Jungchen.«
»Warum denn da und nicht hier, Oma?«
»Ganz einfach: Die Inder sind alle sooo dünn, und das kommt davon, dass die meisten fast nichts zu essen haben. Opa wird sich dort fühlen wie eine noch viel dickere Weißwurst. Und er wird versuchen, sich klein zu machen, und zack! – isst er nur noch Gemüse. Hier in Deutschland würde er doch nur denken, dass er ziemlich schlank ist. Siehst du, wie klug mein Plan ist?«
»Und dann?«
»Und dann und dann! Sei nicht ungeduldig, Jungchen, gut Ding will Weile haben, ein Mordplan ist kein Pappenstiel.«
»Bitte, bitte! Noch ein bisschen!«
»Also gut, aber nur ein bisschen, abgemacht?«
»Abgemacht.« Sie machte eine kleine Pause, schaute sich nach allen Seiten um, als ob sie fürchtete, jemand könne uns belauschen. Dann sagte sie leise:
»Weißt du, was ich dann mit ihm mache?«
»Nein«, flüsterte ich.
»Dann fahre ich mit ihm nach Zanskar. Das ist ein unbekanntes Königreich, ganz hoch oben im Himalaya-Gebirge.«
»Zanskar«, wiederholte ich, wie jemand, der eine Speise abschmeckt. Das Wort fühlte sich geheimnisvoll an.
»Ja, Zanskar«, raunte Oma und blickte ganz verschwörerisch. »In Zanskar gibt es nur Steine, Schnee und ein paar heiße Quellen. Und genau zu denen werde ich ihn bringen.«
»Aber warum so weit weg?«
»Weil man dort nur zu Fuß gehen kann«, sagte Oma ungeduldig.
»Und davon soll Opa sterben?«
»Nun stell dir doch deinen Opa einmal vor, Jungchen! So groß und stark wie er ist. Und plötzlich darf er nicht mehr so viel essen, wie er will, und plötzlich darf er kein Fleisch mehr essen, und plötzlich muss er wochenlang auf viertausend Metern Höhe zu Fuß durch karges Land gehen. Und anschließend setzt man ihn in eine heiße Quelle! Was meinst du?«
Ich musste zugeben, dass das alles gar nicht zu meinem Opa passte. Außer, dass er groß und stark war und sehr viel Fleisch aß, war Opa ein Mann, der gerne Auto fuhr, teuren Wein trank und schmutzige Witze erzählte. In Zanskar würde er Yoga machen müssen, dürfte keine Kraftwörter mehr benutzen und keiner anderen Frau hinterherschauen, sonst würde man ihn auf ein Brett mit Nägeln setzen, dafür wollte Oma sorgen. Und an allen diesen Verboten würde er zwangsläufig sterben.
»Das ist ein toller Mordplan, Oma, wann willst du anfangen?«
Sie schaute mich eindringlich an und sagte dann langsam wie jemand, der gleichzeitig an etwas anderes denkt:
»Ich muss erst noch ein paar andere Mordpläne mit dir besprechen, Jungchen, und du musst mir sagen, ob sie besser oder schlechter sind als dieser, einverstanden?«
»Einverstanden!«
So ging das viele Jahre lang, Omas Mordpläne waren alle sehr fantasievoll und je älter ich wurde, desto realistischer wurden sie. Ihren letzten Mordplan erzählte sie mir zwei Monate vor meinem fünfzehnten Geburtstag. Darin sollte Opa in Rudi Carrells neuer Sendung Am Laufenden Band mitmachen und gewinnen. Oma wollte Rudi Carrell mit viel Geld bestechen, damit er Opa auf eine unbewohnte Insel im Pazifik schickte, unter dem Vorwand, dass dies sein Hauptgewinn sei. Opa würde dann auf seinem Hauptgewinn verhungern. Auf die Frage, wie sie das viele Geld aufbringen würde, antwortete Oma, sie werde natürlich vorher eine Bank überfallen und sich zu diesem Zweck als RAF-Terroristin verkleiden, damit der Verdacht von ihr abgelenkt würde.
»Das ist ganz leicht«, sagte sie, »wenn man nämlich behauptet, dass es die Terroristen waren, dann glauben es alle.« Damals las ich schon die Zeitung und wusste, dass sie wohl recht hatte. Es war ein wirklich guter Plan.
Dann aber kam alles anders. Ungefähr ein halbes Jahr, nachdem Oma aufgehört hatte, Mordpläne zu erzählen und mir stattdessen Jugendbücher zu lesen gab, die alle nur halb so interessant waren, starb Opa an Rattengift. Er war mit den Jahren wirklich schwächer, vor allem aber senil geworden. Oft erzählte er denselben schmutzigen Witz drei- oder viermal hintereinander, meist eher sich selbst als anderen. Häufig lachte er dann auch noch dröhnend und schlug mit der Faust auf den Tisch. Er hatte mehrere Autounfälle verursacht, weil er betrunken war von den teuren Weinen, die er so gerne trank. Und wenn er anderen Frauen hinterherschaute, lief ihm Speichel aus dem Mundwinkel. Zudem war er ziemlich taub geworden. Wir Kinder hatten uns daran gewöhnt, mit ihm zu schreien, Oma aber sprach jetzt besonders leise mit ihm. Er schaute sie dann verständnislos an, aber sie wiederholte es nicht und er fragte auch nicht nach.
Plötzlich also war Opa tot. Und Oma war untröstlich, als die Polizei kam, um einige Fragen zu stellen. Sie kamen zu sechst, vier in Uniform mit Schirmmützen auf dem Kopf, die sie nicht abnahmen, und zwei in Zivil mit schwarzen Lederjacken und Sonnenbrillen. Sie waren alle kleiner als ich und standen breitbeinig herum. Sie setzten Oma ziemlich unter Druck, behaupteten sogar, sie habe ihren Mann ermordet. Meine Mutter war empört und wollte die Polizisten hinauswerfen, aber Oma hinderte sie daran.
»Es ist ihre Arbeit, Kleines«, sagte sie nachsichtig, »sie müssen mir auf den Kopf zusagen, dass ich alles geplant habe, um an meiner Reaktion zu sehen, ob es wahr ist oder nicht. Ist es nicht so, Herr Kommissar?«
»So ungefähr«, nuschelte einer der Männer in Zivil.
»Siehst du, Kleines? Es ist gar nicht schlimm, dass sie behaupten, ich hätte deinen lieben Papa ermordet, wenn es gar nicht wahr ist, weil er doch mein geliebter Petermann war.« Meine Mutter begann zu schluchzen, ich begann zu weinen, und Oma schnäuzte laut in ihr Taschentuch. Die Polizisten wurden von Unruhe ergriffen, umzingelt von drei weinenden Menschen, streckten sie schließlich die Waffen und traten den Rückzug an, nicht ohne eine Vorladung zum Verhör auf dem Tisch liegen zu lassen.
Oma ging pünktlich hin und erzählte den Polizisten, ihr geliebter Petermann hätte seit einiger Zeit die seltsame Gewohnheit gehabt, sein gebrauchtes Kukident-Wasser zu trinken, und in seiner Vergesslichkeit habe er vergessen, dass es sich um Tabletten handele, und deshalb habe er Rattengift in sein Kukident-Wasser geschüttet, das nun natürlich kein Kukident-Wasser mehr gewesen sei, sondern Rattengift-Wasser. Sein Gebiss habe dann die ganze Nacht in dem Rattengift-Wasser gelegen, und das allein wäre ja nicht tödlich gewesen, aber da er die seltsame Angewohnheit gehabt habe, sein Kukident-Wasser zu trinken, sei es nun mal geschehen wie es geschehen musste. Die Polizisten schauten Oma an, als sei sie verrückt. Einer fragte ungläubig, ob Opa denn das Rattengift direkt neben dem Kukident aufbewahrt hätte. Da erzählte Oma ihnen, dass Opa schon ganz häufig weiße Ratten gesehen hätte, und dass sie vermute, dies hänge mit dem vielen teuren Wein zusammen, den er immer trank. Auf jeden Fall habe die Angst vor den Ratten in den letzten Jahren immer weiter zugenommen, weshalb ihr geliebter Petermann immer Rattengift griffbereit haben wollte. Sie sei entschieden dagegen gewesen, was ja auch verständlich sei, da sie noch nie weiße Ratten in der Wohnung gesehen hatte, er aber habe geantwortet, das liege nur daran, dass sie keinen Wein trinke. Sie habe dann ein paar Mal mitgetrunken, aber nie irgendwelche Ratten oder andere Tiere bemerkt und es deshalb wieder aufgegeben. »Siehst du!«, habe er triumphierend gerufen, und seitdem hätten sie nicht mehr über das Rattengift im Badezimmerschrank gesprochen.
Als sie nach Hause kam, war Oma in bester Laune. Sie zog mich auf den Balkon und erzählte mir, das Verfahren sei eingestellt worden. Ich gratulierte ihr, und sie umarmte mich.
»Jungchen!«, rief sie aus, »ach, Jungchen!« Wir standen eine Weile Arm in Arm auf dem Balkon, während dunkle Regenwolken über uns hinwegzogen, um irgendwo im Hinterland abzuregnen. Es war kühl.
»Oma«, sagte ich nach einer Weile zögernd, »warum hast du Opa eigentlich …«
»Pssst!«, machte Oma, »hörst du das?« Ich hörte nichts.
»Eine Nachtigall! Um diese Jahreszeit!« Ich strengte mich an, aber alles, was ich hörte, war das ferne Tuten eines großen Schiffs, das Rascheln der trockenen Blätter in den Alleebäumen vier Stockwerke unter uns und die Musik aus einem Fenster weiter oben. Oma stand da und lauschte mit geschlossenen Augen und einem ganz und gar friedlichen Gesichtsausdruck. Ich fragte nichts mehr. Oma konnte sich auf mich verlassen. Niemand wusste, dass sie mir jahrelang Mordpläne erzählt hatte, in denen es darum ging, Opa zu beseitigen. Ich trauerte um Opa, obwohl er mich in letzter Zeit nicht immer mit dem richtigen Namen angesprochen hatte. Einmal hatte er mich ganz mürrisch angefahren und gesagt: »Was wollen Sie schon wieder hier, junger Mann?« Aber Oma war mir doch immer näher gewesen.
An meinem sechzehnten Geburtstag beschloss Oma, die Zeit für meine sexuelle Aufklärung sei gekommen und es gebe niemand Besseren dafür als sie. Fortan erzählte sie mir in allen Einzelheiten, wie sie Opa als junges Mädchen kennen gelernt hatte.
Sie lebte damals in Berlin und war ein begeistertes Mitglied von »Glaube und Schönheit«. Sie träumte davon, eines Tages selbst die Leitung des Werks zu übernehmen. Am liebsten schaute sie mit ihren Freundinnen den Zwangsarbeitern zu, die mit nackten Oberkörpern den Schutt von den Straßen räumten oder Luftschutzbunker aushoben. Das Wachpersonal drückte beide Augen zu, wenn sie ihnen kichernd Brotstücke zuwarfen und es genossen, dass die Männer sich gleich zu mehreren darum stritten.
Eines Tages geschah etwas Unerwartetes. Eben hatte sie einem der Arbeiter, einem sehr großen und starken, der erst ein paar Wochen da war, heimlich ein ganzes Brötchen vor die Füße geworfen. Er stand nur wenige Schritte von ihr entfernt, auf der anderen Seite eines Bauzauns. Aber anstatt sich auf den Boden zu werfen und das Brötchen sofort zu verschlingen, blieb er ruhig stehen, schaute zu Boden, schaute meiner Oma direkt in die Augen, schaute erneut zu Boden und setzte seinen linken Fuß auf das Brötchen. Es gab ein knackendes, knisterndes Geräusch. Meine Oma stand da wie zermalmt.
»Hast du das gesehen?«, fragte er sie in akzentfreiem Deutsch. Sie nickte schüchtern.
»Das bist du.«
Seitdem trafen sie sich regelmäßig. Mein Opa hieß eigentlich Piotr und war von der Wehrmacht an die Heimatfront geschickt worden, weil das Reich starke Arbeiter aus dem Osten stets willkommen hieß.
Hier nun begann die sexuelle Aufklärungsarbeit meiner Oma. Abend für Abend erzählte sie mir von ihren Liebesspielen mit Opa. Meistens trafen sie sich heimlich während der Mittagspause, das war die einzige Zeit, in der Opa sich die Beine vertreten durfte. Beim ersten Mal lauerte Oma ihm auf, um zu sehen, wohin er gehen würde, beim zweiten Mal wartete sie dort, wo er vorbeikommen musste. Als er sie sah, tat er, als bemerke er sie nicht. Nach wenigen Metern blieb er stehen und verschwand im Eingang eines ausgebombten Hauses. Oma folgte ihm, und da packte er sie, zog ihr den Rock hoch und legte sie bäuchlings über einen Mauerrest. Während er sie erbarmungslos mit seinem Glied traktierte, zischte er ihr Kraftwörter ins Ohr. Sie kamen mir alle bekannt vor. Einzig, dass er Oma damals am liebsten »Brötchen« nannte, war mir neu.
Oma ging täglich zur Baustelle und ließ Opa machen, was immer er machen wollte. Wäre das Reich nicht wenige Monate später zusammengebrochen, man hätte sie bestimmt erwischt. Als Deutschland kapitulierte, war Oma im dritten Monat schwanger.
»Als deine Mutter geboren wurde, Jungchen«, sagte Oma eines abends mit einem Seufzer, »war unser Glück vorbei.«
»Warum denn das?«, fragte ich überrascht.
»Oh, während der Schwangerschaft war es noch gut, weißt du, Opa fand meinen dicken Bauch sehr anziehend, wir spielten oft Flüchtlingsfrau und Rotarmist. Es war eine schöne Zeit. Aber als deine Mutter auf der Welt war, wurde mein geliebter Petermann plötzlich zu einem polnischen Katholiken. Es war schrecklich.«
»Aber was tat er denn?«, fragte ich verständnislos.
»Was er tat? Er tat nichts mehr!«, rief sie mit einer Empörung, die seit damals keine Stunde gealtert war. »Von einem Tag auf den anderen behandelte er mich wie ein Marienbild, das man zwar anbeten, aber nicht berühren und vor allem nicht traktieren darf. Jeden Wunsch las er mir von den Lippen ab, als wäre er nicht der größte und stärkste aller Zwangsarbeiter gewesen, ein brutales Schwein, sondern ein unterwürfiger Weichling. Oh, damals habe ich angefangen, ihn zu hassen!« Oma musste innehalten, so aufgebracht war sie. Aber dann atmete sie tief durch und lachte:
»In meiner Wut verlangte ich ganz unmögliche Sachen von ihm. Der Arme! Im Hungerwinter 46/47 führte er eine Kompanie Trümmerfrauen an, die die Stadt entrümpeln sollten. Es war so kalt, dass die Menschen starben, aber ich schickte ihn zu Fuß aufs Land, weil ich einen Schnaps haben wollte. Er blieb drei Wochen fort.« Sie machte eine Pause und schaute gedankenverloren aus dem Fenster. »Als er wiederkam, hatte er den Schnaps und roch nach einem anderen Schoß.«
»Warum hast du dich nicht von ihm getrennt?«
»Niemals, Jungchen! Einer muss das Sagen haben, und wenn ich so dumm war, einen Schwächling zu heiraten, dann war das mein Schicksal.«
»Aber Oma, du hättest doch einen anderen finden können!«
»Nein, nein. Das verstehst du noch nicht, aber ich wusste damals, dass ich nie wieder eine solche Chance haben würde. Außerdem wollte ich mich nicht noch einmal in einem Mann täuschen müssen.«
Damals erzählte Oma mir ihr ganzes Leben. Vielleicht war ich der einzige Mensch, der sie wirklich kannte. Meiner Mutter hatte sie kaum etwas anvertraut. Sie erzählte mir, dass Opa als Pole und ehemaliger Zwangsarbeiter leichtes Spiel bei den amerikanischen Besatzern hatte. Sie drückten ihm eine Kamera in die Hand und ließen ihn Aufnahmen machen, für die er genügend Geld bekam, um sich und seine Familie über Wasser zu halten. Ich kannte Opas Fotoserien über die Hamsterzeit sehr gut, sie hingen überall in unserer Wohnung und dienten meiner Mutter als Beweis dafür, dass ihr Vater ein Genie war. Dass er unter der Hand pornografische Aufnahmen machte, die er teuer verkaufte, das wusste nur meine Oma.
»Alleinstehende junge Frauen gab es ja genug damals. Er bezahlte sie, machte Aufnahmen von ihnen, schlief mit ihnen und kam dann nach Hause, um die Fotos zu entwickeln.«
»Und du wusstest das?«
»Natürlich nicht! Das heißt, nicht offiziell. Aber dein Opa war ein lausiger Lügner, Jungchen. Er erzählte mir, die Amerikaner hätten ihm das Fotolabor gekauft, damit er Geheimdienstarbeit für sie erledigte.« Sie tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. »Welche Sorte Geheimdienstarbeit das war, habe ich bald entdeckt.«
»Und du hast nichts gesagt?«
»Was sollte ich sagen, wir lebten besser als die meisten anderen Menschen. Und wenn dein Opa auch als Mann nichts mehr taugte, als Ernährer und Familienvater war er wunderbar.«
»Aber du hast ihn doch gehasst!«
»Papperlapapp, Jungchen, ich war nur ein bisschen wütend auf ihn. Als Familie waren wir glücklich. Schau dir deine Mutter an, sie ist doch ziemlich normal, oder nicht?«
»Ja, vielleicht hast du recht.«
Nach diesem Gespräch lag ich lange wach. Seit Opas Tod hatte Oma sich verändert, fand ich. Sie war nicht mehr so fantasievoll, nicht mehr so lebensfroh. Stattdessen erzählte sie mir Geschichten aus der Vergangenheit, die mich aufwühlten. Von meiner Mutter wusste ich, dass Opa oft verreiste, vor allem später, als er Dozent an der Universität wurde und sich auf erotische Literatur spezialisierte. Oma behauptete, die vielen Kongresse, zu denen er reiste, seien nichts als Orgien gewesen, die er gemeinsam mit Kollegen aus aller Welt organisierte. Meine Mutter aber ließ einmal durchblicken, dass Opa das Leben zu Hause kaum ertrug, weil Oma ständig auf ihm herumhackte.
»Das stimmt, Jungchen, ich habe auf ihm herumgehackt. Es war unsere gemeinsame Währung. Er parkte falsch und ich verteilte Knöllchen.«
Ungefähr zu dieser Zeit verliebte ich mich zum ersten Mal. Sie hieß Lisa und war eine Klassenkameradin. Im Unterricht sah sie oft in meine Richtung. Sie hatte einen leichten Silberblick, deshalb fühlten sich außer mir noch drei andere Jungen angesprochen. Ich wartete einfach, bis sie abgeblitzt waren. Als das geschehen war, wusste ich, dass ich mir Zeit lassen konnte. Ich saß im Unterricht, schaute sie an und stellte mir vor, dass ich sie packen, ihr den Rock hochreißen und sie über einen Mauerrest legen würde, um sie zu traktieren. Ich würde sie »dreckiges Brötchen« oder »Fötzchen« nennen und wie meine Hure behandeln. Dann bekämen wir Kinder und wären glücklich.
Es kam anders. Eines Tages, ich verließ gerade die Sporthalle, stand sie einfach da und lächelte mich an mit ihrem Silberblick. Ich dachte an Karel Gott, wenn er Weißt du wohin singt, und wollte schnell weiter. Sie stellte sich mir in den Weg und sagte mit ihrer rauchigen Stimme:
»Wohin so eilig?«
Meine Knie wurden weich, ich suchte nach einer Ausrede und stotterte etwas von Hausaufgaben und Mittagessen. Aber sie lachte mich aus und sagte:
»Komm mit, ich zeig dir was.« Ich ahnte, was das war und fühlte mich schlecht. Aber mir fehlte der Mut, Nein zu sagen. Also ging ich mit ihr auf die Mädchentoilette und wurde entjungfert.
Auf diese Weise waren wir bis zur Abiturfeier zusammen. Sie holte sich, was sie wollte, und ich ließ es geschehen.
Eines Tages fragte sie mich, ob ich sie liebte. Ich sagte:
»Nein.« Sie schaute mich eine Weile an.
»Das wusste ich schon«, sagte sie dann. »Und wenn du jetzt Ja gesagt hättest, hätte ich Schluss gemacht.« Ich war verwirrt und sie lachte mich aus.
»Ich mach’ dir ein Angebot«, sagte sie sachlich. »Wir machen weiter wie bisher, und wer das bessere Abitur macht, darf bestimmen, was danach passiert.« Lisa war eine sehr gute Schülerin, ich dagegen ein Wackelkandidat. Ihr Angebot war unfair. Ich stimmte trotzdem zu. Noch am selben Tag verlangte ich von meiner Mutter Nachhilfelehrer für alle heiklen Fächer. Sie war perplex, doch sie willigte ein.
Danke, Lisa, wo immer du heute stecken magst, ich will es gar nicht wissen!
Durch unsere Abmachung lernte ich, dass Arbeit wirklich frei macht. Als ich Lisa auf der Abiturfeier mein Zeugnis vorlegte, war sie sprachlos und ich lachte sie an. Dann ballte ich die linke Hand zur Faust, streckte den Daumen nach oben und drehte ihn langsam zur Erde. Während Lisa aus meinem Leben schied, feierte ich ein rauschendes Fest. Jetzt erst begriff ich Omas sexuellen Aufklärungsunterricht: Es ging in der Liebe gar nicht um die Liebe, sondern nur darum, wer das Sagen hat. Das war eine erleichternde Erkenntnis, und sie verhalf mir sogar zu einem Standpunkt, als ich begann, Philosophie zu studieren und mit dem gewaltfreien Dialog konfrontiert wurde.
Oma ging es in dieser Zeit nicht besonders gut. Ich zog von zu Hause fort, und obwohl sie sich nicht beklagte, bemerkte ich doch bald, dass sie keinen Gesprächspartner mehr hatte. Die beiden Frauen lebten jetzt allein in der großen Wohnung.
Meine Schwester hatte sich schon zwei Jahre früher verabschiedet. Gleich mit achtzehn hatte sie einen Schaufensterdekorateur geheiratet, der sie nach einem Jahr »zu dick« fand und nach zwei Jahren nicht mehr mit ihr ins Bett ging. Sie lebten in Berlin.
Meine Mutter hatte sich ganz der Partnersuche hingegeben, weil auch sie die Leere fürchtete, die wir hinterlassen hatten. Sie inserierte in den drei größten deutschen Zeitungen unterschiedliche Kontaktanzeigen und traf sich in ihrer freien Zeit mit Männern, die sie meistens zu dumm oder zu langweilig oder zu pervers fand. Dafür reiste sie durch die ganze Republik. Als sie einmal nach Köln kam, wo ich inzwischen wohnte, stieg sie bei mir ab. Es war das erste Mal seit ich denken konnte, dass wir allein waren. Ich war ein wenig nervös, als ich sie am Flughafen abholte, da ich keine Ahnung hatte, worüber ich mit ihr reden sollte. Als sie dann aber bleich und schwach in der Ankunftshalle erschien, wusste ich, was zu tun war. Sie ließ sich in meine Arme fallen und hauchte mir ins Ohr:
»Ich fliege nie wieder, nie wieder.«
»War es schlimm, Mama?«
»So schlimm wie noch nie. Ich habe den ganzen Flug über geheult, ich habe keine Tränen mehr, ich brauche was zu trinken.«
»Komm, wir fahren nach Hause, da kannst du dich ausruhen.« Wir gingen zu meinem Fiat 500. Es dauerte eine Weile, bis Mutters Gepäck so verstaut war, dass auch wir beide noch Platz hatten. Zu Hause angekommen, stieß Mutter einen Schrei der Empörung aus, krempelte die Ärmel hoch und begann sofort, meine Wohnung, die aus zwei kleinen Zimmern und einer schmalen Küche bestand, zu reinigen. Oma zahlte die Miete, sie hatte darauf bestanden, obwohl Mutter ihr angeboten hatte, meinen Vater zu fragen. Oma hatte daraufhin einen ihrer seltenen Wutausbrüche gehabt.
»Fragen! Wenn ich das schon höre, Kindchen, wirst du niemals begreifen, dass man sich im Leben die Sachen nehmen muss, die man haben will? Herrgott, was habe ich da großgezogen! Verklagen musst du ihn, hörst du?«
»Ach Mama, das haben wir doch schon oft gehabt, bitte …«
»Nicht oft genug! Was fällt diesem Kanaken ein! Meine Tochter! Kanaken! Zu meiner Zeit wären die alle …«
»Bitte Mama, nicht schon wieder!«
Oma bekam einen Weinkrampf und meine Mutter fühlte sich elend. Jetzt lief sie mit Lappen und Eimer durch meine Wohnung, räumte Papierstapel weg, las Essensreste vom Boden auf, warf verschimmeltes Brot in den Mülleimer und wusch meine Wäsche. Weil sie die Lebensmittel im Kühlschrank auf deren Verfallsdatum hin überprüft hatte, mussten wir in ein Restaurant gehen, als sie zwei Stunden später mit allem fertig war.
Im Restaurant saßen wir uns gegenüber. Links von uns saß ein Liebespaar, zwei dicke Menschen, und rechts zwei schwule Chinesen, die sich nichts trauten, weil meine Mutter ihnen nervöse Blicke zuwarf.
»Wie geht es Oma?«, fragte ich, um die Unterhaltung in Gang zu bringen. Sie schaute mich irritiert an und sagte:
»Nicht gut. Sie hat sich einen dreißig Jahre jüngeren Malermeister angelacht und kichert mit ihm herum.« Ich musste grinsen, aber Mutter sah mich streng an.
»Das ist unmöglich!«, sagte sie so laut, dass die Chinesen erschraken.
»Oma hat anscheinend allen Realitätssinn verloren«, fuhr sie leiser fort. »Stell dir nur vor: dreißig Jahre jünger!«
»Aber das ist doch toll für Oma«, fand ich.
»Unsinn! Der nimmt sie doch nur aus. Am Ende heiratet sie ihn noch.«
»Ach, du meinst wegen des Erbes.«
»Natürlich nicht! Ich meine wegen«, sie druckste ein wenig herum, »ich meine wegen Papa.« Damit meinte sie meinen Opa. Aber es klang nicht sehr überzeugend. Oma finanzierte seit vielen Jahren die Familie. In den Augen meiner Mutter gehörte das Geld aber Opa.
»Opa ist tot, Mama«, sagte ich beschwichtigend.
»Sie hat ihn auf dem Gewissen!«, entfuhr es ihr, und diesmal schaute auch das dicke Liebespaar kurz herüber.
»Sie hat ihn auf dem Gewissen«, wiederholte sie leise.
»Wie kommst du darauf?«, fragte ich mit Unschuldsmiene. Sie sah mich eine Weile an und sagte dann niedergeschlagen:
»Weil er niemals sein Kukident-Wasser trank.«
»Aber wie ist dann das Rattengift in ihn gelangt?«
»Er hob sein Gebiss gar nicht in Kukident-Wasser auf, sondern in Wodka, und den trank er dann jeden Morgen.«
»Und das Rattengift?«
»Ich weiß von keinem Rattengift.«
»Aber Opa ist doch an Rattengift gestorben!«
»Wie kommst du darauf? Opa hatte einen Gehirnschlag.« Es entstand eine Pause, in der ich sie anstarrte. Dann beschloss ich, das Thema zu wechseln.
»Erzähl doch mal von dem Mann, den du morgen treffen wirst. Ist er nett?« Aber sie wirkte plötzlich sehr müde.
»Ich weiß nicht«, sagte sie matt. »Je mehr Männer ich treffe, desto weniger Unterschiede bemerke ich.« Endlich kam das Essen.
Auf dem Heimweg begann Mutter im Auto leise zu weinen, wobei sie ihr Gesicht ein wenig affektiert von mir abgewandt hielt. Ich wollte sie nicht fragen, was los sei, tat es dann aber doch.
»Ach, nichts«, sagte sie wehleidig.
»Nun sag schon, Mama«, sagte ich. »Ach«, sagte sie. Zu Hause bestand sie darauf, nicht wie vorgesehen in meinem Bett zu schlafen, sondern auf der Couch.
»Du studierst und musst ausgeruht sein«, sagte sie entschieden.
»Aber Mama«, wandte ich ein, »du triffst morgen einen Kandidaten, du musst frisch aussehen.«
»Ach was«, gab sie zurück, »Männern fällt so etwas nicht auf, die achten auf andere Dinge.«
»Worauf denn?«
»Auf andere Dinge eben.«
»Du meinst, nicht aufs Gesicht?«
»Na ja.«
»Das ist aber komisch«, sagte ich noch, aber sie war bereits auf dem Weg ins Bad, um sich die Zähne zu putzen und ihre Antidepressiva einzunehmen.
Am nächsten Morgen stand sie früh auf, ging einkaufen, bereitete das Frühstück vor, putzte noch ein wenig und weckte mich dann. Sie war guter Laune. Beim Frühstück unterhielten wir uns angeregt über die Tagespolitik. Damals wurde über den Abtreibungsparagrafen 218 gestritten. Meine Mutter war entschiedene Gegnerin der Abtreibung.
»Das ist Mord!«, sagte sie und wiederholte es mehrere Male, »das ist Mord!« Ich versuchte es mit den unterschiedlichsten Argumenten, pochte auf das Recht der freien Selbstbestimmung, auf das Vertrauen in die richtige Entscheidung der Frauen, kritisierte das Patriarchat, aber sie sagte jedes Mal: »Das ist Mord!« Ich beschloss, ein Argument zu verwenden, das ich ein paar Tage zuvor in der Zeitung gelesen hatte.
»Mama, stell dir vor, eine Frau ist vergewaltigt worden und jetzt schwanger. Was soll sie deiner Meinung nach tun?« Sie schaute mich eine Weile schweigend an und sagte dann:
»Wenn ich dich damals abgetrieben hätte, wärst du jetzt nicht auf der Welt.« Es gab eine Pause, in der ich sie anstarrte. Sie lächelte und strich sich Butter auf ihr Croissant.
»Mama, das ist unfair, so kannst du nicht argumentieren.«
»Warum nicht?«, sagte sie und schaute ganz unschuldig.
»Weil es nicht richtig ist. Du deutest irgendetwas Abwegiges an, nur damit ich aus dem Tritt gerate!«
»Und warum nicht? Wenn ich vergewaltigt worden wäre und dich abgetrieben hätte, gäbe es dich nicht. Das ist doch eine Tatsache.«
»Aber du bist nicht vergewaltigt worden!«
»Woher weißt du das? Warst du dabei?«
Ich beschloss, das Thema zu wechseln und fragte sie nach meiner Schwester. Sie machte sich einige Sorgen um sie, denn sie rauchte seit geraumer Zeit Marihuana um abzunehmen, aber es funktionierte nicht.
»Sie hat eine neue Diät entdeckt«, verkündete mir meine Mutter, »Kokain. Und es funktioniert, sie hat schon zwanzig Kilo abgenommen.«
»Aber das ist ja furchtbar«, sagte ich.
»Oma gefällt es auch nicht«, sagte meine Mutter, »aber du kennst deine Schwester ja. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann bekommt sie es nicht mehr heraus.« Das stimmte, meine Schwester war von klein auf stur gewesen.
Nach dem Frühstück wurde meine Mutter plötzlich nervös und brach mehrere Male in Tränen aus. Jedes Mal ging sie dann ins Badezimmer und schminkte sich neu. Ich versuchte, ihr Mut zu machen.
»Es wird schon nicht so schlimm werden, Mama«, sagte ich zu ihr. »Das ist es gar nicht«, schluchzte sie.
»Was ist es dann?«
»Ach«, machte sie, »eigentlich will ich gar keinen Mann mehr.«
Ich war überrascht, damit hatte ich nicht gerechnet.
»Mama?«, sagte ich langsam.
»Ja.«
»Liebst du Papa noch?«
Das hatte ich sie schon lange fragen wollen, aber es war mir immer zu heikel erschienen, weil über meinen Vater nicht gesprochen wurde. Jetzt also hatte ich es gewagt und schaute meine Mutter gebannt an. Sie hatte aufgehört, sich die Nase zu schnäuzen und starrte auf den Boden. Dann stand sie abrupt auf, streifte sich den Mantel über, packte ihre vielen Köfferchen und Taschen und ging zur Wohnungstür.
»Öffne mir sofort diese Tür!«, schrie sie und stampfte auf den Boden wie ein kleines Mädchen. Dabei brach ihr rechter Pfennigabsatz.
»Aber Mama! Ich wollte es nur wissen«, versuchte ich sie zu beschwichtigen. Sie aber sagte nichts, stand nur da und blickte die Wohnungstür an, die ich ihr öffnen sollte. Ohne mich zu regen, sagte ich:
»Mama, es ist mir ganz egal, was zwischen euch passiert ist, das heißt, nein, es ist mir nicht egal, im Gegenteil: Ich will endlich wissen, was zwischen euch passiert ist!«
Sie drehte sich schwerfällig um und schaute mich so wütend an, dass ich mich fühlte wie mein eigener Vater. Sie nahm es nicht wahr, in ihrem Gesicht spiegelte sich ein innerer Kampf, dessen Ausgang plötzlich und unerwartet kam.
»Dein Vater hatte ein Verhältnis mit deiner Oma«, sagte sie gepresst. Gleichzeitig ließ sie ihr Gepäck fallen und sank zu Boden. Da saß sie nun im Schneidersitz, stützte den Kopf in die Hände und weinte hemmungslos.
»Was?«, entfuhr es mir. Dann musste ich lachen, ich musste so laut lachen, dass meine Mutter mich mit offenem Mund anstarrte, während ihr Tränen übers Gesicht liefen.
»Wie kannst du nur darüber lachen!«, schrie sie. Ich wusste es selbst nicht, es tat mir sogar leid für meine Mutter, und ich hätte gerne aufgehört zu lachen. Aber es ging nicht. Meine Mutter hörte auf zu weinen und beobachtete mich nun aufmerksam und mit einem Anflug von Sorge. Schließlich fasste sie sich, stand auf, strich ihren Mantel glatt, wandte sich mir zu und versetzte mir eine schallende Ohrfeige. Ich hörte augenblicklich auf zu lachen. Sie sagte:
»Kannst du dich daran erinnern, dass Oma für zwei Monate in Kur fuhr, als du sechs Jahre alt warst?« Ich konnte mich sehr gut erinnern. Es war ein heißer Sommer gewesen, wir machten Urlaub auf Sylt und mussten jeden Tag zum Nacktbadestrand, weil unsere Eltern es dort so natürlich fanden.
»Sie fuhr damals nicht in Kur«, sagte meine Mutter trocken.
»Wohin fuhr sie denn?« fragte ich naiv.
»Zur Entbindung deiner Halbschwester. Oder Halbtante. Oder Halbtantenschwester. Sie heißt Natascha und lebt bei deinem Vater. So«, sie bückte sich nach ihrem Gepäck, »und jetzt wirst du mich zum Bahnhof fahren. Ich habe es mir anders überlegt, ich brauche keine Männer mehr, eine Frau, der von der eigenen Mutter der Vater ihrer Kinder ausgespannt wurde, hat bewiesen, dass …« Hier versagte ihr die Stimme.
Ich beeilte mich, ihrer Bitte nachzukommen. Wir fuhren schweigend. Am Bahnhof löste sie eine Fahrkarte. Wir warteten in einem Café. Eigentlich gab es nichts mehr zu sagen, aber ich hatte doch noch eine Frage:
»Mama?«
»Ja«, sagte sie geistesabwesend.
»Weißt du, wo sie leben, ich meine …«
»Ich weiß, wen du meinst. Ja, ich weiß es, sie leben in Berlin.«
Noch am selben Tag kündigte ich meine Wohnung. Da ich nun drei Monate Zeit hatte, beschloss ich, sofort nach Berlin zu fahren, um mir dort eine Wohnung zu suchen. Sie sollte möglichst in der Nähe meines Vaters liegen. Ich rechnete mir aus, dass Natascha sechzehn Jahre alt sein musste. Insgeheim freute es mich, eine zweite Schwester zu haben, die vielleicht besser war als die erste. Am meisten aber wunderte ich mich über meine Oma, der es gelungen war, einen so viel jüngeren Mann zu verführen und dabei alle moralischen Grenzen zu überwinden. »Sie ist schon sehr wild, meine Oma«, dachte ich, während draußen die ostdeutsche Landschaft vorüberflog. Mein Inneres fühlte sich an wie ein Suppeneintopf; eine Menge unterschiedlicher Gefühle war darin verkocht, so dass ich sie nicht genau unterscheiden konnte. Bewunderung schwamm darin wie große Fettaugen, aber darunter sah ich trübe ein Entsetzen aus Knoblauch und Cayennepfeffer. Meine Familie erschien mir wie ein Strudel, der mich rückwärts in die Vergangenheit zog, je mehr ich erfuhr. Was würden mein Vater und meine Schwester mir erzählen? Natürlich war ich sehr neugierig, zugleich aber überkam mich eine unbestimmte Angst vor neuen Abgründen.
In der Gegend um Magdeburg wurde die Landschaft eintönig, endlose Felder reihten sich aneinander. Von Zeit zu Zeit sah man Autos, die so klein und zerbrechlich wirkten wie Spielzeug in einer Märklin-Landschaft. Stillgelegte Bahnhöfe huschten an uns vorbei. Leere Landstraßen zogen sich wie Laufmaschen durch die Felder und endeten an Bahnübergängen, an denen niemand wartete. Ich döste ein wenig vor mich hin. Irgendwann verkündete eine niederbayrische Männerstimme über Lautsprecher, der nächste Halt sei Berlin und man erreiche es in wenigen Minuten. Plötzlich stieg eine Hitze in mir auf, und mir wurde bewusst, dass ich im Begriff war, meinen verlorenen Vater wiederzufinden. Ich wusste nicht einmal mehr, wie er aussah. Wenn ich an früher zurückdachte, sah ich vor meinem inneren Auge nur das nervöse Gesicht meiner Mutter, das sich wie ein Plakat vor verschwommene Bilder und Gefühle in den Hintergrund schob. Ich sah meine Schwester, die nackt durch die Wohnung lief, damit unser Vater sie sähe, ich hörte sogar deutlich seine Stimme, dieses abgehackte, radebrechende Deutsch eines Spaniers, wie er sie ermahnte, Kleider anzulegen, ich sah die Enttäuschung auf dem Gesicht meiner Schwester, in die sich immer noch etwas wie Erregung mischte, eine Erregung, die ich nicht verstand. Ich hörte auch meine Oma, wie sie sich im Wohnzimmer mit Opa stritt. Alles schien sich um meinen Vater zu drehen, sogar ich, aber mein Vater blieb für mich unsichtbar.
Dabei war ich gar nicht so klein, als unsere Eltern sich trennten, immerhin fast acht.
»Was haben sie in den zwei Jahren gemacht?«, fragte ich mich und meinte die zwei Jahre zwischen meinem sechsten Lebensjahr, als meine Halbschwester geboren wurde, und dem Zeitpunkt, als mein Vater aus unserem Leben verschwand. Ich beschloss, ihn zu fragen, wie seine Affäre mit Oma aufgeflogen war und vor allem wann. Wo war Natascha in den zwei Jahren gewesen? Ich hatte sie nie zu Gesicht bekommen. Sie mussten sie weggegeben haben, vielleicht in ein Waisenhaus? Ich war mir sicher, dass ich früher oder später alles erfahren würde.
Allerdings verstand ich Omas Groll auf Opa nicht mehr. Wo sie sich doch mit anderen Männern vergnügte, noch dazu mit ihrem eigenen Schwiegersohn! Vielleicht hatte Opa ja die ganze Sache aufgedeckt, vielleicht sogar aus Eifersucht? Aber warum war Oma so ausfällig geworden, als es darum ging, dass mein Vater unsere Mutter nicht finanziell unterstützte? Wie hatte sie ihn genannt? Kanake.
Als der Zug eine Viertelstunde später im Bahnhof Zoo einfuhr, hatte ich so viele Fragen im Kopf, dass ich ganz nervös wurde. Dem Taxifahrer drückte ich wortlos einen Zettel in die Hand, auf dem die Adresse eines Hotels geschrieben stand, und sagte auch nichts, als er einen Umweg fuhr. Ich wollte meine Ruhe haben.
Das Hotel lag in der Nähe des Mietshauses, in dem mein Vater und Natascha wohnten. Das Viertel bestand aus lauter hässlichen neuen Gebäuden. Noch im Hotel beschloss ich, nicht in die Nähe meines Vaters zu ziehen.
Ich rief meinen schwulen Freund Matthias an, der seit ein paar Jahren in Berlin wohnte, weil er nicht zum Bund wollte. Wir verabredeten uns auf der Oranienstraße. Er kellnerte dort in einem für Kreuzberg typischen Café und schrieb in seiner Freizeit komplizierte Texte, denen ich nicht folgen konnte.
Ich musste eine Weile suchen, bevor ich das Café fand, es wirkte ein wenig eingezwängt zwischen zwei breiten Restaurants. Drinnen war es beinahe leer, hinter der Theke stand Matthias mit seinem blonden Lockenschopf und grinste breit, als er mich sah. Wir umarmten uns und er stellte mich der gesamten Belegschaft vor. Da es kaum Gäste gab, setzten wir uns an die Theke und plauderten. Ich erzählte ihm von den ungeheuerlichen Offenbarungen meiner Mutter und von den vielen ungeklärten Fragen, die mich beschäftigten. Währenddessen rauchte er eine Zigarette nach der anderen.
»Sag mal, wie viel rauchst du eigentlich inzwischen?«, fragte ich nach einer Weile.
»Na ja, so drei bis vier Päckchen.«
»Am Tag?« Er nickte und verzog ein wenig das Gesicht. »Was?«, entfuhr es mir. »Aber dann bist du ja in ein paar Jahren tot! Bist du sicher, dass du da nicht irgendwas kompensierst?«
Er schaute mich amüsiert an: »Meinst du vielleicht die Schwänze, die ich nicht lutsche?« Ich zuckte mit den Schultern. »Nein, nein«, sagte er mit einer abwehrenden Handbewegung, »das ist ein rein körperliches Problem.«
»Aha«, machte ich ratlos, während er die nächste Zigarette mit seiner Kippe anzündete und sagte: »Macht der Bundeskanzler auch so.«
Danach erzählte er mir von seinem neuesten Text, den er als ultimative Grenze der deutschen Avantgarde bezeichnete. Es gehe, so Matthias, um ein Wollen, das sich nicht Bahn brechen könne, weil die Erinnerung es an ein Ereignis gekettet habe, das sich wie eine zur Dichtung verdichtete Spirale um den als Linie gedachten Lebensweg des Trägers dieses Wollens – ich vermutete, er sprach von sich selbst, wie in allen seinen Texten – rankte. Er sprach schnell und hob von Zeit zu Zeit den rechten Zeigefinger in die Luft, was ihm das Aussehen eines Professors mit großen Kinderaugen und weichem Mund verlieh.
»Meine Grundthese ist die, dass du nicht einer bist, sondern alle, die vor dir gelebt haben. Du bist dein Vater, deine Mutter, deine Oma, dein Opa, deine andere Oma, dein anderer Opa, alle, alle, selbst dann, wenn du sie noch nie gesehen hast, bist du sie. Verstehst du? Daraus ergibt sich eine dichterische Dichte, aus der heraus erst die Dichtung sich zur Sprache bringen kann, verstehst du?« Ich verstand nicht, aber die plötzliche Vorstellung, meine ganze Familie in mir zu vereinen, verursachte mir Unbehagen.
»Heißt das, wenn meine Oma pervers ist, dann bin ich es auch?«
»Na ja«, sagte er, »warum nicht?« Dann beugte er sich weit vor, schaute mir tief in die Augen und sagte mit verschwörerischem Unterton: »Ich muss dir etwas vorlesen, wenn ich das publiziere, schlägt es ein wie eine Bombe.« Ich fürchtete schon, er werde es mir an Ort und Stelle vorlesen, aber er beruhigte mich. »Es ist noch nicht ganz ausgefeilt, vielleicht lese ich dir nachher einen Ausschnitt vor, zwanzig Seiten, mehr nicht, okay?«
»Okay«, sagte ich tapfer, »worum geht es denn?«
»Es geht darum, wie ein Mann das Bild seines Vaters ganz in sich aufnimmt, um an dessen äußeren Rändern die Verbrennungen zu erkennen, die dessen Gedächtnis erlitten hat, als er die Schwester des Mannes in einer Art berührte, in der er das nie getan hätte, wäre ihm nicht etwas widerfahren, was er vor sich selbst geheim hielt. Es dreht sich also um etwas, das nie ausgesprochen wurde, um etwas, das es eigentlich gar nicht gibt, weil niemand will, dass es in der Welt ist. Trotzdem – oder nein: gerade deshalb beeinflusst es alles.« Hier machte er eine Pause und zog an seiner Zigarette. Im Aschenbecher lag eine weitere angezündete Zigarette. Als ich ihn darauf aufmerksam machte, lachte er. »Passiert mir häufiger. Dann rauche ich eben beide.« Er nahm beide Zigaretten, steckte sie sich links und rechts in die Mundwinkel und grinste mich an, wie jemand, der etwas ganz und gar Originelles tut. Ich lächelte unsicher zurück. Dann kam Matthias wieder zum Wesentlichen:
»Der Text ist natürlich eine theoretisch fundierte Fiktion, sehr poetisch übrigens, er wird dir gefallen.« Ich lächelte ihn freundlich an und bestellte eine weitere Caipirinha.
»Was hältst du denn von meiner neuen Schwester?«, fragte ich ihn nach einer Weile. Er überlegte kurz, zündete sich eine Zigarette an, beobachtete wohlwollend ein Schwulenpärchen, das gerade das Café betrat, und sagte dann:
»Es ist nicht so schlimm wie Missbrauch.«
»Aha«, machte ich verblüfft. So hatte ich das noch nicht gesehen. »Aber meinst du nicht, dass da doch irgendwo Missbrauch im Spiel ist?«
»Wie meinst du das?«
»Na ja, meine Mutter ist doch schon von ihrer Mutter irgendwie missbraucht worden, oder nicht? Und Natascha doch auch.«
»Mag sein«, sagte er nachdenklich, »aber es gibt kein eindeutiges Opfer. Deine Mutter hat sich einen Mann ausgesucht, der das tun würde, hat es vielleicht sogar unbewusst gewollt, und ihn genau deshalb gewählt. Vermutlich geht es in der ganzen Geschichte nur um deine und ihre Mutter. Es ist ja seltsam, dass die Mutter der Tochter den Mann ausspannt.«
»Schon«, sagte ich langsam und bestellte eine Caipirinha.
Nach der vierten Caipirinha gesellte sich ein Pärchen zu uns, ein baumlanger, breitschultriger Mann und eine bildschöne Blondine. Die beiden machten den Eindruck, einem Modekatalog entnommen und unversehens vor uns aufgestellt worden zu sein. Es waren Freunde von Matthias. Ich wurde den beiden vorgestellt, die Blondine musterte mich mit einem Augenaufschlag, der sehr geübt zu sein schien, ihre Miene verriet dabei nicht, was sie dachte. Sie hießen Thomas und Salomé, Thomas’ Händedruck war fest und männlich, er achtete darauf, keinem Blick auszuweichen und nie zuerst wegzuschauen, was seiner betonten Freundlichkeit etwas Starres verlieh. Salomé bewegte sich am liebsten in fließenden Bewegungen, die alles, was sie tat, zu einer Choreografie werden ließ. Selbst ihr Blick, der immer häufiger auf mir ruhte, fügte sich in diesen Bewegungsablauf, und fast hätte ich mir die fünfte Caipirinha bestellt und mich auf die beiden näher eingelassen, aber eine innere Stimme warnte mich. Ich verabschiedete mich und fuhr ins Hotel.
Dort erlebte ich eine Überraschung. Im Foyer saß ein junges Mädchen, das mir um den Hals fiel, wieder und wieder meinen Namen flüsterte und sich als Natascha zu erkennen gab. Mein Zustand hatte sich aufgrund der frischen Luft und der U-Bahnfahrt verschlechtert, ich stammelte eine Entschuldigung, aber sie legte mir kurz entschlossen ihren Arm um die Hüfte und half mir, die Treppen hoch zu steigen. Dann erinnere ich mich an nichts mehr.